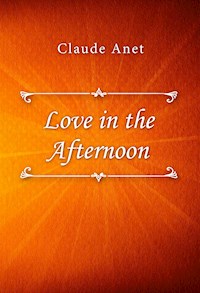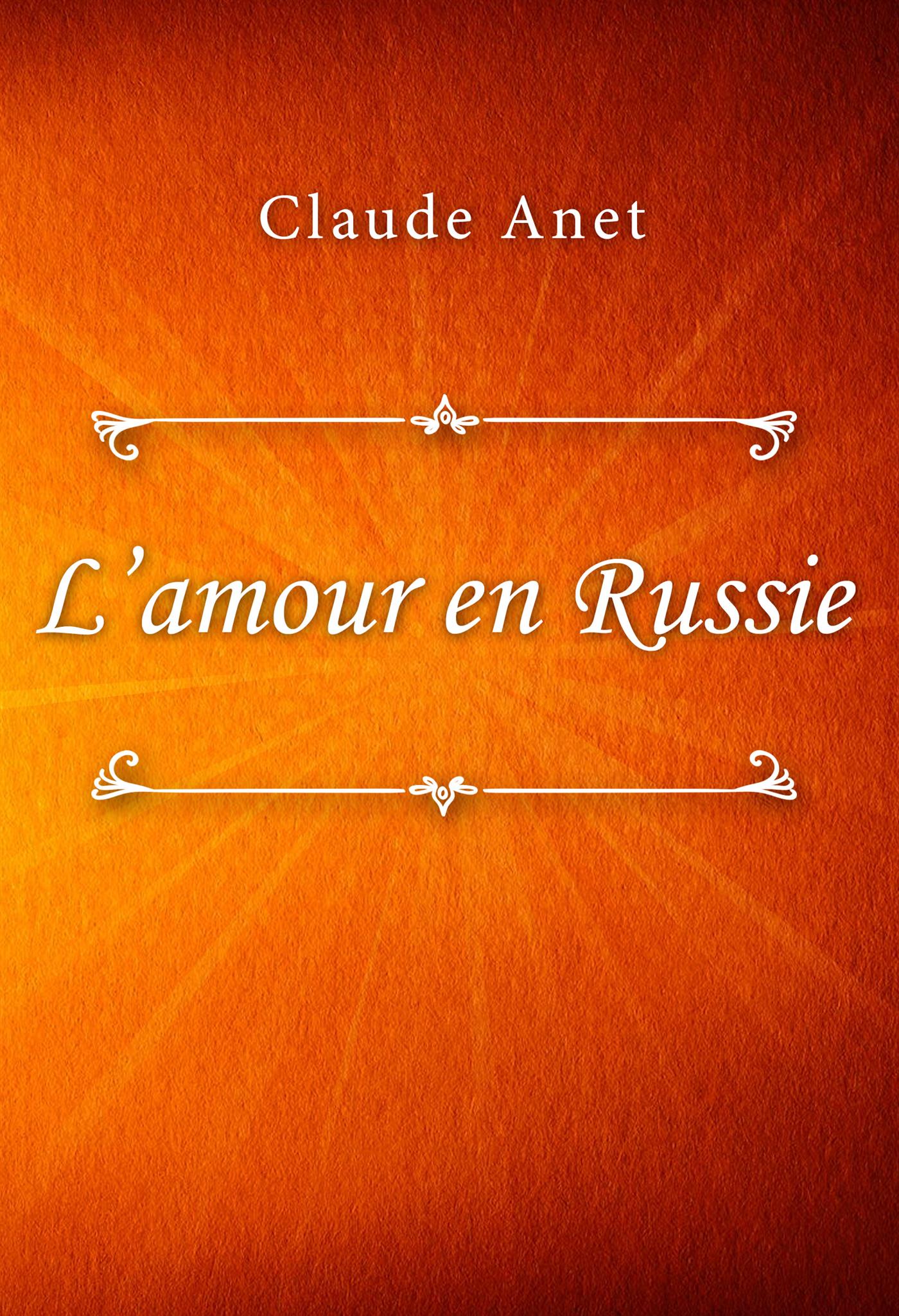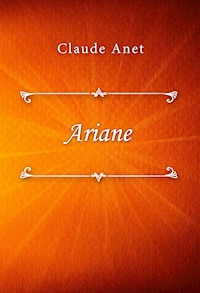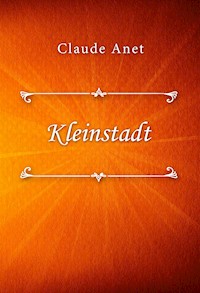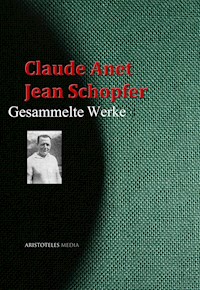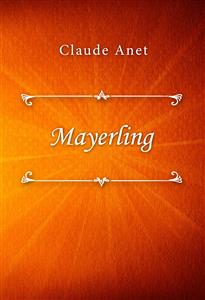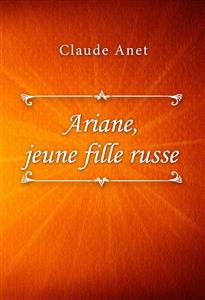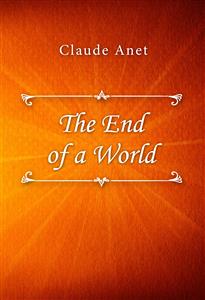16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ariane ist Abiturientin, intelligent, voller moderner Ideen, auch zur Emanzipation und zur Liebe. Da ihr die Männer zu Füßen liegen, gibt sie sich besonders cool. Und will mit ihnen so spielen, wie Männer es mit Frauen tun. Als sie dem älteren Konstantin begegnet, achten beide darauf, sich bloß nicht ineinander zu verlieben. Doch es kommt anders. Eine Liebesgeschichte, die bei ihrem Erscheinen 1920 Wellen schlug. So lesen gleich zwei von Vladimir Nabokovs weiblichen Figuren in Der Späher diesen Roman Anets. "Konstantin musste immerzu an Arianes Lüge denken. Blitzschnell hatte sie erfasst, dass es jetzt nicht anders ging, und hatte sich sogleich in schwindelnde Höhen aufgeschwungen. Wenn er sie da oben schweben sah, empfand er die Angst, die einen befällt, wenn man mit den Blicken einem Akrobaten folgt, der in der Kuppel des Zirkuszelts ein Kunststück vollbringt, bei dem er ums Leben kommen könnte."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Ähnliche
Claude Anet
Ariane
Liebe am Nachmittag
Roman
Aus dem Französischen übersetztund mit einem Nachwort versehenvon Kristian Wachinger
DÖRLEMANN
Die französische Originalausgabe »Ariane, jeune fille russe« erschien 1920 bei Éditions de la Sirène, Paris. Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung.Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2021 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagfoto: © imago images/United Archives; Audrey Hepburn, Love in the Afternoon 1957, Allied Artists Porträt: © Süddeutsche Zeitung Photo/Alamy Stock Photo Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-978-2www.doerlemann.com
Inhalt
Claude Anet
Erster Teil
(Gewissermaßen als Vorrede)
I
Vom Hotel London zum Znamenski-Gymnasium
Ein Himmel von geradezu morgenländischer Klarheit, ein schöner heller, leuchtender Himmel lag blau wie persischer Türkis über den Häusern und Gärten der Stadt, die noch schlief. In der Stille des Morgengrauens war nur das Pfeifen der Spatzen zu vernehmen, die in wilder Jagd über die Dächer und über die Zweige der Akazien hinwegflogen, das lustvolle Gurren einer Turteltaube hoch in einem Baumwipfel, und in der Ferne das gelegentliche Rumpeln der Achsen eines Bauernkarrens, der nur langsam vorankam auf dem unebenen Pflaster der Sadowaja, der eleganten Hauptstraße der Stadt. Am menschenleeren Domplatz, einer ausgedehnten Sandfläche, lag hinter einer hölzernen Wand der Wirtschaftshof des Hotel London mit seinen drei Stockwerken, dessen eintönige, langgezogene Vorderfront aus grauem Steinmauerwerk entlang der Sadowajastraße lag, trostlos, ohne Balkone, ohne Pfeiler, ohne Säulen, ohne jeden Zierrat.
Das Hotel London, das erste Haus am Platze, war für seine gute Küche bekannt. Junge Leute aus wohlhabendem Hause, Offiziere, Unternehmer und Adel waren die Klientel seines berühmten Restaurants, wo ein Ensemble aus drei abgemagerten Juden und zwei Ukrainern nachmittags, abends und bis tief in die Nacht mittelprächtige Potpourris aus Eugen Onegin und Pique Dame, schwermütige Volkslieder und Zigeunerweisen in stampfenden Rhythmen spielte. Was für herrliche Vergnügungen hatte es in diesem angesagten Restaurant gegeben, was für glanzvolle Abendessen, was für ›Orgien‹ – um den Ausdruck zu verwenden, der damals bei uns im Schwange war, wenn die Rede auf die Feste im Hotel London kam!
Das Restaurant des Hotels bestand aus zwei unterschiedlich großen Sälen. Aber es gab keine Nebenräume. Wer abseits der Menge speisen wollte, nahm deshalb im ersten Stock eine Suite aus Salon und Schlafzimmer, die Leo Davidowitsch, der Hotelportier, stets für seine Stammgäste freihielt.
Dieser Leo, ein Jude mit engstehenden, glanzlosen Augen, war der Alleinherrscher im Haus und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt. Die Honoratioren der Gegend suchten seine Freundschaft und verweilten stets kurz im Foyer, um ein paar freundliche Worte mit ihm zu wechseln. Leo war verschwiegen – und Verschwiegenheit und Anstand kann man beim Portier eines so angesehenen Hotels gar nicht hoch genug schätzen. Wie viele rosa Scheine, ja selbst Fünfundzwanzigrubelnoten mochte er stumm angenommen haben, ohne die geringste Regung in seinem blassen Gesicht, Geldscheine, die ihm die fiebrige Hand eines Mannes zusteckte, der aufgewühlt war von der Vorstellung, hier Unterschlupf für ein Liebesabenteuer zu finden. Die Anzahl von Männern, die das Geheimnis ihrer Glückseligkeit sicher verwahrt sehen wollten, scheint nicht gering gewesen zu sein, denn Leo Davidowitsch besaß immerhin drei Häuser. Daran ist zu erkennen, wie hier das Geld floss, mühelos verdient und freudig mit vollen Händen ausgegeben, und dass das Leben in unserer Stadt feurig war wie die glühenden ländlichen Sommertage in diesem südlichen Regierungsbezirk, dessen Hauptstadt sie war. Wer es in dieser Provinz zu Geld brachte, ob in Bergbau, Industrie oder Landwirtschaft, dachte sehnsüchtig an die unvergesslichen Feste des Hotel London und an die französischen Weine, die er dort noch in Gesellschaft liebenswürdiger Frauen trinken würde.
Eines der drei Häuser von Leo Davidowitsch stand an einer abgelegenen Straße in der Vorstadt, nicht weit von der Landstraße, über die in der Abenddämmerung und nachts schöne Traber, eine Zierde unserer Gegend, im Einspänner Pärchen hinter sich herzogen, die darauf aus waren, in Windeseile über die glatte und gut gepflegte Straße zu huschen. Leo dachte daran, später einmal das Erdgeschoss dieses Hauses zu beziehen. Doch zunächst hatte er nur das obere Stockwerk möbliert und dort eine mürrische alte Frau untergebracht. Zahlreiche Leute hatten angeklopft, ob hier zu vermieten sei, denn Wohnungen waren knapp in der Stadt, die in den vergangenen Jahren außerordentlich rasch gewachsen war. Die Antwort der alten Hexe war stets die gleiche gewesen: Die Wohnung sei reserviert. Doch es kam kein Mieter, und manches schlichte Gemüt fragte sich, warum Leo auf eine vorteilhafte Mieteinnahme verzichtete. Andere zuckten die Achseln. Oft sah man allerdings eine Kutsche vor der Tür des kleinen Hauses anhalten, und obwohl die Gardinen sorgfältig zugezogen waren, fiel noch spät in der Nacht Licht durch die Fenster.
In der frühen Morgenstunde, da diese Erzählung beginnt, in der ersten Dämmerung eines warmen Tages Ende Mai, war das große Tor des Hotel London geschlossen, das elektrische Licht in Foyer und Restaurant seit langem abgeschaltet. Knarrend öffnete sich die kleine Tür in der Holzwand zum Wirtschaftshof. Ein junges Mädchen trat auf die Schwelle und blieb einen Augenblick zögernd stehen.
Sie trug die Uniform des bekanntesten Gymnasiums der Stadt, ein schlichtes braunes Kleid mit schwarzglänzender Schürze. Diese Strenge hatte sie abgemildert durch einen weißen Spitzenkragen, der ein wenig zerknittert wirkte, und das Kleid war entgegen der Vorschrift leicht ausgeschnitten und zeigte die dezente Anmut eines schlanken Halses; darauf wiegte sich in sanfter Bewegung ein kleiner Kopf, auf dem sie einen weißen Strohhut mit breiter Seitenkrempe trug, die von einem unter dem Kinn geknoteten schwarzen Band hochgehalten wurde. Das Mädchen wandte den Kopf nach allen Seiten, um die menschenleere Straße zu begutachten. Nach diesem kurzen Innehalten ging sie den Bürgersteig hinab. Hinter ihr erschien ein zweites Mädchen, ein paar Jahre älter, blond, etwas rundlich und schwerfällig im Gang, einen schwarzen Seidenrock und eine Batistbluse unter einem leichten Übergangsmantel.
Das Mädchen in Gymnasiastinnenuniform streckte sich, hob das Gesicht zum Himmel, sog die frische Luft tief ein wie ein Glas kühles Wasser und sagte lachend:
»Was für eine Schande, Olga, es ist schon taghell!«
»Ich wollte schon längst heimgehen«, sagte sie mürrisch, »ich weiß nicht, warum du so spät dran bist … Wobei, eigentlich weiß ich es doch. Und ich muss um zehn im Büro sein! Petrow, der alte Tyrann, wird mich ausschimpfen. Und ich hab viel zu viel Champagner getrunken …«
Die Gymnasiastin sah sie mitleidig an, zuckte, wie sie es gern tat, mit der linken Schulter und blieb eine Antwort schuldig. Sie ging mit schnellen Schritten, ließ beschwingt und fröhlich die allzu hohen Absätze ihrer offenen Schuhe klacken, blickte mit freien Sinnen um sich und genoss es, nach einem verrauchten Raum nun die unerwartete Frische des Frühlingsmorgens um sich zu haben. Zusammen überquerten die beiden den großen Domplatz und gingen dann ihrer Wege, nicht ohne sich für den nächsten Abend verabredet zu haben.
Die Gymnasiastin wollte gerade in eine Straße links vom Dom einbiegen, da hörte sie eilende Schritte hinter sich und drehte sich um. Ein hochgewachsener Schüler in Uniform, Pickel und Hacke mit Goldfaden ins Mützenband gestickt, kam hinter ihr hergelaufen.
Sie blieb stehen. Ihr Gesicht nahm einen harten Ausdruck an, ihre langen Augenbrauen runzelten sich, so dass der Schüler, der sie unverwandt angesehen hatte, unsicher wurde. Voller Nervosität sagte er:
»Vergeben Sie mir, Ariane Nikolajewna … ich habe gewartet, bis Sie allein waren … Ich konnte Sie doch nicht so verlassen … Nach allem, was geschehen ist …«
Mit schneidender Stimme unterbrach sie ihn:
»Was bitte soll geschehen sein?«
Die Verunsicherung des jungen Mannes wurde noch größer.
»Ich weiß nicht …«, stammelte er, »ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll … Ich dachte … Sie nehmen es mir übel? Ich bin verzweifelt … Ich möchte es lieber gleich wissen …« Und, völlig aus der Fassung, schloss er: »So kann man doch nicht weiterleben.«
»Gar nichts nehme ich Ihnen übel«, erwiderte Ariane Nikolajewna geradeheraus, »merken Sie sich das ein für alle Mal: Ich bereue nie, was ich getan habe. Aber denken Sie auch daran, dass ich Ihnen verboten habe, mich auf der Straße anzusprechen … Oder haben Sie das schon vergessen?«
Nach einem kurzen Zögern unter den kalten Blicken des Mädchens machte er auf dem Absatz kehrt und ging wortlos weg.
Ein paar Minuten später stand Ariane Nikolajewna vor einem großen Holzhaus. Im Erdgeschoss befanden sich Geschäfte. Sie stieg ins obere Stockwerk, nahm einen Schlüssel aus der Handtasche und schloss die Tür vorsichtig auf.
Es war still in der Wohnung, nur das Ticken einer großen Wanduhr im Esszimmer war zu hören. Auf Zehenspitzen durchquerte das Mädchen einen langen Flur und stieß die Tür zu einer Kammer auf, wo auf dem schmalen Bett eine junge Frau schlief, mit offenem Mund, halb angekleidet.
»Pascha, Pascha«, sagte sie.
Die Bedienstete schrak aus dem Schlaf hoch und wollte aufstehen.
»Weck mich um neun«, sagte Ariane und drückte sie zurück aufs Bett, »um neun, verstanden? Am Vormittag habe ich eine Prüfung.«
»Schon gut, Ariane Nikolajewna, ich werde es nicht vergessen … Aber es ist ja schon hell. Dass Sie so spät heimkommen! Um Gottes willen, passen Sie auf sich auf. Warten Sie, ich komme und entkleide Sie«, setzte sie hinzu und machte noch einen Versuch, aufzustehen.
»Nein, Pascha, mach dir keine Mühe. Schlaf noch ein wenig. Gott sei Dank kann ich mich selber an- und ausziehen. Bei dem Leben, das ich führe, geht das auch gar nicht anders.« Sie musste lachen.
Wenig später war alles still in dem großen Haus an der Dworanskajastraße.
Um zehn Uhr am selben Tag nahmen im angesehenen Gymnasium von Madame Znamenskaja der Geschichtslehrer Pawel Pawlowitsch und zwei weitere Lehrer als Beisitzer die Abschlussprüfung ab.
In dem hellen und sparsam möblierten Saal mit großer Fensterfront saßen zwei Dutzend Mädchen. Zwischen ihnen flogen Gesprächsfetzen leiser Unterhaltung hin und her, geflüsterte Bemerkungen, kurze, fieberhaft ausgetauschte Sätze. Lebhafte Augen strahlten in blassen Gesichtern; manche Schülerinnen blätterten hastig im Geschichtsbuch, andere verfolgten mit Anteilnahme, was auf dem Podium vor sich ging.
Das Thema für die fünfminütige mündliche Prüfung wurde ausgelost, und ebenso viel Zeit blieb der jeweils nächsten Kandidatin zum Nachdenken, wofür sie an einem kleinen Tisch nebenan Platz nahm. Während Ariane Nikolajewna wartete, bis sie an der Reihe war, zerknüllte sie das Blatt Papier in der Hand, das sie vor den Augen von Pawel Pawlowitsch gezogen hatte.
Zwei Stunden Schlaf hatten ausgereicht, um ihr ihre fast kindlich frische Gesichtsfarbe wiederzugeben. Ihre hellgrauen, eher kleinen Augen lagen geschützt unter den lang geschwungenen Brauen, die an der Nasenwurzel fast aufeinandertrafen. Ihre Nase war gerade und ebenmäßig. Der fein gezeichnete Mund war geschlossen. Ariane verlor sich nicht in Gedanken über den Gegenstand, zu dem sie gleich befragt werden würde, sondern hörte der Schülerin zu, die vor den Prüfern stand und nur verlegene Antworten gab. Arianes graue Augen unter den schwarzen Brauen funkelten, und es war zu sehen, wie sehr sie sich zusammennehmen musste, um ihrer Mitschülerin nicht im Flug zu Hilfe zu kommen.
Eine Aufseherin, die etwas abseits saß, schaute auf ihre Taschenuhr und verließ den Raum. Zwei Minuten später führte sie die Direktorin herein. Die Prüfer beeilten sich, ihr ihren Platz anzubieten. Madame Znamenskaja wehrte mit einer Handbewegung ab und setzte sich etwas weiter hinten auf den Stuhl der Aufseherin.
Ein Murmeln war durch den Saal gegangen. Die Mädchen kommentierten leise, was sie beobachteten.
»Da ist sie ja mal wieder.«
»Sie kommt immer, wenn Ariane dran ist.«
»Eine Schande! Sie bevorzugt sie.«
Kaum hatte sich die Direktorin gesetzt, da klopfte Pawel Pawlowitsch schüchtern auf den Tisch und sagte zu der Schülerin:
»Danke schön.«
Sie trat vom Podium herab, ging an ihren Platz und barg das zunehmend gerötete Gesicht in ihrem Taschentuch.
Mit zögernder Stimme rief der Lehrer:
»Kusnetzowa.«
Ariane trat vor.
Mit gesenktem Blick fragte der Lehrer:
»Welches Thema haben Sie?«
»›Der Prälat von Nowgorod‹.«
Und ohne abzuwarten, dass man ihr Fragen stellte, begann Ariane mit ihrem Vortrag. Mit ihrem präzisen Ausdruck versetzte sie die Zuhörer in Erstaunen. Die verwickeltste Angelegenheit wurde klar, wenn sie darüber sprach, der verworrenste Sachverhalt überschaubar. Sie ordnete alles nach Wichtigkeit, verlor sich nicht in Einzelheiten und zeichnete ein erhellendes Gesamtbild, in dem jedes Detail seinen Platz hatte.
Die Prüfer genossen es, ihr zuzuhören, wie man einem großen Musiker in einem Konzert zuhört. Pawel Pawlowitsch ließ sie nicht aus den Augen, und im ungerührten Gesicht der Direktorin war zu lesen, mit welcher Anteilnahme sie dem geschmeidigen und treffenden Ausdruck von Ariane Nikolajewna folgte. Im Saal waren alle Augen aufs Podium gerichtet.
»Eine Eins mit Stern«, sagte ein Mädchen.
»Mit Auszeichnung und Goldmedaille«, murmelte eine andere.
»Schau dir Pawel Pawlowitsch an«, flüsterte eine Dritte, »er ist in sie verliebt, das sieht man doch.«
»Das weiß ich schon lange«, sagte ein blasses, ernstes Mädchen.
Nach fünf Minuten unterbrach Pawel Pawlowitsch Ariane Nikolajewna.
»Das genügt, Kusnetzowa, vielen Dank.«
Das Mädchen stieg vom Podium herab. Einer der Prüfer wandte sich zu seinem Kollegen:
»Wirklich ein begabtes Kind«, sagte er leise.
Eine Stunde später war die Prüfung zu Ende. Während die Schülerinnen den Saal verließen, blieb Ariane noch da und sprach mit der Direktorin. Die Unterhaltung zog sich in die Länge, nun waren sie allein im Raum. Schließlich neigte sich Madame Znamenskaja in einer Anwandlung von Zärtlichkeit, die das Mädchen verblüffte, ihr zu, gab ihr einen Kuss und sagte:
»Wohin es Sie auch verschlagen mag, Ariane, vergessen Sie nicht, dass ich Ihre Freundin bin.«
Dann ließ sie sie allein.
Im Vorraum warteten zwei Mädchen auf Ariane Nikolajewna. Sie tuschelten mit kleinen, rasch unterdrückten Lachern. Die eine war groß, schmal und blass und bewegte sich ungelenk, die andere war hässlich, mit kleinen Augen und Stupsnase, aber frech und quirlig. Beiden gemeinsam war der schlechte Ruf, den sie genossen; sie trugen öfter Schmuck von zweifelhafter Herkunft, denn sie kamen beide aus armen kleinbürgerlichen Familien. Sie gesellten sich zu Ariane, tätschelten und beglückwünschten sie im Gehen und sagten ihr tausend Schmeicheleien.
»Hören Sie zu, Ariane«, sagte die Größere von den beiden, »wollen Sie nicht mit uns zu Abend essen? Wir treffen ein paar Leute … Im neuen Landhaus, das Popow gerade gekauft hat …« – dieser Popow war der reichste Händler der Stadt, ein älterer Mann von recht abstoßendem Aussehen –, »er hat das sehr originell eingerichtet. Stellen Sie sich vor, es gibt nicht einen einzigen Stuhl im Haus. Nur Sofas. Das muss man gesehen haben, wirklich!«
Ganz aufgeregt legte die Kleinere nach.
»Da gibt es Musiker, die er in einem Nebenraum versteckt: Man hört sie, aber sie sind nicht zu sehen. Und dann hat er etwas total Originelles erfunden. Die Beleuchtung kommt von Kerzenstummeln, die nach und nach, einer nach dem anderen, erlöschen.«
Ariane fragte:
»Und wer speist auf den Sofas? Ich möchte nicht neben Popow sitzen.«
»Freunde von ihm, sehr nette Leute. Warum wollen Sie eigentlich nicht zu Popow? Er ist rasend verliebt in Sie, meine Liebe; er träumt und spricht von nichts anderem als von Ariane Nikolajewna. Sie müssen unbedingt mitkommen.«
»Nein danke«, sagte Ariane, »Popow ist ein schrecklicher Kerl.«
»Aber so geistreich! Und wenn Sie ihn erst singen hören … Er ist umwerfend, Sie würden ihn nicht wiedererkennen.«
»Dann soll er ohne mich singen«, erwiderte Ariane und blieb stehen, »ich werde weder in sein Landhaus noch zu seinen Sofas und seinen Kerzenstummeln kommen, heute nicht und morgen nicht. Richten Sie ihm das von mir aus.«
»Er wird vor Verzweiflung sterben.«
»Dann soll er sich mit Wodka trösten.«
Sie trennte sich von den beiden Mädchen, die ihren Weg fortsetzten, aufgeregt über diese Weigerung und lebhaft miteinander redend.
Die Größere sagte:
»Die ziert sich ja ganz schön, wie albern.«
Und die Kleine:
»Popow wird sich nicht freuen.«
Ariane betrat einen winzigen Park, eigentlich eher nur eine Reihe Bäume und Rosenstöcke am Straßenrand. Unruhig ging dort Pawel Pawlowitsch auf und ab. Er war ein sanftes Wesen, behutsam, verträumt, gutherzig, ängstlich, und nun regelrecht erschrocken, sich plötzlich Aug in Auge mit Ariane Nikolajewna wiederzufinden, obwohl sie sich zwei- oder dreimal die Woche nach dem Unterricht in diesem kleinen Park trafen. Doch jedes Mal lähmte Pawel Pawlowitsch eine Gemütsbewegung, dass es ihm fast die Sprache verschlug. Heute, nach dem kurzen Gespräch mit ihren Kameradinnen, wirkte Ariane reizbar, was zur Befangenheit des Lehrers erst recht beitrug. Immerhin brachte er den Mut auf, ihr vorzuschlagen, sich auf eine Bank in der Nähe zu setzen. Sie lehnte ab, sie sei schon sehr verspätet und werde nicht mehr pünktlich zum Mittagessen daheim sein.
So begleitete er sie, beglückwünschte sie zu ihrer Prüfung und wiederholte den schmeichelhaften Beifall eines der Prüfer: »Wirklich ein begabtes Kind.«
Ariane, deren Kopf auf ihrem dünnen Hals leicht schwankte, richtete sich auf und brummelte:
»Kind! Was für eine Unverschämtheit! Ich bin siebzehn.«
Dann wurde sie wieder still. Auch der Lehrer schwieg verlegen. Sie gingen zügig durch kaum belebte Straßen. Es war schon recht warm, zum ersten Mal in diesem Jahr; so kündigte sich die brütende Sommerhitze des Südens an.
Sie kamen vor das Haus in der Dworanskajastraße, wo Ariane Nikolajewna wohnte. Pawel Pawlowitsch war blasser als sonst; er nahm sich zusammen und begann einen Satz.
Ariane unterbrach ihn:
»Wissen Sie, woran ich gerade denke, Pawel Pawlowitsch? Ich wirke vielleicht besorgt, aber ich bin unglaublich froh. Erraten Sie, warum? Nein? Nun, ich will es Ihnen sagen. Ich denke nur an eines … In ein paar Minuten bin ich in meinem Zimmer. Auf dem Sofa dort finde ich ein schönes weißes Kleid mit irischen Stickereien, und mit Ausschnitt. Und Pascha – kennen Sie Pascha? Sie mag mich, alles was ich tue, ist in ihren Augen gut – Pascha wird weiße Seidenstrümpfe zum Kleid gelegt und neben das Sofa weiße Sandalen gestellt haben. Dann, Pawel Pawlowitsch, werde ich mich von oben bis unten entkleiden, werde diese schreckliche Schuluniform zu Boden werfen, dieses braune Kleid, aus dem ich drei Jahre lang nicht herausgekommen bin. Ich werde darauf tanzen, ich werde darauf herumtrampeln; ich werde Pascha küssen … Nur daran denke ich jetzt. Ich bin frei, frei! Freuen Sie sich mit mir.«
Sie reichte ihm beide Hände. Pawel Pawlowitsch hörte ihr zu, und in seinem Gesicht zeigten sich widersprüchliche Gefühle. Die Freude des Mädchens, allein schon ihre Stimme konnten ihn berauschen; und doch fühlte er in seinem Inneren eine dumpfe Trauer.
Schon hatte Ariane ihn verlassen und ging die Treppe hinauf. Auf der Türschwelle drehte sie sich noch einmal um:
»Wenn Sie nichts Besseres vorhaben, kommen Sie heute zum Abendessen in den Alexanderpark.«
Sie war verschwunden. Pawel Pawlowitsch stand erstarrt auf dem Bürgersteig.
II
Tante Warwara
Als Ariane hereinkam, saßen in dem großen Esszimmer ein paar Leute an einem langen Tisch, dessen Vorsitz Tante Warwara hatte. Sie war eine Frau in den Vierzigern, mit asymmetrischem Gesicht, in dem einem zuallererst zwei große dunkle Augen auffielen, Augen von solcher Schönheit, die allein schon ausreichten, die gängige Meinung in der Stadt zu rechtfertigen: »Warwara ist eine attraktive Frau.« Sie war auffallend frisiert. Ein Seitenscheitel teilte ihr braunes, leicht gewelltes Haar. Ihr Mund war ebenso fein gezeichnet wie der ihrer Nichte, allerdings hatte sie keine schönen Zähne. Warwara Petrowna wusste das und behalf sich, indem sie mit geschlossenen Lippen lächelte und ihre braunen Augen umso mehr leuchten ließ. »Sie ist unwiderstehlich«, hieß es dann bei ihren Bekannten. Sie war schlank geblieben. »Wenn Tante Warwara auf der Straße vorbeikommt«, sagte Ariane immer, »glauben die Leute, ein junges Mädchen zu sehen.« Sie kleidete sich, auch zu Hause, ohne die geringste Nachlässigkeit – etwas durchaus Seltenes in Russland. Sie trug elegantes Schuhwerk; ihre Hände waren gepflegt, ihre Wäsche vom Feinsten, und außer Haus trug sie jahrein, jahraus ein Kostüm aus schwarzem Tuch, das ein guter Schneider in Moskau gefertigt hatte.
In der Stadt war es ein unerschöpfliches Gesprächsthema, wie Warwara Petrowna lebte. Aus ihrer Vergangenheit war bekannt, dass sie unter ungeklärt gebliebenen Umständen ihre Familie verlassen hatte und zum Medizinstudium in die Schweiz gegangen war. Dann war sie als Dorfärztin nach Iwanowo in unserem Regierungsbezirk zurückgekehrt.
Zu der Zeit war bei uns viel von ihrer jüngsten Schwester die Rede, der sehr hübschen Vera, in die der berühmte Romancier Kowalski, der den Winter in der Stadt verbrachte, unsterblich verliebt war. Während man also mit der Ankündigung rechnete, dass das Mädchen und der Schriftsteller heirateten, reiste dieser unerwartet auf die Krim, und jene nach Iwanowo, wo sie bei ihrer Schwester Unterschlupf fand. Ein halbes Jahr lang bekam niemand sie zu Gesicht. Dann fuhr sie nach Paris und heiratete dort im Jahr darauf Nikolaj Kusnetzow, einen Ingenieur, der öfters beruflich in Frankreich zu tun hatte.
Kurz nach Veras Verschwinden aus Iwanowo kam heraus, dass Warwaras Haus noch einen weiteren Gast beherbergte, von dem Warwara sagte, es sei das kränkliche Kind einer Freundin, die es in ihre Obhut gegeben habe. Das kleine Mädchen war nicht in der Dorfkirche getauft worden, und als es achtzehn Monate alt war, fuhr Warwara mit ihm ins Ausland und blieb einige Zeit bei ihrer inzwischen verheirateten Schwester Vera.
Sie kam allein zurück. Da geschah etwas, das Warwaras Leben eine andere Wendung geben sollte. Eines Nachts wurde sie als Ärztin zu einem der größten Grundbesitzer von ganz Russland gerufen, dem Fürsten Y…, der sich zufällig für einen Monat auf einem benachbarten Gut aufhielt. Sie rettete ihm das Leben. Der Fürst wollte sie nicht wieder ziehen lassen, nahm sie mit nach Europa und behielt sie bis zu seinem Tod sieben Jahre später bei sich. Dann ging Warwara zurück in ihre Heimat, mit einem Vermögen von hunderttausend Rubel, zehntausend Rubel Pension und um manche Erfahrung reicher, die sie bei dem glanzvollen Leben im Westen hatte machen dürfen. Sie kaufte ein Haus an der Dworanskajastraße.
Sie wirkte, als hätte sie Russland nie verlassen. Als hätte sie nie etwas anderes getan, hatte sie die Gabe, ihre Zeit mit Nichtstun zu verbringen, und die Tage waren ihr immer zu kurz, obwohl sie nichts hatte, womit sie sie ausfüllte. Sie verließ die Stadt selten; allenfalls fuhr sie im Sommer für einen Monat auf ein kleines Anwesen am Ufer des Don, das sie gekauft hatte, um immer Milch, Eier und frisches Gemüse zu haben. Während der Jahre des Dienens beim Fürsten hatte sie bis zum Überdruss das Fernweh ausgekostet, das bei den Russen so hartnäckig ist. Ihre vergangenen Lebensjahre betrachtete sie wie eine Bühnenkulisse: etwas gewiss Staunenswertes, aber man würde nicht im Traum darauf kommen, sein Leben darin einrichten zu wollen. Man bleibt für ein paar Augenblicke im Rampenlicht und unter den Augen von tausend Zuschauern, aber gleich nach der Vorstellung geht man nach Hause und macht die Tür hinter sich zu.
Warwara Petrowna ging nach Hause, aber sie ließ die Tür angelehnt für die zahlreichen Freunde, die sie tatsächlich bald in der Stadt fand. Seit fünf Jahren war sie schon dort, da starb ihre Schwester Vera Kusnetzowa in San Remo, wo sie allein mit ihrer Tochter lebte, an Schwindsucht. Kusnetzow reiste eilends aus Sankt Petersburg an, nahm seine Tochter mit nach Russland, und weil er nicht wusste, wohin mit ihr, fragte er seine Schwägerin, ob sie sie aufnehmen wolle.
Als die Nachricht das Haus an der Dworanskajastraße erreichte, waren die Bekannten von Warwara rasch der übereinstimmenden Meinung, sie werde ablehnen. Warum sollte sie es auf sich nehmen, so frei wie sie war, ein Kind großzuziehen, das sie kaum kannte? Warwaras Freunde täuschten sich; kaum hatte sie den Brief ihres Schwagers erhalten, telegrafierte sie ohne weiteres Nachdenken nach Sankt Petersburg, man solle ihr ihre Nichte bringen.
Als Ariane zu ihrer Tante zog, war sie ein junges Mädchen von vierzehneinhalb Jahren, körperlich und geistig ihrem Alter voraus. Sie war sehr dünn, aber schon wohlgeformt, mit kräftigen Armen und ernstem Gesicht; ihr gerader Blick hatte etwas Angriffslustiges.
»Wem zum Teufel siehst du ähnlich?«, sagte Warwara Petrowna. »Du hast unseren Mund, aber du wirst nicht so hübsch wie deine Mutter. Und woher hast du diese Art, die Leute anzusehen? Von wem hast du diese Augen? Jedenfalls nicht von deinem Vater, dem siehst du überhaupt nicht ähnlich … Im Übrigen gratuliere ich dir dazu, denn du weißt, was ich von ihm halte …«
Das war die Art, wie Warwara Petrowna sprach. Die Augen des Mädchens leuchteten, aber sie erwiderte nichts darauf.
»Also, du gefällst mir. Ich hatte Sorge, du wärest noch eine Göre; aber ich sehe, dass du ein junges Mädchen bist. Wir werden gut miteinander auskommen.«
Dass das Mädchen nun bei ihr lebte, führte aber zu keinerlei Veränderung im Warwara Petrownas Leben. Sie behandelte Ariane trotz des Altersunterschieds eher wie eine Freundin als wie eine Nichte, für deren Erziehung sie zu sorgen hatte.
Warwara hatte sich, kaum dass sie von zu Hause weg war, an die Freiheit gewöhnt, hatte Geschmack daran gefunden und war zu der Ansicht gelangt, dass sie selber wusste, was für sie gut war. Da die Natur den Verkehr zwischen den Geschlechtern mit Geheimnissen und lebhaften Freuden verknüpft hat, warum sollte man darauf verzichten? Ihr aufgeklärter akademischer Verstand sah keinen Grund dafür, solche gesunden Wonnen von sich zu weisen. Sie hatte an der Universität Liebhaber gehabt, und zurück in der Heimat hatte sie sogar in Iwanowo welche gefunden. Während ihrer Auslandsaufenthalte mit dem Fürsten hatte sie manche Gelegenheit zu vergleichenden Studien über die Vorzüge abendländischer Männer gehabt, und nach der Rückkehr in ihre Geburtsstadt lebte sie weiterhin nach Lust und Laune. Es fehlte ihr an Verständnis dafür, dass man dem Sichhingeben diese große Bedeutung beimaß, wie es so viele romantische Menschen tun. Mit einem Wort, sie hatte hinsichtlich der Liebe einen männlichen Standpunkt. Sie nahm sich einen Geliebten, wenn sie das Bedürfnis dazu hatte, und sie verließ ihn, wenn sie einen anderen fand, der ihrer Laune mehr entsprach. Ihrer Vorstellung nach brauchte man sich nicht in Aufwallungen von Leidenschaft zu vereinigen und nicht unter Tränen zu trennen. In ihren Augen war die Liebe keine Krankheit, und ein Bruch führte nicht zur Tragödie. Sie handelte mit solcher Selbstverständlichkeit, dass ihre Liebhaber nicht auf die Idee kamen, sie hätten das Recht, mehr von ihr zu verlangen, als sie ihnen schenkte. Sie verließ sie im Übrigen nie ganz, sondern auf das innigste erotische Verhältnis folgte ohne viel Lärm und Aufhebens ein freundschaftlicher Umgang. Gelegentlich verweigerte sie sich nicht einmal einem Rückfall. In den ersten Jahren nach ihrer Heimkehr musste sie manchmal nach Sankt Petersburg und Moskau. Dort hatte sie Freunde von früher, bei denen sie abstieg. Wenn sie wieder zu Hause war, erzählte sie von der Reise und den Freuden, die sie dabei genossen hatte, ohne dass sich der aktuelle Liebhaber daran gestoßen hätte.
An all dem sieht man, dass Warwara Petrowna eine gesunde und ausgeglichene Frau war. Ihre Sinne, denen sie nichts vorenthielt, entführten sie nur auf halbem Weg in die Leidenschaft; da sie die Zügel in der Hand behielt, ließ sie sich nicht von ihnen davontragen.
Ihre Liebesmoral, denn die hatte sie, war von zwei Prinzipien geleitet. Sie blieb ihrem Geliebten treu, bis sie von einem neuen Mann fasziniert war. Dies gestand sie dann sofort, denn eine Aufteilung hätte sie nicht richtig gefunden. Sie war stets die Frau eines einzigen Mannes; nur wechselte sie den oft. So hatte sie nie jemanden betrogen. Um einen Mann zu betrügen, muss man ihn lieben, muss ihm mit seinen Gefühlen verbunden sein. Nun hatte Warwara bisher in ihren Geliebten nur Freunde eines ergänzenden Geschlechts gesehen, und die Beziehungen, die sie zwischen ihnen und sich aufbaute, waren fest umrissen. Sie sagte gern von sich, sie habe der Liebe genau den Platz zugewiesen, die sie einnehmen darf. Sie komme nicht höher als bis zur Körpermitte.