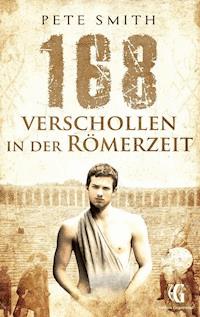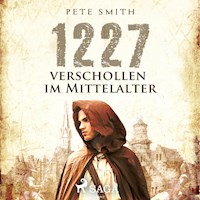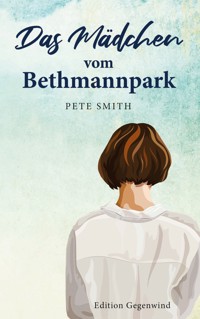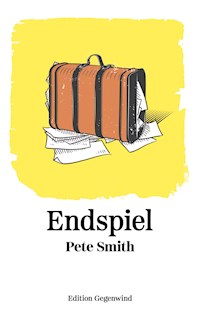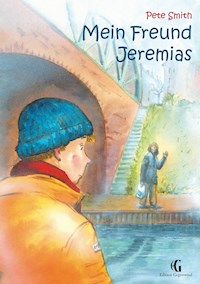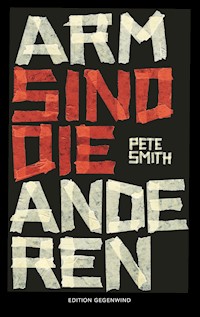
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Es ist die Nacht vor Heiligabend. Sylvester, genannt Sly, kommt von einer Tour durchs Frankfurter Bahnhofsviertel heim. Am Badezimmerspiegel entdeckt er eine Botschaft seiner Mutter: "Ich kann einfach nicht mehr." Sly will nicht glauben, dass sich seine Mutter etwas angetan haben könnte, sondern hält daran fest, dass sie, die häufig unter ihren "dunklen Tagen" leidet, sich bloß eine Auszeit genommen hat. Am nächsten Morgen, es schneit schon seit Tagen ohne Unterlass, begibt sich Sly gemeinsam mit seinen Geschwistern Enja, Inno und Flo sowie seinem mitunter verwirrten Opa auf die Suche nach seiner Mutter und damit auf eine abenteuerliche Odyssee durch Frankfurt am Main. Die Schatten der Vergangenheit holen ihn ein - der prügelnde Stiefvater, die anhaltenden Geldsorgen, Mamas Depressionen. Nach und nach wird ihm bewusst, wie sich seine Mutter durch die existenzielle Not verändert hat, und er gesteht sich ein, dass seine Familie tatsächlich arm ist. Doch in der größten Not findet Sly Hilfe: bei seinen Geschwistern, seinen Freunden, einer geheimnisvollen Schönen, seiner gehandicapten Nachbarin und am Ende sogar bei seinem Großvater und einem leibhaftigen Hellseher. Sprachlich brillant, packend, ebenso humorvoll wie eindringlich, erzählt Pete Smith eine Geschichte von Mut, Hoffnung und Beharrlichkeit. In seinem Roman "Arm sind die anderen" porträtiert der Frankfurter Autor eine Familie, die in den Dunkelzonen unserer Gesellschaft lebt und trotz schwierigster Voraussetzungen verzweifelt darum bemüht ist, die eigene Würde zu bewahren. "Realistisch, spannend und ziemlich cool." Hessischer Rundfunk "Sehr fesselnd geschrieben. Ein Story, die vorwärts drängt. Kann besonders Jungen empfohlen werden." Evangelisches Literaturportal "Smith schreibt sehr realistisch und unsentimental, teilweise mit einer harten, aber nicht platten Wortwahl. Ein schön geschriebenes, anrührendes Werk über die Hoffnung und die Wichtigkeit der Familie in Zeiten wie diesen, das ich jedem nur weiterempfehlen kann." Alliterus "Ein schöner, schonungsloser und ehrlicher Roman zum Thema Jugendarmut." Armutskonferenz Österreich "Die Geschichte zerreißt einem schier das Herz, lässt an Dramatik nichts aus und zeigt eine dunkle Seite der Gesellschaft. Bei den vielen schrägen Ideen bleibt oft das Lachen im Halse stecken, die temporeiche Handlung reißt jeden mit - doch das Ende ist leise und offen. Ein Buch, dem viele jugendliche und ebenso erwachsene Leser und Leserinnen zu wünschen sind!" Borromedien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Smith
wurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers in Soest geboren. An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studierte er Germanistik, Philosophie und Publizistik. Er schreibt Kinder- und Jugendbücher, Essays, Kurzgeschichten, Erzählungen und Romane, für die er mehrfach ausgezeichnet worden ist, unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Der Autor lebt in Frankfurt am Main.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
1
Mama stahl sich ausgerechnet in der Nacht aus unserem Leben, in der ich mit meinem Freund Agi durchs Bahnhofsviertel streifte, eine Nacht wie ein Traum, der sich lautlos heranschleicht, aufregend und fiebrig, eine Nacht, die man nie vergisst, weil sie nie endet, die längste, die dunkelste Nacht meines Lebens.
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich als erstes den Schnee. Flocken, die zu Boden schweben, die herumwirbeln und miteinander verschmelzen, die aufleuchten und verblassen, die vor dem grauen Himmel tanzen und vor dem Weiß der Fassaden verschwinden. Der Platz vor unserem Hochhaus, die Straßen, die Vorgärten, die Büsche und Bäume, die parkenden Autos, der Müll – alles lag unter einer dicken, weißen Decke begraben. Auf der Wiese zwischen unseren Häusern thronte ein gigantischer Schneemann, dem irgendein Witzbold einen ebenso gigantischen Ständer verpasst hatte. Am Rande der Gehwege warfen die Räumfahrzeuge meterhohe Schneegebirge auf. Einen abseits gelegenen Hügel hatten die Zwillinge aus dem dritten Stock festgestampft und ausgehöhlt – seitdem krochen sie jeden Abend in ihre Höhle, um sich vor ihrem besoffenen Alten zu verstecken.
Es war die Nacht vor Heiligabend. Seit fünf Tagen schon schneite es ohne Unterlass. Die Zeitungen würden später von einem Jahrhundertwinter schreiben, dabei waren vom Jahrhundert erst zwei Jahrzehnte vergangen. Ich stand am Küchenfenster und sah hinunter und überlegte, über die weiße Wiese zu stapfen, um einmal im Leben der erste zu sein. Wie lange würde es dauern, bis meine Spur unter neuem Schnee verschwand?
Gegen Winterromantik und weiße Weihnacht und die Schwermut der Verlierer am Ende eines Jahres bin ich immun. Aber in dieser Nacht …
Ich sah hinaus und hoffte, dass irgendetwas geschah. Ein Wunder oder ein Unglück, ein Anfang oder ein Ende, gleich was, Hauptsache, wir würden auch morgen noch darüber sprechen oder besser sogar noch im nächsten Jahr. Die Stille wuchs, eine eisige Kälte breitete sich in mir aus und mit ihr das dumpfe Gefühl einer Bedrohung, ich hielt die Luft an, wartete, doch nichts geschah. Zumindest nichts, das ich wahrnahm. Wer weiß, vielleicht stand die Welt still oder die Zeit, möglich, dass ich taub war oder tot, keine Ahnung, mittlerweile weiß ich bloß, dass man die Einzigartigkeit eines Augenblicks erst wahrnimmt, wenn er längst vorüber ist, und später niemals sicher sein kann, ob ihn die eigene Erinnerung verklärt.
Ich erwachte, als es läutete und Opa brüllte und der Fernseher aufjaulte, worauf eine Tür knallte und irgendwer vor Schmerzen stöhnte.
Wenige Augenblicke später stand Mama in der Tür. Ihre Augen waren gerötet, die Wimperntusche verlaufen.
»Kannst du … bitte …?«
Ihr Mund zuckte, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Sie wartete meine Antwort nicht ab, sondern löste sich auf, wie immer, wenn sie diese Stimmung hat, die sie selbst ihre dunklen Tage nennt, unter der sie jedoch Wochen oder Monate leidet.
Während ich noch nickte, nahm mein Unterbewusstsein wahr, wie es erneut an der Haustür klingelte.
Kannst du …
… bedeutete, dass ich Opa zum Schweigen bringen sollte.
Bitte …
… hieß, wenn du‘s nicht hinkriegst, spring ich aus dem Fenster.
Das Gebrüll kam aus dem Bad. Als ich die Tür aufriss, stand Opa krumm wie ein Fragezeichen in der Badewanne und fummelte an seinem Dings.
»Was ist? Hast du dir wehgetan?«
»Wonach sieht’s denn aus, du Idiot?«, schnauzte er mich an.
Er bückte sich nach der Seife, rutschte aus und landete auf seinem knöchernen Arsch. Wieder brüllte er, diesmal vor Schmerz. Als ich ihm hoch half, läutete es zum dritten Mal.
Meine Geschwister stellten sich weiterhin taub.
»Hey, ihr Toys!«, schrie ich, den glitschigen Arm meines gefährlich trudelnden Opas umklammernd. »Macht endlich einer diese verdammte Tür auf?«
Opa drehte auf. Ich zwang ihn auf die Knie, damit er nicht wieder hinfiel, und wich seinen Schlägen aus. Eine Strähne seiner fusseligen Haare hatte sich in seinen buschigen Brauen verfangen und behinderte seine Sicht. In den Mundwinkeln schäumten weiße Flocken, und sein spitzer Adamsapfel hüpfte über seinen Hals wie eine Springmaus auf Speed. Als er erneut ausholte, drückte ich ihm blitzschnell die Seife in die Hand.
Der Trick funktioniert jedes Mal! Ebenso misstrauisch wie beeindruckt sah Opa zu mir auf.
»Was ist das? Woher …? Kannst du zaubern oder was?«
»Sehe ich aus wie Harry Potter?«
Ich nutzte seine Verwirrung, um ihn über den Badewannenrand auf die versiffte Matte zu bugsieren, die zu waschen ich seit Wochen vor mir herschob. Opas blaurotweiß gestreifter Bademantel, ein Relikt der guten alten Zeit, lag neben dem Klo. Ich half ihm hinein und schlang den Gürtel um seinen dürren Leib. In diesem Moment hörte ich eine vertraute Stimme in meinem Rücken.
»Hey Sly, was geht!« Räusper, schluck, räusper. »Hallo, Herr Schröder. Schicker Bademantel.«
Wenn Agi sich bemüht, Opa gegenüber nett zu sein, geht das meistens daneben. So auch diesmal. Argwöhnisch sah Opa an sich herunter, bevor er erst mich beäugte und dann meinen Freund ins Visier nahm. Dessen hünenhafte Gestalt schien unter den Blicken des Greises zu schrumpfen.
»Will mich der Kanake verscheißern?«, keifte Opa. »Was sucht denn der auf meinem Pissoir? Hat der irgendein Problem? Muss der vielleicht kacken? Oder warum hängt ihm seine Hose im Knie?«
Ruckartig raffte Agi seine Saggy Pants über die Hüfte. »Ich warte lieber draußen«, raunte er und machte sich aus dem Staub.
Opa schimpfte weiter. Ich stellte meine Ohren auf Durchzug und wartete, bis er sich ausgetobt hatte. Mit ihm zu diskutieren, ist zwecklos, weil er eh nichts kapiert.
Opa ist vor einem halben Jahr bei uns eingezogen. Mama hat ihn zu uns geholt, als sie merkte, dass er mit Omas Tod nicht klarkam. Wir haben zwar nicht annähernd so viel Platz wie Mamas Schwester, aber bei der lieben Tante Ida und ihrem Großkotz Karl war Opa leider nicht willkommen.
»Dann rücken wir halt enger zusammen«, meinte Mama, »bis euer Opa in die ewigen Jagdgründe einzieht.«
Im August ist er zweiundsiebzig geworden. An sich kein Alter, sagt Mama und hat damit vermutlich recht. Dennoch hat sich Opa in den letzten Jahren verändert. An manchen Tagen sitzt er stundenlang in seinem Sessel und starrt dumpf vor sich hin. Spricht man ihn an, reagiert er nicht oder er brüllt sofort los, besser, man lässt es. An anderen Tagen wiederum ist er laut und aufgekratzt, mischt sich überall ein, tigert ruhelos durch die Wohnung und hört gar nicht mehr auf zu reden – bloß dass er wieder und wieder dasselbe erzählt. Das fällt sogar Mama auf. Kürzlich wollte sie von mir wissen, ob Opa womöglich Alzheimer hat. Ich habe die Weisen von Wikipedia befragt und erfahren, dass in seinem Alter nur jeder Zwanzigste an Alzheimer leidet. Aber um sicher zu gehen, müsste Mama mit ihm zum Arzt gehen. Davor hat sie natürlich Angst. Wenn Opa ins Heim muss, wäre sie schuld. Und noch mehr Schuld können ihre schmalen Schultern nicht tragen.
Als ich ihn endlich ins Bett gebracht hatte, stand das nächste Problem an, ein weitaus schwierigeres, das ich bis dahin verdrängt hatte:
Wem konnte ich bei meiner Auswechslung die Kapitänsbinde anvertrauen? Wer würde mich vertreten, wenn ich mit Agi loszog?
Mama fiel schon seit Wochen aus. Die dunklen Tage hatten sie wieder einmal voll im Griff. Die meiste Zeit lag sie auf der Couch im Wohnzimmer, wo sie auch nachts schläft. Dazu fühlt sie sich ihrem Vater gegenüber verpflichtet, damit wenigstens er sein eigenes Zimmer hat. Zweiundachtzig Quadratmeter für sechs Personen – da schrumpfen erst die Ansprüche und dann die Bedürfnisse.
Blieben Inno und Enja.
Inno ist die Abkürzung von Innozenz, was so viel bedeutet wie die heilige Unschuld, ein Name, der zu einem Papst passt, aber nicht zu meinem kleinen Bruder. Mit Inno teile ich mir ein Zimmer. Seine Hälfte haben wir auf seinen Wunsch hin komplett schwarz angemalt. Nicht nur die Wände und die Decke über seinem Bett, sondern auch das Regal und den Bettkasten und den kleinen Nachttisch. Auf dem Boden liegt ein schwarzer, fleckiger Teppich, den er auf dem Sperrmüll gefunden hat.
Als wir hier eingezogen sind, hat er allen Ernstes vorgeschlagen, einen Zebrastreifen zwischen seiner und meiner Hälfte zu pinseln. Aus heutiger Sicht hätte ich mich darauf einlassen sollen, da ihm das wenigstens ein paar weiße Streifen in seinem Leben beschert hätte. Denn sonst ist darin alles schwarz – sein Schrank, sein Schreibtisch, sein Bettzeug, sein Schlafanzug, Hosen und Pullis, sein Basecap, seine Unterhosen und Socken, seine Schuhe ... Selbst Innos Seele ist schwarz. Am liebsten treibt er sich auf Friedhöfen herum, um mit den Toten zu sprechen, wie er sagt. Er denkt ziemlich viel nach, vor allem über das Jenseits, oder er liegt im Bett und schmökert in seiner Bibel, der Enzyklopädie denkwürdiger Arten, aus dem Leben zu scheiden. Ja, Inno hat einen Schuss, doch er tut niemandem weh, und außerdem ist er mein Bruder.
An jenem Abend lag der Unschuldige ungewöhnlich früh im Bett und schlief. Oder er tat so, als ob. Ich schlich mich ans Bett und beugte mich über ihn. Sein dichtes, schwarzgelocktes Haar, das einzige Erbe seines portugiesischen Vaters, ließ seine bleiche Haut noch bleicher erscheinen. Bildete ich mir das nur ein, oder spielte ein übermütiges Lächeln um seine Pausbäckchen?
Am Fenster flackerte Innos Kerze. Einen Moment überlegte ich, ob ich sie auspusten sollte – eine effektive Methode, um die Wahrheit aus ihm heraus zu kitzeln. Wie Opa fürchtet sich Inno nämlich vor Gespenstern, auch wenn er seine Furcht lieber Ehrfurcht nennt. Das Kerzenlicht soll die Geister bannen.
Ich spitzte schon meine Lippen, als ich jäh innehielt. Wenn Inno nur so tat, als ob er schliefe, würde ihm die plötzliche Dunkelheit eine Heidenangst einjagen. Bis ich mein kleines Sensibelchen wieder beruhigt hätte, wäre Agi längst über alle Berge.
Ich versuchte mein Glück also bei Enja, meiner zuckersüßen, zickigen, einsamen, einzigen und einzigartigen Schwester. Enja ist das komplette Gegenteil von Inno. Sie ist groß und dünn und so blond, dass sich die Leute nach ihr umdrehen, wenn sie ihre Haare nicht unter einer Kappe oder Kapuze versteckt. Die meiste Zeit verbringt sie damit, durch die Chatrooms der Welt zu surfen, stets auf der Suche nach einem Typen, der sie trotz oder wegen ihrer Härte gegen sich selbst unwiderstehlich findet. Die restliche Zeit blättert sie in irgendwelchen Frauenzeitschriften, die sie aus dem Altpapiercontainer herausfischt. Freundinnen hat Enja keine, denn außer ihr, Gamora, Hit Girl und Black Widow sind alle Weiber Tussen.
Ich klopfte leise, um Flo nicht zu wecken. Flo ist unser Bambi, mit dem sich Enja ihr Zimmer teilt. Nichts geschah. Ich hielt mein Ohr an den abblätternden Lack, doch drinnen blieb es auffallend still. Ich klopfte lauter, wieder ohne Erfolg. Behutsam drückte ich die Klinke herunter und trat ins Zimmer. Flo schnarchte leise, während sich Enja hinter einer Brigitte versteckte.
»Kannst du …?«, flüsterte ich.
»Vergiss es!«, zischte Enja.
»Lieb von dir«, erwiderte ich und zog sachte die Tür hinter mir zu.
Im Flur raffte ich meine Jacke vom Haken und sprintete los.
Agi wartete im Treppenhaus. »Hat mich der alte Sack wirklich Kanake genannt?«, grunzte er.
»Weg hier!«, raunte ich.
Zwei Stockwerke tiefer hörte ich unter dem Dach eine Tür aufspringen und eine schrill-piepsige Stimme, die von Agis Absätzen zerhackt wurde. Ich konnte kaum etwas verstehen, nur »Wichser!« und »Du kannst mich mal!« und »Fick dich doch!«, womit wohl alles gesagt war.
2
Draußen empfing uns dichtes Schneetreiben. Wir zogen unsere Kapuzen in die Stirn und stiefelten los. Wenn man am Wendehammer einer elend langen Sackgasse wohnt, aus der nur ein Weg herausführt, ist man genug gestraft, sollte man meinen. Doch in dieser Nacht belehrten uns die Götter auf grausame Weise eines Besseren. Mit eisigen Krallen kroch mir der Frost unter die Haut und ließ meine Tränen gefrieren. Offenbar waren wir die einzigen auf der Welt, die sich bei einem derartigen Schneesturm hinaus wagten, zumindest war weit und breit niemand zu sehen. Anfangs fror ich nur, dann kam der Schmerz, schließlich waren meine Glieder so steif und taub, dass ich sie kaum mehr spürte. Da wir in die Hauptstraße bogen, erfasste uns von hinten ein Scheinwerfer und warf unsere Schatten voraus. Zu spät erkannten wir, dass es der 56-er Bus war, der schneespritzend an uns vorbeifuhr. Ich rannte los, was sich anfühlte, als trüge ich Beinschienen. Schon setzte der Bus den Blinker, schon leuchteten seine Bremslichter auf, schon kam er zum Stehen. An der Haltestelle wartete niemand, und da sich die Türen öffneten, stieg auch niemand aus. Dennoch wartete der Fahrer, und einen Augenblick klammerte ich mich an die Hoffnung, dass da ein Mensch war, der es ausnahmsweise gut mit uns meinte. In der Sekunde jedoch, da ich sein Heck erreichte, schloss sich die Tür, und der Bus fuhr los. Ich schrie und fluchte, doch der Fahrer reagierte nicht, noch nicht einmal auf meinen Mittelfinger, dafür erschien das Gesicht eines Kindes in der Rückscheibe, das mir zuwinkte, bevor sein Gesicht im Schneesturm verschwand.
Da der nächste Bus laut Plan erst in einer halben Stunde fuhr, machten wir uns zu Fuß auf den Weg. Agi schwankte und schnappte nach Luft. Als wir am Höchster Bahnhof ankamen, war elf Uhr vorüber. Immerhin mussten wir nicht lange auf die S-Bahn warten. Wir setzten uns nebeneinander. Ein Fehler, denn Agis Cool Water raubte mir schier den Atem.
»Kannst du nicht mal weniger draufspritzen?«, zischte ich.
Er grinste breit, sodass sich sein dünner Klobrillenbart zum Trapez spreizte. »Weißt du, wenn ich spritze, dann richtig.«
Agi ist Zypriote, wie er unter Biodeutschen gerne betont, obwohl er in Frankfurt geboren ist und einen deutschen Pass hat, aber Zyprioten, speziell solche, die auf den Namen Agamemnon hören, sind halt besonders, und das in jeder Hinsicht. Agis größter Wunsch ist es, in einer Samstagabendshow neben Kate Upton auf dem Sofa zu sitzen und ihr vor einem Millionenpublikum ins Ohr zu flüstern, wie heiß er sie findet. Die Moderatorin, das war ihm wichtig, würde mit ihm über seinen Migrationshintergrund sprechen, dabei hat Agi nur mikroskopisch wahrnehmbare Migrationsanteile, da schon sein zypriotischer Vater in Frankfurt zur Schule gegangen ist, und schon gar nichts Hintergründiges, im Gegenteil, jeder Gedanke steht ihm auf seine hohe Stirn geschrieben, gut lesbar für jedermann, vor allem für Frauen, kreisen seine Gedanken doch ohne Unterlass nur um das eine.
»Fuck, mein Schwanz klemmt«, brummte er, griff sich in die Hose und fummelte sein Teil zurecht. Als er seine Beine ausstreckte, traf er den Fuß der gegenüber sitzenden Frau.
»Tschuldigung«, seufzte er und leckte sich über die Lippen, »hab einen in jeder Hinsicht harten Tag.«
Die Frau, eine Business-Lady mittleren Alters, rümpfte die Nase, sprang auf und suchte das Weite.
»Umso besser«, murmelte Agi, »bist mir eh zu alt.«
Wenn man mit Agi unterwegs ist, ist das entweder lustig oder peinlich oder beides zugleich. Die Welt ist sein Spielplatz, und wehe, einer stellt sich ihm in den Weg. Inzwischen glaube ich, er kann gar nicht anders. Tatsächlich strotzt mein Freund nur so vor Kraft und weiß für gewöhnlich nicht wohin damit. Dass es für ihn aller Voraussicht nach nur zum Realschulabschluss reicht, kümmert ihn nicht, weil man als Pornodarsteller sowie keinen Abschluss braucht. Seinen neuesten Berufswunsch hat er uns vor einigen Wochen gesteckt, als er und ich zusammen mit DJ und Hermann, dem Cherusker, zum Zocken bei Raymond waren. DJ hat so laut gelacht, dass selbst Raymonds taube Oma hellhörig wurde. Als sie wieder weg war, knöpfte Agi in aller Seelenruhe seine Hose auf und zog sein Teil heraus. Von da an hat niemand mehr gelacht.
Ich sehe das so: Agi hat wenigstens eine Vorstellung von seiner Zukunft, eine Vision, und damit ist er uns anderen meilenweit voraus. In einem halben Jahr muss ich mich entscheiden: abgehen oder absitzen. Keine Ahnung, ob ich eine Lehrstelle finde, keine Ahnung, ob ich es bis zum Abi schaffe. Und selbst wenn, was dann? Ich weiß ja noch nicht einmal, worin ich einigermaßen gut bin. Ich kann boxen, okay, und die Kacke von meinen kleinen Brüdern wegmachen, klar. Bildung ist alles, sagt Mama immer. Aber bei ihr bedeutet alles nichts.
Wer weiß, vielleicht macht Agi ja als einziger von uns Karriere. Und wenn nicht, hat er zumindest seinen Spaß.
Zwanzig Minuten später stiegen wir am Hauptbahnhof aus. Ich wunderte mich, dass um diese Uhrzeit noch so viele Menschen unterwegs waren, aber Agi meinte, das sei normal. Da mein Freund den Weg kannte, überließ ich mich ihm und sah mich in Ruhe um. Inzwischen hatte es zu schneien aufgehört, allerdings blies der Wind hier so eisig durch die Straßen wie vor den Toren der Stadt. Wir folgten einer Gruppe von Bänkern oder Immobilienmaklern, die allesamt Weihnachtsmützen trugen und Bacardi-Cola aus Dosen tranken. Das Viertel war hell erleuchtet, überall blinkten Reklamen, gleißten Balustraden in grünem und blauem Neonlicht, schimmerte hinter hohen Fenstern verheißungsvolles Rot. In den Eingängen verkrochen sich Penner in ihre Schlafsäcke, an Straßenecken lungerten finstere Typen, und vor den Bars forderten uns abgewrackte Gestalten auf, hineinzutauchen ins schummrige Dunkel, um Spaß zu haben oder Lookilooki zu machen.
Einmal kamen uns drei Glatzen entgegen, blieben stehen und starrten uns an, als suchten sie Streit, entschieden sich dann aber anders, ihr Glück. Tatsächlich haben die meisten Typen Respekt vor uns und gehen uns aus dem Weg, selbst die Hardcores und Faschos, obwohl Agi mit seiner schwarzen Mähne und seinen zusammengewachsenen Augenbrauen ihrem Beuteschema haargenau entspricht. Nur dass Agamemnon der König von Mykene ist, was mit griechischer Mythologie und Troja und diesem ganzen Mist zu tun hat, ein Krieger, der keinem Kampf aus dem Weg geht, schon gar nicht an der Seite von mir, Odysseus, seinem Gefährten, dem Findigen und Furchtlosen, was abermals mit Troja und einem hölzernen Pferd und irgendeiner Irrfahrt zu tun hat, egal, zusammen sind wir unbesiegbar, komme wer will.
Der Wind trieb die Menschen vor sich her, nur wir stemmten uns ihm entgegen, dehnten die Zeit, wichen gebückt herumirrenden Gestalten aus, die offenbar nicht fanden, was sie suchten, teilten uns drei Zigaretten hintereinander und ließen uns auf ein kompliziertes Gespräch mit einer traurig dreinschauenden Türsteherin ein, die erst von uns abließ, als Agi seinen Arm um mich legte und vorgab, gar nicht auf Frauen zu stehen.
Den Augenblick höchster Spannung hinauszuzögern, gehört zu unseren Ritualen, weshalb wir erst um Mitternacht die Plexiglastür aufstießen, die Agi zufolge geradewegs zum Olymp führte.
Im Treppenhaus roch es nach schwülem Parfüm mit einer Note Pisse. Irgendwer hörte laute Musik, Mark Forster oder Max Giesinger, keine Ahnung, für mich hört sich das alles gleich an. Im ersten Stock kam uns ein Mann mit Hut entgegen, den ich von irgendwoher kannte. Zwei Stockwerke höher fiel es mir ein. Er war Physiker und hatte vor einem Jahr in unserer Schule einen Vortrag über Schwarze Löcher gehalten – ausgerechnet! Agi schnaufte vor Anstrengung, schaffte es dann aber doch noch so gerade in den fünften Stock, wo die Gemächer seiner Göttin lagen, doch leider war deren Pforte verschlossen.
»Fuck!«, fluchte der König von Mykene wenig erhaben. »Fuck! Fuck! Fuck!«
Ich schlug vor, zu warten und nach einer Weile zu klopfen, worauf Agi stumm nickte und sich eine weitere Kippe anzündete. Wenig später sprang schräg gegenüber eine Tür auf. Ein Männlein schlüpfte heraus und huschte lautlos an uns vorbei zur Treppe. Hinter ihm trat eine Schönheit ins Licht, die uns neugierig musterte.
»Wen haben wir denn da?«
Sie war nur wenig älter als wir. Eine Strähne ihres blauschwarzen Haars umspielte ihre Nase, bis sie sie wegblies. Ihre Augen leuchteten hell, blau oder grün, so genau konnte ich das in dem schummerigen Licht nicht erkennen. Sie trug weiße Hotpants und ein abgeschnittenes T-Shirt und auf dem Bauch ein Tattoo. Never Lose Hope. Ein geflochtener Zopf mit einer Feder fiel ihr über die Schulter. Auf glitzernden Sandaletten mit Pfennigabsätzen tänzelte sie auf uns zu und ergriff meine Hand. An ihrem Arm baumelten Dutzende bunter Reife.
»Na, wie wär’s, Süßer?«
Auf ihrem Zahn funkelte ein Diamant, um ihre rot glänzenden Lippen spielte ein Lächeln. Ich gab mir Mühe, sie nicht anzustarren, und suchte nach Worten, um ihr zu erklären, dass ich kein Geld dabei hatte, jedenfalls nicht genug, doch die Schöne ließ mich einfach stehen und wandte sich meinem Freund zu.
»Was ist mir dir?«
Ich hielt die Luft an. Agis Blicke schleckten über ihre bronzene Haut. Er hatte Geld, deshalb waren wir ja hier. Schon glitt seine Hand in seine Tasche, während ich noch betete, dass er sein Geld aufsparen würde. Doch als ob seine Göttin meine Gebete vernommen hätte, öffnete sich in genau diesem Moment ihre Tür. Agi hielt jäh inne und wandte sich um. In seinen Augen knipste irgendwer ein Licht an.
»Julia!«