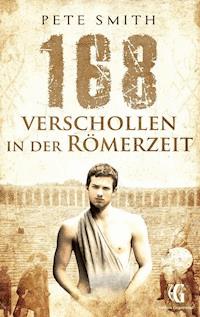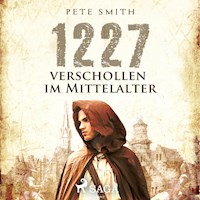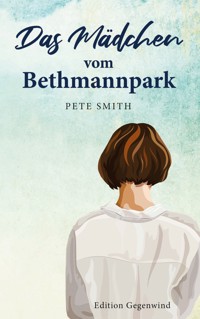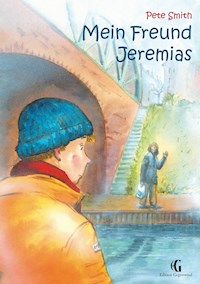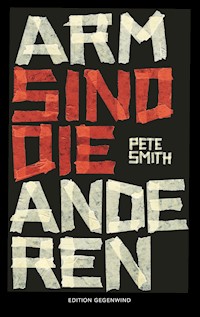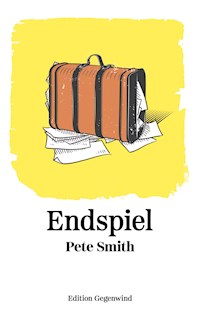
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühsommer 2010. Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Südafrika um den WM-Titel spielt, befindet sich Lionel, Doktorand der Geschichte, in einer Sinnkrise. Sein Freund Ed vermittelt ihm einen Job in der Villa Lichtblick, wo Lionel alten Menschen die Welt des Internets erschließen soll. In der Seniorenresidenz am Frankfurter Dornbusch lernt er die 79-jährige Elena Morgenstern kennen, die sich auf leisen Sohlen in sein Leben schleicht. Eines Tages drückt sie ihm einen Koffer mit Tagebüchern und Briefen in die Hand. Lionel soll festhalten, was nach ihrem Tod dem Vergessen anheimfiele, vor allem aber das Andenken Seraphins bewahren, der Liebe ihres Lebens. Im Mittelpunkt ihrer Aufzeichnungen steht der Auschwitz-Prozess, der den Leidensweg ihres Mannes nachzeichnet und Elena einst dazu ermutigte, sich ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen. Für seinen Roman Endspiel erhielt Pete Smith 2012 den vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst verliehenen Robert Gernhardt Preis. Rezensionen: "In Endspiel findet Pete Smith eine leise, zart bebilderte Sprache. Der Roman ist wie ein schwarzgrundiertes Aquarell, ausgefranst an den Rändern und von Zweifeln getragen." Anne Kuhlmeyer, Culturmag "Das Buch hat mich sehr berührt, es ist auf so vielen Ebenen klug, taktvoll, gut recherchiert, liebevoll und gleichzeitig schonungslos, daß ich es gar nicht ausgelesen haben will. Absolute Leseempfehlung. Michaela Conrad "Endspiel ist ein komplexer und differenzierter Roman, akribisch recherchiert, sprachlich vielfältig und niemals langatmig oder zu schwer." Maria Knissel, Amazon "Ein großartiges Buch, das jede Schulbibliothek in ihr Regal stellen sollte." Barbara E. "Dieser Roman hat mich sehr bewegt und gefangen genommen." Jarmila Kessler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Smithwurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers im nordrhein-westfälischen Soest geboren. Sein Studium der Germanistik, Philosophie und Publizistik an der Universität Münster schloss er mit dem Magister Artium ab. Pete Smith schreibt Kinder- und Jugendbücher, Essays, Kurzgeschichten und Romane, für die er mehrfach ausgezeichnet worden ist, unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst für seinen Roman „Endspiel“. Der Autor lebt in Offenbach am Main.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Prolog
„Stellen Sie sich vor.“
Ich beuge mich zu ihr, fange das Lächeln des Mädchens ein, sehe über die Köpfe der Menschen, sehe über die Leinwand hinaus, wo ein unsichtbares Flugzeug genau in diesem Augenblick eine feine Spur in den Himmel ritzt.
„Stellen Sie sich vor.“
Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Um uns herum schwillt das Geheul der Vuvuzelas, Klagegesang alter Weiber, die den Tod eines Neugeborenen beweinen. Drei Jungen stürmen die Bühne und reißen sich ihre T-Shirts vom Leib. Fahnen wehen Schatten über das Menschenmeer. Zwischen den Bankentürmen steht tief die Sonne.
„Stellen Sie sich vor.“
Ihre Lippen berühren mein Ohr, ihre Stimme flüstert sich durch den Gesang der Nacht. Ulis Fingerspitzen in meinem Haar. Das Lächeln des Mädchens, das mit einem Mal zerbricht. Die klagenden Weiber, die ihre Hände zum Himmel recken.
„Stellen Sie sich vor“, beschwört sie mich, als ob ich nicht längst begriffen hätte. „Genau in diesem Augenblick erlischt das Bild. Dabei ist der Ball gerade erst in der Luft und fliegt und fliegt und landet womöglich im Tor, aber das malen Sie sich nur aus, das können Sie nicht wissen, das werden Sie nie wissen, weil die Leinwand schwarz bleibt, verstehen Sie, genauso fühle ich mich in den Nächten, da ich wachliege und an ihn denke, und am Morgen, wenn ich aufstehe, genauso.“
1
Tosender Applaus, an- und abschwellend wie ein raues Meeresrauschen. Gesichter: erregt, verschwitzt, ungläubig. Ulis ausdruckslose Augen. Ein langhaariges Mädchen, eingewickelt in eine schwarzrotgoldene Fahne. Hupende Autos. Jäh verwandelt sich das Rauschen in Regen, der gegen den Rollladen prasselt, Schritte im Treppenhaus, Stimmen, ein Knall – endlich öffne ich die Augen, der Wecker neben mir blinkt, elf Uhr? Offenbar habe ich zwölf Stunden geschlafen.
„And finally, our twelve points go to: Germany!“
Ich lange hin und drücke Knöpfe, aber das Display hört nicht auf zu blinken, bis ich den Stecker ziehe, mich aufrichte und zurückfalle ins nachtwarme Kissen. Ich schließe die Augen. Einen Moment lang habe ich das Gefühl, als ob Samstagnacht, die Nacht von Oslo, genau in diesem Augenblick endet.
„Das ist nicht wahr, oder?“
„Ich hab’s dir gesagt!“
„Kann das denn sein – selbst die Dänen wünschen uns den Sieg!?“
Wir sitzen auf dem Boden und trinken Cocktails. Armin hat uns gebeten, die Gläser in der Hand zu behalten. Für die ESC-Party hat er sein Wohnzimmer leergeräumt. Über der Tür hängt ein Beamer und bläht das Fernsehbild auf Kinoleinwandformat. Stefan Raab strahlt in die Kamera mit Zähnen so breit wie ein Sofa.
Love, I got it bad for you, I saved the best I have for you, you sometimes make me sad and blue.
„Shit!“
Edgar gräbt seinen Daumen in meinen Arm. Vor der Leinwand kickt die Frau mit dem weißen Kleid gerade ihren zweiten Schuh vom Fuß. Ihre Finger schieben sich unter den Saum, ziehen am Stoff, halten die anderen auf Distanz.
„Sag ihr, sie soll damit aufhören!“
„Sag’s ihr selbst.“
„This is not real!“
Ed rückt von mir ab, Uli schlüpft in die Lücke.
„Amüsiert ihr euch? Ich geh dann mal. Nein, bleib nur. Wir telefonieren, okay?“
Einen ganzen Tag höre ich nichts von ihr. In der Nacht schickt sie mir eine SMS. Tut mir leid. Mehr nicht. Was will sie mir damit sagen? Was tut ihr leid? Warum sagt sie nicht endlich, was mit ihr ist?
Ich lasse das Fahrrad stehen und nehme die Bahn. Ob Edgars Vision tatsächlich aufgeht? Ich habe keine Erfahrung im Umgang mit alten Menschen, meinen Großeltern bin ich nie begegnet. Dabei hätte ich ihren Vater geliebt, schwärmt Ma, bei ihrer Mutter ist sie sich offenbar nicht so sicher. Leider sind beide schon lange tot. Sankt Patrick dagegen schweigt sich über cross-generational relationships aus. Ob seine Eltern noch leben, weiß er nicht. Behauptet er zumindest. Für ihn sind sie so oder so vor langer Zeit gestorben.
An der Alten Oper fordert uns eine Lautsprecherstimme auf, auszusteigen. Außerplanmäßige Wartungsarbeiten, man bitte um Verständnis.
„Wartungsarbeiten!“, höhnt ein Mann mit Schiebermütze und spuckt vor mir aus. „An einem Montag! Hat denen einer ins Hirn geschissen?!“
Draußen klatschen dicke Tropfen aufs Pflaster. Ich sprinte bis zum Eschenheimer Tor, zwänge mich in ein überfülltes Abteil der U 3 und hole vier Stationen später am Dornbusch wieder Luft.
Eine Frau, die ich nach dem Weg frage, schickt mich in die falsche Richtung, ich verfluche sie, ich verfluche Edgar, ich verfluche sein Gefasel vom anstrengungslosen Wohlstand, den er mir, seinem besten Freund und ersten Angestellten, angedeihen lässt: Wirst schon sehen, der Job deines Lebens, dein erster Beitrag zum Generationenvertrag.
„Villa Lichtblick, aber ja doch“, rettet mir ein Postbote den Tag und deutet auf einen verschnörkelten Palast hinter mir, den ich für ein Ensemble luxuriöser Eigentumswohnungen gehalten habe. „Da würde ich meinen Lebensabend auch gern verbringen.“
Die gläserne Tür öffnet sich lautlos. Akanthusornamente an den matt schimmernden Wänden, vier marmorne Säulen, in deren Mitte ein tief hängender Kronleuchter aus lichtblauem Glas, der sich im schwarzen Granitboden spiegelt. Über dem Rand des barocken Tresens lugt der platinblonde Schopf einer Frau. Offenbar telefoniert sie. Ich trete näher und warte. Nach einer Weile sieht sie auf.
„Was kann ich für Sie tun?“
Ich nenne meinen Namen, worauf sie in ihrem Empfangsbuch nachsieht und, das Telefon weiter am Ohr, um den Tresen herum in den Gang zu ihrer Rechten deutet.
„Die letzte Tür links. Herr Dr. Engelhardt erwartet Sie bereits.“
Bevor ich den Lichthof am Ende des Flurs erreiche, schwingt vor mir eine Tür auf. Ein hoch gewachsener Mann, dichtes dunkles Haar, randlose Brille, gestutzter Bart, eilt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu.
„Mein lieber Herr Kaufmann, da sind Sie ja, wie schön, Sie endlich kennenzulernen!“ Bevor er mich umarmt, strecke ich ihm die Hand entgegen. „Engelhardt. Dr. Engelhardt. Haben Sie gut hergefunden?“
Er trägt einen eng geschnittenen, anthrazitfarbenen Anzug, ein schwarzes Hemd mit grauer Krawatte und, wenn ich mich nicht täusche, rahmengenähte Oxford-Schuhe aus Ziegenleder. Ein Hauch Escada weht ihm voraus. Sankt Patrick und er wären sicher die besten Freunde.
„Die Freude ist ganz meinerseits, Dr. Engelhardt“, antworte ich mit Betonung auf seinen Doktor, während mein Über-Ich mahnt, dass ich meine Promotion längst hätte abschließen können, so wäre das Gleichgewicht der Kräfte gewahrt. Davon weiß Dr. Engelhardt nichts und will es nicht wissen. Er drängt zur Eile. Meine Schülerinnen warteten bereits und seien schon sehr gespannt.
In einem rundum verspiegelten Aufzug gleiten wir in den zweiten Stock. Egal, wohin ich blicke, entrinnen kann ich mir nicht. Strähnig hängt mir das Haar im Gesicht, mein nasses Jackett wirft rücklings Falten, und die schwarze Jeans klebt wie Latex auf der Haut.
Dr. Engelhardt ist höflich genug, an meinen Spiegelbildern vorbeizusehen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dazu gehören dürfen“, sagt er und gerät regelrecht ins Schwärmen. „Das Internet, mein Gott, was wären wir ohne, wenn ich nur an meine Kinder denke, ohne Facebook oder WhatsApp. Nicht auszudenken! Selbst meine Frau bekomme ich abends kaum noch zu Gesicht. Vor kurzem hat sie auf einer Schulseite im Internet ihre verschollen geglaubte Freundin aufgespürt. Kennen sich schon seit dem Sandkasten, stellen Sie sich das einmal vor!“
Der weiche Kunststoffboden, Ahorn-Imitat, dämpft jeden Schritt. An den pastellfarbenen Wänden hängen großzügig gerahmte Aquarelle – Muscheln, Sandwellen, Sonnenschirme. Durch die bodentiefen Fenster genießt man Weitblick bis zum Feldberg.
„Im ersten und zweiten Stock befinden sich unsere Pflegestation und die Gemeinschaftsräume“, erklärt Dr. Engelhardt, während wir zügig voranschreiten. „Im dritten und vierten Stock haben wir das betreute Wohnen untergebracht. Die Patienten auf der Pflegestation werden rund um die Uhr versorgt. Demenzkranke, Krebspatienten, einige können sich nur noch unter großen Schmerzen bewegen. Wir sind für sie da, sehen Sie, wir leisten das, was früher die Angehörigen getan haben. Wir sind ihre Familie.“
Auf der Hälfte der Strecke öffnet sich der Flur zu einem kleinen Foyer. An fein dekorierten Bistrotischen sitzen sieben oder acht Heimbewohner, einige im Rollstuhl, kaum einer sieht auf. Eine Schwester streichelt einer uralten Frau übers schüttere Haar. Dr. Engelhardts Gruß ist nicht zu überhören, bleibt aber ohne Reaktion. Ein Mann mit Stoppelbart, der sich auf seinen Krückstock stützt, hebt, da ich ihm zunicke, majestätisch die Hand. Neben ihm krümmt sich eine Frau in ihren Stuhl und schnappt nach Luft.
„Da sind wir schon“, strahlt Dr. Engelhard. Er steuert auf eine offene Tür zu. „Für Ihre Einführung, denke ich, eignet sich unser Gemeinschaftsraum am besten. Aber das ist nur eine Übergangslösung. Wir sind dabei, ein Studio einzurichten, vier Online-Plätze, die Rechner werden nächste Woche geliefert.“
Der Raum ist groß und hell. Um einen ovalen Tisch herum sitzen vier Frauen, die uns ansehen, ohne meinen Gruß zu erwidern. Am Fenster erhebt sich eine Dame und kommt mit leichten Schritten auf uns zu. Ihre schlohweißen Haare sind nach hinten gekämmt, in ihrem Ohrläppchen glänzt eine Perle. Grace Kelly trägt als einzige ein Kleid, schwarz mit weißen Applikationen, und eine Kette aus perlmuttfarbenen Ringen.
„Frau Morgenstern, Herr Kaufmann.“
Bevor ich ihr die Hand reiche, schiebt sie ihre Brille über die Stirn. „An die Stille werden Sie sich gewöhnen müssen, junger Mann“, sagt sie. „Einigen meiner Altersgenossen fällt selbst das Grüßen schwer.“ Ihre Augen, blau wie Gletschereis, lächeln, ihr Mund lächelt nicht.
„Kommen Sie“, sagt Dr. Engelhardt und führt mich zu den anderen. „Darf ich vorstellen: Frau Ferenczy, Frau Becker, Frau Anderson und Frau Schön. Das starke Geschlecht müssen wir noch von den Segnungen des Internets überzeugen.“ Seine Stimme ist laut. „Herr Kaufmann wird Sie nun in die schöne Welt des Internets einführen. Sie werden staunen, was es da alles zu sehen gibt, das kann ich Ihnen versprechen. Nun lasse ich Sie lieber allein und wünsche Ihnen ein allseits gutes Gelingen.“ Ein weiteres Mal schüttelt er mir herzlich die Hand, dann zieht er leise die Tür hinter sich zu.
Ich räuspere mich. „Ich freue mich sehr, dass ich ...“
„Lauter!“ Frau Becker, 87, laut Teilnehmerliste die älteste im Kurs.
„Haben Sie sich schon vorgestellt?“ Frau Anderson, 82.
„Lionel“, antworte ich. „Lionel Kaufmann.“
„Wie Lionel Messi oder Lyonel Feininger?“, fragt Frau Morgenstern, die mit 79 meine jüngste Schülerin ist.
„Sie kennen Messi?“
„Gewiss doch“, erwidert sie und eine ihrer feinen, schwarz gefärbten Brauen hebt sich wie von selbst. „Wie denn nicht? Wer Pelé einen Ausnahmespieler nannte, findet für Messi keine Worte.“
Ihr Blick ist herausfordernd. Sie scheint ergründen zu wollen, ob ich es mit ihr aufnehmen kann – und ob ich dazu bereit bin.
„Ich wüsste gern, was Sie ...“
„Lauter!“
„Natürlich.“ Ich hole Luft, setze erneut an. „Was ich von Ihnen zunächst gern wissen möchte.“ Meine Stimme klingt schrill, wie die eines Fremden. „Mit welchen Erwartungen gehen Sie in diesen Kurs, und wie kann ich auf Ihre Vorstellungen eingehen?“
Stille.
„Haben Sie irgendwelche Wünsche?“
Niemand meldet sich.
„Wer von Ihnen kann auf der Schreibmaschine schreiben?“
Frau Ferenczy, Frau Anderson und Frau Morgenstern heben die Hand.
„Und wer war schon einmal im Internet?“
Allgemeines Kopfschütteln.
„Ein Computer ist im Prinzip eine Kombination aus Schreibmaschine und Fernseher“, improvisiere ich und packe mein Notebook aus. „Mit der Tastatur kann ich entweder Texte schreiben oder Befehle formulieren.“ Ich schließe das Notebook an und warte, bis der Rechner hochgefahren ist. „Hier, sehen Sie, diese Symbole steuern Programme, beispielsweise die, mit deren Hilfe wir ins Internet gelangen.“
In der nächsten halben Stunde erläutere ich meinen betagten Schülerinnen die elementaren Funktionsmerkmale eines Computers und erkläre Grundbegriffe der Hard- und Software. Wir fahren den Rechner gemeinsam hoch und herunter, legen eine Datei an, sichern und verschieben sie, bevor ich den Damen, gleichsam als Anregung für unsere zweite Sitzung am Freitag, erste Blicke ins Netz gewähre. Edgar hat zwar ein leicht zu handhabendes Lernprogramm entwickelt und mir eindringlich sein didaktisches Konzept erläutert; von den spezifischen Problemen seiner Zielgruppe, so stellt sich heraus, hat er allerdings nicht die geringste Ahnung. Frau Anderson nickt schon nach einer viertel Stunde ein. Frau Becker zittert so heftig, dass sie den Cursor nur annäherungsweise ans Ziel bringt. Und Frau Schön bemüht sich mit ihren gichtkrummen Fingern vergeblich, die Maustaste gedrückt zu halten. Als am Ende meiner ersten Stunde eine Schwesternschülerin eintritt, um die Damen zum Mittagstee zu geleiten, habe ich das Gefühl, im Grunde versagt zu haben.
„Ich freue mich auf das nächste Mal, Lionel“, verabschiedet sich Frau Morgenstern, „und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Ich darf Sie doch bei Ihrem Vornamen nennen? Ich danke Ihnen. Lassen Sie sich nur nicht entmutigen, Sie machen das sehr gut.“
Elenas Leben in meinem beginnt an einem Montag, dem letzten Tag im Mai, 38 Stunden nach Lenas Triumph in Oslo und elf Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft.
2
„Lionel?“
Sie steht in der Tür, eine Hand am Rahmen. In ihrem langen schwarzen Kleid sieht sie aus wie ein Mädchen.
„Es ist mir ein wenig unangenehm, aber dürfte ich Sie vielleicht um einen Gefallen bitten?“
Sie hat sich ein Notebook gekauft, ein leistungsstarkes Modell, bei dem, wie ihr der Händler versichert hat, die wichtigsten Tools vorinstalliert seien, ein Rechner mit rasantem Prozessor, großem Arbeitsspeicher und gigantischer Festplatte. Sie hat sich die Begriffe notiert, damit ich sie ihr erkläre. Sie habe Probleme bei der Handhabung, erklärt sie, wenn sie ehrlich sei, wisse sie schon nach dem Einschalten nicht mehr weiter.
Ich bin nicht in Eile, weshalb ich ihr anbiete, sofort nachzusehen. Sie hakt sich bei mir ein, was mir unangenehm ist, da ich sie kaum kenne und sie fast zwei Köpfe kleiner ist, aber schon nach wenigen Schritten fühlt es sich nicht mehr falsch an. Wir nähern uns der lichten Bühne, das Publikum nimmt uns nicht wahr, nur der König hebt sein Zepter und verzieht sein stoppeliges Gesicht zu einem schiefen Grinsen. Der Aufzug wartet schon. Beäugt von unseren vielfach gebrochenen Spiegelbildern, schweben wir in den vierten Stock. Am Ende des Korridors bleibt sie stehen. Ihr Name prangt in Großbuchstaben an der Tür.
„Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Schuhe auszuziehen?“
Auf Socken folge ich ihr in die Wohnung. Eidottergelbe Stores rahmen deckenhohe Fenster. Davor ein Tisch mit weißen Pfingstrosen und zwei hellblau gepolsterte Stühle. „Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen.“
Während sie im Bad verschwindet, sehe ich mich um. Das kleine Wohnzimmer ist spärlich möbliert, eine Schrankwand auf der einen Seite, schräg zum Fenster ein Ohrensessel mit Beistelltisch, Blumen auch hier. Meine Blicke fliegen über die Buchrücken. Böll, Koeppen, Kästner, einige Heile-Welt-Romane, die Autobiographie der Knef neben den Tagebüchern Klemperers. Ein Regal voller Fachbücher, Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch mit Kommentar, ich wundere mich. In der untersten Reihe Bildbände und Fotoalben sowie ein halber Meter Vinyl. Flachbildfernseher und Plattenspieler lassen sich einschließen.
Den Chesterfield spare ich mir auf bis zum Schluss. Ich streiche über das harte, rissige Leder und denke an Sankt Patrick, der sich einen Ohrensessel wie diesen einst per Schiff aus England kommen ließ, ein Monstrum, das, da er es in seine Bibliothek wuchtete, deren Farbe annahm, als habe es schon immer dort gestanden. Ein viertel Jahrhundert ist es her, dass ich auf seinem Schoß saß und er mir Geschichten vorlas von Zauberern, Elfen, Kobolden, Hexen und schüchternen Jungen.
„Behaglich, nicht wahr?“
Sie hält ein Glas in der Hand und sieht wohlwollend auf mich herab. „Ich bitte Sie, so bleiben Sie doch sitzen, er steht Ihnen gut.“
„Mein Vater hatte einen Chesterfield“, erkläre ich, „aber der roch nicht wie dieser, sondern nach einer Art geräuchertem Wachs.“
„Das Schmuckstück gehörte meinem Mann, er liebte ihn, wie er alles Britische liebte, die Briten, fand er, stünden zu ihren Werten, das machte sie ihm so sympathisch. Ich fand das Möbel anfangs nur scheußlich, aber mit den Jahren, so scheint mir, sind wir uns immer ähnlicher geworden. Seit meinem Umzug hierher habe ich darauf gewartet, wer sich wohl als erster hineinsetzt. Als ich Sie sah, wusste ich, dass Sie es sein würden. Ein Chesterfield hat Charakter, das sollten Sie wissen. Er sucht sich seinen Herren aus, wie das Schwert in den Legenden. Lachen Sie nicht! Manchmal werden Märchen wahr. Die guten wie die bösen.“
Ich schließe ihr Notebook an und fahre den Rechner hoch. Dabei erkläre ich ihr den Vorteil eines Passworts aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Sie überlegt nicht lange, sondern tippt eine Ziffern- und Buchstabenfolge ein.
Der Händler hat sie zwar nicht belogen, ihr aber ebenso wenig die Wahrheit gesagt. Die vorinstallierten Tools beschränken sich auf das Betriebssystem und einige Werbeprogramme. Ich erkläre ihr, dass sie ein Softwarepaket benötigt, zumindest ein Programm zur Textverarbeitung und einen Virenscan, den man aus dem Internet herunterladen kann. Schließlich verspreche ich ihr, Dr. Engelhardt zu fragen, ob die Seniorenresidenz Villa Lichtblick einen umfassenden Provider-Vertrag hat, wenn nicht, müsse sie selbst einen abschließen, wobei ich ihr gern helfe.
„Sie sind sehr freundlich“, sagt sie. „Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Bleiben Sie auf eine Tasse Tee?“
Eigentlich sollte ich am Schreibtisch sitzen, aber was soll’s, ein Vorwort bleibt ein Vorwort, für das ich nicht mehr Zeit investieren sollte als für den Text, den es einleitet, daher setze ich mich wieder. Die Pfingstrosen duften wie frisch gepflückt.
„Was machen Sie beruflich, Lionel?“, fragt sie und gießt Tee in hauchzarte Tässchen. „Zucker? Milch?“
Ich warte, bis sie sich gesetzt hat, und höre meinen Erklärungen zu, dass ich Historiker sei (was wie eine Lüge klingt) und dass ich promoviere, was mich ebenso wenig überzeugt.
„Historiker“, wiederholt sie, in ihren Augen den Anflug eines Lächelns. „Sie schreiben Geschichte, das ist sicher sehr aufregend.“
„Ich erforsche sie“, entgegne ich, „was die meiste Zeit leider ziemlich langweilig ist.“
„Haben Sie ein Spezialgebiet? Wie lautet das Thema Ihrer Dissertation?“
„Die Bedeutung des Eigentums in der Entwicklung des neuzeitlichen Bürgertums“, antworte ich und lache wie über einen Witz.
„Das finde ich interessant“, sagt sie und gießt mir nach, „bitte erzählen Sie mir davon.“
Kein Mensch hat sich bislang für meine Dissertation interessiert, weder Uli noch meine Eltern, geschweige denn meine Schwester, auch Edgar nicht oder einer meiner anderen Freunde. Die einzige Ausnahme ist mein Doktorvater, der aber nur auf ein winziges Kapitel der Arbeit wartet, ein bescheidener Beitrag für sein nächstes populärwissenschaftliches Werk, mein Name in seinem Anhang, mehr sitzt nicht drin.
Ich erzähle ihr, was mich am Thema ursprünglich gereizt hat und was mich nun nervt, schweife ab, werde grundsätzlich, stelle erst mein Studium, dann die Geschichtswissenschaft an sich in Frage und reiche, da sie nachhakt, die Begründung hinterher, dass jene zwar vorgebe, die Gemeinschaft der Menschen zu erforschen, das Individuum dabei aber insgeheim verachte. Eine These, die mir jetzt, da sie mich ermuntert, durchaus einleuchtet.
Die meiste Zeit bleibt sie stumm, nickt mir zu, lächelt.
„Wie alt sind Sie, Lionel?“, fragt sie, da ich verstumme.
„29.“
„29. Aber ja!“ Sie beugt sich über den Tisch, um mir Tee nachzugießen. Ihre Augen spiegeln den blauen Tag. „Als ich in Ihrem Alter war, hatte ich Angst vor jedem neuen Jahr. Nun werde ich 80, in einigen Wochen schon, sehen Sie, jetzt wäre es an der Zeit, mich zu ängstigen, aber im Laufe der Jahre, so scheint mir, hat sich die Angst verbraucht.“
3
Der Juni meldet sich, wie der Mai endete, grau und nass. Sintflutartiger Regen tränkt das Land. Ich schalte das Radio aus, lasse den Rollladen herunter und werfe die Zeitung von Frau Huth in den Müll.
Am Nachmittag weckt mich mein Smartphone. Uli.
„Was war denn?“, frage ich.
„Nichts“, sagt sie.
„Und deine SMS?“
„Was meinst du?“
„Du hast dich entschuldigt. Wofür?“
„Für nichts.“
„Verstehe ich nicht.“
„Musst du auch nicht.“
„Würde ich aber gern.“
„Heute Abend“, sagt sie, „treffe ich mich mit Xiao. Sie hat Stress mit ihrem Freund.“
„Xiao?“
„Eine Kommilitonin. Eine Freundin.“ „Und wann sehen wir uns?“
„Einen Moment.“ Offenbar ruft sie den Planer ihres Smartphones auf. „Morgen Mittag. Hast du Zeit? Wir könnten uns in der Mensa treffen. Um eins?“
„Ist gut.“
„Kommst du voran?“
„Geht so. Und du?“
„Eigentlich schon.“
Ich lausche in ihr Schweigen.
„Ich liebe dich“, sagt sie kaum hörbar und legt auf.
Ich dich auch.
Aber ich spüre dich nicht.
Wie denn auch? Ich spüre mich ja selbst nicht.
Die Stille in mir, die Stille um uns herum hat sich ausgedehnt, ich weiß nicht warum. Zugleich ist der Raum, in dem wir uns bewegen, geschrumpft, als könne sich nur noch einer von uns darin ausbreiten und entfalten. Zwei Ansichten sind eine zu viel, nur wer Recht behält, wahrt sein Gesicht. Ihre Empfindlichkeiten beziehe ich auf mich und fange an, mich zu rechtfertigen. Es liegt an mir, das weiß ich selbst.
Ich stehe auf, schiebe die Nudeln von Sonntag in die Mikrowelle und zappe durch die Programme. Ein Typ fragt nach Städten, in denen sich Tiernamen verbergen, spontan fallen mir drei ein, Aalen, Fischbach und Dasseln. Dann zirpt mein Smartphone. Ein Telex von Ed.
Kann heut nicht. Das verdammte Knie. Meld dich!
Eine viertel Stunde hocke ich in T-Shirt und Unterhose auf dem Bett und überlege, ob ich lieber zu Hause bleiben sollte, ohne Uli, ohne Edgar könnte die Dienstagstour lang werden, außerdem, auf nassen Straßen macht sie weniger Spaß. Doch beim nächsten Blick aus dem Fenster hat es zu regnen aufgehört.
„Die Zeit läuft ab“, sagt der Typ im Fernsehen. „Ihre letzte Chance, jetzt oder nie!“
Ich packe meine Inliner in den Rucksack, pumpe mein Fahrrad auf und strampele los.
Im Feierabendverkehr schlängele ich mich durch die Stadt. Einmal touchiert meine Tasche den Außenspiegel eines schrottreifen Golfs, wildes Gehupe hinter mir, doch vor dem Main hänge ich ihn ab. Am Deutschherrenufer machen sich schon die ersten Skater warm. Ich halte Ausschau nach jemand, den ich kenne, und bin zugleich erleichtert, nur fremde Gesichter zu sehen. Über den Türmen reißt die Wolkendecke auf und färbt sich an den Rändern ein. Ein Rollstuhlfahrer winkt mir zu, ich hebe die Hand, aber er meint gar nicht mich, sondern die Frau in meinem Rücken. Zuletzt geben sich die Ordnungshüter die Ehre, wir heißen sie mit La Ola willkommen. Dann rollen wir los. Die Vorhut nimmt mich auf, gleitet mit mir voran durch die heran dämmernde Nacht. Lichter scheinen auf, brennen winzige Löcher ins silbrige Schwarz. Uli liebt die Sterne. Wenn ich nur wüsste, was mit ihr ist, wer von uns beiden sich auflöst, ich weiß es nicht, spüre nur, dass wir einander verlieren, wir blicken uns kaum noch an.
Da die ersten Fahrer das Tempo anziehen, falle ich zurück. Das eintönige Surren und Rauschen, die leisen Stimmen, der Wind, ich gehe auf darin, lasse los, bis sich mit einem Mal der Klang meines Namens in mein Bewusstsein stiehlt.
„Lionel?“
Eine Frau, schwarzer Helm, blonder Zopf, knallrote Lippen.
„Die ESC-Party.“ Sie lacht. „Lena?“
Jetzt erkenne ich sie, sehe sie vor der Leinwand tanzen und überlege, woher sie meinen Namen kennt – Susi, Carsten? – mit irgendwem hat sie über mich geredet oder einer mit ihr. Armer Ed, denke ich und muss lachen.
„Ich freu mich auch“, sagt sie. „Bist du allein hier?“
Inzwischen sind wir uns so nah, dass sich unsere Arme beim Ausschwingen berühren.
„Der Freund, mit dem ich herkommen wollte, hat mich versetzt.“
„Der mit dem starren Blick?“
„Genau der.“
Neben ihr gleite ich durch die glitzernde Dämmerung, ruhig und stet und ohne Angst, erst am Main entlang, dann über den Fluss, hinter der Brücke glänzt eine frisch geteerte Straße wie gesprungenes Glas, jäh empfinde ich so etwas wie Glück oder Gleichmut, was in diesem Augenblick dasselbe ist.
Im Feldbahnmuseum legen wir eine Rast ein. Sie stellt mich ein paar Freunden vor, die sich Witze erzählen, einmal fragt einer, was ich denn studiere, aber meine Antwort versinkt im Gelächter.
Nach einer viertel Stunde fahren wir wieder los. Im Gedrängel verliere ich sie aus den Augen. Es nieselt. Weit vor uns sticht die Pyramide des Messeturms durch die Wolken. „Gute Fahrt!“, ruft der Rollstuhlfahrer, als ich an ihm vorbeigleite. Am Römerhof-Kreisel holt sie mich ein.
„Geschichte studierst du“, sagt sie. „Hätte ich nicht gedacht.“
Sie wird schneller, und ich folge ihr, gleite in ihrer Spur. Unsere Arme schwingen im Takt, links, rechts, ein nächtlicher Tanz, so fliegen wir an allen vorbei, Schatten um Schatten lassen wir hinter uns, das Blaulicht räumt die Autos vor uns aus dem Weg, atemlos erreichen wir die Alte Brücke und rollen aus bis zum Frankensteiner Platz.
„Irre!“, johlt sie und dreht Pirouetten, hakt sich bei mir ein und küsst mich auf den Mund, „das war irre, oder? Einfach irre.“
Ihre Haut duftet nach Wacholder oder ihr Haar oder ihr Atem, in diesem Moment liebe ich sie, doch sie löst sich von mir, lacht und schwebt in weiten Schwüngen fort, über den Uferweg, wo sie kleiner wird, schon bin ich mir sicher, dass ich sie nie wieder sehe, da wendet sie und kehrt zurück.
„Ich würde ja mitkommen“, sagt sie, „aber ich kann nicht, ich hab meine Tage.“
Ein letztes Mal rotiert sie um mich herum, ihr Lächeln hält den Augenblick fest, sie winkt, dann ist sie fort.
Nachher, als ich an der Brüstung stehe und in den Fluss blicke, sinne ich über einen Namen, aber mir fällt keiner ein, der zu ihr passt, ich habe sie nicht gefragt. Am Geländer hängen Trauben von Schlössern, die leise sirren, wenn ein Lastwagen über die Brücke fährt. Unter mir schiebt sich ein Kahn durch die Nacht. In Gedanken springe ich auf.
Kurz vor zehn rufe ich Uli an, lasse es klingeln, bis ihre Mailbox anspringt. Sie hat ihre Ansage geändert, ihre Stimme klingt fremd, im Hintergrund rauscht Verkehr. Ich sage ihr, dass ich sie gern sehen würde und dass ich sie liebe.
Ich überlege, ob ich nach Hause fahren soll, wähle dann aber Edgars Nummer. Ed freut sich und lädt mich ein, auf ein Bier vorbeizukommen, „musst du aber selber mitbringen, mein Knöchel, ich sag dir, einfach die Hölle.“
Die Frankfurter City ist so hell wie am Tag, Licht hinter Glas, bis in den Himmel, eine Stadt wie im Traum. Werde auch ich irgendwann an einem See sitzen und angeln oder am Rande eines erloschenen Vulkans Figuren schnitzen, wer weiß, wie lange ich den grellen Glanz der Großstadt brauche und den Lärm, der meinen Herzschlag übertönt. Die Blumen in den Fenstern, die Bäume im Park, die Wiesen und Wasserspiele, der Fluss – nach mehr Natur verlangt es mich nicht. Wird es um mich herum zu still, wächst mir mein Leben über den Kopf.
Mit einem Sixpack im Korb erreiche ich den Platz des Meisters. Ich stelle das Rad an der Hecke ab und betrete das Labyrinth, unser Ritual. Die Lampe auf Adornos Schreibtisch brennt wie in jeder Nacht, ich meine sogar, sein Metronom unter dem gläsernen Kubus ticken zu hören. Edgar hängt im Fenster und raucht. Sein Antlitz im Schein der Straßenlaterne: ein abnehmender Mond. Wortlos wirft er mir die Schlüssel herunter, die ich in meinem gespannten Hemd wie Sterntaler auffange.
Während wir Bier trinken und Keith Jarrett ohne Hast die Goldberg-Variationen ergründet, berichte ich von der Villa Lichtblick.
„Fünf sind zu wenig“, unterbricht mich Ed. „In vier Wochen sitzt du allein da – und was dann?“
Ich erzähle ihm von Dr. Engelhardt und dem Studio, das er einzurichten gedenkt, dem Lerneifer der alten Damen, aber Edgar hört mir nicht zu.
„Fünf sind nicht genug“, beharrt er, „da steckt mehr drin.“
Der Kurs, das städtische Modellprojekt, ist seine Abzweigung ins Leben, ich verstehe das, ein Jahr Vorbereitung, tatsächlich hat er alle ins Boot geholt, die Stadt, die Kirchen, die Träger der Heime, wenn es läuft, ist er angekommen und erhält in zehn Jahren eine Ehrenplakette oder das Verdienstkreuz am Bande.
„Übrigens“, setze ich an.
„Dein Doktor Engelhardt hat zu wenig Werbung gemacht, das kannst du mir glauben.“
„Ich glaub’s.“
„Da muss mehr kommen. Irgendein Reißer.“
„Apropos.“
„Ich lass mir was einfallen.“
„Erinnerst du dich an die Schöne im weißen Kleid?“
Edgar bekommt seinen starren Blick. „Und?“
„Ich habe sie vorhin getroffen.“
„Wo?“
„Beim Skaten. Sie kannte sogar meinen Namen.“
„Arschloch. Und Uli?“
„Uli ist bei einer Freundin.“
„Prima Timing.“
Ich lese in seinen Augen, was jetzt kommt, die Trübe, die Leere, schon legt er los. Wie beschissen das Leben ist und dass er das alles nicht mehr aushält. Kathis Kälte und die ewigen Diskussionen ums Geld. Dass sie ihm wieder gedroht hat, ihn zu verklagen, obwohl sie doch wisse, was er durchmacht. Dass er wie ein Hund leidet und nicht loskommt von ihr, von der Kleinen, von ihrem Leben zu dritt. Dass all das vorbei ist, will er nicht wahrhaben.
„Ich bin 35, hörst du, 35“, beschwört er mich, als ob ich die Macht hätte, sein Los zu wenden.
Er steht auf und humpelt in die Küche. Kurz darauf kommt er mit einer Flasche Whisky und zwei Gläsern zurück. Beharrlich tastet sich Keith Jarrett an das Quodlibet der 30. Goldberg-Variation heran. Ed gießt uns ein. Wie er sein Glas gegen das Licht hält und wendet, die bernsteinfarbene Flüssigkeit schwappen lässt, das sieht nach Genuss aus, doch dann kippt er den Whisky in zwei Schlucken herunter.
Vorzuwerfen hat er sich nichts. Kathi sei depressiv, überfordert, labil, egozentrisch, rachsüchtig, eine Lesbe, eine Hure, eine Soziopathin, im Grunde eine Mörderin, nur dass ihr Opfer noch lebe. Nach dem dritten Glas schwört er, dass sie bloß habe schwanger werden wollen, egal von wem. Amélie sei ihr im Grunde gleichgültig, er bete dafür, dass die Kleine das nie erfahre.
„Das erste Wort, das sie gesagt hat, war Papa, hörst du, Papa, so ist das.“
Ich setze mein Glas an, als sich Edgar schon wieder nachgießt, einen kräftigen Schluck nimmt und gleich einen hinterher. Abrupt zieht er die Flasche zu sich heran, als fürchtete er, ich könne sie ihm wegnehmen.
„Du musst mit dem Saufen aufhören.“
„Ich muss gar nichts. Mein Whisky, mein Leben.“
„Lass es einfach.“
„Ach, leck mich.“
Er stemmt sich hoch und humpelt ans Fenster. Einige Minuten bleibe ich sitzen, dann geselle ich mich zu ihm. Gemeinsam sehen wir hinab auf den Platz. Ein Mann schreitet am Kubus vorbei, Hut und Mantel, bleibt stehen, kehrt zurück, starrt auf den Schreibtisch, beäugt den Stuhl, die Lampe, das Metronom, schüttelt er den Kopf und eilt mit schnellen Schritten davon. Weg aus diesem Labyrinth der Ideen. Adorno, unsichtbar für die Welt, fläzt sich auf seinen Stuhl, legt die Beine auf den Tisch. Du kannst mich mal, so leicht entkommst du mir nicht!
„Mein Leben, hörst du, kann ich mit machen, was ich will, fragt eh keiner nach.“
Später schweigen wir und sinken tiefer und tiefer in sein ausgesessenes Sofa. Er gießt sich ein, Whisky schwappt auf den Tisch. Ich halte meine Hand übers Glas – so habe ich mir den Abend nicht vorgestellt.
Dann ist es still. Ed schläft. Sein Arm liegt auf meinem Bein. Der kleine Zeiger seines Zeppelin-Chronographen nähert sich der Eins. Für einige Momente schließe ich die Augen, tauche ein in die Nacht und gleite durchs Nichts. Bevor ich gehe, schiebe ich ein Kissen unter Eds Kopf.
„Lass dich nicht unterkriegen“, krächzt er, „du nicht.“
4
Kindergeschrei im Treppenhaus. Ich sehe Louis vor mir, den dreijährigen Sohn meiner Nachbarin, er sitzt auf den Treppenstufen hinter der Wand meines Schlafzimmers, das Gesicht rot vor Wut, während sich seine Mutter ein Stockwerk über mir mit einem ihrer Lover vergnügt. Es ist acht, zu früh, um aufzustehen, zu früh für die sich anschleichenden Kopfschmerzen, ich ziehe die Decke über den Kopf, doch der Stoff ist nicht dick genug, um den Zorn des kleinen Mannes zu ersticken.
Endlich springe ich aus dem Bett, bereit, es mit Louis aufzunehmen, renne durch den Flur, doch als ich die Wohnungstür aufreiße, ist das Treppenhaus leer und still wie eine Kathedrale.
Ich dusche kalt, koche eine Kanne Tee und esse zwei Erdnusstoasts mit Marmelade, während ich im Videotext die Schlagzeilen des Tages überfliege. Die Arbeitsministerin soll den verwaisten Herrensitz im Schloss Bellevue übernehmen, ihr Kabinettskollege im Verteidigungsministerium verkündet, im nächsten Jahr die Wehrpflicht auszusetzen, für mich kommt das zehn Jahre zu spät. Einige Sekunden ärgere ich mich, doch schließlich siegt die Erkenntnis, dass mich das geschenkte Jahr auch nicht weitergebracht hätte als hierher, in diese Wohnung, in dieses Leben.
Später sitze ich am Schreibtisch und entwerfe Vorworte für meine Dissertation. Wochen habe ich den Text vor mir hergeschoben, Krankheiten und Katastrophen erdacht, jetzt bleibt keine Zeit mehr, die Geduld meines Doktorvaters ist erschöpft und ebenso die meine. Das Allermindeste ist eine Skizze, mit der er arbeiten kann, um meine Lücken in seinem Sinne zu stopfen.
Als es Zeit wird, schwinge ich mich aufs Rad und fahre zur Uni. Der Himmel hängt voller Wolken, doch über dem Taunus klart es allmählich auf. Auf der Treppe vor dem I.G.-Farben-Komplex hocken ein paar Studenten, rosige Gesichter, die mich höflich grüßen, als sei ich ihr Dozent.
Während ich durch die leeren Korridore laufe, hallen mir meine Schritte wie das Echo einer Erinnerung voraus. Das historische Seminar, es kommt mir vor wie eine Erfindung für Menschen, die sich am Leben der Großen berauschen. Ein Spiegelkabinett, Metaphysik, die Wette auf einen Traum. Was habe ich hier verloren?
Mein Doktorvater lässt mich eine halbe Stunde warten. Ich händige ihm das Vorwort-Fragment und die ihm nützlichen Kapitel meiner Arbeit aus und blicke so oft auf die Uhr, bis er mich fragt, ob ich noch einen Termin habe, was ich mit Hinweis auf die halbe Stunde, die er mir gestohlen hat, bejahe. Er nimmt’s mit Humor, er hat, was er braucht, am Ende klopft er mir sogar auf die Schulter und wünscht mir Glück und Erfolg.
Wir treffen uns vor der Mensa. Uli sitzt auf der Freitreppe, neben ihr eine Asiatin mit Pumphosen, einem weiten Herrenhemd und kurzgeschorenem Haar.
„Das ist Xiao“, sagt Uli und hält mir ihre Wange hin. „Lio. Mein Freund.“
Ich gebe Xiao die Hand, aber die sieht mich nicht an, beinahe abweisend, als hätte ich ihr etwas getan.
Wir gehen hinein und reihen uns in die Schlange vor dem Wok ein, wo die beiden die Köpfe zusammenstecken, ich verstehe nicht, worüber sie sich unterhalten, einmal drückt Uli Xiaos Hand, die starrt die ganze Zeit über zu Boden.
Wenige Schritte vor der Essensausgabe dreht sich Uli nach mir um. „Xiao wird eine Zeit lang bei mir wohnen“, erklärt sie beiläufig, „so ist es am besten.“
„Am besten?“
„In der derzeitigen Situation.“
Ich wüsste gern, was sie damit meint, doch in diesem Augenblick dreht sich Xiao nach uns um und deutet zur Köchin hinter der Theke, die mit großem Gleichmut unsere Bestellung erwartet.
Später trinken wir in der Rotunde Cappuccino. Uli will alles über meine erste Kursstunde in der Villa Lichtblick wissen. Ich erzähle ihr von Dr. Engelhardt, Grace Kelly und den schwerhörigen, gichtkranken Damen, einige Male lacht sie, während Xiao beharrlich schweigt.
Bevor wir uns trennen, nimmt mich Uli in den Arm.
„Ich freu mich auf dich“, flüstert sie. „Sehr sogar.“
Was sie mir eigentlich sagen will, erschließt sich mir erst, als ich mein Chaosreich betrete und die nasse Regenhaut über den Wandhaken stülpe. Das Wasser, das den Ärmel herabrinnt, tropft in Ulis Hausschuhe, ausgerechnet, das stumme Echo ihrer Botschaft trifft mich mit Wucht. Wenn Xiao bei ihr einzieht, wird Uli bei mir wohnen, drei mal drei Meter lassen keinen anderen Schluss zu, für einige Tage wenigstens, wahrscheinlich für länger.
Vor einem Jahr, ich erinnere mich, wir hatten im Schauspiel Huis Clos gesehen, was genau sie aufbrachte, weiß ich nicht mehr, nur dass ihr das, was sie zu sagen hatte, wichtig war: Die wahrhaftige Begegnung zweier Menschen setze einen gemeinsamen Alltag voraus, ohne den jede Partnerschaft eine Affäre bleibe, deren Unverbindlichkeit reizvoll sei, die ohne ein gemeinsames Gelingen und Scheitern aber nie jene Tiefe gewinne, die ein wortloses Einvernehmen erlaubt.
„Wortloses Einvernehmen, verstehst du, nicht schweigsames Nebeneinanderherleben.“
Das war auf ihre Eltern gemünzt. Meinen Einwand, dass Sartre und Beauvoir ihren eigenen Stil gepflegt hätten, ließ sie nicht gelten.
„Die Frage ist einfach, will ich ständig verliebt sein oder stetig lieben? Für dich klingt das vielleicht kitschig, für mich nicht.“
5
„Wir kommen uns näher“, begrüßt mich Frau Morgenstern, als ich am Freitag, unausgeschlafen, aber pünktlich, das neue Internet-Café der Villa Lichtblick betrete. Frau Becker, erfahre ich, ist am Morgen gestürzt, und Frau Schön lässt mir ausrichten, dass sie ihrer Gelenkschmerzen wegen nicht mehr am Kurs teilnehmen kann. Während ich die vier PC-Plätze begutachte, male ich mir Edgars Enttäuschung aus und lege ein Schweigegelübde ab, um ihn vorerst zu schonen.
„Heute möchte ich mit Ihnen das Verschieben, Einfügen und Kopieren von Textbausteinen vertiefen“, beginne ich und fahre die Rechner hoch.
„Textbausteinen?“ Frau Ferenczy schüttelt den Kopf.
„Ein Absatz beispielsweise oder ...“
„Warum Absatz?“, mischt sich Frau Anderson ein.
„Bausteine, das klingt wie Bauklötzchen“, sagt Frau Ferenczy, „ich mein ja nur, finden Sie nicht?“
„Sie haben Recht“, beschwichtige ich und fange den amüsierten Blick Frau Morgensterns auf. „Wenn ich mich unverständlich ausdrücke, korrigieren Sie mich bitte. Also.“
„Zu meiner Zeit waren Bauklötzchen noch aus Holz“, erklärt Frau Anderson, „heute ist alles aus Plastik.“
„Mein Brillenetui ist auch aus Plastik“, sagt Frau Ferenczy, „fühlen Sie mal, nix Leder, Plastik, aber leidlich stabil.“
„Wir fangen langsam an“, sage ich, gehe um den Tisch herum und rufe auf allen Bildschirmen einen x-beliebigen Text auf, von dem ich den ersten Absatz markiere. „Mit der Maus, sehen Sie, können wir Wörter, Sätze oder ganze Absätze innerhalb eines Textes oder auch mehrerer Texte verschieben, löschen und kopieren. Wollen Sie das einmal gemeinsam probieren?“
Der stille Ernst der alten Damen, ihre Ungeduld, ihre Freude und ihr heiliger Zorn – tatsächlich kommen wir uns an diesem Nachmittag näher. Immer wieder staune ich, wie aufmerksam sie mir folgen, wie vorbehaltlos sie mich, den fünfzig Jahre Jüngeren, als Lehrer akzeptieren. Gerade habe ich das Tor zum Internet aufgestoßen, als es an der Tür klopft. Ein Mann tritt ein, bronzene Haut, das volle Haar so weiß wie sein fein gestutzter Bart, blauer Anzug mit goldenen Knöpfen, weißes Hemd und blaue Fliege, wenn der Rollator nicht wäre, gäbe er den Schiffskapitän auf einer Yacht.
„Clemens Clemens“, stellt er sich vor, und ich muss lachen, weil mir Humboldts Aufsatz über die Verdoppelung der Silben in den Sprachen der Südsee in den Sinn kommt, loloa lang, lololoa sehr lang, ich reiche ihm die Hand, Herr Clemens lacht ebenfalls, allem Anschein nach ist er nicht nur ein eleganter, sondern ein überaus fröhlicher alter Herr.
„Ein spontaner Entschluss“, erklärt er, und Frau Ferenczy seufzt, „wenn ich ein wenig schnuppern dürfte, so sagt man doch, ich will aber auf keinen Fall stören.“
„Sie stören gewiss nicht“, erwidere ich, „im Gegenteil, machen Sie es sich bequem, wir wollten gerade verreisen.
Fragt sich nur noch, wohin.“
„In den Schwarzwald“, schlägt Frau Ferenczy vor.
„Nach Mallorca!“, ruft Frau Anderson.
„Auf die Zugspitze?“, bringt sich Herr Clemens ein.
„Und Sie?“, wende ich mich an Frau Morgenstern. „Wohin würden Sie gern verreisen?“
„Ich überlege noch.“ Sie setzt ihre Brille ab und betrachtet den Globus auf dem Monitor. „Mal sehen. Vielleicht auf die Spielplätze meiner Kindheit. Ist das möglich?“
„Wenn Sie mir verraten, wo Sie aufgewachsen sind.“
„In Elbing, Westpreußen, heute Elblag in Polen.“
„Kein Problem. Lassen Sie uns mit Mallorca beginnen.“
Als das Kameraauge des Satelliten vom Weltall herabschwebt und die Mittelmeerinsel im Bild erscheint, stößt Frau Anderson einen spitzen Schrei aus. Alle rücken näher heran.
„Da, da unten!“, ruft Frau Anderson und drückt den Finger auf Port d’Andratx. „Warten Sie, wann war das, ich glaub, kurz nach der Wende, jedenfalls war mein Jüngster da schon nicht mehr dabei. Wie nah geht das?“
Ich aktiviere die Straßenansicht und fahre mit ihr einmal rund um die Bucht von Port d’Andratx. Frau Anderson reißt mir die Maus aus der Hand, während die anderen ungeduldig auf ihren Stühlen rutschen, als säßen sie auf gepackten Koffern. Ich lasse Frau Anderson gewähren, chauffiere Frau Ferenczy in den Schwarzwald und fliege mit Clemens Clemens die Zugspitze hinauf. Als ich an Frau Morgensterns Bildschirm Elbing ansteuere, bleiben die Nahbilder unscharf, auch die Straßenansicht enttäuscht, statt realer Schauplätze sind nur schematische Darstellungen zu sehen.
„Tut mir leid“, sage ich. „Offenbar ist Polen noch nicht in Europa angekommen.“
„I wo“, antwortet sie, „das muss Ihnen nicht leidtun.
Wahrscheinlich soll das so sein. Das Haus meiner Eltern, die Stadtkirchen, der Fluss – als Kind kam mir alles so groß vor und ist in meiner Erinnerung sogar noch gewachsen.
Wer weiß, vielleicht ist es besser, sich seine Illusionen zu bewahren, damit alles am rechten Platz bleibt, nicht wahr?“
„Möchten Sie einen anderen Ort besuchen, vielleicht einen, den Sie noch nicht kennen?“
„Darf ich?“
Sie nimmt mir die Maus aus der Hand und schiebt sie vorsichtig über den Tisch. Ihre Augen folgen dem Cursor.
Als der Pfeil an den oberen Rand des Fensters stößt, rückt sie prompt zurück.
„Ohne die Schmerzen“, sagt Anderson mit einem Mal, „wäre das Alter erträglich.“
Frau Ferenczy neben ihr blickt auf. „Jaja, die Schmerzen, die machen einen mürbe, irgendwann will man nur noch schlafen. Schluss, Aus, Ende.“
„Aber gegen die Schmerzen gibt es doch Medikamente“, wende ich ein.
„Pah!“ Frau Ferenczy wischt über den Tisch. „Die Pillen helfen dir doch nur, wenn du die halbe Packung schluckst.
Und danach bist du so rammdösig, dass du tagsüber schläfst und die ganze Nacht wach liegst.“
Auch Frau Morgenstern winkt ab. „Arzneien helfen gegen Gelenkschmerzen, den Schmerz dahinter betäuben sie nicht.“
„Cala, Cala.“ Frau Anderson schüttelt ihre Schmerzen weg, ihre Finger schnippen durch die Luft wie die Finger einer Flamencotänzerin. „Cala ... Herrschaftszeiten! Cala, sagen Sie schon, das Fischerdorf, da wo die alle hinfahren, Cala, Cala, o jemine, ich hör den Kalk rieseln, das war so malerisch da, ich komm einfach nicht drauf.“
Frau Ferenczy tippt mir auf die Schulter. „Kennen Sie das, wenn Sie der Splitter, von dem Sie nachts geträumt haben, tagsüber schmerzt?“
Sofort hängt Frau Anderson wieder an meinem Arm. „Sie wissen schon, Cala soundso, das Fischerdorf, verdammichnochmal.“
Angesichts einer Insel, die an malerischen Fischerdörfern ebenso reich ist wie an schönen Buchten, gestaltet sich unsere Suche aufwendig und kompliziert. Im Anschluss soll ich Clemens Clemens auf den Eibsee abseilen und Frau Ferenczy ins Glottertal geleiten, am Ende fehlt die Zeit, um mich noch einmal Frau Morgenstern zu widmen, die sich still von mir verabschiedet.
Bevor ich die Rechner herunterfahre, sehe ich nach, welchen Ort sie zuletzt besucht hat. Auf den ersten Blick wirkt der Ausschnitt auf ihrem Monitor wie ein abstraktes Bild. Ein graugrüner Hintergrund, durchzogen von weißen, parallel laufenden Linien, dazwischen, symmetrisch geordnet, Dutzende Rechtecke in unterschiedlichen Grauabstufungen.
Oświęcim steht im Suchfenster.
Auschwitz.
6
Porträts von Menschen, die ihr Leben längst hinter sich haben. Karge Landschaften. Häuserzeilen. Ein Schuttberg, der über den Rahmen quillt. Eine Urkunde der Jerusalem-Wallfahrer. Getrocknete Blumen hinter Glas. An einer Wand eine Bleistiftzeichnung – die verträumten Augen einer jungen Frau.
„Sind Sie das?“
Sie schweigt.
„Von wem stammt die Zeichnung?“
Vielleicht hört sie mich nicht.
„Nett haben Sie’s hier“, sage ich nach einer Weile.
„Nicht wahr?“
Sie sieht sich in ihrer Wohnung um, als ob sie sie mit meinen Augen sähe.
„Hier kann man es aushalten.“ Sie öffnet die Balkontür, warme Luft weht herein. „Der Blick von hier ist weiter als in der Stadt.“
Ihre Silhouette, eingefasst vom Rahmen der Tür, bewegt sich nicht.
„Hätte ich aber die Wahl gehabt“, sagt sie, „wäre ich in Bornheim geblieben. Sehen Sie, das Unerträgliche sind gar nicht die Schmerzen, auch nicht die nachlassende Kraft oder die scheußlichen Flecken am Leib. Unerträglich ist es, die lieb gewordene Freiheit einzubüßen, die Selbständigkeit, das bisschen Würde, das einem im Alter noch bleibt. In der Innenstadt musste ich niemanden fragen. Samstags war Markt, mein Supermarkt vor der Tür, und zum Arzt hatte ich es fünf Minuten – was will man mehr! Kochen, waschen, putzen – alles kein Problem. Doch irgendwann. Auf einmal fängt es an zu zwicken, hier und hier, plötzlich fühlen sich die Beine müde an, von einem Moment auf den anderen bricht dir der Schweiß aus, dein Herz rast wie verrückt, und der Arzt sagt, machen Sie mal halblang, Ihre besten Jahre sind vorbei. Zuerst denkst du: Der spinnt doch! Dem werd ich’s zeigen! Doch irgendwann, wenn du japsend auf der Treppe stehst und dich fragst, ob du es noch bis zur Tür schaffst, überlegst du dir, ob dein Arzt vielleicht Recht hat und du dir beizeiten nicht doch Hilfe suchen solltest, denn mit deinen müden Beinen und deiner schwachen Pumpe sind vier Stockwerke ohne Aufzug mindestens zwei Stockwerke zu viel.“
„Das Bild“, versuche ich es noch einmal und deute auf die Zeichnung. „Sind Sie das?“
„I wo“, antwortet sie bestimmt, „das war ich mal.“
„Von wem stammt die Zeichnung?“
„Von meinem Mann.“
„War er Künstler?“
Sie streicht über den Rahmen des Bildes. „Künstler? Ja, vielleicht, auf seine Art. Von Berufswegen war er Lehrer. Er hat Fremdsprachen unterrichtet, wissen Sie, hauptsächlich Englisch. Aber er konnte mindestens sechs weitere Sprachen verstehen.“
„Darf ich fragen, seit wann Sie allein leben?“
„Oh, schon lang, viel zu lang.“
Ich schlage den Nagel in die Wand. Sie hätte einen Pfleger darum bitten können, aber sie hat mich gefragt. Warum rahmt sie einen Zeitungsausschnitt? Eine Ruine? In ihrem Bett liegt ein Kuschelbär. Ihr Telefon hat extragroße Ziffern.
Während sie Tee kocht, frage ich sie, ob sie Kinder hat.
Sie schüttelt den Kopf. „Und Sie, Lionel? Haben Sie Kinder?“
Ich schüttele den Kopf.
„Wollen Sie denn Kinder?“
„Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Später. Das hängt davon ab.“
„Wovon?“
„Ich weiß nicht. Ob es passt.“
„Warten Sie nicht zu lang. Irgendwann hat Sie das Leben überholt.“
Sie nimmt das Sieb aus der Kanne und stellt es in die Spüle.
Während ich mich setze, gießt sie uns ein.
„Er hieß Seraphin“, bemerkt sie, ohne mich anzusehen.
„Schön war ich für ihn. Schön war ich, wenn ich mich in seinen Augen sah.“
„Wie haben Sie sich kennengelernt?“
„Oh, das ist eine lange Geschichte.“
„Ich habe Zeit“, entgegne ich und sehe in ihre gletscherblauen Augen. „Erzählen Sie mir Ihre Geschichte.“
Einen Moment schweigt sie. Als sie sich setzt, lächelt sie plötzlich.
„Ich habe eine bessere Idee, Lionel. Was halten Sie davon, wenn Sie mir meine Geschichte erzählen?“
7
Um kurz vor fünf klingelt das Telefon.
„Ma?“
Ma nenne ich sie, weil sie Ma genannt werden will. Für Mama sei ich zu alt, Mutti klinge spießig, Mutter findet sie zu unpersönlich, und Mum sei tabu, absolut tabu, so dürfe ich sie nie wieder nennen! Am liebsten hätte sie, wenn ich sie bei ihrem Vornamen riefe, aber das will ich nicht, Freunde werden wir nie sein.
„Die Geschäfte laufen schlecht“, hebt sie ohne Gruß oder Floskel an, „die Leute wollen für Kunst nichts mehr ausgeben, geschenkt ja, bis zehn Euro vielleicht, aber mehr nicht, lieber investieren sie in Gold oder Aktien oder in ein fabrikneues Statussymbol.“
„Und wie geht es dir?“
„Oh, danke, kann nicht klagen, soweit, so gut.“
Ich sehe sie, umgeben von ihren stummen, bunten, runden, aus rohen Stämmen gemeißelten, weibshohen Fruchtbarkeitsgöttinnen, auf dem Schottener Marktplatz sitzen und die Besucher danach begutachten, ob er oder sie, die ihre Skulpturen belachen oder bewundern, nicht doch noch eine erwerben, wenigstens eine, schließlich kommt beinahe jede Woche eine neue dazu. Immer freitags sitzt sie da, am Rande des Platzes, wo die Fachwerkhäuser enden und der hässliche Putz beginnt, wo die Standgebühren etwas günstiger sind als mittendrin, und wartet auf einen Käufer oder besser noch einen Galeristen oder Mäzen, von denen sich jedoch nie jemand nach Schotten verirrt. Eine Stunde vor Abbruch ruft sie mich oder Dakota an und lädt ihren Schutt bei uns ab, ich kehre den Dreck zusammen und puste ihr Staub ins Gesicht.
„Du könntest die Kunst zu deinem Hobby machen“, schlage ich vor.
„Red nicht so ein dummes Zeug.“
„Und tagsüber einer anständigen Arbeit nachgehen.“
Ich sehe ihre schrundigen Finger durch die Luft wischen, vergeblich, Ratschläge sind lästiger als Fliegen.
„Uli wohnt für ein paar Tage bei mir“, sage ich, „nächsten Samstag zieht sie bei mir ein, ich weiß nicht, für wie lange, sie überlässt einer Freundin ihr Zimmer.“
„Ach ja?“
Warum selbst Mütter, die sich Ma nennen lassen, glauben, dass ihre Söhne verwahrlosen, verhungern, verkommen, verwildern, sofern sich ihrer beizeiten nicht eine gute Fee erbarmt, werde ich nie begreifen.
„Für ein paar Tage“, wiederhole ich.
„Hör auf mich.“
„Was meinst du?“
„Wirst schon sehen.“
„Lass gut sein.“
„Wirst schon sehen.“
Ich höre ihren Atem, die Stimmen um sie herum, den Glockenklang einer Uhr. Dann kommt sie zum Eigentlichen.
„Hast du mal wieder was von deinem Vater gehört?“
„Es geht ihm gut“, antworte ich. „Er angelt und hält Vorträge.“
„Ja, das kann er am besten.“
„Und er hat sich einen Hund gekauft, einen Border Collie, er nennt ihn Bernanke.“
„Einen Border Collie“, wiederholt sie. „Ist das nicht ein Hütehund?“
„Er lässt dich grüßen“, lüge ich.
„Sag ihm, dass er dir ein paar Fotos schicken soll. Vom Haus und vom See und natürlich von seinem neuen Hund, wie kann er denn einen Hund Bernanke nennen, ist das nicht dieser Kerl von der Wall Street, das sieht ihm ähnlich.“
Vor meinen Augen erscheint das Haus meiner Kindheit, ein uraltes Blockhaus mit großen Fenstern, Blick auf den See und die Berge, das Motorboot am Steg, seine Yacht, mit der wir hinausfuhren, um zu angeln, wenn kein Fisch anbiss, summte er sein Lied, far above Cayuga‘s waters, die Musik weht über den See bis hinauf zu seinem winzigen Weinberg, dem Goldhügel, aus dessen Beeren er jedes Jahr seinen Wein keltern ließ, den ich an Weihnachten probieren durfte, ein halbes Gläschen, nicht mehr. Ich erinnere mich an seinen Pick-up, den alten Lincoln, mit dem er mich morgens zur Nursery School chauffierte, an den Weg in die Stadt, an Ithaca selbst, der mythischen Heimat meines wirtschaftsweisen Vaters, der kluge, liebenswerte Freunde um sich scharte, die bei uns ein und ausgingen, ohne sich anzukündigen, für Sankt Patrick die Flamme der Freiheit, für Ma die Glut, an der sich ihr ewiger Streit entzündete, da der Fürst Hof hielt und seine Magd die Gäste bewirtete. Und doch hat all das mit mir nichts zu tun, ich erinnere mich daran wie an einen Film oder eine Erzählung, die Bilder in