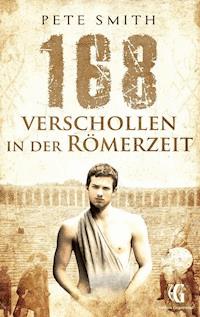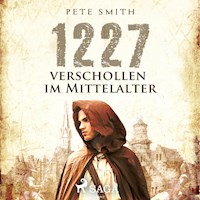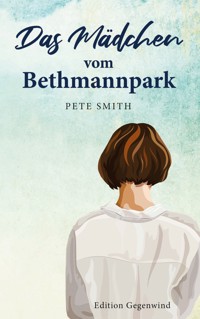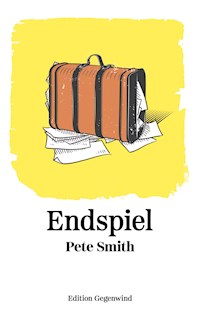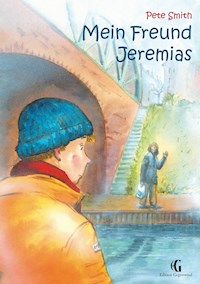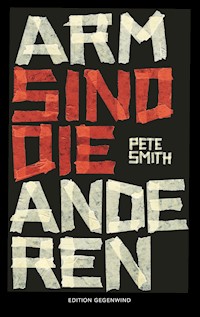Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Verschollen ...
- Sprache: Deutsch
Seit zwei Jahren ist Levent, Schüler des Hochbegabten-Internats Burg Rosenstoltz, spurlos verschwunden. Bei ihren Nachforschungen kommen seine Mitschüler Nelson, Judith und Luk Levents Geheimnis auf die Spur und entdecken schier Unglaubliches: Ihr Freund hat die Theorie der Zeitreise in die Praxis umgesetzt und ist in das Jahr 1227 gereist, in dem auf Burg Rosenstoltz ein großes Ritterturnier abgehalten wurde. In den Katakomben der Burg stoßen sie auf Levents Zeitmaschine. Um ihren Freund zurückzuholen, folgen sie ihm auf seinem Weg ins Mittelalter. Sie finden ihn im Kerker der Burg, wo er auf seine Hinrichtung als Ketzer wartet... "1227 - Verschollen im Mittelalter" ist der erste Teil der spannenden Zeitreise-Trilogie um Nelson und seine Freunde (weitere Romane: "168 - Verschollen in der Römerzeit" und "2033 - Verschollen in der Zukunft").
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Smith
wurde 1960 als Sohn einer Spanierin und eines Engländers in Soest geboren. An der Universität Münster studierte er Germanistik, Philosophie und Publizistik. Er schreibt Kinder- und Jugendbücher, Essays und Romane, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Er lebt in Frankfurt am Main.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Dritter Teil
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Edition Gegenwind
ERSTER TEIL
„Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“
Meister Eckhart (1260–1327)
1
D as Gewitter kam näher. In den letzten Minuten hatte sich der Himmel über der Burg zusehends verfinstert. Von seinem Platz am Fenster überblickte Nelson die weite Ebene, an deren hinterem Rand es gerade hell aufflammte. Kurz darauf spürte er wieder dieses tiefe Grollen, das sich allmählich an die Burg heranschob.
„Wenn wir über die Zeit reden“, hörte er Professor Winkeleisen sagen, „dann sollten wir uns zunächst darüber verständigen, welche Zeit wir meinen.“
Nelson sah auf seine Armbanduhr: 15.57 Uhr, acht, neun, zehn Sekunden. In einundzwanzig Minuten und zwanzig Sekunden würde das Gewitter über sie hereinbrechen. Plus/ minus drei Sekunden. Darauf würde er selbst seinen geheiligten Kompass verwetten.
„Isaac Newton betrachtete die Zeit als eine absolute Größe, die überall auf der Welt – und wenn ich Welt sage, dann meine ich nicht nur unsere winzige Erde, sondern das unermessliche Universum – in gleicher Weise zu bestimmen ist.“ Professor Winkeleisen räusperte sich. „Diese Vorstellung sieht die Zeit als einen Pfeil, der, vor Ewigkeiten abgeschossen, Ewigkeiten lang in gerader Richtung weiterfliegen wird. Die meisten Menschen glauben an diese Art von Zeit. Für sie entspricht eine Stunde auf der Erde exakt einer Stunde auf der Venus oder dem Jupiter oder wo immer sonst.“
Der Wind jaulte um die Burg herum, peitschte über den Hof und fuhr so gewaltig in die uralte, knorrige Rotbuche, dass ihre bunten Blätter wie wild auseinander stoben. Nelson zwang sich, seinen Blick von den peitschenden Ästen und den dunklen Wolken zu lösen und nach vorn zur Tafel zu sehen, auf die sein Lehrer gerade mehrere Begriffe kritzelte:
absolute Zeit (Newton)
relative Zeit (Einstein)
Ende der Zeit (Hawking)
„Albert Einstein“, fuhr Professor Winkeleisen fort, „hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie dargelegt, dass Raum und Zeit ein vierdimensionales, gekrümmtes Gebilde namens Raumzeit formen. Alles, was Masse und Energie besitzt, verzerrt die umliegende Raumzeit. Zeit ist bei Einstein also nicht mehr absolut, sondern abhängig von Masse und Geschwindigkeit, also relativ. Können Sie mir folgen?“
Nelson blickte sich um. Einige seiner Mitschüler nickten, andere sahen uninteressiert zur Decke. Ein Arm schnippte hoch. Fünf Finger mit langen, orange lackierten Nägeln zitterten durch die Luft wie aufgeregte Kolibris.
„Judith?“
Ein Teenager mit halblangen, wasserstoffblond gefärbten Haaren und einer löchrigen, ausgewaschenen Jeans erhob sich und stöckelte auf hohen Absätzen zur Tafel.
„Wenn Zeit durch Masse gekrümmt wird“, begann sie und nahm einen Filzstift zur Hand, „bedeutet dies, dass die Zeit in großer Nähe zu einem superschweren Stern langsamer vergeht als in weitem Abstand dazu. Eine weitere Folgerung aus Einsteins Relativitätstheorie: Je höher die Geschwindigkeit, mit der ein Raumschiff unterwegs ist, desto langsamer vergeht für dessen Insassen die Zeit.“ Judith malte zwei Kreise auf die Tafel, darauf zwei Figuren, die sie A und B nannte. „Das bringt uns zum berühmten Zwillingsparadoxon: Zwilling A beginnt eine Reise durchs All, während Zwilling B daheim bleibt und die Kohle ranschafft. A bewegt sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit, wodurch die Uhr für ihn um einiges langsamer tickt als für Bruder B. Wenn A auf die Erde zurückkehrt, muss er feststellen, dass sein Zwillingsbruder längst in Rente ist und auch so aussieht, während er selbst kaum gealtert ist.“
Nelson hörte nur mit einem Ohr zu. Er kannte das in- und auswendig. Stattdessen beobachtete er seine Mitschüler und stellte zweierlei fest: Während sich die meisten Jungen streckten, um einen Blick auf den Paradiesvogel zu werfen, der da so unverschämt selbstsicher über Paradoxa philosophierte, begannen einige Schülerinnen, miteinander zu tuscheln, und schossen Blicke wie giftige Pfeile auf Judith ab.
„Korrekt“, bemerkte Professor Winkeleisen und entließ Judith auf ihren Platz. „Das Zwillingsproblem scheint unserem gesunden Menschenverstand zu widersprechen. Und doch haben Experimente Einsteins Theorie bestätigt. Im Jahre 1975 etwa synchronisierte die US-amerikanische Wissenschaftlerin Carol Allie von der University of Maryland zwei Atomuhren, von denen eine auf der Erde blieb, während die andere auf eine längere Flugreise geschickt wurde. Als diese Uhr von ihrer Reise wieder zur Erde zurückkehrte, verglich Carol Allie die von beiden Uhren gemessene Zeit und stellte fest, dass die Zeit der fliegenden Uhr den Bruchteil einer Sekunde langsamer vergangen war als die Zeit der Erduhr. Erstaunlich, finden Sie nicht?“
„Ist ja sowieso alles relativ!“, rief einer der Norton-Zwillinge dazwischen, die sonst allenfalls dadurch auffielen, dass sie Gerüchte streuten oder in der Nase bohrten.
„Bis auf deinen Rotz! Der ist nicht nur relativ, sondern ziemlich eklig“, erwiderte ein Mädchen und rieb einen imaginären Popel zwischen Daumen und Zeigefinger.
Vorn steckten zwei blasse Typen die Köpfe zusammen und kicherten wie zwei Kindergartenkinder über ein schlimmes Wort.
„Aber, aber, meine Herrschaften“, beschwor Professor Winkeleisen seine Schüler, „das ist doch wirklich unter unserem Niveau!“ Er pochte aufs Pult um fortzufahren. „Kennt jemand von Ihnen noch ein anderes Experiment, das Einsteins Thesen bestätigt?“
Der Wortschwall verebbte, und Stille kehrte ein. Professor Winkeleisen schritt durch die Reihen, doch niemand meldete sich. Schließlich blieb sein Blick an Nelson hängen.
„Wenn Sie so nett wären, uns Einlass in Ihre Gedankenwelt zu gewähren“, sagte Professor Winkeleisen, und einige Schüler grinsten. „Hallo, Nelson, ja, Sie meine ich.“
Nelson drehte sich langsam um und sah die Blicke der gesamten Klasse auf sich gerichtet. Automatisch rief er die letzten Sätze seines Lehrers ab, die er unterbewusst gespeichert hatte, und formulierte bereits eine Antwort, während einige Mitschüler ihm noch schadenfrohe Blicke zuwarfen.
„In einem anderen Experiment“, begann er und unterdrückte ein Gähnen, „haben Wissenschaftler Elektronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch einen Teilchenbeschleuniger gejagt. Der Zerfallsprozess der beschleunigten Elektronen war, wie sich zeigte, am Ende weniger fortgeschritten als jener der in Ruhe verbliebenen Teilchen.“
„Aber dann müssten doch“, unterbrach ihn ein schlaksiger Schüler, der seine fusseligen Haare zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, „bei Geschwindigkeiten jenseits der Lichtgeschwindigkeit auch Zeitreisen möglich sein, oder nicht?“
Über Professor Winkeleisens Gesicht glitt ein unmerkliches Lächeln. „Theoretisch ja“, antwortete er und wandte sich der Tafel zu. „Womit wir bei Stephen Hawking gelandet sind, dem vielleicht größten Physiker unserer Zeit.“
Der Sturm hatte an Kraft zugelegt. Heftig rüttelte er an den Fenstern, die auf Nelson nicht den stabilsten Eindruck machten. Sein Lehrer deutete gerade auf die Tafel, um fortzufahren, als es draußen einen gewaltigen Schlag tat. Einige Schüler sprangen zum Fenster. Doch im Hof war bloß eine Leiter umgefallen, die Hausmeister Kunkel offenbar dort vergessen hatte.
„Die bescheidenen Energien, die auf unserer Erde walten“, hob Professor Winkeleisen an, „sind nichts im Vergleich zu jenen Gewalten, die am Rande eines in sich zusammenstürzenden Sterns entfesselt werden. Solche Sterne, die massenhaft Energie aufsaugen, nennen wir bekanntlich Schwarze Löcher. Einstein selbst wollte an die Existenz dieser unheimlichen Gebilde nicht glauben, obwohl sie zwingend aus der allgemeinen Relativitätstheorie hervorgeht, denkt man jene konsequent zu Ende. Erst Stephen Hawking hat uns vermittelt, wie wir uns so ein Schwarzes Loch vorzustellen haben.“
„Und was haben Schwarze Löcher mit Zeitreisen zu tun?“, fragte der Zopfträger dazwischen.
„Üben Sie sich in Geduld, Luk“, erwiderte Professor Winkeleisen, „ich werde Ihren Durst sogleich stillen.“ Er trat hinters Pult und malte einen auf dem Kopf stehenden breitkrempigen Zylinder an die Tafel.
„So in etwa könnte ein Schwarzes Loch aussehen. Das Hubble-Weltraumteleskop hat die Existenz solcher Löcher zweifelsfrei nachgewiesen. Aus ihnen kann kein Lichtstrahl entweichen. In ihrem Innern steht die Zeit still.“ Professor Winkeleisen schritt durch die Reihen seiner Schüler und blickte dabei jedem ins Gesicht. „Wenn es aber Punkte im Universum gibt, an denen die Zeit stillsteht, müsste man – zumindest theoretisch – zwei dieser Punkte miteinander verbinden können. Dann erhielte man einen Tunnel, durch den Zeitreisen möglich wären. Diese Zeittunnel nennen wir Wurmlöcher.“
Ein Blitz entflammte den Himmel und kurz darauf explodierte ein gewaltiger Donner über der Burg. Einige Schüler zuckten zusammen. Nelson warf einen Blick auf die Uhr. Noch wenige Minuten ...
„Sie müssen sich das so vorstellen“, erklärte ihr Lehrer und malte im Abstand von etwa einem Meter zwei Punkte an die Tafel. „Dies sind zwei Orte im Universum, eine Milliarde Lichtjahre voneinander entfernt. Nehmen wir an, die Tafel wäre biegsam. Wir können sie so weit zusammendrücken, bis die beiden Punkte nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. Dann bohren wir da, wo die Punkte sind, von beiden Seiten ein Loch durch die Tafel und schieben einen Strohhalm hindurch. Der ist jetzt unser Wurmloch, durch das Sie eine Milliarde Lichtjahre in einem Moment überwinden. Sehen Sie, so.“
Nelson fing einen Blick von Judith auf. Lächelte sie etwa?
„In den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts“, fuhr Professor Winkeleisen fort, „hat der US-amerikanische Physiker Kip Thorne von der University of California in Berkeley anhand dieses Modells die Möglichkeit von Zeitreisen wissenschaftlich dargelegt. Sein Freund und Kollege Stephen Hawking blieb zunächst skeptisch: Um eines dieser winzigen Wurmlöcher aufzublähen und so lange offen zu halten, dass ein Raumschiff hindurch gleiten könnte, wären gigantische Mengen an negativer oder exotischer Masse notwendig. Solche Mengen sind für uns jedoch nicht verfügbar, was im Übrigen auch Kip Thorne bewusst war. Immerhin wollte er nicht ausschließen, dass eine Superzivilisation in ferner Zukunft über genug Energie verfügen könnte, um Wurmlöcher als Zeitschleifen nutzbar zu machen. Doch das werden selbst Sie nicht mehr erleben, fürchte ich.“
Von hinten schnippte irgendwer ein Papierkügelchen durch die Luft, das haarscharf an Luk vorbeizischte. Da der Zopfträger zusammenzuckte, lachte die ganze Klasse.
Bis auf Nelson.
Der starrte fasziniert nach draußen und zählte rückwärts: sieben, sechs, fünf, vier, drei, zw ...
Im nächsten Moment geschahen mehrere Dinge gleichzeitig: Ein greller Blitz zuckte durchs Klassenzimmer, dem ein fürchterlicher Donner folgte, der das alte Gemäuer bis in seine Grundfesten erzittern ließ. Einige Schüler schrien vor Schreck auf, andere duckten sich, und Professor Winkeleisen fuhr so heftig zusammen, dass er den Stuhl, auf den er sich soeben setzen wollte, verfehlte und unsanft auf seinem Hosenboden landete. Während alle wie gebannt hinaus starrten, wo ein Feuerwerk aus Blitz und Donner niederging, warf Nelson einen Blick auf seine Uhr. Es war exakt 16 Uhr, 18 Minuten und 30 Sekunden. Auch in Zukunft würde er nicht ohne seinen geliebten Kompass durch die Weltgeschichte spazieren müssen.
2
Gott blies, und sie wurden zerstreut“, zitierte einer.
„„Gott würfelt nicht, er kegelt“, antwortete ein anderer.
„Gäbe es keinen Gott, so müsste man ihn erfinden“, warf ein Dritter ein.
Sie standen in Gruppen beieinander. Kurz nach dem Donnerwetter hatte sie die Ouvertüre zu Beethovens Neunter in die letzte Pause des Tages gerufen. Professor Winkeleisen war als einer der Ersten draußen gewesen. Nelson hatte ihn in sein Zimmer eilen sehen, wo er wahrscheinlich im Lotussitz hockend das heilige Om beschwor.
Zwar stand einigen Schülern noch der Schreck ins Gesicht geschrieben; doch zumindest die üblichen Verdächtigen gaben sich schon wieder betont lässig.
Nelson entdeckte Judith, die mit geschlossenen Augen an einem Pfeiler lehnte. Sie hatte jetzt eine bunte Flickenjacke an, aus der einzelne Wollfäden heraushingen. Judith sah cool aus, fand Nelson, auf eine seltsame Weise unnahbar und verletzlich zugleich. Er schlenderte hinüber.
„Hey.“
„Lord Nelson“, antwortete sie, ohne ihre Augen zu öffnen. „Auch keine Lust auf die geistige Diarrhö unserer geschätzten Mitschüler?“
Nelson grinste. „Nicht wirklich.“
„Du bist neu hier, richtig?“, fragte Judith und schlug die Augen auf. Erst jetzt bemerkte Nelson, dass sie mit dem Peace-Zeichen bedruckte Kontaktlinsen trug.
„Relativ neu“, antwortete er. „Bin einige Wochen lang in der Klasse von Professor Benjamin gewesen, aber seine fraktale Geometrie war mir zu theoretisch.“
„Soso, zu theoretisch“, erwiderte Judith und blickte ihn spöttisch an.
Nelson merkte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Er ging in die Hocke. Tat so, als ob sich sein Schuhband gelöst hätte. Er hasste das. Es passierte einfach zu oft. Als ob er irgend so ein pickeliges Muttersöhnchen wäre.
Das erste Mal, Nelson erinnerte sich daran noch ziemlich genau, war er rot angelaufen, als ihn seine Eltern zu diesem durchgeknallten Psychologen geschleppt hatten. Sie waren einigermaßen beunruhigt gewesen, weil ihr Sohn den eigenen Vater auf mehrere Rechtschreibfehler in dessen „Handbuch für Botschaftsangehörige im Ausland“ hingewiesen hatte.
Nun ja, Nelson war drei gewesen – und das Handbuch auf Englisch.
Der Psychologe hatte ihm eine Reihe von Tests vorgelegt und nach Auswertung derselben immer wieder den Kopf geschüttelt, sodass Nelson schon befürchtet hatte, der arme Mann sei plötzlich irre geworden. „Das kann nicht sein“, hatte er immer wieder gemurmelt und Nelson anschließend weitere Aufgaben lösen lassen, nur um am Ende wieder mit dem Kopfschütteln anzufangen und Nelsons Eltern fassungslos mitzuteilen, dass ihr Sohn anders sei als normale Dreijährige, wobei er ihnen – nebenbei gesagt – kein Geheimnis verriet. Seine aufgeregte Mutter musste immer wieder nachhaken, bis der Psychologe endlich stillhielt und sie mit einem seltsamen Glanz in den Augen fixierte. „Das ist unglaublich“, flüsterte er ehrfürchtig, „einfach unglaublich! 184, hundert-vier-und-achtzig, das ist mir in den ganzen 24 Jahren meiner beruflichen Praxis noch nicht untergekommen – 184 – wissen Sie, dass Einstein, der große Einstein, einen Intelligenzquotienten von 172 besaß, wissen Sie das?“
Nelsons Eltern hatten das nicht gewusst. Jetzt, da sie den IQ ihres Sohnes erfuhren, rissen sie die Augen auf und erbleichten. Und Nelson, als wollte er neue Farbe in ihre Gesichter zaubern, wurde mit einem Mal feuerrot. Das erste Mal in seinem dreijährigen Leben. Ein erstes Mal, dem allzu viele weitere Male folgen sollten.
Fortan hatte Nelsons Vater einen Privatlehrer nach dem anderen engagiert, um den unendlichen Wissensdurst seines Sohnes zu stillen. Doch etliche dieser gebildeten Damen und Herren, die den Botschafter und seine Familie in den vergangenen neun Jahren bis in die hintersten Winkel der Welt begleitet hatten, gaben entnervt auf – was einerseits an Nelsons ständigen Fragen, andererseits aber auch an den Strapazen eines Lebens im Ausland lag.
„Als Diplomat bist du eine Flaschenpost“, pflegte sein Vater zu sagen, „du weißt nie, wohin es dich verschlägt oder wer dich bekommt.“
Schließlich hatte es sie zurück in ihre Heimat verschlagen. Endlich durfte Nelson auch den letzten Privatlehrer in die Wüste schicken, um auf eine echte Schule zu gehen. Denn danach hatte er sich immer gesehnt: eine normale Schule mit Kindern, die durcheinander redeten, ohne Grund loskicherten, wie blöde einander jagten, Lehrer ärgerten und verbotene Dinge taten, von denen er noch gar keine Ahnung hatte.
Wenn er an seinen Privatunterricht zurückdachte, dann war da immer diese Stille – ein kleiner Raum, ein Tisch, zwei Stühle, Massen von Büchern, darin nur er und sein Lehrer, eine Atmosphäre wie im Kloster, konzentriert und unlustig, sechs Tage die Woche über all die Jahre.
Er hatte ferne Länder gesehen, schon, fremde Kulturen kennengelernt, Eindrücke und Erfahrungen gesammelt wie andere ein ganzes Leben lang nicht. Aber glücklich war er dabei nie gewesen. Zu jenem Glück, das er ersehnte, gehörten Freunde. Solche, die auch am nächsten Tag noch da waren. Von den meisten Mitschülern, die er in der Fremde kennenlernte, hatte er sich nach einem Jahr wieder verabschieden müssen.
Daher hatte er gejubelt, als ihm seine Eltern vor wenigen Monaten eröffnet hatten, dass sie ihn auf ein privates Internat geben wollten, da herkömmliche Schulen seine Fähigkeiten nicht in angemessener Weise fördern könnten. Ein Internat entließ seine Schüler nur in den Ferien nach Hause: Nelson hatte sechs Schuljahre in einer echten Klasse verpasst und freute sich jetzt darauf, auch die Wochenenden mit Freunden zu verbringen.
Das Internat Burg Rosenstoltz war eine Privatschule für Kinder und Jugendliche mit außergewöhnlichen Begabungen und Fähigkeiten, wie es in der schuleigenen Satzung hieß. Die Leute in der Gegend blickten mit Misstrauen hinauf zur Burg, die sie abfällig „Geniefabrik“, „Burg Frankenstein“ oder „Schloss Wundersam“ nannten und auf der sie in irgendeiner Hinsicht auffällige Kinder reicher Eltern vermuteten. Völlig zu Unrecht, wie Nelson schon nach wenigen Tagen feststellen durfte. Denn die meisten jener Schüler, die das Internat besuchten, empfanden sich selbst weder als Genie, noch glichen sie Psychos, und an Wunder glaubte schon gar keiner. Man war so normal, wie man in einer Welt wie der gegenwärtigen nur sein konnte.
Nun ja, zumindest in ihren Interessen unterschieden sich die Internatsschüler von ihren Altersgenossen anderswo. Neben fraktaler Geometrie und Astrophysik bot Burg Rosenstoltz eine ganze Reihe weiterer Fächer, die an herkömmlichen Schulen eher selten Eingang in die Unterrichtspläne finden. So konnten Nelson und seine Mitschüler Sprachen wie Arabisch, Persisch und Sanskrit erlernen, sich mit Ägyptologie oder Byzantinistik befassen, in die Gedankenwelten von Philosophen wie Kant, Sokrates, Nietzsche oder Heidegger eintauchen, sie konnten komponieren, Hochhäuser planen und Vers-Epen verfassen oder eine neue Ethik in der Medizin entwerfen, die den Errungenschaften der Molekulargenetik Rechnung trug. Im Internat Burg Rosenstoltz gab es kaum Pflichtfächer – unterrichtet wurde vor allem nach Interesse. Der Stundenplan wechselte alle drei Monate – denn länger brauchten die meisten Schüler nicht, um den neuen Stoff zu erfassen.
„Zu theoretisch“, wiederholte Judith spitz, „und was ist mit gekrümmter Raumzeit, Schwarzen Löchern und Quantenschaum? Wo siehst du da den Praxisbezug?“
Nelsons Schuhband schien sich immer wieder zu lösen. Er bückte sich, während sich seine Gedanken überschlugen. Klar, wenn er gewollt hätte, wäre jetzt eine heiße Diskussion entbrannt. Schließlich hatte er sich mit dem Thema Zeitreise so intensiv befasst wie wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt. Aufbauend auf den Arbeiten von Newton, Einstein und Hawking, hatte er eine Theorie entwickelt, deren praktische Umsetzung unmittelbar bevorstand.
Doch er zog es vor zu schweigen. Er verspürte keine Lust, gegen Judith anzutreten. Nicht hier und nicht jetzt. Natürlich würde sie ihn für verrückt erklären. Wie alle anderen. Zeitreisen galten auch unter intelligenten Menschen als Humbug – jenseits jeder Vorstellungskraft und jeder Möglichkeit zur Realisation. Sie hatten es ja vorhin erst erlebt: Selbst Professor Winkeleisen verwies Zeitreisen ins Reich der Fantasie. Bis zum endgültigen Beweis hieß es also, sich weiter in Geduld zu üben.
„Und wie lange bist du schon hier?“, fragte er, als er wieder hochkam, und hoffte, dass Judith auf sein kleines Ablenkungsmanöver eingehen würde.
„Seit hundert Jahren. Ich darf wohl behaupten, dass ich zu den Gründungstöchtern unserer ehrwürdigen Anstalt zähle.“ Judith klimperte mit den Lidern. „Meine Eltern konnten mich gar nicht früh genug loswerden, als sie vor drei Jahren erfuhren, dass einige Professoren und Profiteure die geniale Idee hatten, ein Heim für kleine Klugscheißer zu gründen, um deren geplagte Mütter und Väter vor nie enden wollenden Fragen und nervtötenden Diskussionen zu bewahren. Ihre pubertierenden Hirnmonster sperrte man fortan auf Burg Frankenstein, eine als Bildungseinrichtung getarnte Irrenanstalt.“
Nelson starrte sie an. Ihre Worte klangen zwar lustig, ihre Stimme aber nicht.
Judith fing seinen Blick auf und zwang sich zu einem Lächeln. „Vergiss es“, sagte sie leise. „Wäre einfach nett gewesen, wenn sie mir ausnahmsweise zum Geburtstag gratuliert hätten. Eine Karte hätte es schon getan, mit einem Anruf hatte ich sowieso nicht gerechnet. Aber selbst das bringen meine ach so besorgten Eltern nicht fertig.“
„Du hast heute Geburtstag?“, vergewisserte sich Nelson. Judith nickte. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte er und war sich im selben Augenblick bewusst, wie lahm das klang.
„Ach, lass stecken“, antwortete Judith denn auch und setzte wieder ihr spöttisches Grinsen auf. „Wer ist eigentlich auf die grandiose Idee gekommen, dir diesen bescheuerten Namen zu verpassen, Lord Nelson?“
„Mein Vater. War ein großer Bewunderer Nelson Mandelas. Du weißt schon, der Expräsident von Südafrika.“
„Ah ja? Ich dachte, da will jemand an die Schlacht von Trafalgar erinnern, an Lord Nelson, du weißt schon, der Kriegsadmiral.“
In diesem Moment erklang wieder die Ouvertüre zu Beethovens Neunter.
Judith stöhnte. „Du könntest mich tragen“, sagte sie und verzog das Gesicht. „Ich hab schließlich Geburtstag.“
Gemeinsam schlenderten sie zurück ins Klassenzimmer, wo gerade eine Papierkugelschlacht tobte. Ein Bleistift sauste haarscharf an ihnen vorbei.
„Werden die denn nie erwachsen?“, zischte Judith und bedachte einen der Kontrahenten mit einem ätzenden Blick.
Wenig später kehrte auch Professor Winkeleisen zurück. Statt seiner braunen Cordhose trug er jetzt einen Jogginganzug – ein Hinweis darauf, dass Nelson mit seiner Vermutung, ihr Lehrer werde die kurze Unterbrechung zu einer Yoga-Session nutzen, richtig gelegen hatte.
„Wir waren, wenn ich mich recht erinnere, bei der theoretischen Erörterung einer Reise durch die Zeit angelangt“, begann er. „Unser Gedankenspiel bezog sich auf eine Reise in die Zukunft. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass unsere heutige Zivilisation – einmal abgesehen davon, dass sie gar nicht über die entsprechende Technologie verfügt – noch nicht einmal von der Energieaufbringung her in der Lage wäre, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen oder ein Wurmloch zu öffnen und als Zeittunnel zu nutzen.“
Nelson sah, dass Judith genervt die Augen verdrehte.
„Ganz und gar unmöglich“, fuhr Professor Winkeleisen fort, „ist eine Reise in die Vergangenheit. Das schließt auch künftige Zivilisationen ein. Denn selbst die schlausten Köpfe haben keinen Weg gefunden, die Chronologieschutzthese zu knacken. Weiß jeder damit etwas anzufangen? Ja, Luk.“
Der Junge mit dem Pferdeschwanz hatte die Hand gehoben.
„Nach der Chronologieschutzthese wirken die Gesetze der Physik so zusammen, dass Zeitreisen makroskopischer Objekte in die Vergangenheit verhindert werden“, dozierte er, wobei sich seine vom Stimmbruch verzerrte Stimme mehrmals überschlug.
„Makroskopische Objekte“, äffte ihn eine Schülerin nach.
Einige kicherten. Andere, zu denen die Norton-Zwillinge gehörten, bedachten Luk mit Namen wie Schlaufurz oder Klugscheißer. Nelson beobachtete, wie Luk sich auf seinem Stuhl versteifte. Das Mädchen, eine blondzopfige Brillenträgerin mit lila Strickjacke, beugte sich zu ihrer Nachbarin und flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin diese laut losgackerte.
„Ich muss doch bitten!“, schritt Professor Winkeleisen ein und klopfte aufs Pult. „Was uns Luk sagen will: Die Gesetze der Physik weisen in die Zukunft. Oder anders ausgedrückt: Ein Glas, das einmal auf den Boden gefallen und zersprungen ist, kann nicht zurückspringen und sich wieder zusammensetzen.“
Die Brillenträgerin tuschelte noch immer.
„Also gut, Maria“, schritt Professor Winkeleisen ein, „Sie können uns sicher erläutern, weshalb auch die Gesetze der Logik einer Zeitreise in die Vergangenheit widersprechen.“
Die Brillenträgerin hörte abrupt auf zu lachen. Blut schoss ihr ins Gesicht, bis ihre Wangen den Farbton ihrer Strickjacke angenommen hatten.
„Nun“, beharrte Professor Winkeleisen und wandte sich wieder der ganzen Klasse zu, „hat einer von Ihnen eine Idee?“
Nelsons Gedanken schweiften ab. Er wusste, was jetzt kam, und es langweilte ihn. Großvater-Paradoxon, Informations-Widerspruch, die Besucher-Theorie – das hatte er alles schon tausend Mal gehört oder gelesen, doch überzeugt hatte es ihn nie. Er merkte, wie sich Enttäuschung in ihm breit machte. Aber was hatte er denn erwartet? Dass sein Lehrer seine Auffassungen teilte und öffentlich behauptete: Ja, natürlich, Zeitreisen sind möglich? Selbst wenn Professor Winkeleisen davon überzeugt gewesen wäre, würde er schweigen. Denn nichts war so schlimm, wie sich unter Kollegen lächerlich zu machen. Widersprach eine solche Behauptung doch jeder gängigen Lehrmeinung. Dennoch: Selbst wissenschaftliche Thesen, das hatte Nelson schon früh gelernt, wurden ein ums andere Mal verworfen. Was gestern galt, war heute ungültig. So wie die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe und der Mittelpunkt der Welt. Trotzdem stellten die Gelehrten ihre neuen Erkenntnisse stets als unumstößliche Tatsache hin – bis der nächste kam und mit derselben Selbstsicherheit wieder das Gegenteil behauptete. Wenn sich Teenager vorwagten, um wissenschaftliche Thesen zu äußern, wurden sie gelobt und belächelt, auch das hatte Nelson mehr als einmal erfahren: gelobt für ihren Mut, das glatte Eis der Wissenschaften zu betreten – und belächelt dafür, dass sie allem Anschein nach darauf ausgerutscht waren. Niemand nahm Jugendliche wirklich ernst. Das war auf Burg Rosenstoltz, dem Internat für Hochbegabte, im Übrigen nicht anders. Hier wurden die Schüler zwar angehalten, eigene Meinungen zu äußern, aber Nelson hatte schon nach wenigen Wochen gemerkt, dass die Ansichten der Schüler vornehmlich nur deshalb dargelegt werden sollten, damit sie von den Professoren am Ende auseinandergepflückt werden konnten. Im Grunde ging es auch hier darum, Wissen zu vermitteln. Wissen aus Büchern. Wenn Schüler jedoch Fragen stellten, die über das Buchwissen hinausgingen, reagierten viele Lehrer mit kaum verhohlener Ungeduld. Sollte dann auch noch einer behaupten, jene Nuss geknackt zu haben, an der sich bereits die größten Denker aller Zeiten die Zähne ausgebissen hatten, war er bei den meisten unten durch. Bei den Lehrern genauso wie bei seinen Mitschülern.
Also schwieg Nelson und wartete weiter auf den Tag, an dem er das letzte Puzzlestück einfügen würde und seine Erfindung ...
„... wenn Nelson also, statt aus dem Fenster zu sehen, in die Vergangenheit reiste und dort verhinderte, dass sich seine Großeltern kennenlernen, womit er gleichzeitig seine eigene Geburt verhindern und sich der Möglichkeit berauben würde, in die Vergangenheit zu reisen, um zu verhindern, dass sich seine Großeltern kennenlernen ... Das nennen wir das Großvater-Paradoxon.“ Professor Winkeleisen grinste ihn verschmitzt an.
Einige Schüler lachten und Nelson spürte, wie er erneut rot wurde. Er sah hinüber zu Judith. Aber sie beachtete ihn nicht.
Professor Winkeleisen fuhr zur Klasse gewandt fort. „Oder stellen Sie sich vor, Sie sind ein glühender Verehrer Albert Einsteins, und Sie nutzen die Gelegenheit, ihn in der Vergangenheit aufzusuchen, um mit ihm über seine Relativitätstheorie zu diskutieren. Nur, Einstein ist gar nicht das Jahrhundertgenie, für das Sie ihn halten, sondern ein unbedeutender, ja einfältig wirkender Beamter in einem Schweizer Patentamt. Sie wundern sich. Sie stellen ihn auf die Probe. Sie zitieren aus seinen Werken, die Sie mitgenommen haben, um sie von Ihrem großen Idol signieren zu lassen. Und Einstein entpuppt sich als Schlitzohr: Er nimmt die Bücher an sich, gibt sie als die eigenen aus und streckt der Welt damit gleichsam die Zunge heraus. Denn von diesem Moment an ist er ja der, für den Sie ihn immer hielten. Sie wissen es nun zwar besser, aber mit diesem Wissen sind Sie vollkommen allein, denn Ihre Geschichte wird Ihnen niemand abnehmen. Paradoxie Nummer zwei nennen wir den Informations-Widerspruch.“
Nelson streckte sich unauffällig. Großvater-Paradoxon, Informations-Widerspruch ... Fehlte nur noch die Besucher-Theorie.
„Wen das noch nicht überzeugt hat“, fuhr Professor Winkeleisen fort, „dem sei Folgendes gesagt: Zeitreisen kann es schon aus einem ganz einfachen Grund nicht geben – wären wir sonst nicht ständig von Zeitreisenden umgeben? In der Gegenwart müsste es von Besuchern aus der Zukunft doch nur so wimmeln. Und das Schlimmste: Sie würden uns mit ihren Ratschlägen quälen, wie wir dieses oder jenes tun oder lassen sollen, denn sie wissen ja, welche Neuerungen sich durchsetzen werden – oh Gott, wäre das grässlich, sagen Sie doch selbst!“
„Und wenn die Ufos Zeitmaschinen sind?“, rief ein hagerer Bursche. „Schließlich gibt es etliche Berichte darüber. Ich erinnere nur an Roswell und ...“
„Dann wundert mich nur“, unterbrach ihn Professor Winkeleisen und sah seinen Schüler durchdringend an, „warum unsere Verwandten aus der Zukunft nicht aktiv geworden sind, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Sie hätten zum Beispiel Hitler verhindern und so Millionen Menschenleben retten können. Sie hätten uns einen Auto-Antrieb aus Wasserstoff schenken können, um unsere Luftverschmutzung zu stoppen. Und sie hätten uns an einer fortschrittlichen Technologie teilhaben lassen können, die jedem Menschen dieser Erde mindestens eine tägliche Mahlzeit und ausreichend Wasser beschert, auf dass niemand mehr verhungern oder verdursten müsste. Glauben Sie nicht, dass künftige Generationen solch segensreiche Erfindungen mit uns teilen würden?“
Wenn sie dazu in der Lage wären, dachte Nelson und blickte wieder hinaus.
Das Gewitter hatte sich endlich verzogen, und auch der Sturm schien sich allmählich zu legen. Die Landschaft aber wirkte noch immer wie in graue Farbe getunkt.
Gerade schritt Hausmeister Kunkel durch den Hof. Anscheinend inspizierte er die Dächer der Burg. Immer wieder schüttelte er den Kopf, als könnte er nicht fassen, was er da sah. Ein Fremder hätte bei seinem Anblick glauben müssen, dass der Schaden, den das Gewitter angerichtet hatte, schier unvorstellbar war. Nelson jedoch wusste wie jeder Schüler und jeder Lehrer dieser Schule, dass das Kopfschütteln zu Alois Kunkel gehörte wie sein ewiges Schlüsselgeklimpere. Für den Hausmeister von Burg Rosenstoltz schien die Welt eine einzige Aneinanderreihung von Katastrophen zu sein und Kunkels Stoßseufzer „Auch das noch!“ war unter den Internatsschülern längst ein geflügeltes Wort.
Kunkels Frau kam dazu und legte ihrem Mann einen Arm um die Schulter. Er schüttelte noch immer ungläubig den Kopf. Sie redete auf ihn ein, anscheinend jedoch ließ er sich nicht beruhigen. Schließlich nahm sie sein Gesicht in beide Hände und drückte ihm einen Kuss auf den Mund. Das saß.
Nelson zuckte zusammen, als sich plötzlich eine Hand auf seine Schulter legte. Professor Winkeleisen stand neben ihm und lächelte ihn an.
„Und, Nelson, wollen Sie nicht in die Pause?“
Erschrocken blickte sich Nelson um und stellte fest, dass das Klassenzimmer bis auf seinen Lehrer und ihn leer war.
„Sie erinnern mich an einen meiner ehemaligen Schüler“, bemerkte Professor Winkeleisen. „Ganz wie Sie. Tauchte hin und wieder einfach ab, und niemand konnte ihm folgen. Hoch intelligent und hoch sensibel. Interessierte sich ganz besonders für die Zeit oder besser für die Überwindung derselben. Stand eines Tages mitten im Unterricht auf und behauptete, dass Zeitreisen möglich seien. Stellen Sie sich das einmal vor!“
Nelson horchte auf. „Dass Zeitreisen möglich seien?“
„Ja doch! In die Zukunft genauso wie in die Vergangenheit! Von diesem Gedanken schien er wie besessen. Paradoxa haben ihn nicht interessiert. Auch Energieprobleme schien es für ihn nicht zu geben. Immerzu sprach er vom Licht. Das Licht sei der Schlüssel, mit dem man das Buch der Geschichte öffnen und darin eintreten könne. Levent war sehr poetisch, müssen Sie wissen. Seine Mitschüler haben ihn ausgelacht. Und was macht er? Packt eines Tages seine Schultasche und geht. Mitten im Unterricht! Am nächsten Morgen dann“, Professor Winkeleisen schnippte in die Luft, „ist er plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt! Die Polizei sucht jeden Winkel der Burg ab, befragt jeden unserer Schüler und jeden einzelnen Lehrer. Doch niemand hat Levent gesehen. Niemand hat irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt. Tage vergehen, was sag ich, Wochen, in denen die Angst wächst und die Hoffnung schwindet. Levent ist, war, Waise, müssen Sie wissen. Und die einzigen Verwandten, die die Polizei seinerzeit ausfindig machen konnte, hatten ihn noch nie im Leben gesehen.“ Er seufzte. „Was soll ich sagen: Levent blieb verschwunden – bis zum heutigen Tag. Zwei Jahre ist das jetzt her. Einige glauben, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Andere, dass er sich womöglich etwas angetan hat. Gott bewahre!“ Professor Winkeleisen schüttelte sich. „Wenn da nicht dieser seltsame Hinweis gewesen wäre ...“
„Was für ein Hinweis?“
Sein Lehrer seufzte. „In einem seiner Schulhefte fand sich eine Notiz. Sie ist oft zitiert worden, weshalb ich mich an ihren Wortlaut noch genau erinnere: Sollte ich jemals zurückkehren, werde ich jünger als ein Säugling sein und älter als ein Greis. Merkwürdig, nicht wahr?“
3
Ein, aus. Ein, aus. Ein ... Atme, verdammt, atme! Solange du atmest, wirst du leben.
Er versuchte sich darauf zu konzentrieren – ein, aus, ein, aus – gegen die Angst zu atmen, die auf seine Brust drückte, schwer wie ein Block aus Blei, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die dumpfe Traurigkeit, dass er all das, was ihm lieb war, durch eine Gedankenlosigkeit verloren hatte.
Irgendetwas kroch über sein Bein. Eine Ratte, dachte er, aber der Gedanke schreckte ihn nicht – im Gegenteil – eine Ratte war ein lebendiges Wesen inmitten dieser endlosen Nacht aus Tod und Verwesung. An dem Gestank glaubte er manchmal ersticken zu müssen. Aber anscheinend gab es in dieser fäulnisgeschwängerten Luft doch noch einen Rest Sauerstoff, der ihn am Leben hielt.
Sie hatten es nicht dabei belassen, ihn am Bein festzuketten, sondern ihm auch die Arme auf den Rücken gebunden, sodass er sich noch nicht einmal kratzen konnte.
Das Schlimmste jedoch in diesem stinkenden, feuchten Loch
war die Finsternis. Er hatte keine Vorstellung davon gehabt, wie dunkel die Welt sein konnte! Kein Schimmer drang in dieses unterirdische Verlies, nicht ein Hauch von Licht. Er hätte seine Hand auch dann nicht gesehen, wenn er sie ganz nah an sein Auge hätte halten können. Genauso musste es sich anfühlten, wenn man blind war!
Das Einzige, was er außer dem Gestank und der Dunkelheit wahrnahm, war von Zeit zu Zeit ein leises Wimmern. Es wehte von weit her an sein Ohr.
Nur einmal war er plötzlich überzeugt gewesen, dass es ganz nah war, dass jene Kreatur, die in ihrem Schmerz nicht an sich halten konnte, vielleicht sogar in einem angrenzenden Kerker lag, wie er selbst festgekettet an einen Eisenring im nackten Fels. Hatte man sie gefoltert? Oder ließ man sie qualvoll verdursten? Sie weinte wie ein wundes Kind, und ihr Leid ließ ihn sein eigenes nur umso schlechter ertragen.
Er hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren. Er wusste weder, wie lange er schon in diesem Loch vor sich hin vegetierte, noch ob es Tag oder Nacht war. Wie lange er nichts mehr gegessen oder getrunken hatte, konnte er nur ahnen. Lange genug jedenfalls, um keinen Hunger mehr zu empfinden. Da, wo einmal sein Magen gewesen war, klaffte nur noch ein Loch.
Der Durst hingegen quälte ihn in jeder Sekunde: seit jenem Moment, da sie ihn hier rein gestoßen und festgekettet hatten wie einen Hund. Der Durst brannte in seiner Kehle, die trocken war wie Staub und ihm das Schlucken unmöglich machte. Mehr als einmal hatte er versucht, den nackten Fels abzulecken, aber danach war es ihm nicht besser gegangen. Er konnte kaum noch an etwas anderes denken als an Wasser. In seiner Vorstellung tauchte er in einen Fluss, stand unter einem Wasserfall oder badete in eiskalter Cola. Einmal hatte er sich sogar die Lippe aufgebissen, um an seinem eigenen Blut zu saugen, aber das hatte seinen Durst noch verstärkt. Übriggeblieben war der metallische Geschmack in seinem Mund.
Atme, befahl er sich, atme, verdammt! Und so atmete er: ein, aus, ein, aus. Gegen die Angst zu verdursten. Gegen die Angst, in dieser Finsternis verrückt zu werden. Und gegen die Angst, sie könnten zurückkommen und ihm beide Augen ausstechen, wie sie es bei dem Alten gemacht hatten: mit einem glühenden Spieß und einem eiskalten Grinsen.
4
Nelson lag auf der Seite und starrte in das schwarze Nichts, das ihn umgab. Sein Zimmernachbar Gottfried war schon vor Stunden eingeschlafen und gab seit einigen Minuten schlürfende und schmatzende Geräusche von sich. Vielleicht lutschte er im Traum an einem Schnuller.
Nelson drehte sich auf die andere Seite. Professor Winkeleisens Worte gingen ihm nicht aus dem Kopf. Oder besser die Worte jenes Schülers, der eines Nachts beschlossen hatte, ohne Abschied von hier zu verschwinden.
Sollte ich jemals zurückkehren, werde ich jünger als ein Säugling sein und älter als ein Greis.
In den vergangenen Stunden hatte Nelson hin und her überlegt, was der Junge, den sein Lehrer Levent genannt hatte, damit gemeint haben konnte.
Vielleicht war der Satz ein Zitat. Aus einem Buch oder einem Film, den Nelson nicht kannte. Er klang wie ein Rätsel. Der Teil eines Ganzen. Womöglich hatten die seltsamen Worte überhaupt nichts mit dem Verschwinden des Jungen zu tun. Oder hatte sich der hochintelligente und hochsensible Waisenjunge bloß furchtbar einsam gefühlt und wollte sich mit seiner kryptischen Ankündigung vor allem interessant machen? War Levent ein Philosoph, der sich auf eine Erkenntnisreise begeben hatte? Oder ein Spinner? Möglicherweise beides. Oder schlicht ein Spaßvogel, der eines Tages auf die Idee verfallen war, die Welt an der Nase herumzuführen.
Nelson hatte alle möglichen Gedanken in seinem Hirn gewälzt, hin und her, her und hin. Nur um am Ende immer wieder zu jener Erklärung zurückzukehren, die zwar die unwahrscheinlichste von allen war, gleichzeitig aber auch die nächstliegende: Levent hatte seinen, Nelsons, Traum verwirklicht und war in die Zeit gereist! In die Vergangenheit oder in die Zukunft. Da er nicht sicher war, ob er jemals zurückkehren würde, hatte er seinen eigenen Nachruf hinterlassen, den zu deuten jedoch selbst den Professoren nicht gelang.
Nelson stellte sich vor, wie es Levent in diesem Moment ergehen mochte: Vielleicht floh er gerade vor einer Horde ausgehungerter Neandertaler. Oder er half als Arbeitssklave beim Bau der Cheopspyramiden. Oder er bot sich seinen eigenen Großeltern als Babysitter an, um mit jenem Jungen, der einst sein Vater werden würde, Cowboy und Indianer zu spielen. Das weite Spektrum der Möglichkeiten umfasste selbst eine, die Nelson selbst oft durchgespielt hatte: Danach befand sich Levent in diesem Moment möglicherweise in einer Zeitschleife, aus der er sich durch eigene Anstrengung nicht befreien konnte und nur deshalb verschwunden blieb.
Entsetzlich war vor allem ein anderer Gedanke – dass der Schüler, den sein Lehrer Levent genannt hatte, gar nicht mehr lebte: Ein blutrünstiger Urmensch hatte ihn mit seiner Keule erschlagen. Oder sein zerschmettertes Skelett ruhte unter einem der gewaltigen Steinquader von Gizeh, weil sich kurz vor Vollendung der Pyramiden ein furchtbares Unglück ereignet hatte. Oder ...
Nelson schreckte hoch. Er wischte alle düsteren Bilder beiseite, sog die Lungen voll Luft und atmete langsam aus.
Nein, Levent lebte! Und er würde ihn aufspüren!
Der Gedanke war plötzlich da. Er, Nelson, musste den fremden Jungen retten. Denn er fühlte sich ihm auf eine seltsame Weise verbunden. Was nicht bloß mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Zeit und die Reise ins Ungewisse zu tun hatte.
Da war noch etwas anderes.
Obwohl sie sich niemals kennengelernt hatten, war Nelson sicher, in Levents Gedankenwelt eintauchen zu können und darin einen Hinweis zu entdecken, der allen anderen verborgen geblieben war.
Bislang wusste er allerdings ziemlich wenig. Eigentlich nur, dass der fremde Junge ein Waisenkind und bei seinem Verschwinden in etwa so alt gewesen war wie Nelson derzeit.
Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf: In jeder Lehranstalt gab es doch Jahrbücher mit biografischen Angaben und den Porträts der Schüler samt ihren Abschlüssen! Zumindest war das in den USA so, wo Nelson ein Jahr zugebracht hatte. Und wenn es kein Jahrbuch gab, dann doch zumindest Bewerbungsunterlagen oder Zwischenzeugnisse, Beurteilungen, Krankenakten, irgendetwas.
Und was war überhaupt aus Levents Sachen geworden, die er in der Burg zurückgelassen hatte? Seine Bücher, seine Hefte, seine Klamotten, sein persönlicher Besitz? Er konnte doch unmöglich alles eingepackt haben und damit unbemerkt verschwunden sein. Unwahrscheinlich, dass irgendwer einen