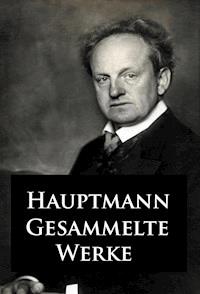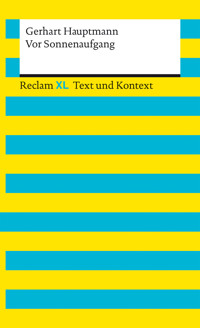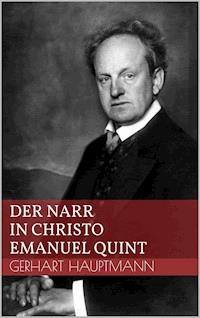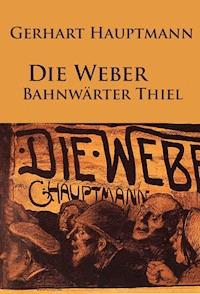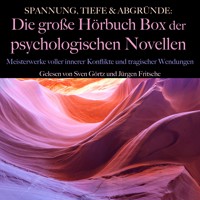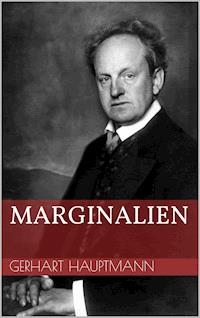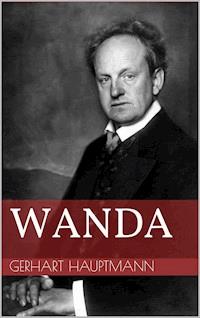0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Dr. Friedrich von Kammacher ist am Ende. Sein bester Freund ist tot, seine Ehefrau dem Wahnsinn verfallen, und seine wissenschaftliche Reputation durch Eigenverschulden zerstört. Da er nichts mehr zu verlieren wähnt, schifft er sich auf das nächste Boot nach Amerika ein. An Bord kann er auch das Ziel seiner Begierde im Auge behalten: Eine 16-jährige Tänzerin, der er verfallen ist. Die Schiffsreise wird keine Vergnügungsfahrt. Aufgerieben zwischen den alten Ansichten eines im Verfall begriffenen Europas und der Hoffnung auf die "Neue Welt" entstehen Spannungen zwischen den verschiedenen, zusammengepferchten Passagieren. Mitten auf dem Ozean kommt es zu einer schweren Kollision mit einem Schiffswrack. Unter den Passagieren entsteht Panik. Wer kann sich retten? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Atlantis
Roman
Gerhart Hauptmann
Atlantis
Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-72-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Buch 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Buch 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zuerst erschienen: 1912
Buch 1
1
Der deutsche Post- und Schnelldampfer »Roland« verließ Bremen am 23. Januar 1892. Er war eines der älteren Schiffe der Norddeutschen Schiffahrtsgesellschaft unter denen, die den Verkehr mit New York vermittelten.
Die Bemannung des Schiffes bestand aus dem Kapitän, vier Offizieren, sechs Maschinisten, einem Proviant- und einem Zahlmeister, einem Proviant- und einem Zahlmeister-Assistenten, dem Obersteward, dem zweiten Steward, dem Oberkoch und dem zweiten Koch und schließlich dem Arzt. – Außer diesen Leuten, denen das Wohl des gewaltigen schwimmenden Hauses anvertraut war, waren Matrosen, Stewards, Stewardessen, Küchengehilfen, Kohlenzieher und andere Angestellte an Bord, mehrere Schiffsjungen und eine Krankenpflegerin.
Das Schiff führte von Bremen aus nicht mehr als hundert Kajütpassagiere. Das Zwischendeck war mit etwa vierhundert Menschen belegt.
Auf diesem Schiff wurde für Friedrich von Kammacher von Paris aus telegraphisch ein Kajütplatz belegt. Eile tat not. Der junge Mann mußte, kaum anderthalb Stunden, nachdem ihm ein Platz gesichert war, den Schnellzug besteigen, mit dem er dann gegen zwölf Uhr nachts in Le Havre anlangte. Von hier aus trat er die Überfahrt nach Southampton an, die ohne Zwischenfall vor sich ging und die er in der Koje eines schrecklichen Schlafsaales verschlief.
Bei Morgengrauen war er an Deck, als die Küsten Englands sich, einigermaßen gespenstisch, mehr und mehr annäherten, bis schließlich der Dampfer in den Hafen Southamptons einlief, wo Friedrich den »Roland« erwarten sollte.
Im Schiffsbüro sagte man ihm, es liege am Kai ein kleiner Salondampfer zur Abfahrt bereit, die dann erfolge, sobald der »Roland« draußen gesichtet werde. Man empfahl Herrn von Kammacher, sich gegen Abend mit Sack und Pack auf ebendiesem Salondampferchen einzufinden.
Er hatte nun viele müßige Stunden vor sich, in einer fremden und öden Stadt. Dabei war es kalt, zehn Grad unter Null. Er entschloß sich, ein Gasthaus aufzusuchen und, wenn irgend möglich, einen beträchtlichen Teil der Zeit zu verschlafen.
In einem Schaufenster sah er Zigaretten von Simon Arzt in Port Said ausgelegt. Er ging in den kleinen Laden, den gerade eine Magd auskehrte, und kaufte mehrere hundert Stück davon.
Dies war eigentlich mehr ein Akt der Pietät, als daß er besondere Raucherfreuden gesucht hätte.
Friedrich von Kammacher trug ein Portefeuille aus Krokodilshaut in der Brusttasche. Dieses Portefeuille enthielt, unter andren Papieren, auch einen Brief, den Friedrich vor kaum vierundzwanzig Stunden erhalten hatte. Er lautete so:
Lieber Friedrich!
Es hat nichts geholfen. Ich bin aus dem Sanatorium im Harz als ein verlorener Mann in das Haus meiner Eltern zurückgekehrt. Dieser verfluchte Winter im Heuscheuergebirge! Ich hätte nicht sollen nach meiner Rückkehr aus tropischen Gegenden gleich einem solchen Winter in die Klauen geraten. Das Schlimmste war allerdings der Pelz meines Kollegen, dieses verfluchte Möbel, das der Oberteufel in der Hölle besonders verbrennen soll und dem ich den ganzen Hundejammer verdanke. Lebwohl! Ich habe mich natürlich auch mit Tuberkulin spritzen lassen und daraufhin beträchtlich Bazillen gespuckt. Enfin: es sind noch genug zurückgeblieben, um mir den baldigen Exitus letalis zu gewährleisten.
Nun aber das Wesentliche, mein guter Freund. Ich muß meinen Nachlaß regeln. Da finde ich nun, ich schulde Dir dreitausend Mark. Du hast es mir seinerzeit ermöglicht, mein ärztliches Studium zu vollenden, das mich nun allerdings recht elend im Stiche läßt. Doch dafür kannst Du natürlich nichts, und es ist auch kurios genug, daß jetzt, wo alles verloren ist, mich gerade die schlimme Erkenntnis besonders quält, Dir leider gar nichts vergelten zu können. – Sieh mal: mein Vater ist ein städtischer Hauptlehrer, der seltsamerweise etwas erspart, aber dafür auch, ohne mich, fünf unversorgte Kinder hat. Er betrachtete mich als sein Kapital und wandte an mich beinahe mehr, als zulässig war, in der Hoffnung auf reichliche Zinsen. Heute sieht er, als praktischer Mann, Kapital und Zinsen verloren.
Kurz, er ängstet sich vor Verbindlichkeiten, die leider nicht mit mir hinübergehen in die – pfui! pfui! pfui! (dreimal ausspucken!) – bessere Welt. Was soll ich tun? Würdest Du auf die Rückzahlung meiner Schuld verzichten können?
Übrigens war ich schon einige Male fast hinüber, alter Freund. Und es bleiben für Dich Aufzeichnungen über den Verlauf solcher Zustände, die vielleicht wissenschaftlich nicht ohne Interesse sind. Sollte es mir, nach dem großen Moment, aus dem Jenseits irgend möglich sein, mich bemerklich zu machen, so hörst Du später noch mehr von mir.
Wo bist Du eigentlich? Lebewohl! In den fulminanten Orgien meiner nächtlichen Träume schaukelst Du nämlich immer auf hoher See. Willst Du vielleicht auch Seereisen machen?
Es ist Januar. Liegt nicht wenigstens ein gewisser Vorteil darin, wenn man das Aprilwetter nicht mehr zu fürchten braucht? – Ich drück’ Dir die Hand, Friedrich Kammacher!
Dein Georg Rasmussen
Diesen Brief hatte der Empfänger von Paris aus sogleich telegraphisch beantwortet, in einem Sinne, der dem heroisch sterbenden Sohn die Sorge um seinen gesunden Vater vom Herzen nahm.
Im Reading-room von Hofmanns Hotel am Hafen schrieb Friedrich die Antwort für den sterbenden Freund:
Lieber Alter!
Meine Finger sind klamm. Ich tauche eine geborstene Feder unermüdlich in schimmelige Tinte. Wenn ich aber nun nicht schreibe, so kannst Du früher als in drei Wochen von mir keine Nachricht erhalten: denn ich gehe heut abend an Bord des »Roland« von der Norddeutschen Schiffahrtsgesellschaft.
Deine Träume scheinen mir wirklich nicht ohne zu sein, denn es ist ganz ausgeschlossen, daß Dir jemand von meiner Seereise etwas verraten haben kann. Zwei Stunden, bevor Dein Brief mich erreichte, wußt’ ich ja selbst noch nichts davon.
Übermorgen jährt sich der Tag, wo Du nach Deiner zweiten Weltreise direkt von Bremen zu uns in die Heuscheuer kamst, einen Sack voll Geschichten, Photographien und die Zigaretten von Simon Arzt mitbrachtest. Ich hatte kaum den Boden Englands betreten, als ich unsere geliebte Marke, zwanzig Schritt weit vom Landungsplatz, im Schaufenster fand. Natürlich kauft’ ich sie, und zwar sogleich massenweise, und rauche sogar eben eine zur Erinnerung. Leider wird der entsetzliche Reading-room, in dem ich schreibe, nicht wärmer davon.
Vierzehn Tage warst Du bei uns, da pochte in einer Winternacht an meine Haustür das Schicksal an. Gleich stürmten wir beide vor die Türe, und da haben wir uns erkältet, wie es scheint. Was mich betrifft, so habe ich heut mein Haus verkauft, meine Praxis aufgegeben, meine drei Kinder in Pension geschafft; und was meine Frau betrifft, so wirst Du ja wissen, was über sie hereingebrochen ist.
Teufel nochmal! es ist manchmal hübsch gruselig, zurückzudenken. Es war uns beiden doch eigentlich recht, als Du die Vertretung unseres kranken Kollegen bekamst. Ich sehe Dich noch in seinem Fuchspelz und Schlitten auf der Praxis herumgondeln. Und als er starb, da hatte ich eigentlich nichts dagegen, Dich als biederen Landarzt in unmittelbarer Nähe ansässig zu sehen: obgleich wir uns über eine solche Landarzt-Hungerpraxis von jeher gehörig lustig machten.
Nun, alles ist recht sehr anders gekommen.
Weißt Du noch, mit welcher Monotonie wir unsere Witze über die Goldammern machten, die damals scharenweise in die verschneite Heuscheuer einfielen? Man näherte sich einem kahlen Strauch oder Baum, und plötzlich war’s, als ob er sich schüttelte und zahllose goldene Blätter um sich stäubte und abwürfe. Wir deuteten das auf Berge von Gold. – Des Abends speisten wir dann auch Goldammern, weil sie von Sonntagsjägern in Menge angeboten und von meiner schnapsfrohen Köchin vorzüglich gebraten wurden. Du schwurest damals, Du bliebest nicht Arzt, außer der Staat stelle Dir die Vorräte eines riesigen Magazins zur Verfügung, arme Kranke mit Mehl, Wein, Fleisch und allem Nötigen zu versorgen. Und nun hat Dir dafür der böse Dämon der Ärztezunft was ausgewischt. Aber Du mußt mir wieder gesund werden!
Ich reise jetzt nach Amerika. Warum? das wirst Du erfahren, wenn wir uns wiedersehen. Ich kann meiner Frau, die bei Binswanger ist, also in ausgezeichneter Pflege, nichts mehr nützen. Ich habe sie vor drei Wochen besucht. Sie hat mich nicht einmal wiedererkannt. – Im übrigen habe ich mit dem Ärzteberuf, auch mit der bakteriologischen Forschung, tatsächlich abgeschlossen. Du weißt, es ist mir ein Unglück passiert. Mein wissenschaftlich geachteter Name ist ein bißchen schlimm zerzaust worden. Es wird behauptet, ich hätte statt des Milzbranderregers Fäserchen im Farbstoff untersucht und in meiner Arbeit beschrieben. Es kann ja sein, doch ich glaube es nicht. Schließlich und endlich ist es mir gleichgültig.
Ich bin mitunter recht angewidert von den Hanswurstiaden dieser Welt: dadurch fühle ich mich dem englischen Spleen sehr nahegerückt. Beinahe die ganze Welt, jedenfalls aber Europa ist für mich eine stehengebliebene kalte Schüssel auf einem Bahnhofsbüfett, die mich nicht mehr reizt.
Doktor Friedrich von Kammacher gab diesem Brief einen herzlichen Abschluß, adressierte und überreichte ihn einem deutschen Hausknecht zur Beförderung. Hierauf stieg er in sein Zimmer hinauf, dessen Fenster gefroren waren, und legte sich bei eisiger Temperatur in ein großes, frostiges Doppelbett hinein.
Der Zustand eines Reisenden, der eine nächtliche Überfahrt hinter sich hat und im Begriffe steht, die Reise über den Ozean anzutreten, ist an sich nicht beneidenswert. Allein die Verfassung, in der sich der junge Arzt befand, enthielt ein Wirrsal von schmerzlichen, zum Teil einander bekämpfenden Erinnerungen. Sie traten vor sein Bewußtsein, einander verdrängend, in einer unablässigen Jagd. Er wäre gern eingeschlafen, um für die kommenden neuen Dinge ein wenig gestärkt zu sein, aber er sah, mit offenen Augen oder die Lider darüber deckend, alles in gleicher Helligkeit.
Sein Leben hatte sich durch ein Jahrzehnt, vom zwanzigsten bis zum dreißigsten Jahr, auf bürgerliche Weise entwickelt. Eifer und große Befähigung in seiner besonderen Wissenschaft trugen ihm die Protektion großer Lehrer ein. Er war Assistent bei Koch gewesen. Aber auch bei dessen Gegner Pettenkofer in München hatte er eine Reihe von Semestern zugebracht.
So kam es, daß er, sowohl in München als in Berlin, auch sonst in Kreisen der bakteriologischen Wissenschaft, als einer der fähigsten Köpfe galt, dessen Karriere eigentlich nicht mehr in Zweifel stand. Höchstens trug ihm eine gewisse Neigung zur Schöngeisterei bei den trockenen Herren Kollegen hie und da leise-bedenkliches Kopfschütteln ein.
Heut, nachdem die verunglückte Arbeit Friedrich von Kammachers erschienen war und das große Fiasko erlitten hatte, hieß es in Fachkreisen allgemein: Zersplitterung durch Nebeninteressen hätte den jungen, hoffnungsvollen Geist zur Selbstvernichtung geführt.
Friedrich war eigentlich nach Paris gereist, um eine Leidenschaft loszuwerden, aber ihr Gegenstand, die sechzehnjährige Tochter eines Mannes aus der Artistenwelt, hielt ihn fest. Seine Liebe war eine Krankheit geworden, und diese Krankheit hatte deshalb vielleicht einen so hohen Grad erreicht, weil der Befallene nach den trüben Vorfällen jüngst vergangener Zeit für das Gift der Liebe besonders empfänglich war.
Das geringe Gepäck Doktor von Kammachers deutete nicht auf eine sorgfältig vorbereitete Seereise. Der Entschluß dazu wurde in einem Verzweiflungsrausche gefaßt oder eigentlich mehr durch einen leidenschaftlichen Ausbruch erzwungen: als die Nachricht kam, der Artist und seine Tochter hätten sich am dreiundzwanzigsten Januar in Bremen auf dem Post- und Schnelldampfer »Roland«, mit dem Ziel New York, eingeschifft.
2
Der Reisende hatte nur etwa eine Stunde bekleidet im Bett gelegen, als er aufstand, sich, nachdem er das Eis des Waschkruges eingeschlagen, ein wenig wusch und in die unteren Räume des kleinen Hotels hinunterstieg. Im Reading-room saß eine jugendlich-hübsche Engländerin. Ein weniger hübscher und weniger junger israelitischer Kaufmann trat herein, der sich bald als Deutscher entpuppte. Die Öde der Wartezeit bewirkte die Annäherung. Der Deutsche war in Amerika ansässig und wollte mit dem »Roland« über den großen Teich dorthin zurück.
Die Luft war grau, das Zimmer kalt, die junge Dame schritt unruhig auf und ab, an dem ungeheizten Kamin vorüber, und das Gespräch der neuen Bekannten verlor sich bald in Einsilbigkeit.
Die Zustände eines unglücklich Liebenden sind für seine Umgebung entweder verborgen oder lächerlich. Ein solcher Mensch wird abwechselnd von lichten Illusionen verzückt oder von dunklen gefoltert. Ruhelos trieb es den jungen Narren der Liebe trotz Wind und Kälte ins Freie hinaus und durch die Straßen und Gassen des Hafenstädtchens. Er dachte daran, wie ihn sein Landsmann andeutungsweise nach dem Zweck seiner Reise ausgeforscht und wie er selber, nicht ohne Verlegenheit, einiges hatte vorbringen müssen, um nur mit seinem geheimen Zweck nicht preisgegeben zu sein. Von jetzt ab würde er sagen, beschloß er bei sich, falls etwa wiederum Frager sich zudrängten, er reise hinüber, um den Niagara und den Yellowstone-Park zu sehen und dabei einen Studienfreund zu besuchen.
Während des schweigsamen Mittagessens im Hotel wurde bekannt, daß der »Roland« wahrscheinlich bereits gegen fünf bei den Needles eintreffen werde. Nachdem Friedrich mit seinem neuen Bekannten, der für sein eigenes Geschäft in der Konfektionsbranche reiste, Kaffee getrunken und einige Zigaretten von Simon Arzt geraucht hatte, begaben sich beide Herren, mit allem Gepäck, auf den Salondampfer, der übrigens seinem pompösen Titel durchaus nicht entsprach.
Hier gab es nun einen stundenlangen, höchst ungemütlichen Aufenthalt, während der niedrige Schornstein schwarzen Qualm in den schmutzigen gelben Nebel, der alles bedrückte, aufsteigen ließ. Von Zeit zu Zeit klang die Schaufel des Heizers aus dem Maschinenraum. Nach und nach kamen fünf oder sechs Passagiere, alle recht schweigsam, mit ihren Gepäckträgern. Die Kajüte des Tenders lag über Deck. Im Innern, unter den Fenstern – eigentlich war der Raum ein Glaskasten –, lief eine Bank mit roten Plüschpolstern.
Keiner der Reisenden hatte Ruhe genug, sich irgendwo dauernd niederzulassen. Die Unterhaltung geschah in einem bänglichen Flüsterton. Drei junge Damen – die mittelste war jene junge Engländerin aus dem Reading-room – gingen unermüdlich hin und her, der ganzen Länge nach durch die Kajüte, mit bleichen Gesichtern und fortwährend tuschelnd.
»Ich mache die Reise hin und zurück schon zum achtzehnten Mal«, erklärte jetzt plötzlich ungefragt der Konfektionskaufmann.
Jemand erwiderte: »Leiden Sie an der Seekrankheit?«
»Ich bin«, gab der Konfektionär zurück, »und zwar jedesmal, kaum daß ich das Schiff betreten habe, eine Leiche.«
Endlich, nach langem, vergeblichem Warten, schien sich im Innern des Tenders und an seinem Steuer etwas vorzubereiten. Die drei Damen umarmten und küßten einander. Die mittelste, hübscheste, die aus dem Reading-room, blieb auf dem Schiffe zurück, die andern faßten Fuß auf der Kaimauer.
Aber das Tenderchen wollte noch immer nicht in Bewegung geraten. Endlich wurden die Trossen von den eisernen Ringen der Kaimauer losgemacht. Es gellte ein herzzerreißender Pfiff, und die Schraube begann, wie zur Probe, langsam das schwarze Wasser zu quirlen. Inzwischen war ringsum die Nacht, stockfinster, zur Herrschaft gelangt.
Im letzten Augenblick wurden Friedrich noch einige Telegramme überbracht. Seine Eltern wünschten ihm glückliche Reise. Sein Bruder hatte einige herzliche Worte aufgesetzt. Zwei andere Depeschen stammten die eine von seinem Bankier, die andere von seinem Rechtsanwalt.
Nun hatte der junge Doktor von Kammacher weder einen Freund noch einen Verwandten, nicht einmal einen Bekannten am Kai von Southampton zurückgelassen, und doch entstand, sobald er fühlte, wie das Tenderchen in Bewegung kam, ein Sturm in ihm. Er hätte nicht sagen können, ob es ein Sturm des Wehs, der Qual, vielleicht der Verzweiflung war oder ein Sturm der Hoffnung unendlichen Glücks.
Es scheint, daß der Lebensgang ungewöhnlicher Männer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in eine gefährliche Krise tritt. In einer solchen Krise werden angesammelte Krankheitsstoffe entweder überwunden und ausgeschieden, oder der Organismus, der sie beherbergt, unterliegt. Oft ist ein solches Unterliegen der leibliche Tod, zuweilen aber auch nur der geistige. Und wiederum eine der wichtigsten und für den Betrachter bewunderungswürdigsten Krisen ist die an der Wende des dritten und vierten Jahrzehnts. Schwerlich wird die Krise vor dem dreißigsten Jahre einsetzen, dagegen wird es öfter vorkommen, daß sie sich bis zur Mitte der dreißiger Jahre, ja darüber hinaus verzögert: denn es ist zugleich eine große Abrechnung, eine fundamentale Bilanz des Lebens, die man gerne solange als irgend tunlich lieber hinausschieben als etwa zu früh in Angriff nehmen wird.
Es würde nicht auszudrücken sein, in welchem Umfang Friedrich sein ganzes bisheriges Leben ins Bewußtsein trat, nachdem er den Boden Europas verlassen hatte. Im Lichte dieses äußeren Abschieds stand gleichsam ein ganzer Weltteil der eigenen Seele da: und zwar hieß es hier nicht auf Wiedersehen, sondern der Verlust war für immer besiegelt. Was Wunder, wenn in diesen Augenblicken Friedrichs ganzes Wesen, fast bis zur Haltlosigkeit, erschüttert schien.
3
Rings um den kleinen Dampfer preßte sich dicke Finsternis. Die Hafenlichter waren verschwunden. Die Nußschale mit dem gläsernen Pavillon fing beträchtlich zu schaukeln an. Dabei pfiff und heulte der Wind durch die Fugen. Zuweilen zwang er den kleinen Dampfer stillezustehen. Plötzlich schrie die Dampfpfeife mehreremal, und wiederum ging es mit irgendeinem Kurs weiter ins schwarze Dunkel vorwärts.
Das Klappern der Fenster, das Beben des Schiffskörpers, die gurgelnde, unterirdische Wühlarbeit des Propellers, verbunden mit den plärrenden, pfeifenden, heulenden Tönen des Windes, der das Schiff auf die Seite legte: dies alles zusammen erzeugte in den Reisenden einen Zustand äußerster Unbehaglichkeit. Immer wieder, als wenn es nicht aus noch ein wüßte, stoppte das Dampfboot, ließ den spitzen und gellenden Laut der Pfeife ertönen, den mitunter die wilde Bewegung des schwarzen Luftmeers so völlig erstickte, daß er nur noch wie das hilflose Hauchen einer heiseren Kehle klang – und ging dann mitunter rückwärts, mitunter vorwärts, bis es wiederum ratlos liegenblieb, vom Schwall der Wogen gedreht und emporgehoben, scheinbar verloren und versunken in ewiger Finsternis.
Mit einem Male erdröhnte es dann, quirlte das Wasser, ließ gewaltig zischende Dämpfe aus, pfiff, schrecklich und angstvoll, einmal, zweimal – Friedrich von Kammacher zählte siebenmal – und hatte plötzlich seine höchste Geschwindigkeit, als ob es dem Satan entlaufen wollte, – und jetzt, auf einmal, wandte es sich und lag vor einer gewaltigen Vision, unter einer Fülle von Licht.
Der »Roland« war bei den Needles angelangt und hatte sich vor den Wind gelegt. Im Schutze seiner mächtigen Breitseite schien das Dampferchen wie in einen taghell beleuchteten Hafen gelangt. Der Eindruck, den die überraschende Gegenwart des gewaltigen Ozeanüberwinders in Friedrich hervorbrachte, glich einem Fortissimo von höchster Kraft.
Noch nie hatte Friedrich vor der Macht des menschlichen Ingeniums, vor dem echten Geiste der Zeit, in der er stand, einen gleichen Respekt gefühlt wie beim Anblick dieser schwarz aus dem schwarzen Wasser steigenden riesigen Wand, dieser ungeheuren Fassade, die aus endlosen Reihen runder Luken Lichtströme auf eine schäumende Aue vor dem Winde geschützter Fluten warf.
Matrosen waren damit beschäftigt, an der Flanke des »Roland« die Fallreeptreppe herunterzulassen. Friedrich konnte bemerken, wie oben an Deck, wo sie mündete, zum Empfange der neuen Passagiere bereit, eine zahlreiche Gruppe uniformierter Schiffsbediensteter stand. Während nun jeder im Innern des kleinen Salondampfers, von plötzlicher Hast ergriffen, sich seines Gepäcks versicherte, beherrschte den jungen Arzt das ganze Ereignis mit der Kraft der Erhabenheit. Es war nicht möglich, angesichts dieser gigantischen Abenteuerlichkeit die Überzeugung von der Nüchternheit moderner Zivilisation aufrecht zu halten. Hier wurde jedem eine verwegne Romantik aufgedrängt, mit der verglichen die Träumereien der Dichter verblaßten.
Während das Tenderchen sich, kokett auf dem schwellenden Gischte tanzend, halb schwebend der Fallreeptreppe näherte, fing hoch oben an Deck des »Roland« die Musikkapelle zu konzertieren an. Es war eine flotte, entschlossene Marschweise, von jener kriegerischen und zugleich resignierenden Art, wie sie den Soldaten in den Kampf, das heißt zum Siege oder zum Tode führt. Ein solches Orchester von Blasinstrumenten, Becken, Trommeln und Pauke hatte nur noch gefehlt, um die Nerven des jungen Arztes gleichsam in einen feurigen Regen aufzulösen.
Es war nicht zu verkennen, daß diese Musik, die aus der Höhe in die Nacht und auf das manövrierende Tenderchen herunterscholl, mit der Absicht veranstaltet wurde, die Ängste zaghafter Seelen zu betäuben. Draußen lag der unendliche Ozean. – Man konnte nicht anders in einem solchen Augenblick, als ihn nächtlich und finster vorstellen! – eine furchtbare Macht, die dem Menschen und dem Werke des Menschen feindlich ist. Nun aber rang sich aus der Brust des »Roland«, von den Tiefen des Basses aufsteigend stärker und stärker ein ungeheurer Laut, ein Ruf, ein Gebrüll, ein Donner hervor, von einer Furchtbarkeit und Gewalt, die das Blut im Herzen stocken machte. Nun, lieber Roland, schoß es Friedrich durch den Sinn, du bist ein Kerl, der es mit dem Ozean aufnehmen wird. Damit stellte er seinen Fuß auf die Reeptreppe. Er hatte vergessen, was er bisher gewesen und weshalb er hierhergekommen war!
Als er unter den wilden Rhythmen der Bande die oberste Sprosse der Treppe erreicht hatte und endlich auf dem geräumigen Deck unter dem grellen Licht einer Bogenlampe stand, war er erstaunt, wie vielen vertrauenerweckenden Männergestalten er sich gegenüberbefand. Es war eine Sammlung prächtiger Menschen, vom Offizier bis zum Steward herab, alles große und auserlesene Leute, dazu von einem Gesichtsschnitt, der ebenso kühn als schlicht, ebenso klug als treuherzig anmutete. Friedrich von Kammacher sagte sich, daß es doch wohl noch etwas wie eine deutsche Nation gebe, und fühlte zugleich Stolz und vertrauende Sicherheit. Ja, eine der Stützen dieses Gefühls war die überaus sonderbare Meinung, die flüchtig in seiner Seele auftauchte, daß unser Herrgott sich niemals entschließen werde, eine solche Auslese edler und pflichtgetreuer Menschen wie junge Katzen im Meer zu ertränken.
Er wurde allein in einer Kabine zu zwei Betten untergebracht, und bald darauf saß er, aufs beste bedient, an dem einen Ende der hufeisenförmigen Tafel im Speisesaal. Man aß und trank, aber es ging, da das eigentliche Diner schon vorüber war, nicht sehr lebhaft zu in dem niedrigen, weiten, leeren Raume, unter der kleinen Gesellschaft der Nachzügler, weil jeder ermüdet und hinreichend mit sich selber beschäftigt war.
Während des Essens wurde es Friedrich schwer, sich vorzustellen, daß er nun wirklich auf der Fahrt nach Amerika, ja überhaupt auf einer Fahrt begriffen war. Das kaum bemerkliche leise Erbeben des Gebäudes, in dem er war, erschien zu gering, um als Begleiterscheinung einer Fortbewegung gedeutet zu werden. Es kam ihn, als er seiner Gewohnheit gemäß einige Gläser Wein zu sich genommen hatte, eine Empfindung ruhevollen Behagens an, ein wohliger Zustand der Erschöpfung. Wie wunderlich, dachte er, im sicheren Vorgefühl eines festen Schlafs, daß ich seit Wochen, ja Monden zum erstenmal gerade hier, auf diesem rastlosen Ozeandurchpflüger, Stunden der Ruhe und der Entspannung finden soll.
Er hatte denn auch zehn Stunden lang wie ein Kind in der Mutter Wiege geschlafen, als er die Augen wieder öffnete und immer noch etwas wie einen seligen Frieden empfand. Sein erster Gedanke war jenes Mädchen, das nun auf viele Tage und Nächte hinaus durch die gleiche geräumige schwimmende Herberge zu Leid und Freude mit ihm verbunden blieb. Friedrich streichelte über die Wände, die gleichsam ein leitendes Medium wurden, durch das er mit der Geliebten in Berührung kam und aus dem der lebendige Odem ihres Wesens in ihn einströmte.
Friedrich befand sich im Speisesaal, wo ihm das reichliche Frühstück serviert wurde, das er mit herzhaftem Appetit genoß. Ich habe geschlafen, sagte er sich, und wie in einer beliebigen Nacht im Zustande der Betäubung gelegen und bin dabei an zweihundert Meilen über den Atlantischen Ozean vorgedrungen. Wie eigentümlich, wie sonderbar!
Friedrich verlangte die Passagierliste, und als er darauf zwei Namen entdeckte, die zu finden er mit vollkommener Sicherheit voraussetzen mußte, schrak er zusammen, ward bleich und bekam Herzklopfen.
4
Sobald Friedrich von Kammacher die Namen Hahlström und Tochter gelesen hatte, faltete er die Liste zusammen und blickte sich um. Es mochten fünfzehn bis zwanzig Personen, Damen und Herren, im Saale versammelt sein, die alle mit Essen beschäftigt waren oder den Stewards ihre Frühstückswünsche kundgaben. Aber Friedrich kam es vor, als ob sie alle zu keinem anderen Zwecke da wären, als ihn zu belauern und zu beobachten.
Der Speisesaal nahm die ganze Breite des Schiffes ein, und seine Luken verfinsterten sich von Zeit zu Zeit durch Wogen, die sich dagegenwarfen. Friedrich gegenüber saß ein Herr in Schiffsuniform, der sich ihm als Schiffsarzt vorstellte. Es entwickelte sich sogleich ein Fachgespräch sehr lebhafter Art, trotzdem Friedrich nicht bei der Sache war. Er konnte nicht schlüssig darüber werden, wie er sich bei der ersten Begegnung mit Hahlströms verhalten sollte.
Er half sich durch einen Selbstbetrug, indem er sich sagte, daß er gar nicht der kleinen Hahlström wegen gekommen wäre, sondern daß er die Reise in die Neue Welt wirklich nur angetreten habe, um seinen besonders lieben Freund Peter Schmidt zu besuchen und New York, Chikago, Washington, Boston, den Yellowstone-Park und die Katarakte des Niagara zu sehen. Er wollte das auch den Hahlströms mitteilen und übrigens ihnen gegenüber den Zufall für diese sonderbare Begegnung verantwortlich machen.
Er merkte, wie er innerlich mehr und mehr an Haltung gewann. Die Idolatrie der Liebe nimmt im Zustand der Trennung von dem Idol zuweilen einen verhängnisvollen Umfang an. So hatte Friedrich während seines Aufenthaltes in Paris in einem Zustand beständigen Fiebers gelebt, und seine Sehnsucht war auf ein unerträgliches Maß gestiegen. Es hatte sich um das Bild der kleinen Hahlström ein Nimbus gelegt, der das innere Auge Friedrichs auf eine so zwingende Weise bewundernd auf sich zog, daß er für alles andere buchstäblich erblindete. Diese Illusion war plötzlich geschwunden. Er schämte sich, fand sich geradezu lächerlich, und wie er aufstand, um zum ersten Male hinauf an Deck zu gehen, war es ihm gar nicht anders zumut, als ob er sich aus engen drückenden Fesseln befreit hätte.
Dieses Gefühl der Freiheit und der Gesundung steigerte sich, als der salzige Luftzug oben ihm herzerfrischend ins Innere drang. Männer und Frauen lagen auf Klappstühlen in einem bedauernswürdigen Zustand ausgestreckt. Ihre Gesichter hatten den grünen Zug einer tiefen Gleichgültigkeit, und erst an diesen Erscheinungen merkte der junge Arzt, daß der »Roland« nicht mehr durchaus gelassen durch glattes Wasser glitt, sondern schon merklich rollte und stampfte. Zu seiner eigenen Verwunderung spürte Friedrich selber nicht das geringste von der gefürchteten Seekrankheit.
Er ging um den Damensalon herum, am Eingang einer Extrakabine vorüber und gab sich unterhalb der Kommandobrücke dem stählernen, salzigen Seewinde preis. Unter ihm, bis gegen die Spitze des Schiffes hin, hatten es sich die Passagiere des Zwischendecks bequem gemacht. Der »Roland«, der, wie es schien, mit Volldampf lief, gelangte trotzdem wohl kaum zur Entfaltung seiner vollen Geschwindigkeit. Die langen Wogenzüge, die der Wind ihm entgegenführte, hinderten ihn. Es war eine zweite Kommandobrücke, wahrscheinlich für den Notfall, über dem unteren Deck errichtet, und Friedrich fühlte angesichts des tanzenden Schiffes plötzlich die starke Verlockung, oben auf dieser leeren Brücke zu stehn.
Natürlich erregte er einiges Aufsehen, als er unter die Zwischendeckler hinab und dann auf eisernen Sprossen empor in die zugige Höhe der eisernen Brücke kroch und sich dort oben im Luftstrom aufstellte: aber das kümmerte ihn fürs erste nicht. Es war ihm auf einmal so toll, so erfrischt, so erneuert zumut, als ob er weder jemals Grillen gefangen noch unter den Launen einer nervenkranken Gattin gelebt noch im stockigen Winkel einer Provinz praktiziert hätte. Niemals hatte er, wie es ihm vorkam, Bakteriologie studiert, noch weniger damit Fiasko gemacht. Er war niemals auf eine solche Weise verliebt gewesen, wie es noch kurz vorher den Anschein gehabt hatte.
Er lachte, den Kopf vor dem starken und frischen Strome des Windes zurückgelehnt, sog gierig den salzigen Hauch und war genesen.
In diesem Augenblick scholl ein allgemeines wildes Gelächter vom Zwischendeck zu Friedrich herauf; gleichzeitig peitschte ihm etwas, das er weiß und gewaltig vor dem Bug des Schiffs hatte aufbäumen sehen, ins Gesicht, so heftig, daß er beinahe erblindete, und er fühlte, wie er, durchnäßt bis aufs Hemd, rieselnd von Wasser, im Luftzug stand. Die erste Welle war übergekommen.
Eben noch war ihm gewesen, als habe er das Wikingertum als den echten Beruf seines Lebens ausgefunden, und schon kroch er, innerlich fröstelnd und zitternd, unter allgemeinem Gelächter, die eiserne Leiter wieder hinab. Er hatte noch seinen grauen runden Hut, einen sogenannten Praliné, auf dem Kopf. Sein Paletot war innen gesteppt und mit Atlas gefüttert, er trug Glacés, elegante Stiefel aus dünnem Chevreauleder, mit Knöpfen daran. Alles dieses war jetzt mit kalter salziger Lauge getränkt worden. Die Passagiere des Zwischendecks, durch die er, hinter sich eine feuchte Spur lassend, einen nicht gerade rühmlichen Abzug nahm, krümmten sich. Mitten in seinem Ärger aber redete Friedrich eine Stimme an, die ihn sogar mit Namen nannte. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als er aufblickend einen Kerl aus der Heuscheuer zu erkennen glaubte, der wegen Trunks und allerlei Unredlichkeiten im übelsten Rufe stand.
»Wilke, sind Sie’s?« – »Jawohl doch, Herr Doktor.«
Wilke hatte einen Bruder in den New England States von Nordamerika, den er aufsuchen wollte. Er behauptete, die »Menschheit« in seiner Heimat sei niederträchtig und undankbar. Zu Hause scheu und mißtrauisch, sogar dem Arzt gegenüber, der ihm seine letzte Stichwunde am Hals behandelt hatte, ward er hier, mit andern auf den Wogen des großen Wassers schwimmend, offen und redselig wie ein gutgeartetes Kind.
»Sie haben auch keinen Dank gehabt, Herr Doktor«, sagte er schließlich in den breiten, vokalreichen Lauten seiner Mundart und zählte Friedrich eine Menge diesem unbekannt gebliebene Fälle auf, wo ihm Gutes durch üble Nachrede vergolten worden war. Er meinte, daß die von Plassenberg und Umgebung, wo Friedrich gewohnt und praktiziert hatte, solcher Leute, wie er und der Doktor seien, nicht würdig wären. Für solche Leute sei der rechte Platz im Lande der Freiheit, Amerika.
Zurückgekehrt auf das Promenadendeck, wurde Friedrich durch den blonden Kapitän des »Roland«, Herrn von Kessel, in höchsteigener Person gestellt. Er sagte ihm einige freundliche Worte.
Die Kabine, in der sich Friedrich umzog, war, nun das Schiff sich stärker bewegte, ein problematischer Aufenthalt. Eine runde, durch dickes Glas verschlossene Luke gab ihr das Licht. Sobald sich die Wand, in der sich die Luke befand, erhob und wie ein schräges Dach nach innen legte, fiel durch die Luke aus dem zerrissenen Himmel Sonnenlicht auf das gegenüberliegende, untere Mahagonibett; hier aber, auf dessen Kante sitzend, suchte sich Friedrich festzuhalten, den Kopf gebeugt – sonst stieß er an das obere Bett – und krampfhaft bemüht, die weichende Rückwärtsbewegung der Hinterwand nicht mitzumachen. Die Kabine befand sich im Turnus jener Bewegung, die man das Rollen nennt, und Friedrich mußte es manchmal vorkommen, als werde die Lukenwand zum Plafond und dieser zur rechten Seitenwand, dann wieder, als werde die Bettwand zum Plafond, hingegen dieser zur Lukenwand, wobei denn die wirkliche Lukenwand sich, als wollte sie ihn zum Aufspringen einladen, fast waagerecht vor seine Füße schob: ein Augenblick, in dem natürlich die Luke ganz unter Wasser und die Kabine verfinstert war.
Es ist nicht leicht, sich in einem Zimmer, das so in Bewegung ist, aus- und anzuziehen. Und darüber, daß es, seit er es vor einer Stunde verlassen hatte, so in Bewegung geraten konnte, war Friedrich einigermaßen erstaunt. Stiefel und Beinkleider aus dem Koffer nehmen oder über Füße und Beine ziehen, war hier eine turnerische Tätigkeit, so daß er unwillkürlich darüber ins Lachen geriet und Vergleichungen anstellte, woran sich sein Lachen immer erneuerte. Man kann nicht sagen, daß dieses Lachen von Herzen kam. Er sagte, ächzend und arbeitend, solche und ähnliche Worte zu sich: Hier wird meine ganze Persönlichkeit durchgeschüttelt. Ich irrte mich, als ich annahm, daß es während der letzten zwei Jahre schon geschehen sei. Ich dachte: dein Schicksal schüttelt dich. Nun werden mein Schicksal und ich geschüttelt. Ich glaubte, ich hätte Tragik in mir. Nun poltere ich mit meiner ganzen Tragödie in diesem knisternden Kasten umher und werde damit vor mir selbst entwürdigt. – Ich habe die Gewohnheit, über alles und jedes nachzudenken. Ich denke zum Beispiel über den Schiffsschnabel nach, der sich in jede neue Woge begräbt. Ich denke über das Lachen der Zwischendeckler nach, dieser ärmsten Leute, denen es, glaub’ ich, nicht locker sitzt und die es mir also als Wohltat verdanken! Ich denke über den Lump, den Wilke, nach, der zu Hause eine bucklige Nähterin geheiratet, um ihr Erspartes gebracht und täglich mißhandelt hat und den ich soeben beinahe umarmt hätte. Ich denke über den blonden, teutonischen, etwas weichlichen Kapitän von Kessel nach, diesen nur etwas zu gedrungenen schönen Mann, der überdies hier unser absoluter Herrscher und König ist und dem man vertraut auf den ersten Blick. Und schließlich denke ich über mein eigenes fortwährendes Lachen nach und gestehe mir, daß Lachen nur in den allerseltensten Fällen geistreich ist.
Auf solche und ähnliche Art und Weise setzte Friedrich sein inneres Zwiegespräch eine Weile fort, wobei auch jene Leidenschaft im Lichte der bittersten Ironie erschien, die ihn zu dieser Reise veranlaßt hatte. Er war nun wirklich vollkommen willenlos, und in diesem Zustand, im engen Käfig, auf hohen Wogen des Ozeans, schien es ihm, als werde ihm in derbster Form das Verfahren des Schicksals und seine eigene Ohnmacht vorgehalten.
Es war immer noch eine erhebliche Anzahl Menschen an Deck, als Friedrich oben wieder erschien. Man hatte die Liegestühle der Kranken oder Siestahaltenden an den Kajütenwänden festgemacht. Die Stewards boten Erfrischungen an. Es war nicht uninteressant zu sehen, wie sie mit sechs, acht vollen Limonadengläsern über das großartig schwingende Deck balancierten. Friedrich sah sich vergeblich nach Hahlström und Tochter um.
Nachdem er einige Zeit mit aller gebotenen Vorsicht hin und her die ganze Länge des Decks ausgemessen hatte, bemerkte er die hübsche Engländerin, die er zuerst im Reading-room des Hotels zu Southampton gesehen hatte. Sie hatte es sich mit Decken und Pelzwerk an einem gegen den Wind gedeckten Platz bequem gemacht, der durch den nahen Schornstein erwärmt wurde. Ein sehr beweglicher junger Mann saß neben ihr und machte den Ritter. Er sprang plötzlich auf und begrüßte Friedrich. Nun hatte dieser zwar den Namen des Jünglings, Hans Füllenberg, bis jetzt, wie er meinte, noch nicht gehört, aber der flotte junge Mensch wußte glaubhaft zu machen, daß er gemeinsam mit Friedrich in einer bestimmten Abendgesellschaft gewesen war. Er begab sich nach irgendeinem Eisenbergwerk-Distrikt in der Nähe von Pittsburg in Pennsylvanien.
5
»Wissen Sie denn, Herr von Kammacher«, sagte er plötzlich, »daß die kleine Hahlström ebenfalls hier auf dem Schiffe ist?«
»Was denn für eine Hahlström?«, fragte Friedrich.
Hans Füllenberg konnte sich gar nicht genug darüber wundern, daß Friedrich die kleine Hahlström vergessen habe. Er glaubte sich doch genau zu erinnern, Friedrich gesehen zu haben, als die kleine Hahlström im Künstlerhaus zu Berlin ihren Tanz getanzt hatte.
»Wenn Sie ihn nicht gesehen haben, Herr von Kammacher, so haben Sie wirklich viel versäumt«, sagte der junge berlinische Gentleman; »erstens hatte die kleine Hahlström, als sie erschien, sehr wenig an; dann aber war, was sie machte und vorführte, wirklich bewundernswert. Es herrschte darüber nur eine Meinung.
Man trug zuerst eine große künstliche Blume herein. Die kleine Hahlström lief auf die Blume zu und roch daran. Sie tat das mit geschlossenen Augen, nachdem sie vibrierend, wie mit den Flügelchen einer Biene, und geschlossenen Auges die Blume gesucht hatte. Plötzlich schlug sie die Augen auf und erstarrte zu Stein. Auf der Blume saß eine riesige Kreuzspinne. Nun floh sie in den entferntesten Winkel des Raums zurück. Schien es anfangs, als schwebe sie ohne Schwere über die Erde hin, so war die Art, wie das krasse Entsetzen sie nun durch den Raum geblasen hatte, noch mehr dazu angetan, sie als unwirklich erscheinen zu lassen.«
Friedrich von Kammacher hatte das Mädchen, außer bei jener Matinee im Künstlerhaus, achtzehnmal ihren furchtbaren Tanz tanzen sehen. Während der junge Füllenberg ihn mit »famos«, »großartig«, »kolossal« und ähnlichen Kraftworten herauszustreichen versuchte, erlebte er ihn bei sich wiederum. Er sah, wie sich der kindliche Körper, nachdem er eine Weile gezittert hatte, der Blume aufs neue annäherte, und zwar nach den Rhythmen einer Musik, die durch Tamtam, Becken und Flöte ausgeführt wurde. Diese zweite Annäherung geschah durch Zwang, nicht durch Lüsternheit. Die Tänzerin hatte das erstemal feine duftende Strömungen in der Luft als Spuren benutzt, die nach dem Quell des Aromas hinleiten konnten. Ihr Mund war dabei geöffnet geblieben. Die Flügelchen ihres Näschens hatten vibriert. Das zweitemal zog ein grausiges Etwas sie an, das ihr abwechselnd Furcht, Entsetzen und Neugier erregte, wobei sie die Augen weit offenhielt und nur manchmal, um nichts zu sehen, angstvoll mit beiden Händen bedeckte.
Alle Furcht aber schien sie mit einemmal abzustreifen. Sie hatte sich ohne Grund geängstigt und nun erkannt, eine unbewegliche dicke Spinne sei im Grunde für ein Geschöpf mit Flügeln nicht gefahrbringend. Und dieser Teil ihres Tanzes war von großer Anmut und drollig überquellender Lustigkeit.
Nun begann eine neue Phase des Tanzes, die sich nachdenklich einleitete. Die junge Tänzerin wollte sich, scheinbar in einem Zustande gesättigter Tanzlust, nach genossenem Blumenrausch mit Bewegungen wohliger Müdigkeit zur Ruhe begeben, als sie hier und da an ihrem Körper etwas wie Fäden eines Spinngewebes abstreifte. Dies war zuerst eine stillversonnene Tätigkeit, in die jedoch mehr und mehr eine sonderbare Unruhe kam, die sich allen Zuschauenden mitteilte. Das Kind hielt inne, dachte nach und wollte sich einer gewissen Besorgnis wegen, die ihm aufgestiegen war, anscheinend selbst auslachen. Im nächsten Augenblick aber erbleichte es und tat dann einen erschrockenen und sehr kunstvollen Sprung, als ob es aus einer Schlinge herauswollte. Der mänadisch geworfene Schwall ihres weißblonden Haars ward hierbei eine lodernde Flut und das Ganze ein Anblick, der Rufe der Bewunderung auslöste.
Die Flucht begann, und nun war das Thema des Tanzes – der übrigens unter dem Titel »Mara oder das Opfer der Spinne« ging – die Fiktion, als ob Mara mehr und mehr in die Fäden der Spinne verwickelt und schließlich darin erdrosselt würde.
Die kleine Hahlström befreite den Fuß und fand ihren Hals von der Spinne umschnürt. Sie griff nach den Fäden an ihrem Halse und fand ihre Hände eingeschnürt. Sie riß, sie bog sich, sie entschlüpfte. Sie schlug, sie raste und verwickelte sich nur immer mehr in die furchtbaren Fäden der Spinne hinein. Endlich lag sie zum Holz umschnürt, und man fühlte die Spinne ihr Leben aussaugen.
6
Da sich Friedrich von Kammacher nach der Meinung des jungen Füllenberg nicht hinreichend für die kleine Tänzerin Hahlström erwärmte, nannte er einige andere Berliner Berühmtheiten der jüngsten Zeit, die ebenfalls auf dem »Roland« die Reise nach den Vereinigten Staaten machten. Da war der Geheimrat Lars, ein in Kunstkreisen wohlbekannter Mann, der bei staatlichen Ankäufen von Werken der Malerei und der Plastik mitzusprechen hatte. Er ging nach Amerika, um dortige Sammlungen zu studieren. Ferner war Professor Toussaint da, ein bekannter Bildhauer, der in einigen deutschen Städten seine Denkmäler aufgestellt hatte, Werke von einem übel verwässerten berninischen Geist. Toussaint, erzählte Füllenberg, brauche Geld. Er brauche eigentlich jenes Geld, das seine Gattin verbraucht habe.
»Wenn er den Fuß auf amerikanischen Boden setzt«, meinte Hans Füllenberg, der mit dem gesellschaftlichen Klatsch Berlins gleichsam geladen war, »so hat er nicht so viel im Besitz, um auch nur die Hotelrechnung der ersten drei Tage zu begleichen.«
Fast im selben Augenblick, als Friedrich den Bildhauer, der, in einem Triumphstuhle liegend, die Bewegungen des »Roland« mitmachte, ins Auge faßte, wurde ein sonderbarer Mann ohne Arme von einem Burschen, der ihn am Rockkragen hielt, über Deck geführt und sorgfältig durch eine nahegelegene kleine Tür in das Rauchzimmer hineinbugsiert. »Es ist ein Artist«, erklärte der junge Berliner dem Arzte, »er wird in dem New-Yorker Varieté von Webster und Forster auftreten.«
Einige Stewards balancierten über das Deck, es wurde in großen Tassenköpfen heiße Bouillon an die fröstelnden Passagiere ausgegeben. Nachdem der junge Berliner seine Dame mit Brühe versorgt hatte, ließ er sie sitzen und begab sich mit Friedrich ins Rauchzimmer. Hier herrschte natürlich Lärm und Qualm, und auch die beiden Herren zündeten ihre Zigarren an. In einem Winkel des kleinen Raumes wurde Skat gedroschen, an mehreren Tischen in deutscher und englischer Sprache politisiert. Doktor Wilhelm, der Schiffsarzt, erschien, den Friedrich bereits beim Frühstück kennengelernt hatte. Er kam von der Morgeninspektion des gesamten Zwischendecks. Er nahm an Friedrichs Seite Platz. Zweihundert russische Juden waren im Zwischendeck, die nach den Vereinigten Staaten oder nach Kanada auswanderten. Dazu kamen dreißig polnische und ebensoviele deutsche Familien, diese sowohl aus dem Süden wie aus dem Norden und dem Osten des Reiches. Doktor Wilhelm lud den Kollegen ein, am folgenden Tage die Inspektionstour mitzumachen.
Der Ton in dem kleinen Rauchzimmerchen war der des Frühschoppens, wie er in Bierstuben üblich ist: das heißt, die Männer ließen sich gehen, und die Unterhaltungen wurden mit lauten Stimmen geführt. Auch entwickelte sich jener derbe Humor und jene geräuschvolle Lustigkeit, bei der den Männern die Zeit verfliegt und die sehr vielen eine Art Betäubung und somit eine Art des Ausruhens in der Hetze des Daseins ist. Friedrich sowohl als Doktor Wilhelm waren diesem Treiben nicht abgeneigt, das ihnen, aus ihren Studienzeiten gewohnt, Erinnerungen aller Art belebte und nahebrachte.
Hans Füllenberg fand sich sehr bald durch die Gesellschaft der beiden Ärzte gelangweilt, die seiner auch übrigens fast vergessen hatten, und schlich sich zu seiner Dame zurück. Er sagte zu ihr: »When Germans meet, they must scream, drink till they get tipsy and drink ›Bruderschaft‹ to each other.«
Doktor Wilhelm schien auf den Ton in diesem Rauchzimmer stolz zu sein. »Unser Kapitän«, erklärte er, »hält streng darauf, daß unsere Herren hier ungestört bleiben und die Gemütlichkeit keinen Abbruch erfährt. Mit anderen Worten, er hat es sich in den Kopf gesetzt, Damen unter keiner Bedingung zuzulassen!« – Der Raum hatte zwei metallene Türen, die eine nach Backbord, die andere nach Steuerbord. Wenn eine davon geöffnet wurde, so mußte der Gehende oder Kommende mit der Bewegung des Schiffes und dem Druck des herrschenden Windes jedesmal einen lebhaften Kampf bestehen. Gegen die elfte Stunde, wie täglich bei leidlichem Wetter um diese Zeit, stieg, in großer Ruhe, die massive Gestalt des Kapitäns von Kessel herein. Nachdem die üblichen Fragen nach Wind und Wetter, guten oder schlimmen Reiseaussichten einige freundliche, aber karge Antworten des Herrn Kapitäns gezeitigt hatten, nahm er am Tische der Ärzte Platz.
»An Ihnen ist ja ein Seemann verlorengegangen!«, wandte er sich an Friedrich von Kammacher, und dieser erwiderte: er müsse leider vermuten, der Kapitän irre sich, denn er, Friedrich, habe von der einen Seewassertaufe vollkommen genug und sehne sich nicht nach einer zweiten. Ein Lotsenboot hatte vor einigen Stunden, von der französischen Küste her, die letzten Neuigkeiten gebracht. Ein Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, der erst seit einem Jahre in Dienst gestellte Doppelschraubendampfer »Nordmannia«, hatte bei der Rückfahrt nach Europa Havarie gehabt und war, etwa sechshundert Seemeilen von New York, umgekehrt und nun, ohne weiteren Unfall, wiederum in Hoboken angelangt. Eine sogenannte Springflut oder Springwelle hatte sich aus dem verhältnismäßig ruhigen Meer plötzlich neben dem Schiffe erhoben, und die gewaltige Wassermasse, herniederstürzend, hatte den Damensalon, die Diele des Damensalons und die des nächstfolgenden Decks bis zur Tiefe durchgeschlagen, wobei das Klavier aus dem Damensalon bis in den Schiffsraum hinuntergeschleudert worden war. Dies und anderes erzählte in seiner ruhigen Weise der Kapitän. Und weiter, daß Schweninger in Friedrichsruh bei Bismarck sei, dessen Tod man jetzt stündlich befürchten müsse.
7
Auf dem »Roland« war das internationale Gong noch nicht eingeführt. Ein Trompeter schmetterte ein helles Signal durch die Kajütengänge und über Deck, zum Zeichen, daß man sich in den Speisesaal zu Tische begeben möge. Das erste dieser Trompetensignale erscholl durch das Klagen des Windes in die enge, lärmende, überfüllte Rauchkabine hinein. Der Bursche des Mannes ohne Arme erschien, um seinen Herrn zurückzugeleiten. Friedrich hatte mit viel Interesse das Betragen des Herrn ohne Arme verfolgt: er war von außergewöhnlicher Frische und geistiger Regsamkeit; er sprach Englisch, Französisch und Deutsch mit der gleichen Geläufigkeit und parierte, zur allgemeinen Freude, die schnodderigen Redensarten eines jungen und geckenhaften Amerikaners, dessen Respektlosigkeit sogar vor der geheiligten Person des Kapitäns nicht haltmachen zu wollen schien.
Die Tafel im Speisesaal war in Form eines Dreizacks aufgestellt. Der geschlossene Teil der Gabel lag nach der Spitze des Schiffes zu, die drei Zinken waren nach rückwärts gerichtet. Hier, am Ende der mittelsten Zinke, war, vor einer Art Kamingesims und einem Wandspiegel, die blaubefrackte elegante Gestalt des Oberstewards Pfundner aufgerichtet. Herr Pfundner, zwischen vierzig und fünfzig alt, glich mit seinem weißen, sorgsam gebrannten Haar, das gepudert schien, einem Haushofmeister aus Ludwigs des Vierzehnten Zeit. Wie er mit gerade gerichtetem Haupt den schwebenden und bewegten Saal überblickte, schien er zugleich der besondere Trabant des Kapitäns von Kessel zu sein, hinter dem er stand und der, am Ende der mittelsten Zinke sitzend, zugleich der Wirt und vornehmste Gast der Tafel war. In seiner Nähe saßen der Arzt, Doktor Wilhelm, und der erste Schiffsoffizier. Da der Herr Kapitän an Friedrich Gefallen gefunden hatte, ward ihm ein Platz neben Doktor Wilhelm eingeräumt.
Nachdem etwa die Hälfte der vorhandenen Plätze besetzt waren, stolperten die Kartenspieler aus der Rauchkabine herein, und die Stewards begannen nun, auf Kommando, den Dienst zu versehen. In der Gegend der Kartengesellschaft knallten nach kurzer Zeit die Sektpfropfen. Als Friedrich flüchtig den Blick dorthin richtete, hatte er plötzlich Herrn Hahlström erkannt, der aber ohne die Tochter erschienen war. Von einer Art Galerie herunter scholl ununterbrochen Tafelmusik. Auf dem Konzertprogramm, das den Namen des Schiffes, das Datum und einen Mandoline zupfenden Neger in Frack und Zylinder zeigte, waren sieben Piecen aufgeführt.
8
Immer noch wurde der Vorderteil des Schiffes und mit ihm der Saal, samt Tischen, Tellern und Flaschen, samt den tafelnden Herren und Damen und den bedienenden Stewards, samt den gekochten Fischen, Gemüsen, Braten und Mehlspeisen, samt der Musikkapelle und samt der Musik, abwechselnd hoch über einen Wasserberg hinausgehoben und dann talab in die Tiefe der nächsten Woge versenkt. Die gewaltige Arbeit der Maschine durchbebte das Schiff, und die Wände des Speisesaales hatten einstweilen noch, mit fünfzehn Meilen Geschwindigkeit durch die Salzflut gedrängt, den ersten Anprall des widerstrebenden Elementes auszuhalten.
Man tafelte bei elektrischem Licht. Die graue Helle des wolkigen Wintertages, die überdies von dem Ansprung der gurgelnden Fluten gegen die Luken aller Augenblicke ausgeschlossen wurde, hätte den Raum nicht hinreichend zu beleuchten vermocht. Friedrich genoß die verwegene Situation, gleichsam in einem Walfischbauch bei frivoler Musik festlich zu tafeln – diese ganz ungeheuere menschliche Dreistigkeit –, lächelnd und überwältigt von Staunen. Von Zeit zu Zeit stieß das gewaltige Schiff in seiner stetig verfolgten Bahn auf augenblicklichen Widerstand. Eine gewisse Kombination entgegenwirkender Kräfte richtete sich gegen die Spitze des Schiffs, wo sie die Wirkung eines festen Körpers, ja zuweilen beinahe einer Klippe hervorbrachte. In solchen Augenblicken schwieg dann immer der Lärm des Gesprächs, und viele bleiche Gesichter sahen sich nach dem Kapitän oder nach der Spitze des Schiffes um.
Allein, Herr von Kessel und seine Leute waren in ihre Mahlzeit vertieft und achteten dieser Erscheinung nicht, die das Schiff für Augenblicke zu einem bebenden Stillstand brachte. Sie aßen oder sprachen fort, wenn etwa, wie öfters geschah, der Wurf, Druck oder Sprung einer Wassermasse scheinbar die Wände durchbrechen wollte. Dieses mächtige, nur durch eine lächerlich dünne Wand ausgeschlossene zornige Element, das mit erstickter Wut, haßgurgelnd, dumpf hereindonnerte, schien die Seeleute nicht zu beunruhigen.
Friedrichs Blick ward immer wieder von der langen Gestalt Hahlströms angezogen. Neben ihm saß ein etwa fünfunddreißigjähriger Mann mit dichtem Schnurrbart, dunklen Wimpern und Augen, die manchmal einen scharfen, ja stechenden Glanz zu Friedrich herübersandten. Dieser Mensch beängstigte Friedrich. Es war zu bemerken, daß der schon leicht ergraute Hahlström, den man jedoch noch immer für einen schönen Mann gelten lassen mußte, sich mit gnädiger Miene von dem Fremden den Hof machen ließ.
»Kennen Sie diesen blonden langen Herrn, Kollege?« Friedrich erschrak und vergaß das Antworten. Er blickte nur Doktor Wilhelm, der gefragt hatte, hilflos an. »Es ist nämlich ein Australier, namens Hahlström«, fuhr dieser fort, »der uns früher ins Handwerk gepfuscht hat. Ein sonderbarer Mensch außerdem. Übrigens reist er mit einer Tochter, einem nicht uninteressanten Balg, das aber fürchterlich an der Seekrankheit leidet und sich seit der Abfahrt von Bremen noch nicht aus der horizontalen Lage erhoben hat. Der Schwarze, der neben Hahlström sitzt, scheint, sagen wir, na, ihr Onkel zu sein.«
»Kollege, was gebrauchen Sie eigentlich für Mittel gegen die Seekrankheit?« Mit diesen Worten suchte Friedrich, heimlich erschreckt, das Gespräch abzulenken.
9
»Sie hier, lieber Doktor? Ich traue ja meinen Augen nicht!« Mit diesen Worten fühlte sich Friedrich am Fuß der Kajüttreppe, als er gerade das Deck erklimmen wollte, von Hahlström angehalten.
»Herr Hahlström! Das ist ja ein sonderbarer Zufall, wahrhaftig, das ist ja beinahe, als wenn tout Berlin sich verabredet hätte, nach Amerika auszuwandern.« So und auf ähnliche Weise heuchelte Friedrich Überraschung, in etwas geschraubter Lebhaftigkeit.
»Baumeister Achleitner aus Wien!« Herr Achleitner, jener Mann mit den stechenden Augen, ward hiermit durch Hahlström vorgestellt. Der Baumeister lächelte interessiert und hielt sich dabei, um nicht durch die Bewegung des Schiffes gegen die Wände geschleudert zu werden, krampfhaft an der messingnen Treppengeländerstange fest.
Auf den ersten Treppenabsatz mündete die Tür eines etwas düsteren Rauchsalons. Eine Polsterbank lief an den braun getäfelten Wänden herum, und man konnte durch drei oder vier Fenster in das Quirlen und Brodeln der Wellen hinausblicken. Den ganzen ovalen Raum zwischen den Polstern füllte ein dunkel gebeizter Tisch. »Eine geradezu gräßliche Bude, in der einem angst und bange wird«, sagte Hahlström. Im nächsten Augenblick rief ihn eine trompetenähnliche, lachende Stimme an: »Wenn wir so beibleiben, versäumt Ihre Tochter bei Webster und Forster ihren kontraktmäßig ersten Tag und ich mit, bester Hahlström. Dieses Sauwetter ist ja fürchterlich. Wir machen wahrhaftig keine acht Knoten. Nehmen Sie sich in acht, daß Ihre Tochter nicht etwa noch obendrein Konventionalstrafe zahlen muß. Ich bin ein Tier! Ich kann acht Tage im Salzwasser liegen und sterbe nicht. Wenn wir am ersten Februar – wir haben heute den fünfundzwanzigsten – abends acht Uhr in Hoboken festmachen, so kann ich um neun quietschvergnügt auf dem Podium bei Webster und Forster stehn. Das kann Ihre Tochter nicht, bester Hahlström.«
Friedrich betrat mit den Herren das Rauchzimmer. Er hatte in dem Sprecher bereits den Mann ohne Arme erkannt. Dieser Krüppel war, wie Friedrich später durch Hahlström erfuhr, weltbekannt. Sein einfacher Name, Artur Stoß, hatte seit mehr als zehn Jahren auf den Affichen1 aller großen Städte der Erde geprangt und eine zahllose Menge in die Theater gezogen. Seine besondere Kunst bestand darin, alles das, wozu andere ihre Hände gebrauchen, mit den Füßen zu tun.
Artur Stoß nahm das Mittagsmahl. Man hatte es ihm in diesem wenig benutzten Raum serviert, weil es unmöglich ist, einen Mann, der Gabel und Messer mit den Zehen zu fassen gezwungen ist, an der gemeinsamen Tafel essen zu lassen. Wie Artur Stoß mit seinen entblößten, sauberen Füßen Gabel und Messer zu gebrauchen verstand und trotz der starken Bewegung des Schiffs, während er bei bestem Humor die witzigsten Sachen sagte, Bissen um Bissen im Munde verschwinden ließ, das hatte für die drei Herren durchaus den Wert einer Schaustellung. Übrigens fing der Artist alsbald Herrn Hahlström und seinen Begleiter auf eine mitunter etwas bissige Weise zu foppen an, wobei er mit Friedrich Blicke wechselte, als ob er diesen weit höher einschätze. Solche Attacken bewogen denn auch die beiden Herren, sich nach kurzer Zeit an Deck zu verziehen.
»Ich heiße Stoß!« – »von Kammacher!« – »Es ist schön von Ihnen, daß Sie mir etwas Gesellschaft leisten. Dieser Hahlström und sein Trabant sind widerlich. Ich bin seit zwanzig Jahren Artist, aber ich kann solche schlappe und faule Kerls, die selbst nichts tun mögen und dafür ihre Töchter ausnutzen … sie sind mir wie Brechpulver, ich kann sie nicht sehen. – Dabei spielt er den großen Mann! Gott bewahre, er baronisiert, er ist nicht Artist! Wo wird er denn aus den Knochen seiner Tochter Bouillon kochen. Die Nase hoch! Sieht er einen Dukaten im Dreck, und jemand von Distinktion ist zugegen, er läßt ihn liegen, er hebt ihn nicht auf. Es ist nicht zu leugnen, daß er ein gefälliges Exterieur besitzt. Er hätte das Zeug, er gäbe einen ganz talentvollen Hochstapler ab. Er macht sich’s bequemer, er läßt sich lieber von seiner Tochter und von den Verehrern seiner Tochter aushalten. Es ist erstaunlich, wie viele Dumme es immer wieder gibt. Dieser Achleitner! Geben Sie bloß mal Obacht, wie Hahlström von oben herab, mit welcher Würde, den Gönner spielt. – Hahlström ist früher Bereiter gewesen. Dann ist er mit einem Kaltwasserschwindel und schwedischer Heilgymnastik verkracht. Dann ist ihm die Frau davongelaufen: eine tüchtige, arbeitsame Frau, die jetzt als Direktrice bei Worth in Paris ein brillantes Auskommen hat.«
Friedrich zog es zu Hahlström hinauf.
Das Vorleben dieses Mannes, wie er es unerwartet durch Stoß erfuhr, war ihm in diesem Augenblick gleichgültig. Was der Artist in bezug auf die Dummen sagte, die nicht aussterben, jagte Friedrich eine flüchtige Röte ins Angesicht.
Artur Stoß wurde mehr und mehr redselig. Er saß wie ein Affe, eine Ähnlichkeit, die bei jemandem, der die Füße als Hände gebrauchen muß, nicht zu vermeiden ist. Und als er die Mahlzeit beendet hatte, steckte er sich, wie irgendein anderer beliebiger Gentleman, seine Zigarre in den Mund.
»Solche Leute wie Hahlström«, fuhr er mit knabenhaft heller Stimme fort, »sind eigentlich der gesunden und geradegewachsenen Glieder nicht wert, die ihnen unser lieber Herrgott gegeben hat. Freilich es bleibt, wenn man auch wie ein olympischer Sieger gewachsen ist, immer mißlich, wenn hier oben – er klopfte an seine Stirn – zu wenig vorhanden ist. Bei Hahlström ist leider zu wenig vorhanden. Sehen Sie mich an! Ich will nicht sagen, jeder andere, aber mindestens unter zehnen neun würden in meiner Lage schon als Kinder zugrunde gegangen sein. Statt dessen ernähre ich heut eine Frau, besitze eine Villa am Kahlenberge, füttere drei Kinder eines Stiefbruders durch und überdies noch eine ältere Schwester meiner Frau. Die ältere Schwester war Sängerin und hat leider ihre Stimme verloren.
Ich bin heute schon vollkommen unabhängig. Ich reise, weil ich mein Vermögen auf eine gewisse Summe abrunden will. Wenn heute der ›Roland‹ untergeht, so kann ich sozusagen mit größter Gelassenheit Wasser schlucken. Ich habe meine Arbeit getan, ich habe mit meinem Pfunde gewuchert: für meine Frau, für die Schwester meiner Frau und für die Kinder meines Stiefbruders ist gesorgt.«
Der Bursche des Artisten erschien, um seinen armlosen Herrn zum Mittagsschlaf in die Kabine abzuholen. »Bei uns geht alles pünktlich und wie am Schnürchen«, sagte Stoß, und mit bezug auf den Burschen fuhr er fort: »Er hat seine vier Jahre bei der deutschen Marine abgedient. Ich kann bei meinen Seereisen andere Leute nicht gebrauchen. Ein Mann, der mir etwas nützen soll, muß eine Wasserratte sein.«
Anschlag, Plakat <<<