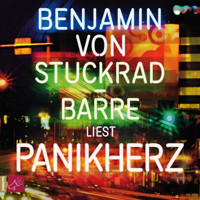12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Deutschland ganz unten, Deutschland ganz oben – und mittendrin: Stuckrad-Barre, mit Stift, Papier und Kamera Im Jahr 2001 brachte er »Deutsches Theater« heraus, den »Fotoroman einer Gesellschaft, die nur in der Öffentlichkeit und im Rollenspiel noch zu sich selbst zu kommen vermag« (FAZ). Nun erscheint die Fortsetzung: Reportagen, Porträts, Erzählungen, Mono- und Dialoge – ein Sittengemälde unserer Zeit.Wahlkampf, Streik, Demonstrationen, Konsum, Fußball, Kino, Theater, Musik, Literatur, Mode, Stadtleben, Überlandfahrten. Politik, Kultur, Gesellschaft. Mit seinem Verfahren der teilnehmenden Beobachtung findet Stuckrad-Barre Momente der Wahrheit inmitten von Vorgängen, die genau diese verschleiern sollen. Dabei wechselt sein Blick permanent zwischen außen und innen, so dass nicht nur Erkenntnis über all die anderen Menschen, sondern auch über ihn, den Zuschauer, aufblitzt. Und so entsteht aus vielen Einzelbeobachtungen ein deutscher Klappaltar, aus vielen Texten eine Großerzählung, archäologisch blicken wir auf unsere Gegenwart: Das sind die Fragen, Personen und Orte, die uns bewegen – das sind die Bedingungen, unter denen wir leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Benjamin v. Stuckrad-Barre
Auch Deutsche unter den Opfern
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Benjamin v. Stuckrad-Barre
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Benjamin v. Stuckrad-Barre
Benjamin von Stuckrad-Barre, 1975 in Bremen geboren, ist Autor von »Soloalbum«, 1998, »Livealbum«, 1999, »Remix«, 1999, »Blackbox«, 2000, »Transkript«, 2001, »Deutsches Theater«, 2001, »Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft – Remix 2«, 2004, »Was.Wir.Wissen«, 2005, »Auch Deutsche unter den Opfern«, 2010, »Panikherz«, 2016, »Nüchtern am Weltnichtrauchertag«, 2016, »Udo Fröhliche«, 2016, »Ich glaub, mir geht’s nicht so gut, ich muss mich mal hinlegen – Remix 3«, 2018 und »Alle sind so ernst geworden« (mit Martin Suter), 2020. Der neue Roman erscheint im April 2023.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Reportagen, Erzählungen, Porträts, Mono- und Dialoge – ein Sittengemälde unserer Zeit. Wahlkampf, Streik, Demonstrationen, Konsum, Fußball, Kino, Theater, Musik, Literatur, Mode, Stadtleben, Überlandfahrten.
Politik, Kultur, Gesellschaft.
Mit seinem Verfahren der teilnehmenden Beobachtung findet Stuckrad-Barre Momente der Wahrheit inmitten von Vorgängen, die genau diese verschleiern sollen. Dabei wechselt sein Blick permanent zwischen außen und innen, so dass nicht nur Erkenntnis über all die anderen Menschen, sondern auch über ihn, den Zuschauer, aufblitzt. Und so entsteht aus vielen Einzelbeobachtungen ein deutscher Klappaltar, aus vielen Texten eine Großerzählung, archäologisch blicken wir auf unsere Gegenwart: Das sind die Fragen, Personen und Orte, die uns bewegen – das sind die Bedingungen, unter denen wir leben.
Inhaltsverzeichnis
Bildcollage
Vorwort
Jahresvorausblick
Viren-Alarm
Hamburger Wahlkampf
Diskutieren mit Günter Grass
Protest
Die Kanzlerin telefoniert ins Weltall
Udo Lindenbergs Comeback
1. Ich zieh meinen Hut
2. Wenn du durchhängst
3. Ganz anders
4. Was hat die Zeit mit uns gemacht
5. Mein Ding
6. Stark wie zwei
7. Der Deal
8. Chubby Checker
9. Der Greis ist heiß
10. Woddy Woddy Wodka
11. Nasses Gold
12. Interview mit Gott
13. Verbotene Stadt
14. Der Astronaut muss weiter
Leander Haußmann als Pädagoge
Polizeistreik
Trockengebiete
Bierbotschafter Steinmeier
Deutschland : Türkei
Fernsehen mit Dieter Hildebrandt
Das Deutsche Fernsehen
Zugfahrt mit der Juso-Vorsitzenden
Obama in Berlin
Die Schlange vor dem Reichstag
Die Google-Party
Paparazzi
Vor Herlinde Koelbls Kamera
Scientology
Jonathan Meese malt einen Warhol
Die SPD am Schwielowsee
Die Sonntagsfrage
Fashion Week
Finale auf der Fanmeile
Mit Hans Magnus Enzensberger unterwegs im Wahlkampf
Donnerstag, 25. September 2008, Marienplatz
Freitag, 26. September 2008, Karlsplatz
Das Rauchverbot
Der Berliner Weihnachtsbaum
Falcos zehnter Todestag
Wintertagebuch
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Tom Cruise auf dem roten Teppich
Mit Til Schweiger im Kino
Betriebsbesichtigungen mit dem Berliner Wirtschaftssenator
Plakate für die Hessen-Wahl
Outlet-Center
Mitternächtliche Elektronikfachmarkt-Eröffnung
Auf dem Abwrackhof
Guido Westerwelle im Bundestagswahlkampf
Frank-Walter Steinmeiers Sommerreise
Cem Özdemirs Kulturwahlkampf
Mit Angela Merkel im Rheingold-Express
Physik für Mädchen
Der Polterabend des prominenten Friseurs
Der monatliche Plattenkauf
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Grönemeyer vs. Westernhagen
Straßenwahlkampf: Die Linke
Straßenwahlkampf: CDU
Willy-Brandt-Haus, 27. September 2009
Zwischenzeit
Christoph Schlingensiefs »Tagebuch einer Krebserkrankung«
Der 9. November: Ein Gespräch mit Alexander Kluge
Dank
Vorwort
Ich lese jeden Tag Zeitung, höre jeden Tag Nachrichten im Radio, und sehe das, was ich schon den ganzen Tag lang gehört und gelesen habe, abends noch drei- bis viermal im Fernsehen. Ich bin informiert über alles und alle, über jedes und jeden. Durch das ständige Hören und Sehen entgehen mir nicht die kleinsten Nuancen in der sich ständig entwickelnden Darbietung aktueller Realitäten. Da ich in München den Sender Bayern Fünf höre, der alle fünfzehn Minuten Nachrichten von sich gibt, und in Berlin Info-Radio vom RBB, der das gleiche alle zwanzig Minuten darbietet, weiß ich auch ganz genau Bescheid über die Hierarchie der gegebenen Informationen. Es würde genügen, beide Sender zur halben und zur vollen Stunde abzuhören, denn da passieren die wichtigen Sachen, und nicht um viertel oder zwanzig nach oder vor. Es gab mal einen Werbeslogan für Bayern Fünf, der dazu aufforderte, mit dem Ohr unentwegt dran zu bleiben: »…denn in fünfzehn Minuten kann sich die Welt verändern.« Kann sein, wenn wir öfter mal, möglichst alle Viertelstunde, einen Nine-Eleven oder einen Tsunami hätten. Man hat dann den Spruch etwas verändert, wahrscheinlich, weil er sich durch die Assoziierung von Katastrophen doch als kontraproduktiv für die Zuhörerquote erwies. Außerdem möchte der Mensch gar nicht, dass sich dauernd was ändert, und wenn, dann höchstens in dem Sinne des von der Politik, insbesondere der bayerischen, seit Jahrzehnten immer wieder mit neuen, unerwarteten Inhalten versehenen Spruches: »Es muss was geschehen, aber es darf nix passieren!«
Da ist mir die Information durch das geschriebene Wort, in meinem Fall noch die Zeitung, doch viel lieber. Ganz abgesehen davon, dass »gelesen haben« einfach seriöser klingt als »gehört haben«. Ausgesprochen elitär, wenn auch schon mit dem leichten Beigeschmack von altmodisch, klingt es, etwas »in einem Buch gelesen« zu haben. Das Buch hat einen großen Vorteil gegenüber den audio-visuellen Medien: Es kann, aber muss nicht aktuell sein. Wir sollten ohnehin aufhören, die Aktualität (»das zum gegenwärtigen Zeitpunkt Wesentliche«) als Kriterium für die Beurteilung von Qualität zu verwenden. Es könnte sonst sein, dass einer, der gerade »Asterix und Obelix« liest, sich seinem Gewissen gegenüber verpflichtet fühlt, dabei an Guerillakriege des 21. Jahrhunderts zu denken und diese Erkenntnis auch als gegenwärtig wesentlich zu verbreiten.
In der Literatur gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts den Begriff der literarischen Reportage. In den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts soll diese Gattung angeblich ihren Höhepunkt erreicht haben. Dabei dürften einige Jahrhunderte unter den Tisch gefallen sein. Vielleicht lässt sich bei der »Ilias« noch über die Identität des Autors streiten, dem Werk allerdings ist erheblicher Realitätsgehalt nicht abzusprechen. Der Gallische Krieg gilt nicht als von Cäsar erfunden, aber durchaus als ein wesentliches Stück lateinischer Literatur. Wie ist die Italienische Reise von Goethe literarisch einzuordnen und wie die Reisebilder von Heine? Borges hat sehr viel später noch die »lateinamerikanische Phantastik« miterfunden, in der er zwar real existierende Personen benennt und zitiert, andererseits nichtwirkliche Elemente als Realität behandelt. Irgendwann hat sich dann schließlich Truman Capote in aller Bescheidenheit als alleiniger und eigentlicher Erfinder der Gattung geoutet.
Ob das vorliegende Buch dazu gehört, fragt sich allerdings. Schon der Titel »Auch Deutsche unter den Opfern« könnte vermuten lassen, dass es sich hier nur um längst fällige kritische Gedanken zur militärischen (Afghanistan) und medizinischen (Gesundheitsreform) Lage der Nation handelte. Man würde aber dem Autor unrecht tun, wenn man ihm unterstellte, den Leser nicht bewusst in die Irre zu führen. Er weiß schon, was er gemeint hat, auch wenn er es nicht gleich sagt.
Der Autor beschreibt, was ist. Er schreibt Szenen, Momentaufnahmen, szenische Ausschnitte. Von diesen Ausschnitten kann der Leser auf das Ganze schließen oder auch nicht. Im ersten Fall amüsiert er sich, im zweiten denkt er darüber nach, worüber er sich amüsiert hat und was das Ganze sein könnte.
Dieses Ganze kann sowohl inhaltlicher Art sein als auch stilistischer. Ich habe immer vermutet, dass die Wahrheit eher im Stil des Gesagten oder Geschriebenen liegt als in dessen Inhalt. Mit einfacheren Worten gesagt: Auf das wie kommt es an. Diese Ansicht ist in unserem Land nach wie vor nicht populär, weil undeutsch. Umso erfreulicher ist es, in diesem Buch das wiederzufinden, was bei der Lektüre von Alfred Kerr, Karl Kraus, Kurt Tucholsky und anderen genuin deutschen Literaten so beeindruckt und gut getan hat: Die Vermeidung von Pathos, dieses Fast-Foods fürs Gemüt, keine Spur ist hier zu finden von feierlicher Ergriffenheit und leidenschaftlich-bewegtem Ausdruck.
Die Beherrschung der Sprache, ohne sie zu vergewaltigen, sie einem Ziel, aber nicht einem Zweck dienlich zu machen, das ist eben nicht mehr (nur) Journalismus. Nehmen wir einmal an, es handelte sich bei dem vorliegenden Werk nicht um sogenannte Reportagen, sondern um fiktive, mehr oder minder erfundene Geschichten. Man würde sagen… tja, was würde man wohl sagen?
Soll ich Ihnen was sagen? Etwas, was nur ich weiß? Alles in diesem Buch ist erfunden. Ich bin mit dem Autor sehr gut befreundet. Ich war dabei. Alles ist reine Fiktion. Ein Beispiel: Der Autor wollte eine Szene über eine Diskussion mit einem älteren deutschen Literaturnobelpreisträger schreiben. Er suchte einen Namen für den greisen Dichter. Der Name sollte authentisch wirken. Also nannte er ihn einfach Günter Grass. Genial.
Und so ist es im ganzen Buch: Sollte in der Geschichte ein Schauspieler vorkommen, so hieß dieser einfach Til Schweiger oder Tom Cruise. Wenn es sich um eine deutsche Kanzlerin handelte, dann erfand der Autor für sie den geradezu absurden, aber auf eigentümliche Weise treffenden Namen Angela Merkel. Ganz wunderbare, griffige, bildhafte Namen tragen die Figuren dieser Geschichten: Sänger heißen Lindenberg, Friseure Walz und Minister Steinmeier oder gar Westerwelle. Allein die Namensgebung ist ein onomatopoetisches Meisterwerk.
Über die sozioklimatischen Bedingungen, unter denen Humor und Ironie in der literarischen Reportage gedeihen, will ich mich hier nicht näher auslassen, obwohl sie zu meinen Lieblingsthemen gehören. Da ich stundenlang darüber reden könnte, tue ich es nicht. Ich lese lieber ein Buch wie dieses.
Helmut Dietl
Jahresvorausblick
Sabine Christiansen lutscht einen Pfefferminzbonbon und erklärt kurz, was sie heute vorhat: Ein positiver Ausblick auf das just begonnene Jahr soll es werden, mit Stars und auch ganz normalen Menschen. In der Garderobe warten Wolfgang Joop, Fiona Swarovski, Reinhold Messner, Mika Häkkinen, Oliver Bierhoff und noch viele, viele andere ähnlich normale Gäste; die Kanzlerin wird zugeschaltet.
»Sabine Christiansen – Mein 2008« heißt die Sendung, und deshalb sagt die Moderatorin auch schnell noch was ganz Persönliches: Für sie gehe es in diesem Jahr vor allem um »Entschleunigung«. Etwas atemlos schluckt sie den Bonbonrest runter, gleich beginnt die Sendung. Im Studio verhindert währenddessen der umsichtige Jörg Kachelmann möglicherweise einen Eklat, auf dem Platzschild seines Sitznachbarn Henning Mankell fehlt nämlich ein »l«, »Mankel« steht da. Die darüber von Kachelmann informierte Christiansen-Mitarbeiterin malt den fehlenden Buchstaben geschwind dazu, da kommt der von vielen Menschen gern gelesene Autor auch schon, nimmt Platz, und wer weiß denn schließlich, wie empfindlich der vielleicht ist?
Dann geht es los und dauert vor allem wahnsinnig lang. Es wird allerlei besprochen, es wird gewarnt, gelobt, geworben und gelabert, und wem schon bei Christiansens einstigem Sonntagabendplausch die Gästezahl immer etwas zu großzügig bemessen schien, der wird vom Sofa aus diese Sendung (oder sagt man da schon »Show«?) endgültig als babylonische Zumutung empfinden. Knapp 50 Gäste in 90 Minuten zu befragen, hat Sabine Christiansen sich vorgenommen. So richtig entschleunigt geht das natürlich nicht. Politiker, Sportler, Schauspieler, Unternehmer – oder, mal so herum, wer war eigentlich nicht eingeladen? Behinderte, Kinder und Tiere kommen auch vor. Alles kommt vor, denn – so Christiansen – »das Jahr ist bunt«. Der Fernsehzuschauer erfährt, dass es im neuen Jahr Wetter geben wird, Wahlen, Konzerte, Filme und eine Fußball-Europameisterschaft. Natürlich auch Probleme, aber wir können es schaffen. Wenn sich alle ein bisschen anstrengen!
Brisant auch, was Meinungsforscher im Auftrage Christiansens herausgefunden haben, nämlich zum Beispiel, dass sich viel mehr Deutsche auf die Europameisterschaft freuen als auf die Landtagswahlen. Da hätte man doch ruhig noch nachbohren können: Haben Sie gern viel Geld? Lieben Sie Gewalt? Möchten Sie lieber einen Pool im Garten haben oder ein Atomkraftwerk? Die interessantesten Menschen des Jahres werden Barbara Becker, Wolfgang Joop, Dieter Zetsche und Bully Herbig sein. Sagt Sabine Christiansen.
Der Aufnahmeleiter guckt erschöpft: 51 Minuten Überlänge! Werden nun versehentlich die paar Glanzmomente eliminiert? Swarovskis von recht hohen Absätzen herab gepredigte Prognose, es werde nicht so sehr ums Äußere gehen 2008, mehr so ums Innere? Die Stille nach einem komplizierten, aber ziemlich guten Witz von Geraldine Chaplin? Eigentlich alle Antworten von Bully, die jeweils die vorangegangene Frage als etwas zu small getalkt bloßstellten? Kachelmanns hinterm Schädel von Waldemar Hartmann postierte Victory-Hasenohren? Am Morgen hatte Kachelmann noch eine Wetterstation in Uevekoven eingeweiht. In – wo? Ja, eben: So einer wie Kachelmann hätte tatsächlich manch Interessantes erzählen können über Deutschland 2008. Ging aber nicht, zu viele Gäste. Also ihm, sagt Kachelmann hinterher, habe noch Veronica Ferres gefehlt. Richtig, die war das, die nicht da war.
Draußen ist es für eine Januarnacht genau so erstaunlich mild, wie Kachelmann es vorausgesagt hat. Er schüttelt dem Aufnahmeleiter die Hand: »Also, wenn ihr meinen Auftritt rausschneiden müsst, kann ich damit gut umgehen.«
Viren-Alarm
Es beginnt brandgefährlich: Dr. Cornelius Bartels schüttelt dem Reporter zur Begrüßung die Hand! Könnte also sein, dass das Virus gerade von Wirt zu Neu-Wirt gesprungen ist. Jetzt noch unbedacht mit der Hand den Mund berühren, wie man das ja manchmal so macht, zum Husten, Niesen, Nachdenken oder Essen – dann könnte das Virus sich einnisten, eine Großfamilie gründen, und nach ein paar Stunden müsste man für ungefähr zwei Tage praktisch im Badezimmer wohnen. Schwallartiges Erbrechen und sturzbachartiger Durchfall! »Ja ja«, hat Bartels den passenden Witz parat, »das Noro-Virus ist zur Zeit in aller Munde«. Die Zahl der durch das Noro-Virus verursachten Magen-Darm-Erkrankungen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht, gab das Robert-Koch-Institut kürzlich bekannt; Dr. Bartels ist Wissenschaftler an diesem Institut und konzipiert derzeit eine Kampagne, die besseres, wirksameres Händewaschen lehren soll.
Als Herr Bartels gerade alles sehr schön erklärt (ein paar lateinische Begriffe schmücken jeden Satz, und insgesamt versteht man ihn ganz gut), da klingelt das Telefon, ein Kollege von Herrn Bartels, wie es denn so gehe und so weiter. Ihm wieder gut, jawohl, wieder. Er habe nämlich darniedergelegen, und Schuld sei wohl, jetzt kommt’s, das Noro-Virus gewesen. Klassischer Verlauf (also zwei Tage Klo), Schüttelfrost, katerartige Beschwerden. Zum Glück ruft er an und steht nicht hier im Raum, wäre ja unhöflich, ihm nicht die Hand zu schütteln. Und ihn stattdessen zu küssen (was weniger gefährlich als Händeschütteln ist, das ist doch mal eine gute Nachricht!), dafür ist man einfach zu wenig Südländer.
Aber man kann natürlich auch als (was das Küssen Wildfremder betrifft) eher gehemmter Mensch das Risiko einer Infektion verringern, und zwar am besten durch häufiges Händewaschen. Kann man sich, im Sinne der Gefahrenabwehr, auch besonders gut die Hände waschen? Oh ja, man kann – mindestens 30 Sekunden lang, mit warmem Wasser und Seife. Öffentliche, vielfrequentierte Waschräume sind natürlich besonders beliebte Virenwohnorte; zum Beispiel so ein Instituts-Herrenklo: Da hängt kein versifftes Frotteehandtuch, sondern eine Papierhandtuch-Box, das ist schon mal gut. Sei das nicht der Fall, trockne er seine Hände immer so, sagt Herr Bartels – und reibt sich die Hände am Hosenbein trocken. Also, 30 Sekunden, besonders bitte auch die Fingerzwischenräume einseifen, und dann, wenn man es ganz perfekt machen will, den Wasserhahn mit einem Papierhandtuch zudrehen, sonst war der Waschvorgang eventuell wertlos. Jetzt noch die Tür mit Ellenbogen oder Fuß öffnen? Zwar wirkt man dann beinahe zwangserkrankt, aber bei »Monk« finden das ja alle lustig, also, was soll’s.
Dankeschön, Herr Doktor, auf Wiedersehen.
Jetzt hätte man ihn fast geküsst.
Hamburger Wahlkampf
In seinem Büro im Kurt-Schumacher-Haus sitzend, versucht Michael Naumann heute alles zu sein, nur kein guter Verlierer. Er hat da ein paar Kniffe drauf, sein Gegenüber einzuschüchtern und dumm dastehen zu lassen, das macht ihm Spaß. »Was Sie nicht zu wissen scheinen«, »Wenn ich Sie da berichtigen darf«, »Wenn Sie sich in New York ein bisschen auskennen«, »Ich habe bereits – da waren Sie noch gar nicht auf der Welt – …«, »Das ist, mit Verlaub, dummes Zeug«, »Ach, wissen Sie«.
Gut. Und sonst so? Schon die Zeitungen gelesen heute? Nur die »Süddeutsche«, sagt er, und dass einen »so was« natürlich freue. Was denn in den anderen so stehe, erkundigt er sich betont beiläufig und entzellophaniert eine Schachtel Dunhill-Zigaretten – ob es störe, wenn er raucht? Naumanns Sprecher Günter Beling, dessen Beliebtheit bei Hamburger Journalisten mäßig ist, da er unliebsame Naumann-Berichterstattung gern mit Beschwerdeanrufen bei den jeweiligen Chefredakteuren kontert, kneift die Augen zu, spitzt die Lippen und schüttelt den Kopf. So schlimm sei das gar nicht in den Zeitungen heute.
Naumanns »Blackout« im TV-Duell mit Ole von Beust, dieser »Aussetzer« ist das beherrschende Thema in den Hamburger Zeitungen, diskutiert wird, wie viele Stimmen so ein »schwerer Stotter-Anfall« kosten oder eventuell gar bringen könnte. Natürlich kommen auch Psychologen zu Wort. Es wird sogar kolportiert, Naumann habe nach der Sendung zu von Beust gesagt, damit habe er, von Beust, die Wahl wohl gewonnen. Sprecher Beling wird dies heute allen aufgeregt Anrufenden gegenüber als »Witz« sprachregeln.
Gewählt wird erst am kommenden Sonntag, aber in Umfragen hatten viele Hamburger bekundet, sie wollten ihre endgültige Entscheidung vom »Ausgang des TV-Duells« abhängig machen, und da dieses aber nur von 60000 Hamburgern gesehen wurde, sind die Nacherzählungen und Interpretationen in den Zeitungen nicht ganz unwichtig. Das von Naumann heute vorgeblich einzige bislang gesichtete Blatt, die »Süddeutsche Zeitung«, ging früher in Druck, das TV-Duell kommt nicht vor in einem langen, wohlwollenden Naumann-Porträt, Überschrift: »Der Rosenkavalier«. Natürlich, so was freut einen. Beling drückt Besuchern heute besonders gern eine SPD-Wahlkampfzeitung in die Hand, »Der neue Bürgermeister« steht auf der Titelseite, daneben ein Naumann-Foto.
Als Henning Voscherau ihn beim nicht gerade zwanglos zu nennenden gemeinsamen Nachsendungs-Rumgestehe, die Schulter tätschelnd, wiederaufzurichten versucht hatte mit dem aufmunternd gemeinten Satz »Das macht dich menschlich«, da wirkte Naumanns Nicken wie ein Kopfschütteln. Auch das noch, ausgerechnet, sagte Naumanns Mimik, nach all den Jahren in hohen Positionen, tollen Städten, ja Häfen, an Schaltstellen und immer obenauf – und nun also »menschlich«, Prost Mahlzeit. Dem als Nothelfer der Hamburger SPD Eingesetzten, diese Rolle mit Wonne Spielenden, schlägt nach seinem Aussetzer etwas entgegen, das in dieser Adressierungsrichtung nicht zu seinem Selbstentwurf passen will: Mitleid.
Noch bevor Voscherau ihn tätscheln, seine Ehefrau Marie Warburg ihn küssen und er die Zuspruchs-SMS seiner Tochter laut verlesen konnte, war ihm CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla in die Quere gekommen, der währenddessen schon von fleißigen Mitarbeitern eine schnell auf einem Faxgerät kopierte Pressemitteilung verteilen ließ (»Ole von Beust klarer Sieger – Naumann ohne Konzept«). Da so viele Fotografen um die beiden herum standen, mussten sie natürlich ein wenig witzeln und alles nicht so eng sehen, das schaut dann immer besser aus. Während die Auslöser klickten und die Blitze blitzten, gab Naumann dem gegnerischen Generalsekretär gönnerhaft Wissenswertes über dessen Wahlkreis Kleve mit auf den Weg und fragte ihn, ob er überhaupt wisse, was ein »Kielschwein« sei. So oder so, Naumann erklärte es gern. Er hatte nämlich Pofallas generalsekretärsüblich markigen, so dämlichen wie zitablen Spruch, Naumann sei auf einem Segelboot besser aufgehoben als im Hamburger Rathaus, im Wahlkampf immer mit einer Einladung an Pofalla erwidert, doch mitzusegeln, und zwar als, eben, »Kielschwein«. Die Endung »Schwein« ist natürlich auf jedem Marktplatz und in jedem Saal ein sicherer Lacher, doch da man nun schon mal so schön zusammenstand, erläuterte Naumann dem freundlich über des Herausforderers Schulter die Verteilung seiner Presseerklärung kontrollierenden Generalsekretär, welche stabilisierende Längsstrebe im Schiffsrumpf nun eigentlich genau der Segler als Kielschwein bezeichnet.
In anderen deutschen Städten hat man andere Beschimpfungs-Parameter, in Hamburg wird man im Wahlkampf gern maritim: Die SPD sagt, Herr von Beust möge doch lieber vor Sylt herumsegeln, und die CDU sagt eben dasselbe von Herrn Naumann. Auch wer in Problemstadtteilen wohnt, hat es hier wenigstens nicht weit bis zum Wasser und versteht also, was gemeint ist. Obwohl viele junge Hamburger Schüler noch nie am Hafen waren, sagt Naumann nun, und dass ihn das bestürze. Er möchte jetzt über Bildung sprechen, sein prioritäres Wahlkampf-Thema. Ach ja, die Bildung. Je nach Adressat lässt Naumann die seine entweder, wie man so sagt, raushängen, oder er beklagt deren »durch Ole von Beust« vorangetriebenen Verfall, all diese Verheerungen im Hamburger Schulsystem. Er wird das alles ändern – wenn er denn gewählt wird. Wie auch immer, ein bisschen hängt sie also immer heraus aus seinem Sprechen, die Bildung. Als ehemaliger Verleger, ehemaliger Kulturstaatsminister, beurlaubter Herausgeber, mit Promotion über Karl Kraus Ausgestatteter, selbst also Höchstgebildeter, hat Naumann sich da ein glaubwürdiges Wahlkampf-Thema ausgesucht. »Wir werden die Studien…pläne … die … Entschuldigung, wir werden die Pläne an den … Schulen, oh Gott … wir werden die Schulpläne an den … wir werden … die Schulstunden entrümpeln«, hatte er am Abend zuvor in die Duell-Kamera gesprochen. Einen Tag später nun hat er, was man immer hat, einen Tag nach einer Schlagfertigkeitskrise: gut zurechtgelegte, pointierte Erwiderungen. Ein Blackout könne ja schon mal vorkommen, wenn man einem politisch Schwarzen gegenüberstehe, der so schamlos an der Wahrheit vorbeisegele (maritim!) wie eben von Beust, sagt Naumann also am Tag darauf und guckt beifallheischend. Denn »in der Sache« – und so schwingt er sich nun weiter durch Programm und selbst- bis sprachverliebte Überzeugungsgrammatik. Die Schulklassen in Hamburg seien zu groß, von elternvermögensunabhängiger Chancengleichheit könne nun wirklich keine Rede sein – Naumann ist jetzt in Hochform. Jetzt. Den Ausrutscher lebenslang auf Youtube wiederzufinden, darauf freue er sich schon, merkt er nebenbei tapfer an.
Sprecher Beling gießt Kaffee in rote Porzellanbecher, bedruckt mit dem Hamburger Stadtwappen, der Aufschrift »Bürgermeister für Hamburg«, dazu Michael Naumanns Unterschrift und das SPD-Logo. Diese Becher sind momentan sehr berühmt in Hamburg. Nach seiner Ernennung zum Spitzenkandidaten der hiesigen SPD musste Naumann dem Großteil der Hamburger zunächst mal überhaupt bekannt gemacht werden, die roten Becher haben dabei geholfen. Die Fotografin Karin Rocholl wurde im März vergangenen Jahres beauftragt, den gerade Gekürten zu porträtieren, und brachte, wie sie das immer bei Porträt-Terminen tut, einige ihr passend erscheinende Requisiten mit; für die Naumann-Bilder hatte sie im Geschäft »FahnenFleck« allerlei Hamburg-Devotionalien zusammengekauft. Als sie ihm einen Rettungsring mit Stadtwappen darauf hinhielt, fragte er, ob sie verrückt geworden sei, den roten Becher aber nahm er bereitwillig am Henkel, ein schöner Blickfang; der Kandidat trug ein Hemd, die oberen beiden Knöpfe offen – und guckte freundlich in Rocholls Kamera. Das so entstandene Foto gefiel ihm sehr gut, ein paar Wochen später hing es in ganz Hamburg. Kurz darauf wurde Rocholl mitgeteilt, dass das Motiv einigen Hamburgern zu salopp erschiene, und so wurde ein weiterer Fototermin vereinbart: Naumann trug diesmal Jackett und Krawatte, nahm seine Lesebrille in die linke Hand, den rechten Zeigefinger legte er in ein aufgeschlagenes Buch, unter dem der Deckel eines Laptops hervorlugte – auf dem neuen Motiv sollte also so einiges mitgeteilt werden. Der rote Becher wanderte an den Bildrand, aber er blieb. Gegen dieses etwas zugeknöpftere Bild gab es bis heute keine Einwände in Hamburg, es hängt an jeder Laterne und Plakatwand, an der kein Ole-von-Beust-Plakat hängt, und die SPD hat die roten Becher als Werbegeschenk in Umlauf gebracht. In den Umfragen liegt Naumann hinter von Beust, aber er hat aufgeholt.
Schließlich hatte Helmut Schmidt gesagt, »Mike, Sie müssen das machen«. Und Mike machte also: Er installierte eine vom Rest der Partei widerwillig zur Kenntnis genommene Mannschaft um sich herum, eine eigene Sekretärin, den strengen Sprecher Beling; er stellte ein »Kompetenz-Team« zusammen aus Personen wie Monika Griefahn oder Kurt Bodewig, die als Hoffnungsträger zu präsentieren schon einiges Selbstbewusstsein verlangt, aber daran herrscht ja ohnedies bei Naumann kein Mangel. Zehn Monate lang ist er in einem von der Partei geleasten, bürgernahen roten Golf durch Hamburg gefahren und hat »mit den Menschen« gesprochen. Er recherchierte, guckte sich alles an, stieg in jeden Keller hinab, um den ob seines – hanseatisch formuliert – abwechslungsreichen Lebenslaufs skeptischen Hamburgern zu beweisen, dass er es ernst meint. Von seinen Stadterkundungstouren hat Naumann viele illustrative Fallbeispiele mitgebracht, mit denen er seine politische Gegenwartsanalyse und sein Zukunftsprogramm geschickt, auf die Dauer etwas ermüdend unterfüttert: Das türkische Mädchen, das wegen seines Kopftuchs als Banklehrling abgelehnt wurde. Der arbeitslose Fleischer, der zum Biokostverkäufer umgeschult wurde und trotzdem keine Stelle fand. Die Großfamilie, die; der alleinerziehende Vater, der; die überforderte Lehrerin, die; die Ein-Raum-Gaststätte, in der – und so weiter. Er weiß, dass dies eine Kitsch-Falle ist, ja dass Wahlkampf überhaupt Kitsch-Saison ist und Plattitüden-Wettstreit, aber, wie man in Hamburg sagt: Nützt ja nichts.
Naumanns Habilitationsschrift trug den Titel »Strukturwandel des Heroismus. Vom sakralen zum revolutionären Heldentum«. Vielleicht möchte er auch einfach nur seine Biographie abrunden: zurück zum sakralen Heldentum – und nebenbei ist es doch auch ganz schön, in der eigenen Stadt als Schlussakkord eines vorbildlichen öffentlichen Bürgerlebens noch mal für alle sichtbar der Erste zu sein.
Gefragt, wie er, Dr. Naumann, die Sprachverrottung auf Plakaten und in Diskussionen aushalte, ja ob er ihr nicht als Wahlkämpfer zwangsläufig selbst zuarbeite, ob ihn nicht schaudere, bei der so ernsthaften wie häufigen Verwendung des Stummelworts »KiTa« beispielsweise, zuckt Naumann die Achseln und sagt, da gebe es nun mal so »automatisierte Fingersätze«, wie einem zum Beispiel dieser gefalle: KiBeG, also Kinderbetreuungsgesetz. Der mal ehrfürchtige, mal naserümpfende, in jedoch kaum einem Naumann-Porträt fehlende Hinweis auf dessen Sprachgewandtheit und literarische Bildung verführt dazu, mit ihm jetzt mal das Thema zu wechseln, man hat ja schließlich die Plakate gesehen, die Broschüren eingesteckt und sogar am Hamburg-Becher genippt. Kinderarmut, natürlich, aber kann einem das nicht auch Kurt Beck erzählen, kann man Naumann jetzt vielleicht mal kurz mit ein paar schönen Formulierungen von Karl Kraus, seinem Karl Kraus!, aus der Argumentationsroutine herausreißen? Einen Versuch ist es wert: »Sozialpolitik ist der verzweifelte Entschluss, an einem Krebskranken eine Hühneraugenoperation vorzunehmen.« Berater Beling guckt alarmiert, trotzdem, eine noch, vielleicht doch ganz hilfreich bei der Verdauung des Fernsehstotterns: »Politik und Theater: Rhythmus ist alles, nichts die Bedeutung.« Man müsse die Schriften von Karl Kraus schon im zeitlichen Kontext ihrer Entstehung lesen, empfiehlt Naumann – aber das hätte einem, etwas anders formuliert gewiss, wahrscheinlich auch Kurt Beck sagen können.
Immerhin, am Abend soll es ja dann literarisch werden, denn da trommelt die SPD in einem Kultur-Veranstaltungsgebäude zum »Endspurt-Auftakt«, und wer da – Hansestadt, Kultur, Trommeln, SPD – nicht fehlen darf, versteht sich wohl von selbst. Aber bevor Günter Grass sich alsdann ein weiteres Mal »mahnend« in den Hamburger Wahlkampf »einmischen« wird, muss erst noch, aus gegebenem Wahlanlass heute in Hamburg, das Partei-Präsidium tagen und am Nachmittag gemeinsam ausschwärmen und in der Fußgängerzone und in einem Einkaufszentrum rote Rosen verteilen.
The Show must go on!, sagt ein Mitarbeiter Naumanns jetzt und klopft dabei mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr.
»Das soziale Deutschland« steht an der Wand, vor der Finanzminister Steinbrück, Parteichef Beck und Kandidat Naumann ein paar Stunden später der Presse gegenübertreten, in einem Haus mit der zu dieser Unterstützungsvisite der Parteioberen gut passenden Adresse »Trostbrücke 6«. Die Journalisten haben viele Fragen an Steinbrück und Beck, die seit heute laufenden bundesweiten Razzien entlang der teuren Liechtenstein-DVD interessieren aktuell mehr als der Hamburger Wahlkampf. Naumann probiert beharrlich, die Verschiebung der HSH-Nordbank-Bilanzpressekonferenz auf die Zeit nach den Wahlen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu hieven, das probiert er seit Tagen, aber – maritim gesprochen – es verfängt nicht so ganz, das Thema. Mit Ausnahme seiner umständlich gedrechselten Nachtragsschlagfertigkeit zum vorabendlichen Gestotter scheint er heute nichts unterbringen zu können. Vielleicht geht es so: Er vermute das SED-Vermögen in Liechtenstein, sagt Naumann nun, einmal mehr einen Tick zu raffiniert. Er guckt sich stolz um, haben es alle gehört? SED-Vermögen! In Liechtenstein! Soviel zur Linken, soviel zu Liechtenstein – und beides in einem, das war doch jetzt wirklich nicht schlecht?
»Im klassischen Sinne des Wortstamms« möchte Naumann nun noch irgendwas verstanden wissen. Die Journalisten schreiben so was aber nicht mehr mit, sie haben Naumann immer wieder geduldig zugehört in den letzten Monaten, und irgendwann reicht es dann auch, Becks Bierzeltrhetorik und Steinbrücks gutgelaunte Brutalkürze lassen sich einfach besser zitieren.
Im »Billstedt-Center«, einem großen Einkaufszentrum in einem Stadtteil mit eher geringer Segler-Dichte, warten zwischen Eiscafé, Parfümerie, Discount-Kleiderladen und Mobiltelefon-Geschäft an einem SPD-Stand Wahlkampfhelfer mit Eimern voller roter Rosen auf Beck und Naumann. Auch Gerda Grossmann steht dort, sie ist seit 49 Jahren SPD-Mitglied, hat einen Zitronenkuchen gebacken und schneidet schon mal ein großes Stück für den Kandidaten zurecht. Als Naumann ankommt, sagt er leise, er wolle jetzt ins Bett. Blumenbündel werden ihm gereicht, auf geht’s, Gerda Grossmann steht da mit ihrem Stück Kuchen, hält es Naumann hin, doch zwischen ihrem Gesicht und seinem baumelt ein Plakat, »70% sind mit der Hamburger CDU-Bildungspolitik unzufrieden« steht da drauf – und so kommen sie nicht zueinander. Straßenwahlkampf kennt keine Metaebene, aber das Einkaufszentrum hat mehrere Etagen. Naumann geht wie in Trance an den Läden vorbei und drückt den Einkaufenden Blumen in die Hand: »Guten Tag, darf ich Ihnen eine Blume schenken, bitteschön. Gehen Sie wählen am Sonntag?« Die Menschen murmeln zurück, es ist ein beiderseitiges Kopfschütteln. »In einer Zeit, wo nur noch E-Cards verschickt werden, kommen so echte Blumen gut an«, sagt Sprecher Beling, mit Nachschubblumen im Arm neben Naumann herlaufend.
Naumann bleibt kurz stehen, schüttelt den Kopf: »Die Bürokratie in der Behörde ist derart komplex, dass man von Chaos sprechen kann.« Jemand hatte ihm gerade im Tausch gegen die Blume seinen Ärger mit dem Wohnungsamt dargelegt. Ein Mädchen sagt jetzt zu Naumann: »Ich so zu meiner Lehrerin heute: ›Ich geh nicht wählen.‹ Und sie dann so: ›Wirf deine Stimme nicht weg‹ und so. Und ich dann so zu ihr: ›Ja, wieso, ich kenn mich doch mit Politik gar nicht aus‹, und dann meinte sie nur so: ›Trotzdem‹.« Naumann nickt und schlägt vor: »Dann wählen Sie doch einfach den, der Ihnen diese schöne Blume geschenkt hat! Michael Naumann heiße ich.« Das Mädchen kreischt auf: »Sie sind Naumann? Voll krass!«
Eindrucksvolle Begegnungen seien das zum Teil, sagt Naumann. Und als Beweis repetiert er zum aberhundertsten Mal den unterwegs aufgesogenen Biographien-Nektar: Ein Ehepaar, das mit seiner Tochter auf 60 Quadratmetern wohnt – und dann die Deutsch-Russin in Hamburg-Bergedorf, Stalingrad überlebt!
Auf der Höhe des Imbiss-Standes »Potato Point« trifft Naumann auf den ebenfalls Blumen verteilenden Kurt Beck. »Ich zisch ab, wir sehen uns heute Abend«, sagt Naumann erschöpft. Beck nickt, Naumann verlässt das Einkaufszentrum – und Beck verteilt weiter Blumen, es käme ihm nie in den Sinn, eine einzige Blume unverteilt zu lassen, »so, noch zur Frau, die hier die Leude satt macht«, dröhnt der Parteivorsitzende im Selbstgespräch gemütlich vor sich hin und gibt der Verkäuferin des Potato Points eine Rose.
Als »weltgewandt, schlagfertig und intellektuell« war Michael Naumann den Zuschauern des TV-Duells vorgestellt worden. Der Moderator sagte zu Naumann, er habe sich ja nun »in die Niederungen der Politik« hinabbegeben. Darauf entgegnete Naumann, jedes vierte Kind lebe in Armut.
Hellmuth Karasek, der Naumann lange kennt, sagt, ihn erinnere Naumanns Mission an Karlheinz Böhms Aufopferung für Afrika. Als er Naumann vor einiger Zeit mal gefragt habe, wie es ihm gehe, habe der geantwortet, es gehe ihm gut, er habe übrigens sieben Minuten Beifall bekommen für eine Rede. Karaseks Frau sagt lächelnd, ein Hamburger Bürgermeister müsse gut aussehen in einem blauen Anzug.
Es ist Abend geworden. Im Ausrichtungssaal der Endspurt-Sause gibt es doppelt so viele Stühle wie Zuhörer. Am Eingang kann man für drei Euro die rote Naumann-Tasse kaufen, für 25 Euro einen »Original-Druck« von Günter Grass: ein Hahn mit rotem Kamm. Für fünf Euro gibt es das Grundsatzprogramm der SPD als Hörbuch, gelesen von Wolfgang Thierse, inklusive des vierzehnminütigen Hits »Bessere Bildung, kinderfreundliche Gesellschaft, starke Familien«.
Nach einer bestürzend einfältigen Grass-Rede fragt Naumann die Anwesenden, ob es einem nicht – wie ihm am Abend zuvor geschehen – die Sprache verschlagen dürfe, wenn die Bilanzpressekonferenz der Landesbank verschoben, die Augenklinik des Universitätskrankenhauses Eppendorf verkauft und weiterhin behauptet werde, der Haushalt sei ausgeglichen, trotz 659 Millionen Miesen. Der wärmende Applaus sagt: doch. Doch, da darf es einem die Sprache verschlagen. Ein guter Übergang zu Kurt Beck, der anschließend den Saal in Grund und Boden redet. »Michael war jetzt zehn Monate unterwegs, auch an den Wochenenden, liebe Freundinnen und Freunde!«
Wörter wie »Verantwortungskorridor«, stark vereinfachende Ausrufe wie »Die Krankenschwester, der Facharbeiter!« und Formulierungen wie »Die Kultur in ihrer Breite und Durchdringung« fliegen am beurlaubten »Zeit«-Herausgeber vorbei in den halbleeren Saal.
Mike, müssen Sie das wirklich machen?
Er tue seine Pflicht, hat Naumann gesagt, und er tue sie gern; zwölf Pfund Gewicht habe er im Wahlkampf verloren, und das täte ihm gut. Grass nickt. Bei Naumanns SED-Liechtenstein-Formulierung hat er fast neidisch geguckt, na ja, ihm war immerhin »das Alphabet des Asozialen, von Ackermann bis Zumwinkel« eingefallen.
Ist es nicht rührend, wie die alten Herren der SPD helfen? Ja, schon – oder es ist ganz einfach genau umgekehrt.
Diskutieren mit Günter Grass
Es ist ein 2001er Bordeaux »St. Moritz«, der da über Lesepult und Manuskriptseiten tropft, auch der braune Pullunder des Nobelpreisträgers hat etwas abbekommen, und bevor Günter Grass nun den 900 versammelten Göttingern aus seinem Tagebuch des Jahres 1990 vorlesen kann, muss erstmal gewischt werden. »Ein etwas feuchter Anfang«, murmelt Grass. Sein Verleger Gerhard Steidl, der hier von Göttingen aus »die Weltrechte« des Autors vermarktet, räumt das zerbrochene Weinglas ab, Grass hatte es auf die nicht ganz waagerechte Kante des Stehpults gestellt, von wo es langsam heruntergerutscht war. Es riecht also leicht säuerlich, als die Lesung beginnt.
Hinter Grass, auf die Leinwand des großen Hörsaals, ist das Cover seines just veröffentlichten 1990er-Tagebuchs projiziert: »Unterwegs von Deutschland nach Deutschland.« Zwei, natürlich von ihm selbst gezeichnete Heuschrecken, die in entgegengesetzte Richtungen streben, eine gen Westen, die andere gen Osten; wie eben bei Grass üblich: dass der Fall klar ist. Heuschrecken! Kapiert?
»Es muss schon Ungewöhnliches anstehen, das mich in die Pflicht nimmt«, liest Grass nun aus seinen Tagebucheintragungen vom 1. Januar 1990 vor. Selbstkritik oder gar Humor sind keine Fertigkeiten, in denen er sich je besonders hervorgetan hat, und da solche Beweggründe wohl ausscheiden, ist es doch immerhin mutig zu nennen, dass er ausgerechnet die Aufzeichnungen jenes Jahres für seine erste nicht literarisierte Tagebuch-Veröffentlichung ausgesucht hat – in keinem anderen Jahr hat Grass nachweislich größeren Unfug geredet und geschrieben als eben 1990, dem Jahr nach dem Mauerfall, dem Jahr der Wiedervereinigung. »In die Pflicht genommen« heißt also: Er konnte nicht anders. Er musste.
Gleich am 1. Januar macht er sich und dem Leser klar, dass dies kein gewöhnliches Tagebuch sein wird, sondern eine permanente Levitenlese: den Deutschen mal ins Stammbuch schreiben, wo der Hase läuft und der Hammer hängt, und »mich auch in beide Wahlkämpfe (Mai und Dezember) einmischen«.
Ein interessanter und für diese Lesung wegweisender Versprecher gleich zu Beginn: »Als wollte ich mich positiv aufrüsten« steht da im Buch, aber Grass sagt »polit…« statt »positiv«, verbessert sich dann; sowas passiert dem geübtesten Vorleser. Dennoch stimmig, dass gerade Grass »politisch« auch dort sieht, wo es gar nicht steht. Politisch aufrüsten also. Einer muss es tun!
Ein Mitarbeiter des Steidl-Verlags hatte, bevor das Weinglas kippte, ein paar einleitende Worte gesprochen, sehr nervös war er und nuschelte vom Blatt ab, daher war nicht genau zu verstehen, ob er die DDR des Jahresbeginns 1990 als »das künftige Anschlussgebiet« bezeichnete oder als »Einschlussgebiet« oder »Abschussgebiet«, irgendwas in der Art jedenfalls, und er betonte dieses Wort gesondert, nahm Mittel- und Zeigefinger zuhilfe, um drumherum distanzierende Anführungsstriche in die Luft zu winken. Die Ungeheuerlichkeit solch eines derart leicht dahingesagten Begriffs löste keinerlei Widerstand im Publikum aus, es wurde genickt, und man war sich also hier unter schuldbewussten Westdeutschen einig, dass damals einiges schiefgelaufen ist; was genau, würde Grass ja dann gleich erklären. »Für interessante Gedanken ist eine Universität ein guter Ort«, hatte der Verlagsmitarbeiter noch auf die an die Lesung anschließende »Möglichkeit zur Diskussion« hingewiesen.
Stimmt eigentlich, dachte ich mir da, holte »Hamit«, Walter Kempowskis Tagebuch des nun von Grass durchgaloppierten Jahres 1990 aus der Tasche, legte die beiden Bücher nebeneinander auf den Hörsaalklapptisch vor mir und blätterte parallel darin, das versprach interessante Gedanken. Der gebürtige Rostocker Kempowski, der acht Jahre in Bautzen eingesessen hatte, erlebte und beschrieb das Wiedervereinigungsjahr so ganz anders als Grass. Die Teilung Deutschlands hatte er über Jahrzehnte – verdrossen zwar, aber unermüdlich – als widernatürlich bezeichnet, die Einheit herbeigesehnt; das ward nicht gern gesehen, das galt als nationalistisch und igitt. Anders als Grass war Kempowski Gewohnheits-Diarist, es musste nichts »Ungewöhnliches anstehen«, das ihn »in die Pflicht nahm«, und schon deshalb sind seine Tagebücher literarisch dem Grass’schen Gedröhne weit überlegen. Zeitlebens hat es Kempowski geschmerzt, dass er von tongebenden Zirkeln gemieden, ja diffamiert wurde, doch für sein Schreiben muss man diese Randstellung heute, im direkten Vergleich mit Grass, wohl als Glück bezeichnen. Im Januar 1990 plant Kempowski Ausflüge in seine alte, nun endlich wieder problemlos erreichbare Heimat, während Grass im selben Monat darlegt, wie er sich ins Rad der Geschichte zu werfen gedenkt, jederzeit überzeugt, ohne sein Gemahne werde alles ein schlimmes Ende nehmen, Großdeutschland und Weltuntergang inklusive. Bei Kempowski mischen sich Freude und Angst, selbst eine Fahrt nach Bautzen will er sich zumuten, und die Aufzeichnungen dieser Gedanken und Erlebnisse sind logischerweise viel bedeutender als das Grundsatzthesen-Gestammel von Grass, der immer gleich alles zu durchschauen glaubt, durch nichts zu überraschen oder zu überwältigen ist, nein, er – wenigstens er! – ist das unverzichtbare Korrektiv des Weltenlaufs.
»Will versuchen, in der Frankfurter Rede das angebliche Recht auf deutsche Einheit im Sinne von wiedervereinigter Staatlichkeit an Auschwitz scheitern zu lassen«, liest Grass nun den Göttingern seine staatsmännischen Größenwahnvorstellungen vom 2. Januar 1990 vor. Niemand im Saal lacht darüber, nein, das ist ernst gemeint und wird ernst genommen. Gelacht wird bei Wörtern wie »Literaturquartett«, »Kotzen«, »Heidepark« oder »Schirrmacher«, man ist sehr selbstgewiss in diesem Saal, man ist im Bilde und weiß Bescheid.
»Aber die Blechtrommel«, wird einem immer entgegengehalten, wenn man sich kritisch zu Werk oder Person Grassens äußert. Schön und gut, aber die letzten Grass-Bücher, sind die gut geschrieben? Sind die interessant? War seine Empörung über die Diskussionen, die das Bekenntnis zu seiner früheren Mitgliedschaft in der Waffen-SS auslöste, nicht einfach nur verlogen und widerlich?
Nein, nein: ein kleiner Nebensatz in Roman und Interview, derart ausgeschlachtet! Kampagne! Natürlich.
Davon abgesehen: Steht nimmermüdes Eingemische und Politgedröhne einem Schriftsteller wirklich gut? Ist die Beachtung gerechtfertigt, die jeder wie geistesschlicht auch immer formulierten Weltgeschehenskommentierung aus dem Hause Grass zuteilwird?
»Schrieb gestern noch rasch und konzentriert zwei Seiten, um sie an Augstein zu schicken, der mir versprach, für den Abdruck zu sorgen.«
Aber: Die Blechtrommel. Ja ja, schon gut.
Grass steht da vorn als rotweinbesprenkelte Karikatur eines politischen Schriftstellers. Politisch ist, wenn möglichst konkret über Politik geredet wird, je mehr, desto besser. Im Auditorium lauter nickende Köpfe: Gut, dass wir unseren Großgünter haben, wir Deutschen sind ein gefährliches, von Ganoven regiertes Volk, es steht nach wie vor schlimm um unser Land – nicht auszudenken, was erst geworden wäre, wenn wir Grass nicht gehabt hätten.
Und es ist ihm wohl nachzusehen, dass das verlässlich große Echo auf all seine stets hochwichtigen Debattenbeiträge, Großpodiumsverlautbarungen und all die »Streitgespräche« mit Augstein, Brandt und wem immer zwangsläufig dazu führen musste, dass er sich ganz selbstverständlich für das Nationsgewissen hält – wer so viel Gehör bekommt, wird taub für die eigenen Fehler und Irrtümer; wer derart im Licht steht, wird blind.
Den vorgetragenen Tagebuchpassagen zufolge war die entscheidende Frage des Jahres 1990, ob Günter Grass seine SPD-Mitgliedschaft würde aufrechterhalten können oder nicht.
»In die Suppe spucken« möchte Grass mit diesem Buch, und zwar allen Wiedervereinigungs-Festrednern, das hat er in den letzten Wochen immer wieder gesagt, und er sagt es auch an diesem Abend. Dass derart notorisches Ein- und Mitmischen, wie er es sich zur Gewohnheit gemacht hat, eine Grundzutat jener gemeinten Suppe ist, fällt ihm offenbar nicht mehr auf.
Bisschen blättern im Kempowski: »An Grass trauen sie sich nicht ran. Der große Rauner faselt von Auschwitz, dass uns die Ermordung der Juden verpflichte, die Teilung aufrechtzuerhalten. (…) Was die Teilung Deutschlands mit Auschwitz zu tun hat, kann einem niemand erklären. Die schreien einen gleich an, wenn man danach fragt.« Dazu kommt es dann: Nach 90 Minuten Tagebuch- und Levitenlese soll diskutiert werden. Da sich zunächst niemand meldet, nehme ich mein Kempowski-Buch als Muthalt in die Hand, erbitte das Mikrophon und spucke also in die Suppe. Ich habe darin nicht so viel Übung wie Günter Grass, daher bin ich nervös und kann mich natürlich nicht an den Wortlaut meiner »Einmischung« erinnern. Sagen jedenfalls wollte ich:
Es ist läppisch, was wir hier über das Jahr 1990 gehört haben, verglichen mit Kempowskis Tagebuch desselben Jahres. Mich macht es zornig, wie Kempowski abgetan wurde als rechter Spinner, auch und gerade von Grass. Es ist ein Skandal, dass in unserem Deutschunterricht vor lauter Grass und Christa Wolf nie Platz für Kempowski war. Kempowskis Tagebücher sind so viel besser geschrieben als dieses von Grass, und sie enthalten viel Mutigeres und Interessanteres zur Wiedervereinigung, und man kann nur staunen, wie diametral zur literarischen Bedeutung die Aufmerksamkeit in Deutschland verteilt wurde. Und es ist doch einigermaßen verwunderlich, dass Kempowski zeitlebens vergeblich darauf warten musste, seine Jahre im Bautzener Zuchthaus als politische Haft anerkannt zu bekommen, und dass Grass ihm nie zur Seite gesprungen ist, was ihm doch ein Leichtes gewesen wäre! Und dass er, Grass, hier daherlabern darf, wie er mit Pfarrer Führer über Deutschland nachdenkt, und kurz drauf dann seiner Verwundung als 17-jähriger Waffen-SS-ler am 20. April, dem Geburtstag des Adolf Führer, gedenkt. Dass das einfach so durchgeht! Dass dieser Grass dieses Rederecht hat!
Das kommt natürlich nicht gut an im Saal, klar. Ich bin jetzt der Partyschreck, die Nervensäge. Unangenehm. Grass kann die Sache routiniert abbügeln, bekommt Applaus, und dieser Applaus sagt: Du Blödmann da, sei still, lass unseren Günter in Ruhe. Kempowski sei doch ein fleißiger Autor gewesen, und es sei doch schön, dass so verschiedene Ansichten und Bücher existierten, gibt Grass mir mit auf den Weg.
Andere Fragen, bitte? Natürlich: Wie genau war das noch mal mit der Treuhand? Was ist mit der SPD los, was ist von der Linken zu halten, ist es nicht ein Skandal, dass in Ost und West noch immer unterschiedliche Löhne für die gleiche Arbeit gezahlt werden? Kann er alles erklären da vorn. Spricht hier eigentlich ein Altkanzler oder ein Schriftsteller, fragt man sich dann doch.
Ich probiere es noch einmal mit Kempowski, wohl wissend, dass es spätestens jetzt nervt. Ich solle bitte einsehen, dass wir in einer Demokratie leben, belehrt Grass mich und sorgt dafür, dass ich ausgelacht werde. Störer lächerlich zu machen, ist für einen Bühnenprofi die leichteste Übung.
Dahinten bitte, ja, noch eine Frage? Die Heuschrecken auf dem Cover. Ach so, natürlich, alles so simpel wie irgend möglich, tatsächlich führt Grass nun Müntefering an, die Heuschrecken, Hedgefonds also, und immer so weiter. Er als über 80-jähriger, holt Grass dann noch mal ganz groß aus, fordere uns junge Leute auf, Widerspruch anzumelden und aufzustehen – es sei schließlich unser Land. Das Asylrecht! Die Autohäuser im Osten! Die Kali-Industrie! Die Krankenkassen! Schäuble! Wahlbeteiligung! Pah! Der ehemalige Postchef läuft frei herum, während jeder noch so kleine Ladendieb ins Gefängnis kommt! Aufstehen, Leute, Widerspruch, Hintern hochkriegen!
»Vielen Dank, dass Sie Tacheles geredet haben«, dankt eine Dame mit lilafarbenem Halstuch Grass abschließend, »jedes Ihrer Worte heute hat mir aus der Seele gesprochen«.
Dann signiert Grass viele hundert Bücher. Neben ihm wacht Verleger Steidl, klappt die Bücher auf, legt sie ihm zur Signatur vor. Am Büchertisch kaufe ich das von Kurt Beck herausgegebene Buch »›Schlagt der Äbtissin ein Schnippchen, wählt SPD!‹ – Günter Grass und die Sozialdemokratie« und stelle mich ganz hinten an in der langen Schlange vor dem Signiertisch. Als ich schließlich vor Grass stehe, sagt er spöttisch: »Ah, mein Freund!«
Tja nun. Ich bin noch immer ziemlich aufgeregt, peinlich war das Ganze schon für mich, und doch empfand ich meine Wortmeldung als richtig. Und hat nicht Grass selbst genau solches Verhalten eingefordert? Aufstehen, die Meinung sagen, auch wenn es mal nicht gar so bequem ist? Grass ist ganz ruhig. Und ich Depp fange wieder mit Kempowski an. Das sei ja eine regelrechte Obsession, sagt Grass. Mag sein, fahre ich fort, aber ich fände es nun mal unglaublich, dass er, Grass, sich für den »Tabubruch« loben ließ, mit seiner Novelle »Im Krebsgang« die Versenkung des deutschen Flüchtlingsschiffs »Wilhelm Gustloff« thematisiert zu haben, lange nachdem Kempowski dies im »Echolot« getan hatte; und dass Grass damals obendrein gesagt hat, er habe dieses Thema einfach nicht den »Rechtsgestrickten« allein überlassen wollen – damit hat er doch wohl Kempowski gemeint, oder nicht?
Schon klar: Diskutieren heißt für Grass, dass er mal rasch seine Meinungen durchgibt. Er guckt mich mitleidig an.
Letzter Versuch, zu ihm durchzudringen: »Herr Grass, Sie rufen zum großen In-die-Suppe-Spucken auf, und tut man das, benehmen Sie sich, als seien Sie Helmut Kohl, und man bedränge Sie, nun endlich die legendären Spendernamen zu nennen.«
»Günter Grass« schreibt er dennoch gütig in mein Exemplar des von Kurt Beck herausgegebenen Buchs, gibt es mir zurück und sagt, ich solle nicht so dummes Zeug reden. Ein bisschen riecht das Buch nach Rotwein, aber nur ein ganz kleines bisschen.
Protest
Es ist kalt und grau, als Barbara sich in die Sonne verwandelt. Barbara ist Aktivistin bei Attac, dem »globalisierungskritischen Netzwerk«, und ihr Sonnenkostüm hat irgendein Seminar gebastelt; »Solarenergie« steht auf der Brust des Kostüms. Die Sonne ist also die Gute, sie hat große Hände, mit denen haut sie gleich die Bösen.
Kasperletheater vor dem Internationalen Handelszentrum in der Berliner Friedrichstraße – die Passanten interessiert das alles nicht so sehr, nichtmal die Polizei ist da, aber die Attac-Kämpfer verteilen unbeirrt Zettel, auf denen steht, dass ihr gleich beginnender Protest gegen die vier Energieversorger EnBW, E.on, RWE und Vattenfall »eine phantasievolle Aktion« gewesen sein wird. Barbara fragt ihre Freunde, wer die Trillerpfeifen hat, denn die braucht man, um so richtig schön zu nerven. Also werden gelbe Attac-Trillerpfeifen verteilt, und dann kann es losgehen.
Vier als Könige verkleidete Jungs haben Kartons in der Hand, darauf stehen Lafontaine-Kampfbegriffe wie »Rekordgewinne« und »Preiserhöhung«. Da müssten doch die vorbeieilenden kleinen Männer und Frauen von der Straße aufhorchen, werden die Aktivisten im Bastelseminar sich gedacht haben. Jeder König stellt einen Stromversorger dar; Jutta mault in ein Megaphon, dass hier »jede Menge wütende Leute« stünden, die »stinksauer auf die Konzerne« seien. Ungefähr zehn wütende Leute sind es tatsächlich, Könige und Sonne mitgerechnet, aber wenn man die Kamerateams, Fotografen und Reporter dazuzählt, stehen nun fast 30 frierende Menschen auf dem Bürgersteig.
Die Sonne verhaut jetzt symbolisch die Könige, Jutta und ihre paar Kampfgenossen helfen der Sonne, die Könige ordentlich zu drangsalieren, sie als »Klimakiller« und »Preistreiber« zu beschimpfen, und die armen, nein, Verzeihung, die total bösen Könige rufen so Sachen wie »Wir wollen unser schönes Geld behalten«, »Haut ab, Bürger« oder »Wir brauchen die Politiker, die unseren Wahnsinn erlauben«. Sie fliehen Richtung Handelszentrum, dem Sitz der Berliner RWE-Repräsentanz, und auf deren Firmenschild schreibt Loni mit Edding ihre Meinung: »Lügen-Bande«, »Geldsammel-Zentrum« und so. Eine Empörungsschwester schaut ihr begeistert über die Schulter: »Au ja, schreib ›Raubtierkapitalismus‹, das ist gut!«
Megaphon-Jutta fordert nun »Enteignung, Zerlegung und demokratische Kontrolle« der Könige, also der Konzerne. Wenn man sie fragt, ob Begriffe wie »Demokratie« und »Enteignung« sich in so enger Nachbarschaft gut vertragen, sagt Jutta, das gehe sehr wohl, sie habe das mit diversen Juristen besprochen. Und fragt man Jutta dann noch, ob ihr nicht kalt sei in ihren Sandalen, sagt sie, auch das gehe prima, ihre (verschiedengemusterten) Wollsocken seien warm genug.
Als der von Rasmus dargestellte König RWE gebeten wird, noch etwas in eine Kamera zu sprechen, sagt Rasmus, nee, der Chris könne viel besser sprechen, er selbst sei mehr so der Denkertyp. Also entledigt er sich geschwind des Kostüms, Chris zieht es über und spricht Sätze mit ziemlich vielen Ähs und Irgendwies in die Kamera. Dann haut Sonne Barbara ihm auf die Krone – und als Beobachter hat man beim Weggehen so abstruse Impulse wie den dringenden Wunsch, kurz mal in die FDP einzutreten. Einfach so, als phantasievolle Gegenaktion.
Die Kanzlerin telefoniert ins Weltall
»Yes, hello …«, spricht Angela Merkel ins Mikrophon, etwas unsicher noch, man telefoniert schließlich nicht täglich mit der Besatzung eines Raumschiffs, schnell aber wird die Kanzlerin stimmfester, sagt auf Russisch und dann auch auf Deutsch: »Guten Tag!« Hinter ihr auf einer Leinwand sieht man die Astronauten in der Internationalen Raumstation ISS wie zum Gruppenbild versammelt; es dauert ein bisschen länger als bei normalen Telefonaten, bis der Gruß angekommen ist, aber nun nicken die Astronauten, das Ferngespräch hat begonnen.
Die Kanzlerin steht auf einer Bühne im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 300 Kilometer himmelaufwärts kreist die Raumstation, neuerdings durch das Forschungslabor »Columbus« bereichert. Wie es ja nicht allzu selten der Fall ist, hat die Bundesrepublik auch bei diesem »europäischen Gemeinschaftsprojekt« den Großteil der Kosten übernommen; unter anderem deshalb ist natürlich ein Deutscher mit an Bord, unser Mann im All: Hans Schlegel. Dem war Anfang der Woche die ungewohnte Umgebung etwas auf den Magen geschlagen, er erholte sich aber schnell und konnte am Mittwoch mit seinem amerikanischen Kollegen Rex Walheim hinaus ins All spazieren und einen Stickstofftank austauschen. Ein bisschen sieht es aus, als säßen die Astronauten in einem Partykeller und guckten sich gemeinsam ein Fußball-Länderspiel an, Deutschland gegen Frankreich, denn hinter ihnen an der Raumstationswand hängen deren Flaggen. Aber das sieht nur so aus, in Wahrheit ist »dort oben« (Merkel) natürlich mit der Inbetriebnahme des neuen Labors allerhand zu tun.
Manchmal erkennt man ja mit etwas Abstand alles etwas besser, und so fragt die Kanzlerin nun Hans Schlegel, wie es unserem Planeten so gehe, von oben betrachtet, und da wird der Astronaut überraschend unwissenschaftlich, spricht von »zarten Farben« und der »Endlichkeit« unseres Planeten. Das Gespräch verläuft jetzt wie mit in jeder Hinsicht entfernten Verwandten: große Herzlichkeit, die aber etwas aneinander vorbei driftet. Wirklich nahe, in Zungennähe liegende Fragen werden höflichkeitshalber ausgespart, zum Beispiel, wie das da oben mit dem Klo funktioniert und wie und ob man da oben die Zumwinkel-Angelegenheit so sieht. Merkel sagt jetzt, dass die quality ja great sei, also listening wäre irgendwie like neighbourhood. Die Kanzlerin kommt allmählich in Fahrt, gleich werden die Männer im Saal mit einer Mischung aus Gönnerhaftigkeit und schlecht unterdrückten Unterlegenheitsempfindungen sicherheitshalber sehr lachen, denn nun thematisiert die Kanzlerin die männerseits stets gefürchtete, von ihr immer wieder herrlich zweischneidig lächelnd vorgetragene Männer-Frauen-Sache: Sie fragt die ISS