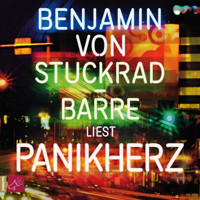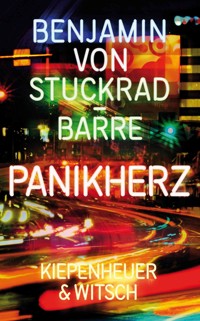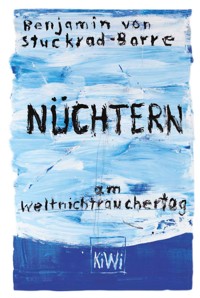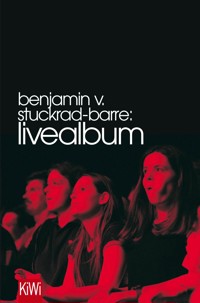
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Autor auf Lesereise, unterwegs mit dem eigenen Werk. Wie verändert sich ein Mensch, wenn er jeden Nachmittag Interviews und jeden Abend den Entertainer gibt? Das Foto in Zeitschriften vertrauter erscheint als das Spiegelbild? Was sucht und findet man auf einer Bühne und dahinter, wer steht davor und wer steht das durch? »Livealbum« erzählt von Höhenflügen und Abstürzen, von skurrilen Erlebnissen mit dem Kulturbetrieb und dessen Personal, von überwältigendem Feedback und irritierenden Rückkopplungseffekten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Benjamin v. Stuckrad-Barre
Livealbum
Erzählung
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Benjamin v. Stuckrad-Barre
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
In der Moral eines Unterhaltungskünstlers muss nur eines Priorität haben, das Wissen nämlich, dass die Leute, die gekommen sind, ernsthaft bedient werden wollen.
FALCO
dies – wie ohnehin alles
für Anke
to know you is to love you
to love you is to be part of you
(Versmaß! Aber von Madonna gesungen, kommt es magischerweise hin.)
Let me entertain you!
Show #1
Unmöglich. DAS konnte es doch nicht sein. Ich guckte durch das mit schwarzen Vögelwarnvögeln beklebte Fenster hinein in die hall of blame – da saßen 40 Neunjährige! Andererseits natürlich besser als neun 40-Jährige, also ging ich durch die mit meinem Plakat beklebte Tür.
– Guck mal, da isser, murmelten die Kinder. Ich sagte in bester Michael-Schanze-Manier
– Guten Abend, na? Dann wollen wir mal loslegen, oder?
Statt mir zu antworten, kicherten sie und riefen
– Frau Bender, er ist daha!
Da kam Frau Bender um die Ecke, und ich sagte den Vertretersatz Nummer 1
– Ah, Frau Bender, richtig, wir hatten telefoniert.
Frau Bender schüttelte mir die Hand und bestätigte gerne, dass wir telefoniert hatten. Richtig. Viel sonst war leider nicht zu sagen, und ich war deutlich zu früh da.
– Kommen Sie doch erst mal mit in mein Büro.
Ja, gerne. Backstage wollte ich. Aber es gab ja gar keine Bühne, bloß eine Ecke mit Tisch, Lampe und einem Mikrofon, mit dem wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg schon Hörbücher von Ernst Jünger aufgenommen worden waren: »The Stahl Tapes Vol. 1–7«; also so ein GANZ altes Mikrophon, bei dem man auf eine Sprechtaste drücken muss, als würde man den »nächsten, bitte« reinrufen.
– Hier können Sie sich aufhängen, probierte sie einen Witz.
– Da haben Sie recht, das ist ja alles ganz merkwürdig hier.
– Och, finden Sie?, wurde sie nun schnippisch und reichte mir einen dieser labbrigen schwarzen Plastikkleiderbügel, für die es überhaupt nur eine einzige Bezugsquelle gibt: mit »Bitte mitnehmen! Gratis!!« beschriftete Pappkartons vor dem Eingang schlecht laufender Boutiquen.
– Kleiner Scherz, sagte ich hilflos. Können wir?
Sie war beleidigt
– WIR können. Die Frage ist, ob SIE können.
– Ja, o. k., gut, also von mir aus können wir dann.
– Guten Abend, sprach ich in das museale Mikrofon hinein. Und – ein Wunder, dass sie nicht salutierend aufsprangen – im Chor scholl es zurück: Guten Aaaabend!
Mit einem Finger musste ich die ganze Zeit auf den Mikrofonknopf drücken, mit der anderen Hand das Buch aufhalten, denn noch stellten sich die Seiten auf, wenn man es aufgeklappt auf den Tisch legte. Am Ende meiner Lesereise würde das bestimmt nicht mehr so sein. Da wäre dann der Lack ab, der Leim auch, und das Papier gewellt, weil so viel Champagner draufgeflossen war. Rascheln, Husten, Lachen, Ratlosigkeit. Andere begannen ihre Welttournee in einem überfüllten Stadion in San Diego, ich in der Kinderbuchecke einer Samtgemeinden-Bibliothek in Bad Irgendwas. Etwas war schiefgelaufen, Koordinationsmängel, keine Ahnung. Ich wünschte meine in solch ausweglosen Situationen ganz bestimmt patent reagierende Agentin herbei. Sie würde mit einem einzigen Anruf aus Holland einen Bus Rentner herbeikommandieren, die den Saal vollmachten, also mit sich. Ich wollte ein Applausband! Und Bonbons für gute Stimmung. Ich wünschte, Jostein Gaarder zu sein, nur einen Abend lang, und solche Situationen zu lieben und für meine Arbeit zu benötigen, auf jeden Fall, das stand fest, mochte ich nicht mehr dort sitzen. Um die Bilderbücher-Rollcontainer schlängelte sich eine lange, verwanzte Plüschpython, auf der die Kinder saßen, an ihren Fingern lutschten und mich erwartungsvoll anstarrten. Ich begann zu lesen. Da kam einmal das Wort »Scheiße« vor, und sie lachten. Ich probierte es noch mal, baute einfach zwei Sätze später ein weiteres »Scheiße« ein – und es funktionierte, sie lachten schon wieder! Zustimmung ist dem Bühnenarbeiter der konstruktivste Ratgeber, doch sollte ich jetzt eine knappe Stunde lang dauernd Scheiße sagen? Und würden sich das die mitgekommenen Eltern bieten lassen? Die Eltern hatten sich an die sogenannten Packtische vor den Schließfächern gelehnt. Dort soll man die ausgeliehenen Bücher in die vorher weggeschlossenen Rucksäcke oder Taschen füllen, nach dem Entleihen, damit nicht so viel geklaut wird.
– Jaaaaa, sagte ich. Ich habe auch Musik mitgebracht. Wollen wir vielleicht ein bisschen Musik hören?
– O. k., warum nicht, war so der Tenor.
Gut. Neben mir stand auf einem Teewagen ein Kompaktanlagenmodell, das Jugendliche in den 80er-Jahren oft zur Konfirmation bekamen, heute ist man da technisch weiter, und es gibt viel bessere (zugleich billigere) Geräte aus Japan, Taiwan oder so. Kinderarbeit aber auch hier in der Bibliothek: Weil mein Buch viel zu selten das Wort Scheiße beinhaltete, musste ich improvisieren. Den Kindern war es ziemlich egal. Hauptsache, es passierte was.
– Wollen wir vielleicht Reise nach Jerusalem spielen?
Ein höchstens 11-Jähriger fragte, ob vorher eine Rauchpause drin sei.
– Jaa, ja klar, sagte ich, dankbar für jeden Vorschlag, dachte an die Eltern auf den Packtischen und revidierte schnell
– Nee, Quatsch, rauchen, dafür bist du doch noch viel zu jung, gewöhn dir das gar nicht erst an.
Da lachten alle Kinder, sie lachten lauter als bei jedem »Scheiße« zuvor. Das Eis war nicht gebrochen, aber Tauwetter setzte ein, notierte ich in den Blankoseitenanhang für eigene Beobachtungen und Weisheiten in meinem kleinen Taschenratgeber »Evangelische Kommentare für viele Lebenslagen«.
Dann spielten wir Reise nach Jerusalem. Die erste Runde gewann ein schielendes Mädchen namens Claudia, und ich schenkte ihr ein Buch, in das ich »für Claudia« reinschrieb, dabei sehr profihaft hochguckte und »Mit C, nehme ich doch an« sagte. C war richtig.
– Jetzt wollen wir mal eure Eltern spielen lassen, paktierte ich geschickt, und die Eltern winkten ab, aber die Kinder riefen alle zusammen einschüchternd »Angsthasen, Angsthasen, Angsthasen, Angsthasen!«, und, na gut, dann machten die Eltern doch mit.
Herr Schönefeld gewann, aber ich hatte kein Buch mehr zum Verschenken dabei, und da sagte der Herr Schönefeld netterweise, dass er das überleben werde. Herr Schönefeld hatte meiner Meinung nach auch geschummelt, denn zum Schluss, als nur noch er und die Frau Brandauer um den letzten verbliebenen Stuhl herumliefen und ich ganz laut den ungefähr zwölfminütigen Aphex Twin-Remix von Celine Dion laufen ließ, schlich er feige beinahe in der Hocke um den Stuhl herum, er saß schon fast und hat auch ein bisschen geschubst. Aber da es ohnehin keinen Preis für Herrn Schönefeld gab, sah ich davon ab, ihn nachträglich zu disqualifizieren.
– Gut, danke, das war’s, sagte ich, weil mir nichts mehr einfiel, und die genügsamen Dorfbewohner applaudierten freundlich, die Kinder holten sich Autogramme, jeder wollte plötzlich eins haben, weil irgendwer damit angefangen hatte. Im Zug hatte ich Autogramme schreiben geübt, verschiedene Varianten, übrig blieben der dadaistische Fußballprofikringel und der kompliziert ausgeschnörkelte Trickbetrügeralbtraum. Jetzt am Anfang fiel noch jede Widmung individuell aus. Einige Kinder kamen wieder und beschwerten sich
– Hier, bei Mario haben Sie viel mehr geschrieben.
Meine erste Lesung war überstanden, und nun gab es Geld. Hinterzimmer, Geldkassette, nachzählen, herrlich. Meine Agentin hatte mir erklärt, manchmal gebe es das Geld schon vorher, aber zumindest hier auf dem Dorf galt noch die alte Chris-de-Burgh-Regel: Don’t pay the ferryman – until he gets you to the other side. Ich unterschrieb eine Quittung, so ein Standardformular aus dem Schreibwarenladen, zu dem der Jingle gehört
– Tut’s der Kuli, ich hab sonst noch einen anderen, ah, er tut’s, gut, das Original behalte ich, und der Durchschlag ist für Sie, und dann bekam ich noch den Hotelschlüssel, denn nach 22 Uhr öffnet einem niemand mehr in Kleinstadthotels.
– Und jetzt gibt es sicher noch ein paar Fragen aus dem Publikum, mutmaßte die Bibliothekarin.
Wir gingen zurück in den großen Raum, und tatsächlich war niemand gegangen. Die Bibliothekarin verscheuchte die Eltern vom Packtisch, schüttete eine Tüte Chips und zwei Schachteln Butterkekse darauf aus, öffnete einen Kanister preisbewusstes Tafelwasser, ließ es in Plastikbecher plätschern und sagte
– So, und jetzt ist Party.
Ich setzte mich auf den Lesetisch, und um mich rum stellten sich die Kinder auf und fragten
– Rauchen Sie?
– Warst du schon mal betrunken?
– Von welcher Marke sind Ihre Schuhe?
– Wissen Sie, wie viel meine Uhr gekostet hat?
– Was wollen Sie später mal werden?
– Bist du verheiratet?
– Haben Sie das Buch selber geschrieben?
Ein Junge wedelte aufgeregt mit einem gelben Wegwerf-Fotoapparat, der beim Druck auf den Auslöser blechern loslachte. Der Junge sagte
– Gibt’s bei Aldi, kannste haben, ich habe noch ganz viele davon.
War es nicht Lesereisenden vielleicht wie Beamten untersagt, Geschenke mit einem Warenwert von über 8 Mark 90 anzunehmen? Ich nahm den Fotoapparat aber gerne und fotografierte den Jungen zum Dank.
– Hähähähähähä, sagte der Apparat.
Ein Vater, der die ganze Lesung über wackeldackelig genickt hatte, begann sehr langsam und ausführlich zu sprechen über »die Beatniks, die ja im Grunde ähnlich gelagert waren«, und da hauten die Kinder so langsam ab, liefen zwischen den Regalen umher und bewarfen sich mit Spielfiguren aus den dann noch unvollständigeren Spielesammlungen, das war ihnen wirklich zu langweilig mit den Beatniks. Die bei der Reise nach Jerusalem nur knapp unterlegene Frau Brandauer fragte
– Ist Ihnen John Lennon ein Begriff?
Ich fragte Wer? und Müsste er denn?, ging zum Hotel, durch den Nachteingang, und rief meine Agentin an. Die hatte mir schließlich untersagt, auf der Tournee jeden Abend auszugehen, weil ich dann schon am dritten Tag so aussähe, dass die Fotografen nur noch Briefmarkenbilder in den Blättern placieren mögen. Um trinken gehen UND postergroß in Regionalzeitungen abgebildet werden zu können, hatte ich, das war ein Kompromiss, für 70 Mark in einer BMW-Cabrio-Fahrerinnen-Drogerie eingekauft: eine Tonerdenmaske, irgendein Fluid und einen daily eye benefit genannten Gelee für jene Gesichtszone, die einem morgens immer am meisten leidtut. Die Verkäuferin hatte mich gefragt, ob sie es als Geschenk einpacken solle, und als ich das verneint hatte, sagte sie, so einen Freund hätte sie auch gerne, der seiner Freundin die Kosmetikeinkäufe abnimmt, das sei ja toll. Vorbereitet war ich also. Ich hatte mir sogar noch eine Grippeimpfung in die Armbeuge schießen lassen. Wie immer bei Spritzen war es zu Komplikationen gekommen, und jetzt hatte ich einen ziemlichen Junkiearm, mein kurzärmliges Lieblingshemd hatte ich also zu Hause lassen müssen.
Meine Agentin fragte mich, ob ich wüsste, wie spät es sei, und ich antwortete nicht, weil sie das rhetorisch gemeint hatte, dabei war es noch gar nicht so spät.
– Sag schon, wie war’s?, fragte sie dann aber doch noch, und ich hörte es ritschen und sie süchtig Luft einsaugen – erst mal eine Zigarette, meine Agentin war wirklich ein Profi, und ich erzählte ihr, dass es ganz in Ordnung war, dass ich aber nie wieder in einer Kinderbuchecke lesen wolle. Ist notiert, sagte sie. Am nächsten Tag sei ja eine Großstadt dran, da würde sie auch vorbeikommen und Händchen halten (mütterlich klang das, aber immerhin war sie mit 20 % an sämtlichen Einnahmen beteiligt, meine Rührung hielt sich also in Grenzen), sowieso sei dort alles entspannter und angenehmer, voller sogar, für den Anfang aber wäre doch so ein Warm-up nicht das Schlechteste. Na, eben.
Beim Frühstück am nächsten Morgen blätterte ich in der Regionalzeitung hektisch zum Kulturteil, obgleich ich ja wusste, dass die Kritik einer Abendveranstaltung immer erst am übernächsten Tag drin ist, zumindest bei einer Regionalzeitung, denn die sind wenigstens ehrlich: In der Nachtausgabe einer Großstadttageszeitung kann man ja oft nachlesen, wie das Konzert war, aus dem man gerade kommt. Diese Artikel beweisen aber immer, dass der Reporter höchstens ein Lied gehört und dann schnell ein Ohr zugehalten und 20 Zeilen Blödsinn durchs Handy gesprochen hat. Da wartet man doch lieber einen Tag. Und tatsächlich kein Wort von der Lesung, auch nicht in der Rubrik »Stadtgeflüster«. Ich hätte natürlich schon gerne gelesen, wie es war. Wie ich war. In der Großstadt, in die ich nun reiste, hätte ich sogar schon VORHER lesen können, wie ich wahrscheinlich gewesen sein würde. Da gab es so viele Blätter, dass alle Meinungen vertreten waren; einmal der Tipp des Tages, und ein Blatt weiter verbot der Ankündiger es seinen Lesern geradezu, die Lesung zu besuchen. Na ja, ich musste auf jeden Fall hin.
Show #2
Von der Kleinstadt zum nächsten Flughafen war es viel zu weit. Ich wünschte mir einen Tourbus. Ich war nicht in der Stimmung, vom Bus in den Nahverkehrszug zu steigen, weiter in den InterRegio, von dort in den InterCity und schließlich ins Taxi und dann endlich ins Flugzeug. Ich war kein Vielflieger, der letzte Flug lag Jahre zurück, war damals billig, in die Sonne und pauschal gebucht, und deshalb verhielt ich mich sehr uncool am Flughafen: 4 Stunden zu früh da, dann der Versuch, zollfrei einzukaufen, obwohl ich nur innerhalb Deutschlands flog, und schließlich gab ich auch noch mein Handgepäck aufs Band, obwohl ich doch im Flugzeug darauf zugreifen wollte, und deshalb musste die Mitarbeiterin der Fluggesellschaft das Band zurückschnurren lassen und das Papierschleifchen wieder abreißen. Hinter mir guckten die Menschen abwechselnd in den Himmel und auf ihre Uhren. Ich setzte mich in die Wartehalle und fing an, Gratiszeitungen zu lesen. Dann machte ich mir einen gänzlich würdelosen Tee: Der Fluggast selbst muss handwarmes Wasser auf Beutel gießen, und die Beutel gibt es nur in nicht schmeckenden Billigsorten wie Früchtecocktail und Ostfriesenmischung. Der Fruchtteebeutel entlässt rote Schlieren ins Wasser, und nach 3 Minuten schmeckt das Gemisch nach nichts mit Zitrone. Zum Glück war die Tasse sehr klein. Wäre sie größer gewesen, hätte ich sie aber auch ausgetrunken, denn wartend schöpft man jede Zerstreuungsoption demutsvoll aus.
Im Flugzeug saßen Henry Maske, Birgit Schrowange, Uwe Ochsenknecht, Ingo Appelt, Ilona Christen, Frank Elstner, Otto Waalkes und lauter andere Berühmtheiten, weil in der großen Stadt ja meine Lesung angekündigt war, haha, und obendrein sogar noch irgendein Fernsehereignis. Einige Minuten lang versuchte ich wie alle anderen Nichtprominenten an Bord, mich normal zu verhalten, also unauffällig, niemanden um ein Autogramm zu bitten, weder meinen Gangplatznachbarn zu fragen, wer denn der da vorne noch gleich ist, noch zu informieren, dass mir der Name auf der Zunge liege, ich aber partout nicht drauf komme, woher ich den noch mal KENNE, ob der Sportler ist oder Moderator oder was es sonst so gibt. Die Prominenten taten mir leid – so künstlich normal verhielten sie sich aus lauter Angst, exaltiert zu wirken und deshalb irgendwann als Leute von gestern in Bunte zu stehen (arrogant! abgehoben!), dass sie verdammt alles erklärten und kommentierten, jeden Furz anmoderierten:
– So, dürfte ich gerade noch mal, ich muss noch mal an meine Tasche ran/Ach, ich zieh mir doch mal meine Jacke aus, ist ja doch nicht so kalt jetzt/Ist das Ihre Lüftung, so, nach rechts schrauben, ja, begreife ich auch nie, diese Zeichnungen/Stört es Sie, wenn ich die Lehne etwas zurückklappe?
Als die Stewardess Zeitschriften verteilte, traute sich keiner, die Branchenschülerzeitungen Gala und Bunte zu bestellen, weil die Anlässe der Berichterstattung ja direkt nebenan saßen, und es jedem Einzelnen offiziell natürlich vollkommen egal war, die schreiben ja doch, was sie wollen, das muss man professionell sehen, das gehört zum Job, schließlich verdienen wir auch eine Menge Geld, wenn es dir in der Küche zu heiß wird, geh doch in die Speisekammer. Ich hatte mir das lässiger vorgestellt, gedacht, da sagt dann Schrowange zu Maske: Guck mal, wie albern ich da schon wieder aussehe und was ich da für blöde Sachen sage, nur damit ich in die Zeitung komme. Und dann würde Maske sagen: Ja, sicherlich, aber ich hier im Klatschteil bei der mit vier Tröten bewerteten Karnevalsparty in Polonaiseverstrickung mit dem amerikanischen Botschafter, und dann noch Ulla Kock am Brink im Arm, auch nicht unpeinlich, ich meine, ich rauche sonst nie Zigarre, und da eben dann doch, weil die Ulla gesagt hat, dass man dann öfter fotografiert wird, und zack, schon hat es geklappt.
Stattdessen stieß Henry Maske sich tollpatschig an der Belüftungsdüse, rieb sich missgelaunt den alpecinnassen Hinterkopf, und dann fiel sein Kleidersack aus dem Handgepäckfach direkt auf den Schoß von irgendeinem RTL-Infogesicht, und das RTL-Infogesicht sagte »Hopsala«, darauf Maske: »Sorry.« Ich begann, die Prominenten gezielt anzugaffen, sie waren so interessant langweilig. Vor mir saßen Ingo Appelt und seine Frau, und aus einer Klatschzeitung, die ich mir unter den neidischen Blicken der anderen bestellt hatte, konnte ich nachlesen, dass Ingo Appelts Manager einen Haufen Geld veruntreut hatte und deshalb jetzt seine Frau das Management übernommen hat. Wenn man solches beim Zahnarzt oder beim Gynäkologen oder auf dem Ausflugsdampfer »MS Loreley« liest, glaubt man es gar nicht, also dass diese Leute wirklich leben und diese Dinge TUN, die da STEHEN, aber nun, bitte schön, konnte ich es direkt überprüfen, und tatsächlich las die Frau des Komikers Ingo Appelt ihm mit Sklaventreiberstimme seinen Terminkalender vor. Und der Seriendarsteller, dessen Namen ich zwar nicht parat hatte, sehr wohl aber, dass er im Sommer auf Anfrage bekannt gegeben hatte »Ja, ich habe ein paar Pfunde zugelegt, richtig«, und sich brav vorgenommen hatte, wieder sein »Kampfgewicht zu erlangen, 10 Kilo müssen runter«, der also wedelte verneinend mit der Hand, als ihm die Stewardess ein Menütablett reichte. Auch das war also wahr und wirklich, das Image dieser Zeitschriften hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihrer Mitteilungen bedurfte offenbar einer Korrektur. Dann musste Henry Maske einer Stewardess erklären, dass er sie nicht gerufen, möglicherweise aber mit dem Kopf den Rufknopf angedötscht hatte.
Am Großstadtflughafen warteten am Ausgang viele Menschen auf die Leute aus den Zeitungen – Abholer und vor allem Autogrammsammler. Die elektrische Schwingtür summte auf, und die Erwarteten traten heraus, grinsten, winkten und nickten mittelgerührt, als sei dies keine Ankunftshalle, sondern eine Galabühne. Mädchen mit Autogrammbüchern sondierten das Angebot und hielten den Ausgewählten wortlos ihre Blankobüchlein hin. Anders als ich gehörte das offenbar dazu. Unangenehm war es meinen Mitfliegern nicht etwa, angesprochen, angegangen und -gefasst zu werden, der Super-GAU war, vor den Augen der Kollegen nicht erkannt zu werden, oder noch härter, wenn einem das gerade gereichte Buch entrissen wurde, weil ein noch Prominenterer des Weges kam. Diese Wackelkandidaten kurz vor der Ausfahrt Gnadenhof, gleichbedeutend mit Einladungen bloß noch zum MDR-Riverboat oder ZDF-Fernsehgarten, gingen deutlich langsamer, damit doch noch jemand kam, und der kriegte es dann richtig besorgt – hallo, Marktwert, schrie jede Bewegung: die Tasche abgestellt, die Sonnenbrille ins Haar geschoben, des Sammlers Stift abgewehrt, Moment, ich habe meinen Spezialstift dabei, umständlich wird der aus der Mantelinnentasche gepellt, so, für wen ist denn das? Heute haben wir den? Und so. Extended Version. Dass die anderen mal bloß nicht denken, es ginge langsam zu Ende. Zwei Mädchen ließen, weil bei dem viele standen, auch Tommi Ohrner in ihr Buch schreiben und fragten den routiniert Signierenden rücksichtslos: Wer sind Sie noch mal? Da fiel Tommi Ohrner überhaupt keine Antwort ein, ja, wer bin ich denn noch mal? Na, der Typ aus dem Fernsehen. Er sagte
– Gute Nummer, muss ich mir merken.
Da guckten die Mädchen mich an und riefen
– Ey geil, da ist Lars Ricken.
Ich überlegte, dass ich meine Haare doch etwas zu kurz geschnitten hatte, und schon hielten sie mir einen Stapel Hefte hin. Ich schrieb ganz ordentlich Lars Ricken, zuerst noch beinahe in Blockschrift, am Ende sah es schon sehr autogrammig aus, mit Schwung und in einem Zug, statt eines exakten i-Punktes ein fahriger Leider-keine-Zeit,-ich-muss-weiter-Mädels-Strich. Und da sagten sie Danke, und das war’s. Ich hatte mich immer gefragt, woher die Leute aus Bunte und Gala sich alle gegenseitig kennen. Ob die sich einmal vorgestellt werden, so, das ist der Soundso aus dem Fernsehen, und das ist die Dingens aus dem Kino, und der da spielt ja Gitarre dort, und sie, kennt ihr euch, also, sie hat früher bei Spiegel-TV-Berichten nachträglich am Schneidetisch die Bilder verwackelt, damit es authentisch und investigativ wirkt, und ist die Frau von ihm, und er war mal Assistent beim Tatort, und jetzt grüßt euch bitte in Zukunft und lasst euch zusammen fotografieren. Jedenfalls gehörte ich plötzlich dazu, bloß weil die Mädchen gedacht hatten, ich sei Lars Ricken, denn nun drehte sich Uwe Ochsenknecht nach mir um und sagte
– Unser Bus ist da vorne, glaube ich, Sie fahren doch auch zur Preisverleihung, oder?
Zwar musste ich ja keineswegs zur Preisverleihung, aber in die Stadt auf jeden Fall, und warum nicht Geld sparen und mit Uwe fahren. Ich ging hinter Uwe Ochsenknecht her und war überrascht, dass er Lars Ricken nicht duzte. Da schrie Birgit Schrowange
– Wartet ihr auf mich?
Natürlich warteten wir gerne, und ich merkte, spätestens ab zwei Promis wird sich geduzt. Ein netter Mann (»Fahrbereitschaft, Möller mein Name, grüße Sie ganz herzlich«) hoffte, dass wir einen guten Flug hatten, stapelte unser Gepäck in den Kofferraum eines VW-Busses, und Frau Schrowange bat, ihre Tasche nach ganz oben zu legen, weil da ein Kleid drin sei, sie zwinkerte
– Ihr Männer könnt doch ruhig verknittert sein, und da sagte Uwe Ochsenknecht mit einer merkwürdigen Sammelduschenintimität in der Stimme
– Ach, na sicher doch, mehr Falten als mein Gesicht kann auch der zerknittertste Anzug nicht haben, was?
Ich lachte, damit ich nichts sagen musste. Ein Notthema gab es auf jeden Fall, Flugangst nämlich, aber das durfte ich nicht zu früh verpulvern. Wir fuhren los, und ich fragte mich, was Lars Ricken nun tun würde. Ich hatte Angst, dass Uwe Ochsenknecht eventuell auf die Idee kommen könnte, mit mir über Fußball zu sprechen, womöglich gar Internes aus der Nationalmannschaft zu erfahren begehren könnte, und da wäre ich dann aufgeschmissen gewesen, denn Uwe Ochsenknecht wirkte auf mich wie jemand mit ziemlich detaillierten Fußballkenntnissen. Recht bald standen wir in einem Stau, und ich wurde nervös. Ein Gespräch war nur noch schwerlich zu verhindern, so langweilig war es. Herr Möller von der Fahrbereitschaft guckte in den Rückspiegel und fragte höflich, ob er Musik andrehen dürfe. Die Rettung! Auch für eventuelle Geschmacksdebatten war ich gerüstet, da ich durch den Sampler »Lars Ricken’s Hot Shots« um Rickens Vorliebe für unter anderem Metallica und REM wusste, und wir antworteten
Birgit: Musik ist immer gut!
Uwe: Wenn es kein Techno ist, nur zu.
Lars, also ich: Kein Problem.
Damit hatte ich den Ton gefunden, der mich vor Gesprächen bewahren konnte: freundlich, aber kurz angebunden, ein bisschen genervt – der Flug, die Gala, die Gala, dann noch »englische Wochen«, was immer das war, aber Ochsenknecht sah mich die Augen schließen und attestierte das mitfühlend, und dann hatte ich also englische Wochen, meinetwegen, klang doch gut, Hauptsache Ruhe. Der Fahrer legte eine Free-Jazz-Kassette ein. Der Bus gehörte wohl zu einem öffentlich-rechtlichen Fuhrpark. Ich behielt die Augen geschlossen. Birgit sagte mit komödiantisch gemeintem Empörungsanflug
– Nun guck dir unseren Leistungssportler an, doch Uwe fand das normal und erzählte, wie ihm jetzt noch der Rücken schmerzte vom Tennis am Wochenende. Ach, ich wünschte behaupten zu können, Schrowange hätte daraufhin NICHT gesagt, dass sie es aber, hoho, immer noch mit Churchill halte, no sports, haha. Es war so bedauerlich, dass nicht eine Frau mit Klasse wie etwa Senta Berger in diesem Bus saß, die hätte sich nach zwei Sekunden zum 630-Marks-Fahrer gelehnt und mit freundlicher Autorität klargestellt
– Du, Liebling, tust einer alten Frau den Gefallen und drehst den Schmarrn ab, ja? Stattdessen war nur Birgit Schrowange da, die unmusikalisch den Takt zu halten versuchte und übertrieben volksnah nachfragte
– Superguter Sound, was hören wir denn da?
Uwe Ochsenknecht hörte seine Mailbox ab und erzählte allen, die er daraufhin anrief, dass wir gerade im Stau standen, er seine Leopardenstola im Hobbykeller hatte liegen lassen, es darüber hinaus regnete, und er auch nicht wisse, wann genau wir da seien. Keine hot shots, keine hot news, ganz einfach. Der Fahrer fluchte. Alles wegen der Schreinemakers, sagte er. Sonst sei hier um diese Zeit nie Stau, aber die müsse ja nun ausgerechnet ihren Benefizmarathonlauf mitten über die Zubringerstraße legen. Na ja, sagte da Frau Schrowange, ehrlich gesagt, sie selbst unterstütze das auch, sie habe eine Patenschaft für jeden von Michael Schanze gelaufenen Kilometer übernommen zugunsten eines Schulprojekts in Mosambik, der Stau sei zwar etwas nervig, aber sie sei so unglaublich froh, bei dieser Aktion mitzuspenden, zumal das Geld auch wirklich bei den Bedürftigen ankomme, das sei ja keineswegs immer gewährleistet, aber hier eben doch. Am Straßenrand stand »Sugar Sugar Baby«-singend Peter Kraus und bat die Passanten, im Takt zu klatschen, doch die meisten hatten Tüten in der Hand und konnten folglich nicht. Als wir endlich in Zentrumsnähe angelangt waren, bat ich, aussteigen zu dürfen, ich hätte noch was Persönliches zu erledigen, und das war kein Problem. Der Fahrer drehte die Musik leiser und fragte, ob ich den Ablaufplan habe, und ich sagte
– Natürlich, klar, bis später dann.
Ich nahm mir ein Taxi zum Hotel. Dort war ich am frühen Abend mit einem Kamerateam verabredet, danach wollte der Veranstalter mich zur Lesung abholen. Das Hotel war außerordentlich vornehm, und die Rezeptionistin sprach mich dauernd mit meinem Namen an, nachdem ich ihn ihr einmal gesagt hatte. Ich nahm mir einen unrettbar verwachsten Apfel aus der BittegreifenSiezu-Schüssel, biss hinein und fühlte mich willkommen, es lag sogar schon eine Nachricht für mich vor. Meine Agentin hatte ein Fax mit neuen Interviewanfragen geschickt, und ihre Sekretärin hatte unten drauf eine kleine Sonne gemalt. Das fand ich alles sehr nett. Ich setzte mich in die Badewanne und überlegte mir, wie ich abends das Programm optimieren konnte, um vor dem kritischen Großstadtpublikum zu bestehen. Reise nach Jerusalem würde ich mit ihnen nicht spielen können. Vielleicht kamen ja auch nur hämische Journalisten und sonst niemand.
Ich trocknete mich ab und war erfreut, dass meine Haut ganz in Ordnung war, das ist ja immer wichtig, wenn man gefilmt wird. Ich hätte sonst lieber abgesagt, denn mit schlechter Haut gut gelaunt in eine Kamera zu sprechen ist praktisch unmöglich, da starrt man kaninchengleich auf die brutale weiße Lampe, kriegt Depressionen und wird später rausgeschnitten. Und sicherlich würden die auch keinen Maskenbildner mitbringen für das bisschen Film. Ich war gespannt, ob ich das hinkriegte: ein Fernsehinterview. Zwar war es nicht live, aber was hieß das schon, aufgeregt war ich trotzdem. Vielleicht würde ich stottern, oder die Scheinwerfer waren wirklich so heiß, wie immer behauptet wird, oder die Interviewerin war bösartig und würde mein Werk infrage stellen, und schlagfertig wäre ich dann erst hinterher, und dann wäre es zu spät.
Die Nervosität hätte ich mir für wichtigere Gelegenheiten sparen können – die Fernsehtante und ihr Team kamen, stellten einen Gummibaum neben eine Stehlampe, dazwischen einen Sessel für mich, das war’s auch schon mit der Kulisse, und dann musste ich mein Buch in die Hand nehmen und erdulden, wie es ist, wenn Kultur im Fernsehen von Frauen bearbeitet wird, die sich für nichts interessieren, aber prima aussehen, weshalb sie auch den Job gekriegt haben. Die Frau sagte in jeder Hinsicht aus dem Off heraus
– So, ich habe das Buch nicht gelesen, aber soll ja ganz witzig sein, sag mal einfach was so zur Stadt und zu dir und wieso du schreibst und was du dir so in Zukunft vorstellst, nicht länger als zwei Minuten, und schön mich angucken dabei, nicht die Kamera, also, zwei Minuten, nicht zu lange Sätze, und ruhig ein bisschen was Freches.
Das hatte man dann davon, dass man diese werbefinanzierte Bande in sein Zimmer ließ, im festen Glauben, sie könnten einem zumindest nützen, man könnte mit ihnen vielleicht sogar ein erbauliches Gespräch, eine anregende Diskussion führen. Ruhig was Freches. Ich sagte frech was Ruhiges, da klingelte das Telefon, und der Tonmann nahm gereizt seine Kopfhörer ab und sagte
– Ja, der Take ist dann für’n Arsch, vielen Dank auch.
Der Veranstalter war dran und sagte, er warte in der Lobby, wir sollten bald los, es würde sehr voll werden. Daraufhin war ich natürlich gut gelaunt und war zwei Minuten lustig oder frech oder so, jedenfalls bauten die Kulturbeauftragten ihre Geräte ab, und die Redakteurin klemmte sich ihre Notizenklarsichtfolie zwischen die Beine, band sich einen Pferdeschwanz und bat, auf die Gästeliste genommen zu werden, das wolle sie sich nicht entgehen lassen. Plus zwei, wenn das ginge, sie käme also zu dritt, mir war es egal, und ich sagte, ich würde sehen, dass es klappt. Ich hob die Hand zur Verabschiedung und begann laut zu husten, um ihr »Ciao-ie« nicht hören zu müssen.
Am Tag zuvor war mein abendlicher Arbeitsplatz nichts weiter als eine Ecke gewesen, da musste ich nicht lange überlegen, mich bloß hinsetzen, los ging es. Nun aber eine richtige Bühne, Treppe rauf, und die Menschen blickten HOCH. Und da oben saß bloß: ich. Hätte ich doch eine Gitarre gehabt! Eine Gitarre ist ein allgemein akzeptierter Grund, auf eine Bühne zu treten. Dass Kinder sich mit einem Tennisschläger vor einen Spiegel stellen und Konzert spielen, später dann Popstars werden und allen erzählen, dass sie sich als Kind immer mit einem Tennisschläger vor einen Spiegel gestellt und Konzert gespielt haben, na gut. Aber hörte man je einen Autor beichten, dass er sich als Kind immer schon mit einem Buch vor einen Spiegel gesetzt und Lesung gespielt hat?
O. k., alles vergessen. Die Lokalkoloritschnurre, die ich mir genau zurechtgelegt hatte für den Anfang, die Kurzzusammenfassung des Buches und anschließende pointierte Überleitung mitten hinein in den Text – kein Wort mehr da. Wie heiße ich denn noch mal? Da blickten jetzt lauter Augen direkt auf den noch leeren Tisch mit Stuhl und Wasserglas, Spot war schon ausgerichtet, die Leute guckten erwartungsvoll und wurden ruhiger, jetzt musste mal bald was passieren, und zwar mit mir, von mir, jedenfalls ohne mich nicht. Die Musik wurde ausgeblendet, es ging jetzt einfach wirklich los. Ich musste was sagen und am besten nicht so viele Äs. Was für ein schwieriger Job doch das Entertainment ist. Irgendwas würde mir doch schon einfallen. Vielleicht einfach hinsetzen und Hallo sagen, ich soll hier lesen, guten Abend, verkehrt wäre das nicht. Es würde schon werden. Bei aller Sorge – es gibt ja auch Menschen, die müssen bei einem Unicef-Galadinner am Tisch mit Michael Schumacher, Franziska van Almsick und Marie-Luise Marjan ein Gespräch zustande kriegen und es mit ständigen Einwürfen siedend halten. Dagegen war doch so eine Lesung gar nichts. Nicht stolpern, leichte Verbeugung, ah, höfliche Menschen, sie klatschten noch vor dem ersten Wort, das machte doch alles viel leichter, und dann saß ich ja wenigstens, konnte also gar nicht umkippen, und begann nach kurzer Stegreif-Ouvertüre mit dem Text, und den kannte ich ja, da lag das Buch und war besser als jeder Teleprompter, denn ich musste nicht so tun, als fiele mir all das gerade erst ein, es war ja eine Lesung. Der Rest würde sich entwickeln. Jetzt bloß nicht mir selbst zuhören, die eigene Stimme merkwürdig finden und aus dem Takt kommen, weiter im, genau, Text. Und Absatz und blättern, überleiten, weiter, Musik. Zurücklehnen, Schluck nehmen, Masse in Einzelgesichter diversifizieren, ach so seht ihr aus, dann aber auch schon weiter, einen Zwischenruf passabel gekontert und – Pause. Lief doch gut. Hinter die Bühne, ausatmen und hören, wie es drinnen weitergeht. Gemurmel hob an, Soulmusik, ja, meine Güte, man kann sich nicht um alles kümmern. Backstage in der Pause, das ist so wie ein Zwischenstopp an einer Autobahnraststätte: Klo, Spiegelblick, Luft holen, strecken, rauchen, trinken, irgendwo abbeißen, vielleicht telefonieren, und dann fädelt man sich wieder ein.
Mein Publikum an diesem Abend war nett und zahlreich, es lachte angemessen häufig und erduldete wohlwollend auch ruhigere Textpassagen, ohne gleich in Scharen aufs Klo zu rennen oder sabotierend zu brabbeln. Die, die hin und wieder so enthusiasmiert schrie, war wohl meine Agentin. Ich wagte einige improvisierte, vom Text losgelöste Ausführungen und gewann an Stimmsicherheit, ich hatte das Mikrofon, und wenn es kein Scheiß war, ließen sie mich reden. Wenn es doch Scheiß war, merkte ich das früh genug und bog ab, weiter auf Seite soundso, meine Lieblingskapitel in der Hinterhand für den äußersten Notfall, so wie Inge Meysel immer etwas Arsen bei sich führt, falls sie mal nicht mehr lesen, Quatsch, leben will. Es gab jede Menge zu trinken, die Leute rauchten so viel, dass ich ganz heiser wurde, und am Bühnenrand stand meine Agentin und stach verschwörerisch den Topdaumen in die rauchige Luft, den Fußballer immer machen, wenn sie fotografiert werden. Top! In manchen Zeitschriften werden mit Topdaumen auch Filme und Platten bewertet. Einige Fernsehzeitschriften betreiben etwas dezidiertere Analysen und unterscheiden in der Kurzwertung die Qualität des Films hinsichtlich
– Action
– Spannung
– Erotik
– Humor
Es kann ein Film erotisch top, aber unspannend sein. Und Action ist beileibe nicht immer spannend, aber hin und wieder durchaus lustig. Meine Lesung war also gerade top. Nicht allzu erotisch wahrscheinlich, und die Action beschränkte sich im Wesentlichen auf einige Interaktionen mit dem nicht ganz zuverlässigen Musikabspielgerät, aber zumindest ging keiner raus, und irgendwann hörte ich einfach auf, sagte Danke, und die Leute klatschten lange und herzlich, nicht aus Mitleid, es hatte ihnen tatsächlich gefallen.
Sollte ich mich jetzt verbeugen, eine Verbeugung andeuten? Eine Zugabe lesen? Aufstehen, eine Verbeugung bloß andeuten und mich zugabenlos unter die Menschen mischen, und wenn ja, auf wen sollte ich zugehen? Ich blieb sitzen, trank Wasser, blickte umher und versuchte, niemandem in die Augen zu sehen. Die Leute hörten auf zu klatschen, der umsichtige Veranstalter verhinderte durch umgehend losflirrende elegante Musik peinliche Stille, ich packte meine Tasche, stand auf, sprang von der Bühne und ging auf den Pulk der Sitzenden, Stehenden und Guckenden zu. Wo sollte ich stehen bleiben? Ich konnte ja nicht den Raum verlassen, ich musste ja jetzt locker hier rumstehen und nickend und zuhörend Bierflaschen aussaugen, so lief das doch. Oder? Weggehen wäre lächerlich gewesen, und hinter der Bühne war es allein auch nicht weiter spannend.
In einem Interview mit dem Menschenrechtler Peter Gabriel konnte man einmal lesen, wie gefährlich Publikumszuwendungen enden können: Mit Herrn Gabriel waren nach eineinhalb Stunden Mistmusik die Pferde durchgegangen, vom Applaus balsamiert hatte er die Fähigkeit eingebüßt, sein Dasein realistisch zu bewerten, er wollte sich gemein machen und sprang von der Bühne ins Publikum. Doch statt ihn aufzufangen, waren die Leute zur Seite gewichen, sodass Herr Gabriel auf dem Boden landete und sich die Gliedmaßen verstauchte. Recht so. Mir ging es jetzt ähnlich. Ich wollte mich unauffällig in eine Gesprächsrunde eingliedern, doch kaum war ich auf einen halben Meter bei so einem Grüppchen, tat sich vor mir eine Gasse auf. Niemand lud mich ein stehen zu bleiben. Wahrscheinlich war es in ihren Augen jetzt für den Künstler an der Zeit, sich frisch zu machen, Drogen zu nehmen oder Mami anzurufen. Das Ganze zu verarbeiten.
Meine Agentin schlug mir aufmunternd auf den Rücken und sagte, das sei ganz ordentlich gewesen, sie werde sich gleich noch bei dem etwas misslaunigen, »aber doch superwichtigen, das weißte ja« Typen vom Deutschlandfunk oder so auf den Schoß setzen.
Am Ausgang hatte ein Buchhändler einen Büchertisch aufgebaut, er verkaufte eine ganze Menge, und ich durfte signieren, inzwischen schon fast professionell: Namenskrickel, Datum und für soundso, das reichte. Von wegen Lars Ricken. Ein absolut angenehmer Tagesordnungspunkt: Die Leute machten mir Komplimente, während ich sie nach der korrekten Schreibweise ihrer Vornamen fragte. Dass da nichts schiefgeht: mit c oder k/mit einem oder zwei l/mit w oder v/mit ph oder mit f/kurz: Wie man’s spricht, aber wie spricht man’s denn?