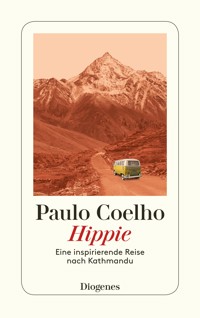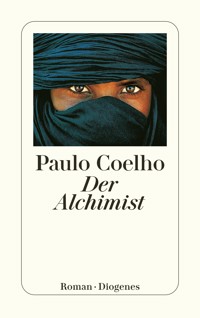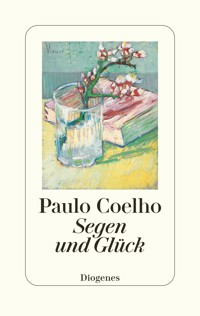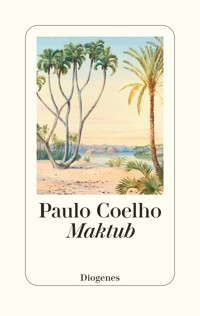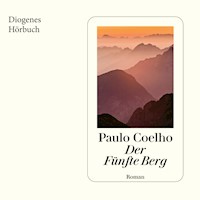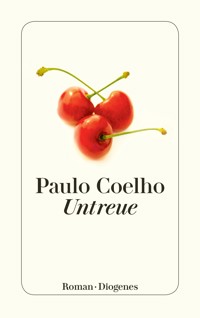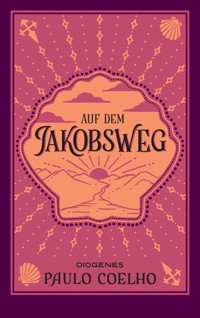
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paulo Coelhos sehr persönliches Tagebuch seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela – ein Reise- und Erfahrungsbericht, in dem bereits die großen Themen seiner Romane angelegt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Paulo Coelho
Auf dem Jakobsweg
Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela
Aus dem Brasilianischen von Maralde Meyer-Minnemann
Diogenes
Heilige Maria,
ohne Sünden empfangen,
bete für uns,
die wir uns an dich wenden.
Amen.
Sie sprachen aber: Herr,
sieh, hier sind zwei Schwerter.
Er aber sprach zu ihnen:
Es ist genug.
Lukas, 22:38
Vorwort
Als ich vor zehn Jahren in ein kleines Haus in Saint-Jean-Pied-de-Port trat, war ich sicher, dass ich nur meine Zeit vergeudete. Damals war meine spirituelle Suche mit der Vorstellung verbunden, dass es Geheimnisse, mysteriöse Wege und Menschen gab, die fähig waren, Dinge zu verstehen und zu kontrollieren, die den meisten Sterblichen versagt waren. Daher erschien mir der Gedanke reizlos, den ›Weg der gewöhnlichen Menschen‹ zu gehen.
Viele aus meiner Generation – und auch ich zähle mich dazu – sind von Geheimnissen und Geheimgesellschaften fasziniert und gaukeln sich vor, dass nur was schwierig und kompliziert ist, uns am Ende das Mysterium des Lebens begreifen lässt. 1974 habe ich diesen Aberglauben teuer bezahlt. Dennoch hat sich, nachdem die Angst verflogen war, die Faszination für das Okkulte einen Platz in meinem Leben erobert. Als mein Meister mir vom Jakobsweg erzählte, erschien mir daher diese Pilgerreise nur mühsam und nutzlos. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, die R.A.M. zu verlassen, diese kleine, unbedeutende Bruderschaft, die aus der mündlichen Weitergabe der symbolischen Sprache entstanden war.
Als mich schließlich äußere Umstände dazu brachten, zu tun, was mein Meister von mir verlangte, beschloss ich, dass ich es auf meine Weise tun würde. Am Anfang der Pilgerreise versuchte ich, aus Petrus, meinem Führer, den indianischen Medizinmann Don Juan zu machen, die Figur, auf die der Schriftsteller Carlos Castañeda zurückgreift, um seine Berührung mit dem Außergewöhnlichen zu erklären. Ich glaubte, dass ich mit ein wenig Phantasie die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg zu einer angenehmen Erfahrung und das, was enthüllt werden würde, zu etwas Okkultem, das Einfache zu etwas Komplexem, das Strahlende zu etwas Mysteriösem machen könnte.
Doch Petrus hat allen meinen Versuchen widerstanden, ihn zu einem Helden zu stilisieren. Das hat unsere Beziehung sehr belastet, und wir haben uns schließlich getrennt, weil wir beide fühlten, dass diese Nähe uns nirgendwohin führte.
Es musste nach dieser Trennung erst geraume Zeit vergehen, bis ich begriff, was diese Erfahrung mir gebracht hatte. Sie gehört heute zu meinem kostbarsten Besitz: Das Außergewöhnliche findet sich auf dem Weg der gewöhnlichen Menschen. Sie erlaubt mir, alle Gefahren auf mich zu nehmen, um dem auf den Grund zu gehen, an das ich glaube. Sie hat mir den Mut verliehen, mein erstes Buch zu schreiben, Auf dem Jakobsweg. Sie hat mir die Kraft gegeben, dafür zu kämpfen, auch wenn mir immer wieder gesagt wurde, dass es unmöglich für einen Brasilianer sei, allein von der Literatur zu leben. Sie hat mir geholfen, würdig und beharrlich den guten Kampf zu führen, den ich tagtäglich mit mir selber austragen muss, wenn ich weiterhin den ›Weg der gewöhnlichen Menschen‹ gehe.
Ich habe meinen Führer nie wiedergesehen. Als das Buch in Brasilien herauskam, versuchte ich, Kontakt zu ihm aufzunehmen, doch er hat nicht geantwortet. Als die englische Übersetzung erschien, freute mich der Gedanke, dass er nun endlich meine Version dessen lesen könnte, was wir gemeinsam erlebt hatten. Ich habe wieder versucht, ihn zu erreichen, doch er hatte inzwischen eine neue Telefonnummer.
Zehn Jahre später wurde Auf dem Jakobsweg in dem Land veröffentlicht, in dem ich meine Reise angetreten hatte, war ich Petrus doch auf französischem Boden zuerst begegnet. Ich hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um ihm sagen zu können: »Danke, ich widme dir dies Buch.«
Paulo Coelho
Prolog
»Und mögest du im heiligen Angesicht der R.A.M. das Wort des Lebens mit deinen Händen berühren und so viel Kraft daraus gewinnen, dass du bis ans Ende der Welt Zeugnis dafür ablegst.«
Der Meister hielt mein neues Schwert erhoben, ohne es aus der Scheide zu ziehen. Die Flammen knisterten in der Feuerstelle. Dies war ein gutes Vorzeichen, denn es bedeutete, dass mit dem Ritual fortgefahren werden sollte. Da kniete ich nieder und begann mit nackten Händen in die Erde vor mir eine Vertiefung zu graben.
Es war in der Nacht des 2. Februar 1986, und wir befanden uns auf dem Gipfel des Gebirges Serra do Mar in der Nähe einer Felsformation mit dem Namen Agulhas Negras/Schwarze Nadeln. Außer meinem Meister und mir waren noch meine Frau, einer meiner Schüler, ein Bergführer aus dem Ort und ein Vertreter der großen, unter dem Namen ›Tradition‹ bekannten Bruderschaft anwesend. Alle fünf, auch der Bergführer, der zuvor von dem in Kenntnis gesetzt worden war, was hier geschehen sollte, nahmen an meiner Ordination als Meister des R.A.M.-Ordens teil, einer alten christlichen, im Jahre 1492 gegründeten Bruderschaft.
Ich hatte eine lange, flache Kuhle in die Erde gegraben. Während ich die Worte des Rituals sprach, schlug ich feierlich mit den Händen auf die Erde. Dann trat meine Frau zu mir. Sie überreichte mir das Schwert, dessen ich mich über zehn Jahre lang bedient hatte und das in dieser Zeit mein Helfer gewesen war. Ich legte das Schwert in die Kuhle, bedeckte es mit Erde und klopfte sie fest. Dabei stieg die Erinnerung an die Prüfungen, die ich durchlaufen hatte, an die Dinge, die ich gelernt hatte, und an die Phänomene in mir auf, die ich hervorzurufen imstande war, denn damals hatte ich stets dieses uralte Schwert, meinen großen Freund, bei mir gehabt. Nun würde die Erde es verschlingen, das Eisen seiner Klinge und das Holz seines Griffes würden den Ort wieder nähren, aus dem es so viel Macht geschöpft hatte.
Der Meister trat auf mich zu und legte mein neues Schwert vor mich auf die Stelle, an der ich das alte vergraben hatte. Da breiteten alle ihre Arme aus, und der Meister ließ um uns ein seltsames Licht entstehen, das zwar keine Helligkeit spendete, jedoch unsere Umrisse in eine andere Farbe als den gelben Schein tauchte, der vom Feuer ausging. Dann zog der Meister sein eigenes Schwert aus der Scheide und berührte damit meine Schultern und meinen Kopf und sagte:
»Aus der Macht und der Liebe der R.A.M. heraus ernenne ich dich zum Meister und Ritter des Ordens, heute und für alle Tage bis an dein Lebensende. R steht für Rigor, die Strenge, A steht für Amor, die Liebe, M steht für Misericordia, die Barmherzigkeit, R steht für Regnum, das Reich, A steht für Agnus, das Lamm, M steht für Mundus, die Welt. Wenn das Schwert dein ist, lass es nie lange in seiner Scheide, denn es könnte rosten. Doch wenn es seine Scheide verlässt, soll es niemals dorthin zurückkehren, ohne zuvor Gutes getan oder einen Weg gebahnt zu haben.«
Mit der Spitze seines Schwertes hatte er mich am Kopf leicht verletzt. Nun musste ich nicht mehr schweigen. Ich musste nunmehr weder verstecken, wozu ich fähig war, noch die Wunder verbergen, die ich auf dem Weg der ›Tradition‹ zu vollbringen gelernt hatte. Von diesem Augenblick an war ich ein Mitbruder.
Ich hielt meine Hand ausgestreckt, um mein neues Schwert mit seinem schwarzroten Griff und seiner schwarzen Scheide zu ergreifen, das aus dem unzerstörbaren Stahl und aus dem Holz gemacht war, von denen die Erde sich nicht genährt hatte. Doch als ich das Schwert an mich nehmen wollte und ich die Scheide berührte, machte der Meister einen Schritt nach vorn und trat mir so heftig auf die Finger, dass ich vor Schmerz aufschrie und meine Hände zurückzog.
Ich sah ihn an und wusste nicht, was ich davon halten sollte.
Das seltsame Licht war verschwunden, und die Flammen ließen sein Gesicht wie eine Geistererscheinung wirken.
Er warf mir einen kalten Blick zu, rief meine Frau zu sich heran und übergab ihr das neue Schwert. Dann wandte er sich mit den folgenden Worten an mich:
»Zieh deine Hand zurück, denn sie klagt dich an! Der Weg der ›Tradition‹ ist nicht der Weg weniger Erwählter, sondern der Weg aller Menschen! Und die Macht, die du zu besitzen glaubst, wird wertlos, wenn du sie nicht mit anderen Menschen teilst! Du hättest das neue Schwert verweigern sollen. Wäre dein Herz rein gewesen, hättest du es erhalten. Doch wie ich schon befürchtet hatte, bist du im entscheidenden Augenblick gestrauchelt und gefallen. Wegen deiner Begehrlichkeit musst du dich nun erneut auf die Suche nach deinem Schwert begeben. Wegen deines Hochmuts musst du es nun unter den einfachen Menschen suchen. Und wegen deiner Verblendung durch die Wunder wirst du jetzt hart kämpfen müssen, um das wiederzuerlangen, was dir großzügig gegeben worden wäre.«
Mir war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kniete noch immer da, sprachlos. Jetzt, wo ich mein altes Schwert der Erde übergeben hatte, konnte ich es nicht mehr zurückbekommen. Und da mir das neue verweigert worden war, stand ich nun wieder da wie am Anfang, macht- und schutzlos. Der Tag meiner himmlischen Weihe, die Gewalttätigkeit meines Meisters, der mir die Finger zertreten hatte, schickte mich zurück in die Welt des Hasses und der Erde.
Der Bergführer löschte das Feuer, und meine Frau kam zu mir, um mir beim Aufstehen zu helfen. Sie trug nun mein neues Schwert; nach den Regeln der ›Tradition‹ durfte ich es ohne Erlaubnis meines Meisters nicht berühren. Wir gingen hinter der Laterne unseres Bergführers schweigend durch den Wald hinunter und gelangten schließlich zu dem Trampelpfad, an dem die Wagen geparkt waren.
Niemand hat sich von mir verabschiedet. Meine Frau legte das Schwert in den Kofferraum und warf den Motor an. Wir schwiegen eine geraume Weile, während sie langsam fuhr, um den Schlaglöchern und Buckeln auf dem Weg auszuweichen.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie, um mir ein wenig Mut zu machen. »Ich bin sicher, dass du es wiederfinden wirst.«
Ich fragte sie, was der Meister zu ihr gesagt habe.
»Drei Dinge. Erstens, dass er etwas Warmes zum Anziehen hätte mitnehmen sollen, da es dort oben kälter war als vorgesehen. Zweitens, dass ihn dies alles nicht überrascht habe, weil es auch anderen schon passiert sei, die genauso weit gekommen waren wie du. Und drittens, dass dein Schwert dich an einer Stelle des Weges, den du gehen musst, erwarten werde. Ich weiß weder das Datum noch die Stunde. Er hat mir nur den Ort genannt, an dem ich es verstecken soll, damit du es findest.«
»Und welcher Weg ist das?«, fragte ich gereizt.
»Ach, das hat er nicht so genau gesagt. Er hat nur gesagt, dass du auf der Landkarte von Spanien einen Weg aus dem Mittelalter suchen sollst mit dem merkwürdigen Namen Jakobsweg.«
Die Ankunft
Der Zöllner schaute lange auf das Schwert, das meine Frau trug, und fragte uns, was wir damit vorhätten. Ich antwortete ihm, dass ein Freund von uns eine Expertise dafür erstellen sollte, bevor wir es zur Versteigerung freigaben. Die Lüge zog. Der Zöllner bescheinigte uns, dass wir mit dem Schwert auf dem Flughafen von Barajas eingereist seien, und wies uns an, das Dokument beim Zoll vorzulegen, falls es bei der Ausreise Schwierigkeiten gäbe.
Wir gingen dann zum Schalter der Autovermietungsfirma, um uns die Reservierung für zwei Wagen bestätigen zu lassen, nahmen die Tickets an uns und suchten dann eines der Flughafenrestaurants auf, um noch eine Kleinigkeit zu essen, bevor wir uns trennten.
Ich hatte im Flugzeug die ganze Nacht kein Auge zubekommen. Zum einen, weil ich Flugangst habe, zum anderen aus Furcht vor dem, was kommen würde. Trotzdem war ich aufgeregt und hellwach.
»Nimm es nicht so schwer«, sagte meine Frau zum x-ten Mal. »Du sollst nach Frankreich fahren und dort in Saint-Jean-Pied-de-Port eine Madame Savin aufsuchen. Sie wird dich mit jemandem zusammenbringen, der dich auf dem Jakobsweg führen wird.«
»Und du?«, fragte ich sie, auch zum x-ten Mal.
»Ich werde dorthin fahren, wohin ich geschickt werde, um das wieder zurückzubringen, was mir anvertraut wurde. Anschließend bleibe ich ein paar Tage in Madrid und fliege dann zurück nach Brasilien. Ich kann unsere Angelegenheiten genauso gut regeln wie du.«
»Ja, ja, ich weiß«, antwortete ich kurz angebunden, denn ich hatte keine Lust, darüber zu reden.
Der Gedanke an die Arbeit, die in Brasilien erledigt werden musste, bedrückte mich sehr. Zwei Wochen nach dem Ereignis bei den Schwarzen Nadeln hatte ich das Wichtigste über den Jakobsweg gelernt, doch dann brauchte ich noch sieben Monate, bis ich mich entscheiden konnte, alles zurückzulassen und die Reise anzutreten. Eines Morgens verkündete mir meine Frau, der Zeitpunkt sei nun gekommen, eine Entscheidung zu treffen, denn sonst könnte ich den Weg der Magie und der Bruderschaft und des R.A.M.-Ordens ein für alle Mal vergessen. Ich versuchte ihr zu beweisen, dass der Meister mir eine unlösbare Aufgabe gestellt hatte, weil ich mich nicht einfach aus der Verantwortung für meine alltägliche Arbeit stehlen könne. Sie lachte und entgegnete, dass dies keine gute Entschuldigung sei, denn während der vergangenen sieben Monate hätte ich nichts Rechtes zuwege gebracht und Tag und Nacht nur damit vertan, mich zu fragen, ob ich nun die Reise machen sollte oder nicht. Und als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, reichte sie mir zwei Tickets, auf denen das Flugdatum stand.
»Dass wir jetzt hier sind, verdanken wir deiner Entscheidung«, meinte ich in der Flughafencafeteria. »Ich weiß nicht, ob es richtig war, jemand anderen entscheiden zu lassen, ob ich mein Schwert suchen soll oder nicht.«
Meine Frau antwortete mir, es sei wohl besser, gleich unsere Autos zu besteigen und sich zu verabschieden, bevor wir anfingen, uns weiterhin gegenseitig irgendwelchen Unsinn zu erzählen.
»Du würdest niemals zulassen, dass jemand anderes auch nur die kleinste Entscheidung in deinem Leben trifft. Nun komm, es ist schon spät.«
Sie nahm ihr Gepäck und ging zum Schalter der Autovermietung. Ich blieb sitzen und beobachtete, wie nachlässig sie mein Schwert trug, das ihr jeden Augenblick unter dem Arm hervorzurutschen drohte.
Auf halbem Wege blieb sie stehen, kam dann an den Tisch zurück, an dem ich saß, küsste mich geräuschvoll auf den Mund und blickte mich lange wortlos an. Mir wurde mit einem Mal bewusst, wie groß die Gefahr eines Scheiterns war. Doch nun hatte ich den ersten Schritt getan und konnte nicht mehr zurück. Ich umarmte sie liebevoll, mit der ganzen Liebe, die ich in diesem Augenblick fühlte, und während sie in meinen Armen lag, bat ich all das, an was ich glaubte, und alle, an die ich glaubte, mir die Kraft zu geben, mit dem Schwert zurückzukehren.
»Hübsches Schwert, was?«, meinte eine weibliche Stimme am Nebentisch, nachdem meine Frau gegangen war.
»Wenn du willst, kaufe ich dir genau so eins«, antwortete eine Männerstimme. »In den Touristenläden hier in Spanien gibt es die zu Hunderten.«
Nachdem ich eine Stunde gefahren war, begann ich, die Müdigkeit zu spüren, die sich in der vergangenen Nacht angesammelt hatte. Die Augusthitze brannte, und ich beschloss, in einer kleinen Stadt kurz anzuhalten, die auf den Straßenkarten als historischer Ort angegeben war. Während ich mit dem Wagen den steilen Hang hinaufkletterte, der dorthin führte, rief ich mir noch einmal alles ins Gedächtnis zurück, was ich über den Jakobsweg gelernt hatte.
Die muslimische Tradition verlangt von jedem Gläubigen, dass er zumindest einmal in seinem Leben nach Mekka pilgert. Das Christentum kannte im ersten Jahrtausend drei Wege, die jedem, der sie bis zu ihrem Ende beschritt, Segnungen und Ablässe versprachen. Der erste führte zum Grabe Petri nach Rom. Sein Symbol war das Kreuz. Romfahrer nannte man diese Pilger. Der zweite führte zum Heiligen Grab Christi in Jerusalem, und die Menschen, die dorthin pilgerten, wurden Palmträger genannt, denn sein Symbol waren die Palmen, die Christus bei seinem Einzug in die Stadt begrüßt hatten. Der dritte Weg führte zu den Reliquien des Apostels Jakobus, die auf der Iberischen Halbinsel an der Stelle begraben waren, an der ein Hirte eines Abends über einem Feld einen Stern leuchten sah. Der Legende zufolge sollen der heilige Jakobus und die Jungfrau Maria dort nach Christi Tod das Evangelium verkündet und die Bevölkerung aufgefordert haben, sich zum Wort Gottes zu bekehren. Der Ort erhielt den Namen Compostela, das Sternenfeld, und bald erhob sich dort eine Stadt, die Reisende aus der gesamten christlichen Welt anziehen sollte. Denjenigen, die diesen dritten heiligen Weg gingen, wurde der Name Jakobsbruder gegeben, und sie erkoren die Muschel zu ihrem Symbol.
Während ihres goldenen Zeitalters im 14. Jahrhundert pilgerten über eine Million Menschen den Jakobsweg entlang, der auch ›Milchstraße‹ genannt wurde, weil sich die Pilger nachts nach dieser Galaxis orientierten. Bis heute wandern Mystiker, Fromme und Suchende die siebenhundert Kilometer, von der französischen Stadt Saint-Jean-Pied-de-Port zur Kathedrale von Santiago de Compostela in Spanien.
Dank dem französischen Priester Aymeric Picaud, der im Jahre 1123 nach Compostela pilgerte, entspricht die heutige Route noch der, der die mittelalterlichen Pilger wie Karl der Große, Franz von Assisi, Isabella von Kastilien und, vor gar nicht langer Zeit, auch Papst Johannes XXIII. folgten. Picaud schrieb fünf Bücher über seine Erlebnisse, die als Werk von Papst Calixtus II., eines großen Verehrers des heiligen Jakobus, ausgegeben und später unter der Bezeichnung Codex Calixtinus bekannt wurden. Im V. Buch des Liber Calixtinus, dem Liber Sancti Jacobi, zählte Picaud Merkmale in der Natur, Brunnen, Hospize, Unterstände und Städte längs des Weges auf. Auf den Kommentaren von Picaud fußend, hat es sich die Gesellschaft der Freunde der Jakobsstraße (Santiago ist der spanische Name des heiligen Jakobus, auf Englisch James, italienisch Giacomo) zur Aufgabe gemacht, diese Merkmale in der Natur bis hin zum heutigen Tage zu erhalten und den Pilgern beizustehen.
Im 12. Jahrhundert begann die spanische Nation in ihrem Kampf gegen die Mauren, die die Halbinsel besetzt hatten, die Mystik des heiligen Jakobus für sich zu nutzen. Mehrere religiöse Ritterorden entwickelten sich längs des Pilgerweges, und die Asche des Apostels wurde zu einem mächtigen spirituellen Bollwerk im Kampf gegen die Muselmanen, die ihrerseits behaupteten, der Arm Mohammeds sei mit ihnen. Doch nach dem Ende der Reconquista, der Wiedereroberung der Iberischen Halbinsel, waren die Militärorden so mächtig geworden, dass der Staat sie als Bedrohung empfand und die Reyes Catolicos, die Katholischen Könige, sich zum Eingreifen gezwungen sahen, um zu verhindern, dass diese Orden sich gegen den Adel erhoben. In der Folge fiel der Jakobsweg allmählich weitgehend der Vergessenheit anheim, und würde er nicht hin und wieder einmal in der Kunst – wie im Film Die Milchstraße von Buñuel oder in Caminante von Joan Manuel Serrat – thematisiert, würde sich heutzutage kaum jemand mehr daran erinnern, dass einstmals Tausende von Menschen diesen Weg gegangen sind, von denen einige später die Neue Welt bevölkert haben.
Die kleine Stadt, in die ich gelangte, lag vollkommen verlassen da. Nach langem Suchen fand ich eine kleine Kneipe in einem mittelalterlich wirkenden Gebäude. Der Wirt, der den Blick nicht von der Nachrichtensendung im Fernsehen wandte, bedeutete mir, dass jetzt Siestazeit und ich verrückt sei, bei dieser Hitze herumzufahren.
Ich bestellte ein kaltes Getränk, war versucht, auch ein wenig fernzusehen, doch ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich dachte nur daran, dass ich in zwei Tagen, mitten im 20. Jahrhundert, ein ähnlich großes Abenteuer der Menschheit erleben würde wie jenes, das Odysseus nach Troja, Don Quichotte auf die kastilische Hochebene La Mancha, Dante und Orpheus in die Unterwelt und Christoph Kolumbus nach Amerika führte: das Abenteuer einer Reise ins Unbekannte.
Als ich wieder ins Auto stieg, hatte sich meine Unruhe etwas gelegt. Selbst wenn ich mein Schwert nicht fand, die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg würde mir erlauben, mich selbst zu entdecken.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Maskierte Menschen und ihnen voran eine Blaskapelle, alle in Rot, Grün und Weiß gekleidet, den Farben des französischen Baskenlandes, zogen durch die Hauptstraße von Saint-Jean-Pied-de-Port. Es war Sonntag, ich hatte zwei Tage am Lenkrad meines Wagens verbracht und hatte keine Minute zu verlieren, und schon gar nicht die Zeit, um an diesem Fest teilzunehmen. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge und erreichte schließlich die Befestigungen, die den ältesten Teil der Stadt bilden, in dem ich Madame Savin treffen sollte. Sogar in diesem Winkel der Pyrenäen war es tagsüber heiß, und ich stieg schweißgebadet aus dem Wagen.
Ich klopfte an die Tür. Klopfte abermals, vergebens. Ein drittes Mal. Mir antwortete nur die Stille. Unruhig setzte ich mich auf einen Mauervorsprung. Meine Frau hatte mir gesagt, dass ich mich genau an diesem Tag dort einfinden sollte, doch niemand öffnete. Vielleicht war Madame Savin ausgegangen, um sich den Umzug anzusehen, dachte ich; doch es war ebenso gut möglich, dass ich zu spät gekommen war und sie beschlossen hatte, mich nicht mehr zu empfangen. Die Wanderung über den Jakobsweg war zu Ende, noch bevor sie begonnen hatte.
Plötzlich öffnete sich die Tür, und ein Kind stürzte auf die Straße. Ich sprang auf und fragte in meinem schlechten Französisch nach Madame Savin. Das kleine Mädchen lachte und wies ins Innere des Hauses. Da erst bemerkte ich meinen Irrtum: Die Tür führte in einen riesigen Innenhof, der von mittelalterlichen, mit Balkons versehenen Häusern umstanden war. Man hatte die Tür für mich offen gelassen, und ich hatte nicht einmal gewagt, die Klinke zu ergreifen.
Ich ging schnell hinein und lief zu dem Haus, das mir das Mädchen gezeigt hatte. Im Inneren fuhr eine dicke, nicht mehr ganz junge Frau einen schmächtigen jungen Mann mit traurigen braunen Augen auf Baskisch an. Ich wartete, bis die Alte den Jungen unter einem Schwall von Beschimpfungen in die Küche schickte. Dann erst wandte sie sich an mich, und ohne zu fragen, was ich denn wollte, führte sie mich resolut in den zweiten Stock des kleinen Hauses. Die Tür zu einem der Zimmer stand offen. Darin stand ein mit Büchern, Gegenständen, Statuetten des heiligen Jakobus und Souvenirs des Wallfahrtsweges vollgestellter Schreibtisch. Sie nahm ein Buch aus dem Regal, setzte sich an den einzigen Tisch im Zimmer.
»Ich nehme an, Sie sind auch ein Wallfahrer nach Santiago de Compostela«, sagte sie ohne Umschweife. »Ich muss Ihren Namen in das Register für den Jakobsweg eintragen.«
Ich sagte ihr meinen Namen, und sie wollte wissen, ob ich die Jakobsmuscheln mitgebracht hätte. So nennt man die großen Kammmuschelschalen, die am Grab des Apostels als Symbol für die Pilgerreise angebracht sind und die den Pilgern untereinander als Erkennungszeichen dienen. Vor meiner Abreise nach Spanien war ich in Brasilien an einen Wallfahrtsort gefahren, Aparecida do Norte. Dort hatte ich ein auf drei Muscheln montiertes Bildnis der Heiligen Jungfrau erstanden. Ich zog es aus meiner Reisetasche und reichte es Madame Savin.
»Hübsch, aber unpraktisch«, meinte sie, als sie mir die Muscheln zurückgab. »Sie könnten auf dem Weg zerbrechen.«
»Sie werden nicht zerbrechen. Ich werde sie zum Grab des Apostels bringen.«
Madame Savin schien nicht viel Zeit für mich zu haben. Sie gab mir ein kleines Heft, das mir die Unterbringung in den Klöstern längs des Weges erleichtern sollte, versah es mit dem Stempel von Saint-Jean-Pied-de-Port, um anzugeben, wo ich meine Reise begonnen hatte, und sagte, dass ich nunmehr mit dem Segen Gottes aufbrechen könne.
»Aber wo ist mein Führer?«, fragte ich sie.
»Was für ein Führer?«, entgegnete sie überrascht, doch mit einem Aufblitzen in den Augen.
Ich begriff, dass ich etwas Entscheidendes vergessen hatte. Weil ich es eilig gehabt hatte, anzukommen und aufgenommen zu werden, hatte ich das alte Wort nicht ausgesprochen, die Losung derer, die dem Orden der ›Tradition‹ angehören oder angehört haben. Ich machte sofort meinen Fehler wieder gut und sagte das Wort. Da entriss mir Madame Savin das Heft, das sie mir wenige Minuten zuvor gegeben hatte.
»Sie werden es nicht brauchen«, sagte sie, während sie einen Stapel alter Zeitungen von einer Pappschachtel nahm. »Ihr Weg und Ihre Unterkunft werden in den Händen Ihres Führers liegen.«
Madame Savin zog dann einen Hut und einen Umhang aus der Pappschachtel. Beide wirkten wie alte Kleidungsstücke, waren jedoch gut erhalten. Sie bat mich, mich in die Mitte des Zimmers zu stellen, und begann dann still zu beten. Dann legte sie mir den Umhang um die Schultern und setzte mir den Hut auf. Ich bemerkte, dass an den Hut und auf die Schulterstücke des Umhangs Muscheln genäht waren. Ohne ihr Gebet zu unterbrechen, nahm die alte Frau einen Stab, der in einer Ecke des Büros gestanden hatte, und legte ihn in meine rechte Hand. An diesem langen Stock hing oben eine kleine Kalebasse für Wasser. Da stand ich nun in Jeans-Bermudas und einem T-Shirt mit der Aufschrift ›I LOVE NY‹, und darüber das mittelalterliche Gewand der Santiago-de-Compostela-Pilger.
Die alte Dame trat auf mich zu. In einer Art Trance legte sie ihre Hände flach auf meinen Kopf und sagte:
»Möge dich der Apostel Jakobus begleiten und dir das Einzige zeigen, was du entdecken sollst. Geh weder zu schnell noch zu langsam, doch immer so, dass du die Gesetze und das, was der Weg verlangt, einhältst. Gehorche dem, der dich führen wird, auch wenn er dir befiehlt, zu töten, Gott zu lästern oder irgendeine unsinnige Tat zu vollführen. Du musst unbedingten Gehorsam schwören.«
Ich schwor.
»Der Geist der alten Pilger der ›Tradition‹ sei auf deiner Reise mit dir. Der Hut möge dich vor der Sonne und bösen Gedanken schützen. Der Umhang möge dich vor dem Regen und vor bösen Worten schützen. Der Stab möge dich vor den Feinden und vor bösen Taten schützen. Der Segen Gottes und des heiligen Jakobus und der Jungfrau Maria mögen dich Tag und Nacht begleiten. Amen.«
Dann fiel sie wieder in ihr altes Verhalten zurück: Mürrisch raffte sie die Kleidungsstücke zusammen und verstaute sie in der Schachtel, stellte den Stab mit der Kalebasse wieder in die Zimmerecke und bat mich, schnell aufzubrechen, da mein Führer mich ein oder zwei Kilometer von Saint-Jean-Pied-de-Port entfernt erwartete.
»Er hasst Blasorchester«, erklärte sie. »Aber er wird es sogar noch in ein, zwei Kilometer Entfernung hören: Die Pyrenäen sind ein außergewöhnlich guter Resonanzkasten.«
Ohne ein weiteres Wort stieg sie die Treppe hinunter und kehrte in die Küche zurück, um den jungen Mann mit den traurigen Augen weiter zu malträtieren. Im Hinausgehen fragte ich sie, was ich mit dem Wagen machen solle, und sie riet mir, ihr die Schlüssel dazulassen, weil sie jemand abholen käme. Also nahm ich meinen kleinen blauen Rucksack, an dem ein Schlafsack festgezurrt war, aus dem Kofferraum. Ich steckte das Bildnis der heiligen Muttergottes von Aparecida und die Muscheln in die Innentasche, schulterte den Rucksack und ging wieder zu Madame Savin zurück, um ihr die Wagenschlüssel zu geben.
»Sie verlassen die Stadt am besten, indem Sie dieser Straße bis zum Tor unten am Festungswall folgen. Und wenn Sie in Santiago de Compostela angekommen sind, beten Sie ein Ave-Maria für mich. Ich bin diesen Weg oft gegangen. Jetzt gebe ich mich damit zufrieden, in den Augen der Pilger die Begeisterung zu lesen, die ich selber noch fühle, aber aufgrund meines Alters nicht mehr in die Tat umsetzen kann. Sagen Sie das dem heiligen Jakobus. Sagen Sie ihm auch, dass ich irgendwann auf einem anderen, direkteren und weniger mühsamen Weg zu ihm kommen werde.«
Ich verließ die Stadt durch die Porte d’Espagne im Festungswall. Einst war dies der von den römischen Eroberern bevorzugte Weg gewesen, und auch die Armeen Karls des Großen und Napoleons Truppen waren durch das Tor gezogen. Ich wanderte schweigend, hörte von fern das Blasorchester, und inmitten der Ruinen eines Dorfes in der Nähe von Saint-Jean wurde ich unvermittelt von einem starken Gefühl überwältigt, und meine Augen füllten sich mit Tränen: Dort in den Ruinen wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass meine Füße auf dem geheimnisumwobenen Jakobsweg gingen.
Die Musik und die in die Morgensonne getauchten Pyrenäen rings um das Tal gaben mir das Gefühl, etwas ganz Ursprüngliches, etwas von den Menschen längst Vergessenes zu erleben. Es war ein seltsames, starkes Gefühl, das ich nicht beschreiben konnte, das mich veranlasste, meine Schritte zu beschleunigen, damit ich so schnell wie möglich den Ort erreichte, an dem mich laut Madame Savin mein Führer erwartete. Im Gehen hatte ich mein T-Shirt ausgezogen und in meinen Rucksack gesteckt. Die Schulterriemen begannen in meine nackten Schultern zu schneiden. Meine alten Turnschuhe hingegen waren so gut eingelaufen, dass ich sie nicht spürte. Nach etwa vierzig Minuten gelangte ich nach einer Biegung des Weges, der um einen riesigen Felsen führte, zu dem alten versiegten Brunnen. Auf der Erde saß ein etwa fünfzigjähriger schwarzhaariger Mann, der wie ein Zigeuner aussah und in einem Rucksack kramte.
»Hallo. Du wartest wohl schon auf mich. Ich heiße Paulo«, sagte ich auf Spanisch, schüchtern wie immer, wenn ich einen Unbekannten treffe.
Der Mann hörte auf, in dem Rucksack herumzustöbern, und schaute mich von oben bis unten an. Sein Blick war kalt, und er schien über meine Ankunft nicht überrascht zu sein. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, ihn zu kennen.
»Ja, ich habe auf dich gewartet, aber ich dachte nicht, dass ich dich so schnell treffen würde. Was willst du?«
Durch seine Frage etwas verwirrt, antwortete ich ihm, dass ich der sei, den er auf dessen Suche nach dem Schwert die ›Milchstraße‹ entlangführen solle.
»Das wird nicht notwendig sein«, sagte der Mann. »Wenn du willst, kann ich es für dich finden. Aber entscheide dich schnell.«
Mir kam die Unterhaltung immer merkwürdiger vor. Dennoch wollte ich ihm, da ich ja unbedingten Gehorsam geschworen hatte, gleich antworten. Wenn er das Schwert für mich finden könnte, würde ich sehr viel Zeit gewinnen und könnte schnell nach Brasilien zu meiner Familie und meiner Arbeit zurückkehren, die mich in Gedanken noch immer beschäftigte. Es konnte dies auch eine List sein, aber eine Antwort würde nichts schaden.
Ich hatte schon beschlossen, das Angebot anzunehmen, da hörte ich plötzlich hinter mir eine Stimme mit sehr starkem Akzent auf Spanisch sagen:
»Man braucht einen Berg nicht zu besteigen, um zu wissen, dass er hoch ist.«
Das war die Losung. Ich drehte mich um und sah einen etwa vierzigjährigen Mann in Khakibermudas und einem schweißdurchtränkten weißen Hemd, der den Zigeuner anstarrte. Er hatte graumeliertes Haar und sonnengebräunte Haut. In meiner Hast hatte ich die elementarsten Sicherheitsvorkehrungen vergessen und mich dem Erstbesten, den ich getroffen hatte, in die Arme geworfen.
»Das Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. Doch nicht dazu wurden Schiffe gebaut«, antwortete ich auf das Losungswort. Der Mann wandte währenddessen den Blick nicht vom Zigeuner, der seinerseits den Mann nicht aus den Augen ließ. Sie sahen einander einige Minuten lang furchtlos und ruhig an, bis der Zigeuner den Rucksack mit einer verächtlichen Geste auf den Boden stellte und in Richtung Saint-Jean-Pied-de-Port verschwand.
»Ich heiße Petrus«, sagte der Neuankömmling, nachdem der Zigeuner hinter dem riesigen Felsen verschwunden war, den ich wenige Minuten zuvor umrundet hatte. »Das nächste Mal sei vorsichtiger.«
Seine Stimme klang sympathischer als die des Zigeuners und auch als die von Madame Savin. Er nahm seinen Rucksack, auf dessen Rückseite eine Muschel abgebildet war, zog eine Flasche Wein daraus hervor, trank einen Schluck davon und reichte sie dann mir. Nachdem ich getrunken hatte, fragte ich ihn, wer der Zigeuner gewesen sei.
»Dieser Weg verläuft an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich und wird häufig von Schmugglern und flüchtigen Terroristen aus dem spanischen Baskenland benutzt«, erklärte mir Petrus. »Die Polizei kommt fast nie hierher.«
»Das ist keine Antwort. Ihr habt euch angesehen, als wärt ihr alte Bekannte. Und auch ich hatte das Gefühl, ihn zu kennen, deshalb war ich auch so unbedacht.«
Petrus lachte und meinte, wir sollten uns nun auf den Weg machen. Ich nahm meine Sachen, und wir wanderten schweigend. Doch Petrus’ Lachen hatte mich verstehen lassen, dass er dasselbe dachte wie ich: Wir waren einem Dämon begegnet.
Wir gingen eine geraume Weile, ohne etwas zu sagen. Madame Savin hatte recht gehabt: Man konnte selbst in einer Entfernung von beinahe drei Kilometern noch das Blasorchester hören. Ich hätte Petrus gern eine Menge Fragen zu seinem Leben, seiner Arbeit und dem Grund seines Hierseins gestellt. Doch ich wusste, dass wir noch siebenhundert Kilometer gemeinsamen Weges vor uns hatten und ich zum gegebenen Zeitpunkt auf diese Fragen eine Antwort erhalten würde. Allein, der Zigeuner ging mir nicht aus dem Sinn, und schließlich brach ich das Schweigen.
»Petrus, ich glaube, dass der Zigeuner der Dämon war.«
»Ja, das war der Dämon.« Als er es mir bestätigte, spürte ich eine Mischung aus Schrecken und Erleichterung. »Aber das war nicht der Dämon, den du in der ›Tradition‹ kennengelernt hast.«
In der ›Tradition‹ ist der Dämon ein Geist, der weder gut noch böse ist. Ihm wird die Rolle des Wächters der meisten für den Menschen erreichbaren Geheimnisse zugeschrieben, und er hat die Macht über die materiellen Dinge. Er ist ein gefallener Engel, der sich mit den Menschen identifiziert und bei entsprechender Gegenleistung immer bereit ist, ihm einen Gefallen zu tun.
Auf meine Frage, was denn der Unterschied zwischen dem Zigeuner und den Dämonen der ›Tradition‹ sei, antwortete Petrus lachend:
»Wir werden auf unserem Weg noch weitere treffen. Du wirst es schon selber herausfinden. Erinnere dich an die Unterhaltung, die du mit dem Zigeuner hattest, dann wird dir etwas auffallen.«
Ich rief mir die zwei Sätze ins Gedächtnis, die wir miteinander gesprochen hatten. Er hatte gesagt, er habe mich erwartet, und mir versichert, er werde das Schwert für mich finden.
Darauf erklärte mir Petrus, dass die beiden Sätze wunderbar in den Mund eines Diebes passten, der dabei erwischt wird, wie er einen Rucksack stiehlt: Er versucht, Zeit zu gewinnen und sich, während er seine Flucht vorbereitet, den anderen gewogen zu machen. Beide Sätze könnten einen verborgenen tieferen Sinn enthalten, oder aber seine Worte gaben nur genau das wieder, was er dachte.
»Und welche ist die richtige Deutung?«
»Beide. Der arme Dieb hat, während er sich verteidigte, seine Worte aus der Luft gegriffen. Er hielt sich für schlau und war dabei nur das Werkzeug einer höheren Macht. Wäre er geflohen, als ich kam, müssten wir uns jetzt nicht über ihn unterhalten. Doch er hat sich mir gestellt, und ich habe in seinen Augen den Namen eines Dämons gesehen, dem du noch auf unserem Weg begegnen wirst.«
Für Petrus war dieses Treffen ein gutes Omen, weil sich der Dämon schon früh offenbart hatte.
»Einstweilen mach dir seinetwegen keine Sorgen, denn, wie gesagt, er wird nicht der Einzige bleiben. Er ist vielleicht der Wichtigste, doch er wird nicht der Einzige bleiben.«
Wir setzten unsere Wanderung fort. Die bislang etwas wüstenartig wirkende Vegetation bestand jetzt aus locker verteilten Büschen. Vielleicht sollte ich besser Petrus’ Rat befolgen und die Dinge auf mich zukommen lassen. Hin und wieder machte er eine Bemerkung zu historischen Ereignissen, die sich dort ereignet hatten, wo wir gerade vorbeikamen. Ich habe beispielsweise das Haus gesehen, in dem eine Königin am Vorabend ihres Todes geschlafen hat, und eine kleine in die Felsen geschmiegte Kapelle, die Einsiedelei eines heiligen Mannes, von dem die wenigen Bewohner des Landstrichs behaupteten, er tue Wunder.
»Wunder sind doch etwas sehr Wichtiges, findest du nicht?«, fragte mich Petrus.
Ich stimmte ihm zu, sagte ihm aber auch, dass ich bislang kein großes Wunder gesehen hätte. Meine Lehrjahre innerhalb der ›Tradition‹ seien eher intellektuell ausgerichtet gewesen. Ich glaubte, dass ich, wenn ich mein Schwert wiedergefunden haben würde, imstande wäre, meinerseits die großen Dinge zu tun, die mein Meister tat.
»Aber das sind keine Wunder, weil sie die Gesetze der Natur nicht ändern. Mein Meister gebraucht seine Kräfte, um …«
Ich brachte meinen Satz nicht zu Ende, weil ich keine Erklärung für die Tatsache fand, dass mein Meister Geister materialisieren konnte, dass er Gegenstände von ihrem Platz bewegte, ohne sie zu berühren, und dass er, wie ich es mehr als einmal gesehen hatte, in der dunklen Wolkendecke eines Nachmittags Lücken blauen Himmels öffnete.
»Vielleicht tut er das, um dich davon zu überzeugen, dass er das Wissen und die Macht besitzt«, entgegnete Petrus.
»Das ist möglich«, meinte ich etwas halbherzig.
Wir setzten uns auf einen Stein, weil Petrus mir sagte, er hasse es, im Gehen zu rauchen. Die Lungen nähmen dann mehr Nikotin auf, und davon würde ihm übel werden.