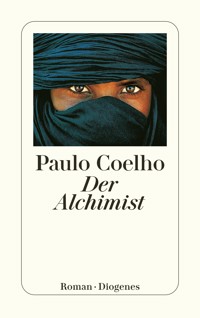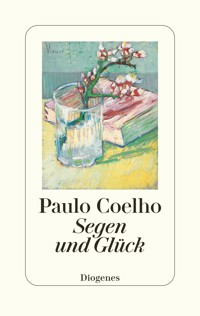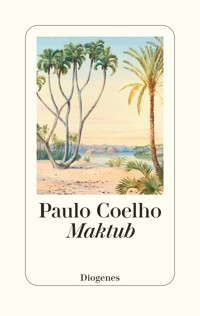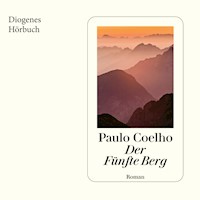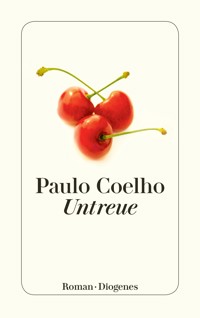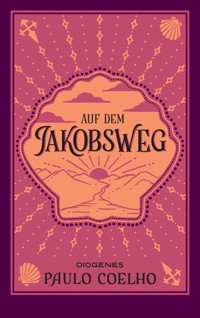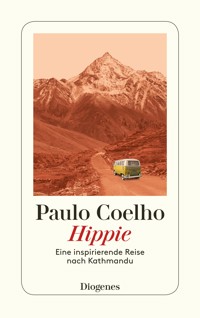
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch schreibt Paulo Coelho über sein Leben als junger Rockmusiker aus Südamerika. Als ihm in Amsterdam die Holländerin Karla begegnet, trifft sie die Liebe wie der Blitz. Sie beschließen, aufzubrechen und auf dem Hippie-Trail nach eigenen Werten zu suchen und danach zu leben. Dabei sind ihre Freunde sowie die Musik, die damals die Welt aus den Angeln hob.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Paulo Coelho
Hippie
Eine inspirierende Reise nach Kathmandu
Aus dem Brasilianischen von Maralde Meyer-Minnemann
Diogenes
Gegrüßet seist du, Maria, ohne Sünde empfangen,
bete für uns, die wir uns an dich wenden. Amen.
Und es ward ihm angesagt: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun.
Lukas 8, 20–21
Ich dachte, dass meine Reise ihr Ende gefunden, bis zum letzten Bereich meines Könnens – dass der Pfad vor mir geschlossen sei, dass der Vorrat erschöpft und die Zeit gekommen, um Schutz zu finden in stiller Verborgenheit. Aber ich finde: Kein Ende kennt dein Wille mit mir. Wenn alte Worte auf der Zunge sterben, dann brechen neue Melodien im Herzen aus; und wo die alte Spur verloren ist, da wird ein neues Land mit seinen Wundern offenbar.
Rabindranath Tagore
Für Kabir, Rumi, Tagore, Paulus von Tarsus, Hafez, die mich begleiten, seit ich sie entdeckt habe, die den Teil meines Lebens geschrieben haben, den ich im Buch erzähle – oft mit ihren Worten.
Was in diesem Buch berichtet wird, habe ich selbst erlebt. Namen, Angaben zu Personen wie auch die Chronologie der Ereignisse habe ich verändert, einige Szenen verkürzt wiedergegeben, aber alles Dargestellte entspricht wirklich Geschehenem. Ich erzähle in der dritten Person, damit jede Figur erkennbar eine eigene Stimme haben kann.
Im September 1970 befanden sich zwei Orte im Wettstreit um das Privileg, als Mittelpunkt der Welt zu gelten: Piccadilly Circus in London und der Dam in Amsterdam. Allerdings sahen dies nicht alle Menschen so. Die meisten hätten auf die Frage wohl geantwortet: das Weiße Haus in Washington und der Kreml in Moskau. Denn die meisten Menschen bezogen ihre Informationen aus Presse, Radio und Fernsehen, also durch bereits damals vollkommen überholte Kommunikationsmittel, die niemals mehr die Bedeutung haben würden wie zur Zeit ihrer Erfindung.
Im September 1970 waren Flugtickets sehr teuer, was nur einer Elite erlaubte zu reisen. Zu dieser Elite gehörte natürlich nicht die überwältigende Mehrzahl aller Jugendlichen, die in den herkömmlichen Kommunikationsmitteln nur auf ihr Äußeres reduziert wurden: lange Haare, bunte Kleidung, ungewaschen – eine glatte Lüge, aber diejenigen, die Zeitung lasen, kannten ja keine dieser Jugendlichen, und die Erwachsenen glaubten jeder angeblichen Nachricht, die imstande war, jene herabzuwürdigen, die sie für eine »Bedrohung der Gesellschaft und der guten Sitten« hielten. Mit ihrer schlimmen Zügellosigkeit und der »freien Liebe« brachten sie in ihren Augen eine ganze Generation von fleißigen jungen Männern und Frauen in Gefahr, die versuchten, es im Leben zu etwas zu bringen. Jenseits der überholten Kommunikationsmittel verfügte diese immer größer werdende Menge junger Menschen jedoch über ein eigenes System der Nachrichtenverbreitung, das für diejenigen, die nicht dazugehörten, nicht wahrnehmbar war.
Der »Unsichtbaren Zeitung« lag nichts daran, das neue Volkswagenmodell oder die neuen Waschmittel, die überall auf der Welt herausgebracht wurden, bekannt zu machen oder zu kommentieren. Ihre Nachrichten beschränkten sich auf die Frage, welches die Route für die nächste Reise ebenjener unverschämten, schmutzigen Jugendlichen sein würde, die die »freie Liebe« praktizierten und Kleidung trugen, die kein Mensch mit gutem Geschmack anziehen würde. Die jungen Frauen trugen Blumen im geflochtenen Haar, lange Röcke, bunte Blusen, keine Büstenhalter, dazu bunte Ketten aus unterschiedlichsten Materialien; die jungen Männer, seit Monaten unrasiert, das Haar lang, trugen zerschlissene Jeans – sie hatten natürlich meist nur diese eine, denn Jeans waren überall auf der Welt teuer, außer in den USA, wo sie mittlerweile nicht mehr die typischen Hosen von Fabrik- und Feldarbeitern waren, sondern auch von allen Jugendlichen bei riesigen Konzerten in San Francisco und anderswo getragen wurden.
Die »Unsichtbare Zeitung« war entstanden, weil die jungen Leute sich bei diesen Konzerten darüber austauschten, wo sie sich als Nächstes treffen und wie sie die Welt entdecken könnten – ohne in einen Touristenbus steigen zu müssen, in dem Reiseleiter auf die immer gleiche Weise Landschaften kommentierten, während sich die Jüngeren langweilten und die Alten schliefen. Und so wurde von Mund zu Mund weitergegeben, wo das nächste Konzert stattfinden und welches die nächste angesagte Reiseroute sein würde.
Und auch aus finanziellen Gründen wurde niemand ausgeschlossen, denn das wichtigste Buch dieser Gemeinschaft hieß Europe On Five Dollars a Day, geschrieben von Arthur Frommer. Darin konnten alle erfahren, wo man für wenig Geld unterkommen konnte, was man gesehen haben musste, wo man preiswert essen und welches die Treffpunkte und Orte waren, an denen man Live-Musik hören konnte. Das einzige Manko war, dass Frommer damals seinen Reiseführer auf Europa beschränkt hatte. Gab es denn keine anderen interessanten Orte? Wollten die Leute lieber nach Paris als nach Indien reisen? Aber die »Unsichtbare Zeitung« machte auch eine Route in Südamerika bekannt, nämlich die in die alte, hoch in den Anden gelegene Ruinenstadt Machu Picchu, wobei aber allen eingeschärft wurde, nicht mit Nicht-Hippies darüber zu sprechen. Andernfalls hätte der Ort schon bald eine Invasion von Barbaren mit Fotoapparaten und von Reiseleitern zu befürchten, die den Touristen langatmig erklärten, wie die Indios mit ihren primitiven Mitteln eine so gut versteckte Stadt hatten bauen können.
Aber gerechterweise sollte noch ein anderes Buch erwähnt werden, das zwar nicht so populär war wie Frommers Buch, aber von Leuten verschlungen wurde, die bereits ihre sozialistische, marxistische, anarchistische Phase hinter sich hatten. Es hieß Aufbruch ins dritte Jahrtausend und entstammte der Feder des Franzosen Louis Pauwels und des in der Ukraine geborenen Mathematikers, Ex-Spions und unermüdlichen Erforschers des Okkultismus Jacques Bergier. Dieses Buch wurde von all jenen gelesen, die von der marxistischen Bewegung enttäuscht und davon überzeugt waren, dass die Behauptung, Religion sei »das Opium des Volkes«, nur von jemandem stammen könne, der nichts vom Volk und noch weniger von Opium verstand. Denn zum Glauben dieser schlechtgekleideten Jugendlichen gehörten Gott, Götter, Göttinnen, Engel und dergleichen. Und Pauwels und Bergier waren zudem von der Existenz von Alchimisten und Magiern überzeugt. Das Buch wurde zwar nie zu einem großen Verkaufserfolg, denn es war extrem teuer – dafür wurde jedes Exemplar von mindestens zehn Personen gelesen. Da in Pauwels’ und Bergiers Buch Machu Picchu vorkam, wollten alle dorthin, nach Peru.
So trafen sich dort bald junge Leute aus aller Welt, zumindest aus dem Teil der Welt, in dem es, anders als etwa in der Sowjetunion, Reisefreiheit gab. Sie begaben sich auf die sogenannten »Hippie-Trails«, obwohl viele von ihnen gar nicht wussten, was das Wort »Hippie« genau bedeutete, aber das war letztlich auch uninteressant. Vielleicht bedeutete es ja auch so etwas wie »großer Stamm ohne Anführer« oder »Outlaws, die keine Überfälle machen«.
Um reisen zu können, brauchten die Jugendlichen Reisepässe, jene kleinen von der Regierung gelieferten Heftchen, die mit dem Geld (gleichgültig ob viel oder wenig) in eine am Gürtel befestigte Tasche gesteckt wurden und zwei Zwecke erfüllten. Der erste war natürlich, dass man damit Grenzen überschreiten konnte – solange einen die Grenzbeamten nicht zurückschickten, weil sie sich von dem beeinflussen ließen, was sie in den Zeitungen lasen. Diesen Nachrichten zufolge handelte es sich bei den ungewohnt aussehenden Menschen mit den langen Haaren, den Blumen und Glasperlenketten, die da vor ihnen auftauchten, um Drogensüchtige, die sich im Zustand ständiger Ekstase befanden.
Der zweite Zweck des Reisepasses war, seinen Inhabern bei extremer Geldknappheit zu helfen. Die besagte »Unsichtbare Zeitung« lieferte stets Informationen über die Orte, an denen Reisepässe verkauft werden konnten. Der Preis richtete sich nach dem Land: Ein Pass aus Schweden, wo alle blond, groß und blauäugig waren, gehörte nicht zu den beliebtesten. Aber ein brasilianischer Pass war auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert – weil Brasilen ein Land war, in dem es neben blonden, großen und helläugigen auch große und kleine Schwarze mit dunklen Augen, Orientalen mit Mandelaugen, Mulatten, Indios gab, kurz und gut, weil Brasilien ein riesiger Schmelztiegel von Kulturen war, was den Pass zu einem der begehrtesten des Planeten machte.
Hatte er seinen Pass verkauft, ging der ursprüngliche Inhaber des Reisepasses zum Konsulat seines Landes, mimte dort den Verzweifelten, der überfallen und dem alles gestohlen worden war, allem voran Geld und Pass. Die Konsulate der reicheren Länder boten Pass und Rückflugtickets an. Die Konsulate armer Länder, bei denen es sich oft um Militärdiktaturen handelte, stellten regelrechte Verhöre an, um herauszufinden, ob der Antragsteller womöglich auf der Liste gesuchter »Terroristen« stand. Wurde festgestellt, dass das Mädchen oder der Junge sauber war, mussten ihnen die Konsulate wohl oder übel einen neuen Pass ausstellen. Rückflugtickets jedoch boten sie keine an, weil kein Interesse an Personen bestand, die womöglich im Heimatland die lokale, im Respekt vor Gott, Familie und dem Besitz erzogene Jugend negativ beeinflussen würden.
Doch zurück zu den Reiserouten der Hippies: Nach Machu Picchu war Tiahuanaco in Bolivien dran. Dann Lhasa in Tibet, wo die Einreise äußerst schwierig war, weil es, der »Unsichtbaren Zeitung« zufolge, einen Krieg zwischen den Mönchen und den chinesischen Soldaten gab. Genaues wusste man zwar nicht, aber niemand wollte riskieren, eine endlos weite Reise anzutreten, um am Ende Gefangener der Mönche oder der Soldaten zu werden. Indien wurde das nächste Ziel. Die Beatles, die sich im April 1968 getrennt hatten und die für viele Jugendliche zu den großen Philosophen der Epoche gehörten, hatten nämlich kurz zuvor verkündet, dass die größte Weisheit des Planeten in Indien zu finden sei. Das allein genügte, damit junge Menschen aus der ganzen Welt auf der Suche nach Weisheit, Wissen und Erleuchtung dorthin reisten.
Damals kursierte allerdings das Gerücht, Maharishi Mahesh Yogi habe Mia Farrow, die auf Einladung der Beatles in seinem Ashram zu Gast war, Avancen gemacht, obwohl die Filmschauspielerin gerade nach Indien gekommen war, um sich dort von sexuellen Traumata heilen zu lassen, die sie wie ein schlechtes Karma verfolgten. Angeblich, so das Gerücht weiter, habe sie in der großen Höhle des Gurus meditiert, als dieser sie zum Sex nötigte. Als Mia ihnen tränenüberströmt von dem Vorfall erzählte, packten George Harrison und John Lennon umgehend die Koffer, und als der Erleuchtete kam und fragte, was da los sei, war Lennons Antwort: »If you’re so cosmic, you’ll know why.«
Im September 1970 herrschten plötzlich die Frauen – besser gesagt, die jungen weiblichen Hippies hatten das Sagen. Mit Äußerlichkeiten wie etwa modischer Kleidung konnten die Männer – das wurde ihnen immer klarer – bei diesen Frauen nicht mehr punkten. Immer öfter verlegten sich die Hippiemänner deshalb darauf, ihr Inneres nach außen zu kehren, ihre Sensibilität und gelegentlich auch einmal Schwäche zu zeigen. Sie waren nun nicht mehr automatisch die Beschützer.
Auch in der Liebe wurde ihnen die Initiative streitig gemacht. Die Hippie-Frauen warteten nicht darauf, dass ein Mann sie ansprach, sondern wählten sich ihre Männer aus. Sie dachten nicht ans Heiraten, sondern wollten von ihnen nur intensiven, kreativen Sex und eine vergnügliche Zeit. Zudem beanspruchten sie, bei allem und jedem das letzte Wort zu haben. Und als die »Unsichtbare Zeitung« die Nachricht von der sexuellen Belästigung Mia Farrows durch den indischen Guru und John Lennons Reaktion darauf verbreitete, entschieden diese jungen Frauen sich gegen die Indienroute und stattdessen für eine neue. Diese verlief von Amsterdam über die Türkei, den Libanon, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan und einen nördlichen (vom Tempel Maharishis weit entfernten) Zipfel Indiens nach Kathmandu.
Eine dreiwöchige, fast zehntausend Kilometer weite Reise in einem Bus – für nur einhundert Dollar.
Karla saß auf dem Dam in Amsterdam und fragte sich, ob und wann jemand kommen würde, der sie bei diesem magischen Abenteuer begleiten würde. Sie hatte ihren Job in Rotterdam aufgegeben und war, da sie jeden Cent umdrehen musste, statt wie sonst mit dem Zug diesmal per Anhalter hergekommen, was sie trotz der kurzen Strecke fast einen Tag gekostet hatte. Sie hatte von dem Hippie-Trail der Frauen nach Nepal in einer der vielen alternativen Zeitungen gelesen, die wie Pilze aus dem Boden schossen und von Idealisten gemacht wurden, denen es egal war, wenn sich davon nur wenige Exemplare verkauften – Hauptsache, sie brachten ihre Message an den Mann beziehungsweise die Frau.
Karla wartete einen Tag, zwei Tage, eine Woche. Dann wurde sie allmählich nervös. Sie hatte Dutzende junger Männer aus der ganzen Welt angesprochen. Diese waren aber nur daran interessiert, mitten auf dem Dam um einen Obelisken herumzuhocken, den (neben einer Frau mit Kind und zwei Hunden) insgesamt sechs männliche Figuren zierten.
Dass sie keinen Begleiter fand, lag keineswegs an der Länge der geplanten Route. Die meisten kamen von weit her, aus den USA, Lateinamerika oder Australien, und hatten viel Geld für überteuerte Flugtickets und zur Bestechung von Grenzposten ausgegeben, die sie sonst in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt hätten. Wenn sie schließlich Amsterdam erreichten, hockten sie sich einfach nur noch auf den Platz und rauchten Marihuana, was sie hier anders als in ihren Herkunftsländern ungehindert unter den Augen der Polizei tun konnten. Währenddessen wurden sie im wahrsten Sinne des Wortes belagert von Anhängern der zahlreichen Sekten und Kulte, die es in Amsterdam gab. Wenigstens konnten sie dabei eine Weile die Vorwürfe vergessen, die sie sich zu Hause tagaus, tagein hatten anhören müssen: Junge, warum gehst du nicht endlich zur Uni und lässt dir diese langen Zotteln abschneiden. Wir, deine Eltern, müssen uns ja sonst vor den anderen (wer immer damit gemeint war) schämen, dass wir dich nicht ordentlich erzogen haben. Und was du da hörst, ist nun wirklich keine Musik. Und such dir endlich eine Arbeit. Nimm dir ein Vorbild an deinen Geschwistern, sie sind jünger als du, verdienen schon ihr eigenes Geld und pumpen uns nicht wie du ständig an.
Weit weg vom ewigen Gezeter ihrer Eltern konnten sie sich endlich als freie Menschen fühlen. Europa war für sie ein sicherer Hort – solange sie nicht auf die abwegige Idee kamen, hinter den Eisernen Vorhang und in ein kommunistisches Land zu fahren. Und sie waren glücklich, weil man auf Reisen alles lernt, was man für den Rest seines Lebens braucht.
»Ich weiß, du möchtest, dass ich fertigstudiere, aber ein Diplom kann ich auch später noch machen, jetzt muss ich Erfahrungen sammeln, Vater.«
Keinem Vater leuchtete diese Denkweise ein, und deshalb blieb den jungen Männern nichts anderes übrig, als Geld zu sparen, dies oder das zu verkaufen und sich heimlich auf den Weg zu machen.
Karla war also von freien Menschen umgeben, die entschlossen waren, Dinge auszuprobieren, die sie anderswo nicht gewagt hätten.
Warum nicht im Bus nach Kathmandu fahren?
Weil es nicht Europa ist, gaben die jungen Männer zurück. Wir kennen das doch gar nicht.
Aber wenn etwas passiert, können wir immer noch aufs Konsulat gehen und um ein Ticket zurück nach Hause bitten. (Karla kannte zwar keinen einzigen Fall, in dem einem solchen Ansinnen stattgegeben worden wäre, aber das war die Legende, und eine Legende wird zur Wahrheit, wenn sie nur häufig genug wiederholt wird.)
Karla war verzweifelt, weil derjenige, den sie in Gedanken ihren »Begleiter« nannte, einfach nicht auftauchen wollte. Jeden Tag gab sie Geld für einen Schlafplatz aus, wo sie doch einfach im Magic Bus (wie der offizielle Name des Busses nach Kathmandu lautete) hätte schlafen können. Deshalb beschloss Karla, eine Wahrsagerin zu konsultieren, an deren Laden sie auf dem Weg zum Dam immer vorbeikam.
Als sie eintrat, war der Laden leer.
Im September 1970 glaubte eigentlich jeder, über übernatürliche Kräfte zu verfügen oder zumindest dabei zu sein, welche zu entwickeln. Karla war jedoch ein rationaler Mensch, auch wenn sie jeden Tag meditierte und davon überzeugt war, allmählich ihr Drittes Auge – jenen unsichtbaren Punkt zwischen den Augen – zu finden. Doch weil dieses Dritte Auge – oder ihre Intuition – regelmäßig versagt hatte, war sie bisher immer an die falschen Männer geraten.
Mittlerweile hatte Karla überlegt, mit einer Gefährtin loszuziehen, diese Idee aber als selbstmörderisch gleich wieder verworfen, da die Reise durch viele Länder führte, in denen zwei allein reisende Frauen schief angesehen und schlimmstenfalls, wie ihre Großmutter unkte, als »weiße Sklavinnen« verkauft werden würden (die Bezeichnung hatte zwar für Karla durchaus etwas Erotisches, aber am eigenen Leibe wollte sie die Erfahrung nicht machen).
Die Wahrsagerin hieß Leyla, war nur wenig älter als Karla und ganz in Weiß gekleidet. Sie empfing sie mit dem seligen Lächeln derer, die mit einem höheren Wesen in Verbindung stehen, und einer tiefen Verbeugung. Karla sah sich um, wählte einen der bereitstehenden Stühle und setzte sich. Da lobte sie die Frau, weil sie ausgerechnet den »Kraftort« im Raum ausgewählt hatte. Karla redete sich ein, dass sie es tatsächlich allmählich schaffte, ihr Drittes Auge zu öffnen, aber ihr Unterbewusstsein warnte sie, dass Leyla vermutlich zu allen Kunden dasselbe sagte.
Leyla entzündete ein Weihrauchstäbchen – »kommt aus Nepal«, sagte sie, aber Karla wusste, dass die Räucherstäbchenproduktion zusammen mit der von Batikhemden und den Peace- oder Flower-Power-Aufnähern zur florierenden niederländischen Hippie-Industrie gehörte. Leyla nahm ein Kartenspiel und begann zu mischen. Sie bat Karla abzuheben, legte drei Karten aus und begann sie zu deuten.
Karla unterbrach sie.
»Dafür bin ich nicht hergekommen. Ich möchte nur wissen, ob ich jemanden finde, der mich an den Ort begleitet, von dem Sie sagten, dass von dort die Weihrauchstäbchen kommen.« Und sie betonte »von dem Sie sagten, dass von dort die Weihrauchstäbchen kommen«, weil sie kein schlechtes Karma wollte. Hätte sie »ich will an eben jenen Ort« gesagt, hätte sie sich womöglich in einer der Vorstädte Amsterdams wiedergefunden, in der wahrscheinlich die Weihrauchstäbchenfabrik lag.
Leyla lächelte, obwohl sich die Schwingungen im Raum vollkommen geändert hatten – innerlich kochte sie vor Zorn, in einem so feierlichen Augenblick unterbrochen worden zu sein.
»Ja, selbstverständlich werden Sie dorthin fahren.«
»Und wann?«
»Noch vor Ende des morgigen Tages.«
Beide hielten überrascht inne.
Karla spürte plötzlich, dass ihr Gegenüber die Wahrheit sagte, weil deren Tonfall auf einmal positiv und eindringlich war, so als würde die Stimme aus einer anderen Dimension kommen. Leyla ihrerseits war erschrocken – sie trat nicht jedes Mal in diese Welt ein, die zugleich unwirklich und wahr zu sein schien. Sie fürchtete manchmal, dafür bestraft zu werden, dies ganz ohne besondere Vorbereitungen zu tun. Und nachts rechtfertigte sie sich in ihren Gebeten damit, dass sie dies alles nur tue, um ihren Kunden mehr Zuversicht bei der Verwirklichung ihrer Träume zu geben.
Karla erhob sich vom »Kraftort«, bezahlte und ging hinaus, um vor dem Mann, der kommen würde, dort zu sein. »Vor Ende des morgigen Tages« war vage, es konnte ja auch heute sein. Ihr Begleiter würde kommen. Sie musste sich nur noch etwas gedulden.
Sie ging zu ihrem Platz auf dem Dam zurück, schlug das Buch auf, das sie gerade las und das bis jetzt nur wenige kannten – was ihm Kultstatus verlieh. Es hieß Der Herr der Ringe, geschrieben von einem gewissen J.R.R. Tolkien. Darin ging es um mythische Orte wie den, den sie besuchen wollte. Sie gab vor, nichts zu hören, wenn die jungen Männer sie unter einem fadenscheinigen Vorwand in einen belanglosen Flirt zu verwickeln versuchten.
Paulo und der Argentinier hatten über alles geredet, worüber man auch nur ansatzweise reden konnte, und schauten jetzt über das flache Land, ohne wirklich dort zu sein – mit ihnen reisten Erinnerungen, Namen, Sehenswürdigkeiten und vor allem die riesengroße Angst vor dem, was an der niederländischen Grenze passieren könnte, die noch etwa zwanzig Minuten entfernt war.
Paulo schlug den Jackettkragen hoch, um sein langes Haar zu verstecken.
»Hältst du die Grenzbeamten wirklich für so blöd, dass sie darauf reinfallen, Paulo?«
Paulo gab auf. Er fragte den Argentinier, ob er denn keine Angst habe.
»Klar hab ich Angst. Vor allem, weil ich schon zwei Einreisestempel für die Niederlande habe. Dann werden sie misstrauisch. Das kann doch nur eines heißen.«
Drogenhandel, dachte Paulo. Aber waren Drogen in Holland denn nicht frei zugänglich?
»Natürlich nicht. Der Besitz von Opiaten wird streng bestraft. Dasselbe gilt für Kokain. LSD ist natürlich nicht kontrollierbar, weil man nur eine Buchseite oder ein Stück Stoff in die Mischung zu tauchen braucht und es dann schnipselweise verkaufen kann.« Er hielt kurz inne, schien nachzudenken und schüttelte den Kopf. »Aber alles, was sie sonst bei einem finden, kann einen ins Gefängnis bringen.«
Paulo fragte nicht weiter, obwohl er wahnsinnig neugierig war, zu erfahren, ob der Argentinier tatsächlich etwas bei sich hatte. Doch allein die Tatsache, dass er es wüsste, würde ihn zum Komplizen machen. Er war schon einmal festgenommen worden, obwohl er vollkommen unschuldig gewesen war – in einem Land, in dem auf den Flughäfen auf vielen Türen Aufkleber mit der Aufschrift prangten: »Brasilien – liebe es oder verlasse es.«
Wie immer, wenn man einen Gedanken aus dem Kopf verbannen will, weil er negativ aufgeladen ist, kam die Erinnerung an das, was 1968 geschehen war, wie zum Trotz mit aller Macht hoch. Paulo bekam Herzrasen, und von einem Moment auf den anderen war alles, was zwei Jahre zuvor in einem Restaurant in Ponta Grossa geschehen war, wieder da.
Er war soeben von seiner ersten langen Reise auf dem Hippie-Trail zurückgekommen, der damals gerade in Mode kam. Er war mit seiner elf Jahre älteren Freundin unterwegs gewesen. Sie, Tochter aus adligem Haus, geboren und aufgewachsen im kommunistischen Jugoslawien, hatte eine gute Erziehung genossen und sprach vier Sprachen. Nach ihrer Flucht nach Brasilien hatte sie einen Millionär geheiratet, sich jedoch von ihm getrennt, als sie herausfand, dass er sie mit ihren dreiunddreißig Jahren zu alt fand und mit einer Neunzehnjährigen betrog. Sie nahm sich einen ausgezeichneten Anwalt, der eine Abfindung für sie herausschlug, die ihr erlaubte, für den Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten zu müssen. Mit ihr hatte Paulo einen Teil der Reise nach Machu Picchu im sogenannten »Todeszug« zurückgelegt, der sich sehr von dem unterschied, in dem er sich jetzt befand.
»Warum nennt man ihn ›Todeszug‹?«, hatte die Freundin den Schaffner gefragt. »Wir kommen nicht gerade an vielen Schluchten vorbei.«
»Ursprünglich wurde der Zug zum Transport von Leprakranken und von Opfern einer schweren Gelbfieberepidemie benutzt, die die Region von Santa Cruz heimgesucht hatte.«
»Ich hoffe doch, dass die Waggons ordentlich desinfiziert wurden.«
»Seither wurden in der Gegend kaum mehr Tote gefunden. Es sei denn den einen oder anderen Minenarbeiter, weil einer der Kumpel eine alte Rechnung zu begleichen hatte.«
Bei den erwähnten Bergarbeitern handelte es sich um die Arbeiter, die Tag und Nacht in den Bleiminen Boliviens arbeiteten. Nun, sie befanden sich hier jetzt in einer zivilisierteren Welt, und Paulo hoffte, dass an diesem Tag niemand auf den Gedanken kam, alte Rechnungen zu begleichen.
Sie erreichten La Paz, die auf 3640 Meter Höhe gelegene Hauptstadt des Landes. Da sie mit dem Zug hinaufgefahren waren, spürten sie die Auswirkung der dünneren Luft nicht sehr. Als sie ausstiegen, sahen sie jedoch einen jungen Hippie leicht desorientiert am Boden sitzen. Sie fragten ihn, was los sei. »Ich kriege keine Luft.« Ein Passant riet ihm, Cocablätter zu kauen, das sei in den Anden ein probates Mittel, um mit der Höhenluft fertig zu werden; Cocablätter seien im Übrigen auf den Straßenmärkten frei verkäuflich. Der junge Mann fühlte sich jedoch schon bald wieder besser und bat sie, ihn jetzt allein zu lassen. Er wolle noch am selben Tag nach Machu Picchu aufbrechen.
Die Dame am Empfang im Hotel, das sie ausgewählt hatten, bat Paulos Freundin zur Seite, sagte ein paar Worte und machte dann den Eintrag ins Register. Sie gingen hinauf aufs Zimmer und schliefen umgehend ein, allerdings fragte Paulo noch, was die Dame am Empfang gesagt habe.
»Kein Sex in den ersten beiden Tagen.«
Das leuchtete ihm ein. Sie waren ohnehin zu erschöpft, um überhaupt irgendetwas zu tun.
Sie blieben zwei Tage ohne Sex, aber auch ohne die »soroche« genannte Begleiterscheinung des Sauerstoffmangels in der bolivianischen Hauptstadt.
Sowohl er als auch seine Freundin schrieben dies der therapeutischen Wirkung der Coca-Blätter zu, doch hatte es damit überhaupt nichts zu tun. Den »soroche« bekommen nur Menschen, die aus Meereshöhe plötzlich mehrere tausend Meter hochfliegen, ohne dem Organismus Zeit zu geben, sich an die Höhe zu gewöhnen. Die beiden dagegen hatten sieben lange Tage gebraucht, um im »Todeszug« hinaufzufahren. Was nicht nur viel besser war, um sich an die örtlichen Gegebenheiten zu gewöhnen, sondern auch sehr viel sicherer, als mit dem Flugzeug zu kommen. Schließlich hatte Paulo auf dem Flughafen von Santa Cruz de la Siera ein Denkmal zu Ehren der »Heldenhaften Piloten der Luftfahrtgesellschaft Lloyd Aéreo Boliviano« gesehen, »die ihre Leben in Erfüllung ihrer Pflicht verloren hatten«.
In La Paz trafen sie weitere Hippies, die als Mitglieder eines globalen Stammes, der sich der gegenseitigen Verantwortung und Solidarität bewusst war, stets das bekannte Symbol der Campaign for Nuclear Disarmament zeigten. Da in Bolivien alle bunte Ponchos, Jacken, Pullover und Mäntel trugen, waren die Hippies allein wegen der auf ihre Jacke oder Hose aufgenähten CND-Zeichen von den Einheimischen zu unterscheiden.
Die ersten Hippies, denen sie in La Paz begegneten, waren zwei Deutsche und eine Kanadierin. Paulos Freundin, die Deutsch sprach, wurde gleich zu einem Spaziergang durch die Stadt eingeladen, wohingegen er und die Kanadierin einander zunächst nur anschauten, ohne recht zu wissen, was sie sagen sollten. Als die zwei Deutschen und Paulos Freundin nach einer halben Stunde von ihrem Spaziergang zurückkamen, beschlossen sie, gleich aufzubrechen und hier nicht weiter Geld auszugeben. Stattdessen würden sie zum höchstgelegenen Süßwassersee der Welt fahren, mit dem Schiff bis zum anderen Ende und von dort, bereits auf peruanischem Boden, direkt nach Machu Picchu reisen.
Alles wäre planmäßig verlaufen, wären sie nicht in der Nähe des erwähnten Titicacasees auf ein uraltes Monument gestoßen, das als das »Sonnentor« bekannt war. Um das Monument herum saßen mehrere Hippies, die einander an den Händen hielten, wie in einer Zeremonie, die die Freunde nicht stören wollten. Zugleich hätten sie aber gern auch an dem Ritual teilgenommen.
Ein Mädchen sah sie und forderte die vier durch eine Kopfbewegung auf, sich zu ihnen zu setzen.
Das Sonnentor war mit prächtigen Reliefs geschmückt, die Geschichten aus einer bereits vergessenen und dennoch gegenwärtigen Zeit erzählten, Geschichten, die erinnert und erneut erzählt werden wollten. Das Tor war aus einem einzigen Stein gehauen. In der Mitte über der Türöffnung, wo ein möglicherweise durch einen Blitzschlag oder durch ein Erdbeben entstandener Riss durchlief, war eine Gottheit dargestellt, die zwei Schlangenzepter in den Händen hielt. Rechts und links davon waren Engel zu sehen, die verlorenen Symbole einer Kultur, die, den Einheimischen zufolge, zeigten, wie die Welt wiederhergestellt werden kann, falls sie von der Gier des Menschen zerstört werden sollte. Paulo, der durch das Tor den Titicacasee sehen konnte, begann plötzlich zu weinen, als würde er in einem geistigen Kontakt mit dessen Erbauern stehen – Menschen, die den Ort vor dem Ende ihrer Arbeit eilig verlassen hatten, weil sie etwas fürchteten oder weil jemand erschienen war, der sie aufgefordert hatte, mit dem Bau aufzuhören. Das Hippiemädchen, das sie in die Runde eingeladen hatte, lächelte – sie hatte ebenfalls Tränen in den Augen. Die anderen hielten stumme Zwiegespräche mit den ursprünglichen Bewohnern, um herauszufinden, was diese dorthin geführt hatte. Sie respektierten das Mysterium.
Wer Magie erlernen will, muss damit beginnen, um sich zu schauen. Alles, was Gott den Menschen sagen wollte, hat er vor ihnen ausgebreitet in Form der sogenannten Sonnentradition.
Die Sonnentradition ist demokratisch – sie wurde nicht für Wissenschaftler, Priester oder Auserwählte geschaffen, sondern für ganz gewöhnliche Menschen. Die Kraft liegt in allen kleinen Dingen, die Teil des Weges eines jeden Menschen sind: Die Welt ist ein Klassenzimmer, und die Höchste Liebe wird deine Lehrerin sein, denn sie weiß, dass du lebst.
Und alle schwiegen. Sie horchten auf etwas, das sie nicht ganz verstanden, von dem sie aber wussten, dass es die Wahrheit war. Eines der Mädchen sang ein Lied in einer Sprache, die Paulo nicht verstand. Der älteste unter den jungen Männern erhob sich, breitete die Arme aus und sprach ein Gebet:
Der Herr, der Erhabene, gebe uns
Einen Regenbogen für jeden Sturm
Ein Lächeln für jede Träne
Eine Segnung für jede Schwierigkeit
Einen Freund für jeden Augenblick der Einsamkeit
Eine Antwort auf jedes Gebet.
Und genau in diesem Augenblick ertönte die Sirene eines Schiffs – eines Schiffs, das ursprünglich in England gebaut worden war, dann demontiert und per Schiff bis nach Peru gebracht und in Einzelteilen auf Maultieren bis auf die 3800 Meter Höhe transportiert wurde, wo sich der See befindet.
Alle begaben sich an Bord und damit auf die nächste Etappe der Reise nach Machu Picchu, der alten verlorenen Stadt der Inkas.
Dort angekommen, verbrachten sie unvergessliche Tage – denn nur jene, die Kinder Gottes waren, im Geiste frei und bereit, sich dem Unbekannten angstfrei zu stellen, gelangten hierher.
Sie schliefen in den verlassenen Häusern ohne Dach und schauten in die Sterne, liebten sich, aßen, was sie als Proviant mitgebracht hatten, badeten jeden Tag nackt im Fluss, der unterhalb des Berges fließt, und spekulierten darüber, ob die Götter Astronauten gewesen sein könnten, die in dieser Region auf der Erde gelandet waren. Alle hatten das Buch Erinnerungen an die Zukunft des Schweizer Autors Erich von Däniken gelesen, der die Zeichnungen der Inkas dahingehend interpretierte, dass sie die Sternreisenden zeigten. Ebenso wie sie Lobsang Rampa gelesen hatten, den Mönch aus Tibet, der von der Öffnung des Dritten Auges sprach. Dann waren sie auf dem Hauptplatz von Machu Picchu, und ein Engländer erzählte allen, jener Mönch heiße in Wahrheit Cyril Henry Hoskins und sei der Sohn eines Klempners aus England. Seine wahre Identität sei erst kürzlich entdeckt und seine Echtheit vom Dalai Lama in Abrede gestellt worden.
Die gesamte Gruppe war ziemlich enttäuscht, vor allem weil sie wie Paulo davon überzeugt war, dass es zwischen den Augen eine Drüse namens Zirbeldrüse gab, deren wahre Nützlichkeit von den Wissenschaftlern noch nicht entdeckt worden war. Für sie gab es das Dritte Auge wirklich – wenn auch nicht so, wie Lobsang Cyril Rampa Hoskins es beschrieben hatte.
Am dritten Morgen beschloss Paulos Freundin, zurück nach Hause zu reisen; dass Paulo sie begleiten würde, stand für sie außer Frage. Ohne sich zu verabschieden oder zurückzublicken, brachen sie vor Sonnenaufgang auf und fuhren zwei Tage in einem Bus voller Menschen, Haustiere, Essen und Kunsthandwerk am westlichen Hang der Cordilleren hinab. Danach stand für Paulos Freundin auch fest, dass sie nie wieder eine Busreise machen würde, die länger als einen Tag dauerte.
Von Lima aus fuhren sie per Anhalter nach Santiago de Chile. Die Welt war noch ein sicherer Ort, und die Autos nahmen das Pärchen mit, obwohl die beiden den Fahrern mit ihrer bunten Kleidung etwas merkwürdig vorkamen. Nach einer Nacht, in der sie gut und lange geschlafen hatten, baten sie jemanden, ihnen auf einer Landkarte die Route nach Brasilien über einen Tunnel, der Chile dereinst mit Argentinien verbinden würde, aufzuzeichnen. Sie fuhren wieder per Anhalter, weil Paulos Freundin das Geld, das sie noch hatten, für einen allfälligen ärztlichen Notfall sparen wollte – sie war immer vorsichtig, immer die Vernünftigere. Ihre praktisch ausgerichtete kommunistische Erziehung, die sie nie völlig verleugnen konnte, ließ sie nie ganz entspannt sein.
Drüben in Brasilien beschlossen sie auf ihren Vorschlag hin, noch einen Zwischenstopp einzulegen.
»Lass uns nach Vila Velha fahren. Das soll ein ganz phantastischer Ort sein.«
Sie konnten nicht voraussehen, in was für einen Albtraum sie dort geraten würden.
Sie wussten nicht, dass ihnen die Hölle bevorstand.
Sie waren nicht auf das vorbereitet, was sie erwartete.
Sie hatten bereits verschiedene phantastische Orte besucht, wenn auch bei einigen schon jetzt absehbar war, dass sie nicht mehr lange phantastische Orte bleiben würden. Am Ende würden sie von Horden von Touristen zerstört werden, die nur daran dachten, Souvenirs zu kaufen, und daran, die Schönheit dieser Orte mit dem zu vergleichen, was sie zu Hause hatten.
Aber wie seine Freundin es formuliert hatte, gab es keinen Raum für Zweifel, kein Fragezeichen am Ende des Satzes, sondern es war nur eine schlichte Ansage: Selbstverständlich werden wir nach Vila Velha fahren, diesem phantastischen Ort. Eine geologische Stätte mit eindrucksvollen, vom Wind geschaffenen Steinskulpturen – die die Verwaltung der nahegelegenen Stadt unbedingt für den Tourismus erschließen wollte. Der Name Vila Velha war allgemein bekannt. Aber den meisten wäre zuerst wohl die im Staat Espírito Santo gelegene Stadt am Meer eingefallen und nicht das in Paraná gelegene Vila Velha mit seinem Parque Estudal bei Ponte Grossa. Dieses Vila Velha war zwar interessant, aber erheblich mühsamer zu erreichen.
Paulo und seine Freundin waren die einzigen Besucher des Parks und tief beeindruckt von dem, was die Natur schaffen kann. Die Felsformationen waren bekannt als ›Die Schildkröte‹, ›Das Kamel‹, ›Der Kelch‹, obwohl man zu ihren Formen auch ganz anderes assoziieren konnte. So wie für Paulos Freundin das besagte Kamel wie ein Granatapfel und für Paulo selbst wie eine Orange aussah. Anders als das, was sie in Tihuanaco gesehen hatten, ließen diese Skulpturen aus Arenit jede nur mögliche Deutung zu.
Vom Park aus fuhren sie per Anhalter in die nahe Stadt. Da sie nun bald zu Hause sein würden, entschied die Freundin (sie entschied immer alles), dass sie und Paulo nun nicht mehr sparen müssten, sondern sich zum ersten Mal seit vielen Wochen ein gutes Hotel leisten und sich abends ein Essen mit reichlich Fleisch gönnen könnten! Die Region war für ihr gutes Fleisch bekannt. Seit La Paz hatten sie keines mehr gegessen, weil es ihnen überall viel zu teuer war.
Sie checkten in einem wirklich guten Hotel ein, gönnten sich ein Bad, liebten sich und gingen dann hinunter zum Empfang, um sich ein Rodizio-Restaurant empfehlen zu lassen, in dem sie nach Herzenslust Fleisch essen könnten.
Während sie noch auf den Rezeptionisten warteten, kamen zwei Männer herein und forderten sie barsch auf, ihnen nach draußen zu folgen. Beide hatten die Hände in den Taschen, als hielten sie eine Waffe und wollten, dass dies ganz deutlich wurde.
»Keine Panik«, sagte die Freundin, weil sie überzeugt war, dass sie gerade überfallen wurden. »Ich habe oben ja einen Brillantring.«
Aber die Männer hatten sie schon am Arm gepackt und schoben sie nach draußen, wo das Paar voneinander getrennt wurde. Auf der menschenleeren Straße standen zwei Wagen ohne Nummernschilder und zwei weitere Männer, von denen der eine nun seine Waffe auf das Paar richtete.
»Keine Bewegung. Wir müssen euch durchsuchen.«
Rüde begannen sie die beiden abzutasten. Die Freundin öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Paulo dagegen war einfach nur starr vor Angst. Er konnte gerade noch kurz zur Seite schauen, ob jemand Zeuge dieser Szene war und am Ende hoffentlich die Polizei rufen würde.
»Halt den Mund, du Nutte«, sagte einer von ihnen. Die Männer rissen dem Paar die Gürteltaschen, in denen sich Pass und Geld befanden, weg und bugsierten Paulo und seine Freundin jeweils auf den Rücksitz eines der geparkten Wagen. Alles ging so schnell, dass Paulo nicht mitbekam, was mit seiner Freundin geschah – und er wusste auch nicht, was mit ihm geschah.
Dann war da noch ein fünfter Mann.
»Zieh dir das über«, sagte er und reichte ihm eine Art Kapuze, die er ihm, als Paulo nicht schnell genug reagierte, über den Kopf stülpte. »Leg dich auf den Boden!«
Paulo tat, was man ihm befahl. Sein Gehirn reagierte schon nicht mehr. Der Wagen brauste los. Er hätte gern gesagt, dass seine Familie Geld habe und jedes Lösegeld bezahlen würde, aber er bekam noch immer kein Wort heraus.
Der Zug wurde allmählich langsamer, was wahrscheinlich bedeutete, dass sie die niederländische Grenze erreicht hatten.
»Ist bei dir alles okay?«, fragte der Argentinier.
Paulo nickte und suchte fieberhaft nach einem neuen Gesprächsthema, um von seinen Erinnerungen loszukommen. Es war mehr als ein Jahr vergangen, seit sie in Vila Velha gewesen waren, und meistens gelang es ihm, die Dämonen in seinem Kopf in Schach zu halten. Aber sobald er irgendwo das Wort POLIZEI sah, und sei er nur auf der Uniform eines Grenzpolizisten, kehrte die alte Panik zurück. Anders als sonst, wenn er die Geschichte, die zu solchen Panikattacken führte, seinen Freunden erzählte, hatte er jetzt keinen emotionalen Abstand, sondern erlebte in Gedanken alles noch einmal.
»Wenn sie uns an der Grenze nicht reinlassen, ist das kein Problem. Wir bleiben in Belgien und reisen woanders ein«, fuhr der Argentinier fort.
Doch Paulo war plötzlich nicht mehr daran interessiert, sich weiter mit ihm zu unterhalten – die Paranoia kehrte zurück. Was, wenn der Argentinier nun wirklich harte Drogen bei sich hatte? Und wenn die Grenzbeamten zum Schluss kamen, dass Paulo sein Komplize war, und sie ihn ins Gefängnis steckten, bis er seine Unschuld beweisen konnte?
Der Zug hielt. Es war noch nicht die Grenze, sondern ein kleiner Bahnhof im Nirgendwo, in dem fünf Leute ein- und zwei ausstiegen. Als der Argentinier merkte, dass Paulo keine Lust zu reden hatte, überließ er diesen seinen Gedanken, aber er war besorgt. Paulos Gesichtsausdruck hatte sich vollkommen verändert. Der Argentinier beschränkte sich darauf, noch einmal zu fragen: »Ist bei dir wirklich alles okay?«
»Ich versuche nur gerade, meine Dämonen zu vertreiben.«
Der Argentinier verstand und sagte nichts weiter.
Paulo wusste, dass in Europa so etwas, wie er es erlebt hatte, nicht geschehen würde. Oder vielmehr nur in der Vergangenheit geschehen war. Damals waren die Menschen in die Gaskammern geschickt worden oder hatten sich vor Massengräbern aufreihen und zusehen müssen, wie die Reihe vor ihnen von einem Erschießungskommando exekutiert wurde – ohne eine Reaktion zu zeigen. Sie hatten nicht versucht zu fliehen oder ihre Mörder anzugreifen.
Der Grund für diese Passivität ist ganz einfach: Die Panik ist so groß, dass die Menschen gar nicht mehr richtig da sind. Das Gehirn blockiert alles, es gibt keine Angst, nur ein merkwürdiges Gefühl der Unterwerfung unter das, was mit einem geschieht. Die Gefühle verschwinden, und man gerät in eine Art Limbus. Die Ärzte bezeichnen diesen Zustand als »vorübergehende stressbedingte Schizophrenie« oder reduced affect display.
Möglicherweise um die Gespenster der Vergangenheit endgültig zu bannen, durchlebte Paulo die alte Geschichte noch einmal bis zu ihrem Ende.
Der Mann auf dem Rücksitz wirkte menschlicher als die anderen, von denen sie im Hotel angesprochen worden waren.
»Mach dir keine Sorgen, wir werden euch nicht töten. Leg dich auf den Boden des Wagens.«
Paulo machte sich überhaupt keine Sorgen. Sein Verstand hatte schlicht ausgesetzt. Ihm war so, als sei er in eine parallele Wirklichkeit eingetreten, sein Hirn weigerte sich, zu akzeptieren, was gerade geschah. Er fragte nur:
»Kann ich mich an Ihrem Bein festhalten?«