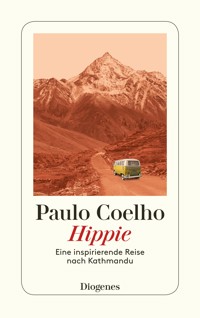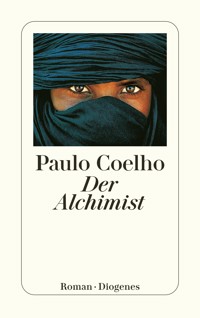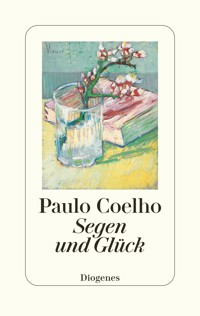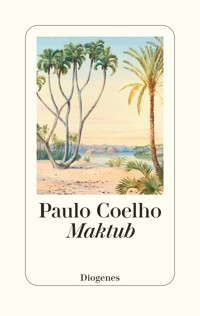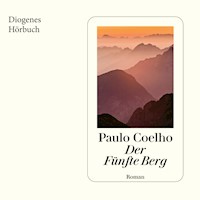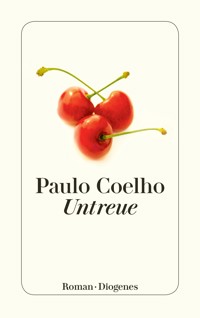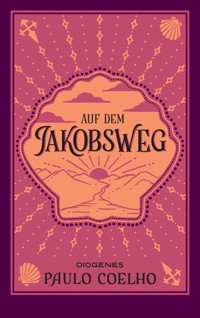9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer ist die Frau hinter dem schillernden Mythos? Paulo Coelho schlüpft in ihre Haut und lässt sie in einem fiktiven, allerletzten Brief aus dem Gefängnis ihr außergewöhnliches Leben selbst erzählen: vom Mädchen Margaretha Zelle aus der holländischen Provinz zur exotischen Tänzerin Mata Hari, die nach ihren eigenen Vorstellungen lebte und liebte und so auf ihre Art zu einer der ersten Feministinnen wurde. Doch als der Erste Weltkrieg ausbricht, lässt sie sich auf ein gefährliches Doppelspiel ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Paulo Coelho
Die Spionin
Roman
Aus dem Brasilianischen von Maralde Meyer-Minnemann
Diogenes
{7}Gegrüßet seist du, Maria, ohne Sünde empfangen,
bete für uns, die wir uns an dich wenden. Amen.
So du aber mit deinem Widersacher vor den Fürsten gehst, so tu Fleiß auf dem Wege, dass du ihn los werdest, auf dass er nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und der Richter überantworte dich dem Stockmeister, und der Stockmeister werfe dich ins Gefängnis.
Ich sage dir: Du wirst von dannen nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller bezahlest.
Lukas, 12; 58–59
{9}Nach wahren Begebenheiten erzählt
{11}Prolog
Mata Haris Hinrichtung am 15. Oktober 1917 in Vincennes, Paris
Foto © Collection Fries Museum, Leeuwarden
Es war kurz vor fünf Uhr morgens. Eine Gruppe von achtzehn Männern, vornehmlich Offiziere der französischen Armee, stieg hinauf in den zweiten Stock des Frauengefängnisses Saint-Lazare in Paris. Ihnen voran ging der Gefängnisaufseher mit einem brennenden Span und zündete damit die Öllampen an den Wänden an. Vor Zelle zwölf blieben alle stehen.
Mit der Leitung des Gefängnisses waren Nonnen beauftragt. Schwester Léonide schloss die Tür auf, trat hinein, strich ein Streichholz an der Wand an und entzündete die Lampe im Inneren der Zelle. Dann rief sie eine der anderen Schwestern, damit sie ihr half.
Behutsam legte sie ihren Arm um die Gefangene, die, wie beide Nonnen bezeugten, tief und ruhig schlief, und weckte sie vorsichtig. Diese nahm fast gleichmütig zur Kenntnis, dass dem Gnadengesuch, das sie einige Tage zuvor an den Präsidenten der Republik gerichtet hatte, nicht entsprochen worden war. Ob sie traurig oder erleichtert war, dass nun alles seinem Ende zuging, wir wissen es nicht.
{14}Auf ein Zeichen von Schwester Léonide betraten nun auch Pater Arbaux, Hauptmann Bouchardon und Dr. Édouard Clunet, der Anwalt der Gefangenen, die Zelle. Letzterem übergab die Schwester einen langen, offenbar als Vermächtnis gedachten Brief, an dem die Gefangene wohl die ganze vergangene Woche lang geschrieben hatte, außerdem zwei graue Umschläge mit Zeitungsausschnitten.
Die Gefangene zog (was unter den gegebenen Umständen grotesk erscheinen mag) ihre dünnen schwarzen Seidenstrümpfe an und schlüpfte in ihre mit Seidenschleifen geschmückten hochhackigen Schuhe. Dann erhob sie sich vom Bett, nahm einen knöchellangen Pelzmantel, dessen Ärmel und Kragen mit einer anderen Pelzart (möglicherweise einem Fuchspelz) besetzt waren, von einem Bügel über dem Kopfende ihrer Pritsche und zog ihn über den schweren Seidenkimono, in dem sie geschlafen hatte.
Sorgfältig kämmte sie ihr zerzaustes schwarzes Haar, fasste es im Nacken zu einem Knoten zusammen und setzte sich einen Filzhut auf, den sie unter dem Kinn mit einer Seidenschleife festband, damit er draußen auf dem freien Feld, zu dem sie gebracht werden sollte, nicht vom Wind fortgetragen werden würde.
Nachdem sie noch ein Paar schwarze Lederhandschuhe vom Tisch genommen und übergestreift hatte, wandte sie sich mit gleichgültigem Gesichtsausdruck den Männern zu und sagte mit fester Stimme:
»Ich bin bereit.«
Daraufhin verließen alle die Zelle und begaben sich {15}zu mehreren Wagen, die vor dem Gefängnis mit laufenden Motoren warteten. Die Wagen fuhren schneller als erlaubt durch die Straßen der schlafenden Stadt und hielten zwanzig Minuten später an der Kaserne von Vincennes, einem Ort, an dem einst ein Fort stand, das im Französisch-Preußischen Krieg von 1870/71 den Franzosen als Hauptquartier gedient hatte. Dort erwartete sie das Erschießungskommando.
Die Gruppe stieg aus – Mata Hari als Letzte.
Die Soldaten hatten sich für die Exekution bereits in einer Reihe aufgestellt. Zwölf Zuaven bildeten das Peloton. Ein Offizier mit gezogenem Säbel stand ganz am Ende der Reihe.
Während Pater Arbaux mit der verurteilten Frau sprach, die von zwei Nonnen flankiert wurde, trat ein französischer Leutnant heran und reichte einer der Nonnen ein weißes Tuch.
»Verbinden Sie ihr bitte die Augen!«
»Muss ich das tragen?«, fragte Mata Hari mit einem Blick auf das Tuch.
Dr. Clunet sah den Leutnant fragend an.
»Nur wenn Madame es so möchte – es ist nicht vorgeschrieben.«
Mata Hari wurden weder die Augen verbunden, noch wurde sie gefesselt. Sie schaute die Vollstrecker ihres Todesurteils einfach nur ruhig an, während der Pater, die Nonnen und der Anwalt sich langsam von ihr entfernten.
Der Leiter des Erschießungskommandos beobachtete seine Leute aufmerksam, um sicherzugehen, dass {16}sie nicht heimlich ihre Gewehre überprüften – denn es ist üblich, in eines der Gewehre eine Platzpatrone einzulegen, damit nachträglich jeder behaupten kann, nicht selbst den tödlichen Schuss abgefeuert zu haben. Aber es schien alles zu seiner Zufriedenheit abzulaufen. Bald würde es zu Ende sein.
»Anlegen«, befahl er mit scharfer Stimme. Die zwölf Zuaven standen stramm und legten ihre Gewehre an.
Mata Hari stand reglos da.
Der Leutnant platzierte sich so, dass alle den Säbel sehen konnten, und hob ihn in die Höhe.
»Zielen!«
Mata Hari stand weiter unbewegt da.
Der Säbel senkte sich, durchschnitt die Luft in einer bogenförmigen Bewegung.
»Feuer!«
Die Sonne, die schon über dem Horizont aufgegangen war, beleuchtete die Szenerie, während die Schüsse gellten und mit dem Mündungsfeuer ein feiner Rauch aus den Waffen kam. Die Soldaten stellten ihre Gewehre mit einer abgezirkelten Bewegung wieder auf dem Boden ab.
Mata Hari blieb noch für den Bruchteil einer Sekunde stehen. Sie starb nicht, wie man es heute aus Erschießungsszenen in Filmen kennt. Sie fiel weder nach vorn noch nach hinten, und sie riss auch nicht die Arme hoch und kippte zur Seite. Vielmehr sackte sie in sich zusammen und hielt dennoch den Kopf erhoben und die Augen geöffnet. Einer der Soldaten wurde ohnmächtig.
{17}In ihren Pelzmantel gekauert, lag Mata Hari da, das Gesicht zum Himmel gewandt.
Ein weiterer Offizier zog, vom Leutnant begleitet, seinen Revolver aus dem Halfter und ging auf den reglosen Körper zu.
Er beugte sich vor, hielt den Lauf an die Schläfe der Spionin, ohne dabei ihre Haut zu berühren. Dann drückte er ab, und die Kugel durchschlug ihren Schädel. Daraufhin wandte er sich an alle Anwesenden und sagte mit feierlicher Stimme:
»Mata Hari ist tot.«
{19}Teil 1
Hochzeitsfoto von Margaretha Zelle, 18, und dem 21 Jahre älteren Offizier Rudolph MacLeod am 11. Juli 1895
Foto © Collection Fries Museum, Leeuwarden
{21}Sehr geehrter, lieber Maître Clunet,
was nach Ablauf dieser Woche geschehen wird, weiß ich nicht. Ich war immer optimistisch, aber die letzte Zeit hat mich bitter, einsam und traurig werden lassen.
Wenn alles so läuft, wie ich es mir erhoffe, werden Sie diesen Brief niemals erhalten. Ich werde begnadigt worden sein – schließlich habe ich mein Leben lang einflussreiche Freunde gehabt. Ich werde diesen Brief verwahren, damit meine einzige Tochter eines Tages nachlesen kann, wer ihre Mutter wirklich war.
Sollte ich mich aber irren, glaube ich kaum, dass diese Seiten aufbewahrt werden, mit deren Niederschrift ich nun meine letzte Woche auf dieser Erde verbringe. Ich war immer Realistin und weiß sehr wohl, dass Anwälte sich nach Abschluss eines Falles, ohne zurückzuschauen, dem nächsten zuwenden.
Ich stelle mir vor, was dann geschehen wird. Sie, mein lieber Maître Clunet, werden ein vielbeschäftigter Mann sein, der durch die Verteidigung einer Kriegsverbrecherin große Bekanntheit erlangt hat. Es werden viele Menschen an Ihre Tür klopfen und um Ihre Dienste bitten – auch wenn Sie den Prozess verloren haben sollten, wird Ihnen {22}das viele Mandanten bringen. Journalisten werden von Ihnen Ihre Version der Geschichte hören wollen. Sie werden in den teuersten Restaurants verkehren und von Ihren Kollegen voller Respekt und Neid angesehen werden. Und obwohl Sie wissen, dass es keinen einzigen konkreten Beweis gegen mich gibt – nur manipulierte Dokumente –, werden Sie öffentlich nie zugeben, dass Sie den Tod einer Unschuldigen nicht haben verhindern können.
Unschuldig? Vielleicht ist das nicht ganz das richtige Wort. Ich war nie ein Unschuldslamm – jedenfalls nicht, seit ich in meine Lieblingsstadt Paris gekommen bin. Ich glaubte, diejenigen manipulieren zu können, die Staatsgeheimnisse von mir erfahren wollten, und ich war überzeugt, all diese Deutschen, Franzosen, Engländer und Spanier könnten mir niemals widerstehen. Doch am Ende war ich diejenige, die das Opfer von Manipulationen wurde.
Verurteilt wurde ich nicht wegen Verbrechen, die ich tatsächlich begangen habe – und deren größtes es war, in einer von Männern beherrschten Welt eine emanzipierte, unabhängige Frau zu sein. Ich wurde wegen Spionage verurteilt, wo doch all das, was ich geliefert habe, nichts als Klatsch aus den Salons der Haute-Volée war.
Zugegeben, ich habe diesen Klatsch in »Geheimnisse« verwandelt, weil ich Geld und Macht wollte. Aber alle, die mich heute anklagen, wussten genau, dass ich nichts Neues erzählt habe.
Schade, dass niemand dies erfahren wird. Diese Briefumschläge werden ihren Platz in einem verstaubten Archiv voller anderer Akten finden, aus denen sie nur ans Tageslicht zurückfinden werden, wenn Ihr Nachfolger, lieber {23}Maître Clunet, oder der Nachfolger Ihres Nachfolgers einst beschließt, Platz zu schaffen und Unterlagen zu alten Fällen zu vernichten.
Dann aber wird mein Name bereits vergessen sein. Doch ich schreibe diesen Brief nicht, damit man sich an mich erinnert, sondern um mich selbst und mein Leben besser zu verstehen. Warum? Wie ist es möglich, dass eine Frau, die so viele Jahre lang alles erreicht hat, was sie wollte, am Ende wegen so haltloser Anschuldigungen zum Tode verurteilt werden konnte?
In diesem Augenblick betrachte ich mein Leben und begreife, dass die Erinnerung ein sich ständig wandelnder Fluss ist.
Erinnerungen sind voller Launen. Bilder von Erlebtem, selbst kleinste Details, können uns so berühren, dass es uns die Kehle zuschnürt. Der Duft von Brot, das über meiner Zelle gebacken wird, erinnert mich an die Zeiten, in denen ich als freier Mensch die Cafés besuchte – und das ist für mich schlimmer als der Tod oder die Einsamkeit hier in meiner Zelle.
Erinnerungen bringen einen Dämon namens Melancholie mit sich – einen grausamen Dämon, dem ich nicht entkommen kann. Der Gesang einer Mitgefangenen etwa oder der Duft nach Rosen und Jasmin einiger Briefe von Bewunderern, die ich nie kennengelernt habe – das kann mich unvermittelt an eine Szene in einer bestimmten Stadt erinnern, die ich damals vielleicht gar nicht bewusst wahrnahm und jetzt doch alles ist, was mir von diesem oder jenem Land bleibt, das ich einst besucht habe.
Die Erinnerungen gewinnen immer. Und mit ihnen {24}kommen noch schrecklichere Dämonen als nur die Melancholie, nämlich Reue und Selbstvorwürfe. Sie sind hier meine einzigen Gefährten, es sei denn, die Schwestern kommen herein und reden ein wenig mit mir. Sie sprechen weder über Gott, noch verurteilen sie mich für das, was die Gesellschaft »Sünden des Fleisches« nennt. Sie brauchen nur ein oder zwei Worte zu sagen, und schon beginne ich zu reden, tauche in diesen Strom von Erinnerungen ein und möchte die Zeit zurückdrehen.
Eine der Schwestern fragte mich einmal:
»Würde Gott Ihnen eine weitere Chance geben, würden Sie alles anders machen?«
Ich antwortete mit einem Ja, aber in Wahrheit könnte ich es nicht beschwören. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Herz jetzt eine Geisterstadt ist, in der von einstiger Leidenschaft, Begeisterung, Einsamkeit, Scham, Stolz, Überkommenem und Traurigkeit nur noch ferne Echos spürbar sind. Aber ich kann sie nicht mehr in mir beleben, auch dann nicht, wenn ich mir selbst leidtue und still vor mich hin weine.
Ich bin eine Frau, die im falschen Jahrhundert geboren wurde. Ich weiß nicht, ob sich in der Zukunft jemand an mich erinnern wird, aber wenn doch, dann möchte ich nicht als Opfer gesehen werden, sondern als eine Frau, die mutig ihren Weg gegangen ist und furchtlos den Preis dafür gezahlt hat.
{25}Bei einem meiner Besuche in Wien lernte ich jemanden kennen, der in Österreich großen Erfolg hatte. Er hieß Freud (seinen Vornamen habe ich vergessen), und die Leute liebten ihn dafür, dass er uns alle von der Schuld für die eigenen Fehler freisprach und sie unseren Eltern anlastete.
Auch ich versuche zu sehen, was meine Eltern falsch gemacht haben, aber ich kann meiner Familie nichts vorwerfen. Mein Vater Adam Zelle und meine Mutter Antje haben mir alles gegeben, was mit Geld zu kaufen war. Sie hatten eine Hutmacherei und investierten in Erdöl, noch bevor andere dessen Bedeutung erkannten. Sie ermöglichten mir, eine Privatschule zu besuchen, bezahlten mir Ballettstunden und Reitunterricht. Als später Stimmen laut wurden, die mich als »eine Frau mit leichtem Lebenswandel« bezeichneten, schrieb mein Vater zu meiner Verteidigung sogar ein Buch. Das hätte er allerdings besser bleibenlassen sollen, denn ich stand zu dem, was ich tat, und er verschaffte mit seinem Plädoyer den Anschuldigungen, ich sei eine Prostituierte und eine Lügnerin, nur noch mehr Aufmerksamkeit.
Ja, ich war eine Prostituierte – wenn man darunter eine Frau versteht, die Gunst und Juwelen als Gegenleistung für Zärtlichkeit und Lust entgegennimmt. Ja, ich war eine {26}Lügnerin, und zwar so zwanghaft, dass ich häufig vergaß, was ich gesagt hatte, und mich ungeheuer anstrengen musste, wieder zurechtzurücken, was ich damit angerichtet hatte.
Nein, meinen Eltern kann ich nichts vorwerfen, höchstens, dass sie mich in der falschen Stadt zur Welt gebracht haben. In Leeuwarden, über das selbst viele meiner niederländischen Landsleute kaum etwas wussten. Wo absolut nichts passierte und ein Tag dem anderen glich.
Schon als Heranwachsende wurde mir klar, dass ich eine besondere Frau war, denn meine Freundinnen sahen mich als Vorbild an.
Als im Jahr 1889 das Schicksal meiner Familie bös mitspielte, mein Vater Konkurs anmelden musste und meine Mutter krank wurde, versuchten meine Eltern, mich aus allem herauszuhalten. Ihnen war es wichtig, dass ich eine gute Erziehung genoss. Als meine Mutter zwei Jahre später starb, schickte mich deshalb mein Vater zu meinem Patenonkel nach Leiden, wo ich eine Schule besuchte, in der ich zur Kindergärtnerin ausgebildet werden sollte, während ich auf einen Mann wartete, der dereinst für mich sorgen würde.
Wenige Tage vor ihrem Tode rief mich meine Mutter zu sich und gab mir ein Säckchen mit Samen.
»Die möchte ich dir schenken, Margaretha«, sagte sie und schüttete einige Samen in ihre aufgehaltene Hand.
Margaretha – Margaretha Zelle, so hieß ich. Wie ich meinen Vornamen hasste! Unzählige Mädchen hießen so, wegen einer berühmten Schauspielerin mit einem untadeligen Ruf – eine ziemlich ausgefallene Kombination!
Ich fragte sie, was das sei.
»Das sind Tulpensamen. Tulpen sind das Symbol unseres {27}Landes. Aber sie sind noch viel mehr. Von ihnen solltest du etwas lernen: Sie werden immer Tulpen sein, selbst jetzt, wo sie genauso aussehen wie die Samen anderer Blumen. Sosehr sie es sich auch wünschen mögen, sie werden nie zu Rosen oder Sonnenblumen werden. Sollten sie ihr Schicksal leugnen wollen, werden sie schließlich ein bitteres Leben haben und sterben.
Also lerne von ihnen, deinem Schicksal freudig zu folgen, ganz gleich wie es ausschaut. Während sie wachsen, entfaltet sich ihre Schönheit, und sie werden von allen bewundert. Doch dann sterben sie und hinterlassen nur ihre Samen, und aus den Samen sprießen, so Gott will, neue Tulpen.«
Damit schüttete sie die Samen in das Beutelchen zurück, das sie trotz ihrer Krankheit selbst genäht hatte – das habe ich mit eigenen Augen gesehen.
»Die Blumen lehren uns, dass nichts ewig währt – weder ihre Schönheit noch ihr Welken ist von Dauer. Am Ende geben sie Samen, aus denen neue Tulpen entstehen. Vergiss das nie, wenn du Freude oder Traurigkeit empfindest – alles vergeht, altert, stirbt und wird aufs Neue geboren.«
Wie viele Stürme würde ich überstehen müssen, bis ich das begriff? Damals jedenfalls kamen mir die mütterlichen Worte hohl vor – ich konnte es nicht erwarten, diese langweilige Stadt zu verlassen. Heute, während ich dies schreibe, ist mir klargeworden, dass meine Mutter von sich selber sprach.
»Sogar die höchsten Bäume wachsen aus Samen, die nur so groß sind wie diese hier. Vergiss das nie, und versuche nie, die Zeit abzukürzen.«
{28}Und dann küsste sie mich zum Abschied. Als mich mein Vater nach ihrem Tod zum Bahnhof brachte, wo ich den Zug nach Leiden bestieg, haben wir auf dem Weg kaum ein Wort miteinander gesprochen.
{29}Fast alle Männer, die ich kennengelernt habe, schenkten mir Schmuck, gaben mir einen Platz in der Gesellschaft, und nie habe ich bereut, sie kennengelernt zu haben – mit einer Ausnahme: den Direktor meiner Schule in Leiden, der mich vergewaltigte, als ich sechzehn war.
Er rief mich in sein Büro, machte die Tür zu, griff mir zwischen die Beine und begann sich selber zu befriedigen. Ich versuchte zuerst, mich zu wehren und mich ihm zu entziehen, dann ihn davon abzubringen, indem ich zu ihm sagte, jetzt sei weder der richtige Augenblick noch der richtige Ort. Doch er schob nur wortlos einige Papierstapel auf seinem Schreibtisch zur Seite, legte mich bäuchlings darauf und drang ein einziges Mal in mich ein – als müsste es schnell gehen, weil jeden Moment jemand an die Tür klopfen könnte.
Meine Mutter hatte mir in einem langen Gespräch und in gewundenen Worten beigebracht, dass »Intimitäten« mit einem Mann nur erlaubt seien, wenn Liebe im Spiel sei und diese Liebe bis zum Lebensende fortdauere. Ich verließ das Büro des Direktors verwirrt und erschrocken, entschlossen, niemandem zu erzählen, was passiert war – bis eine Mitschülerin von sich aus darauf zu sprechen kam. Ich erfuhr, dass außer mir schon zwei andere Mädchen das {30}Gleiche durchgemacht hatten. Aber bei wem sollten wir uns beschweren? Wenn wir jemandem davon erzählten, riskierten wir, von der Schule verwiesen und nach Hause geschickt zu werden. Da hielt ich lieber den Mund und tröstete mich damit, nicht die Einzige zu sein.
Später, als ich durch meine Tanzaufführungen in Paris berühmt geworden war, erzählten es meine ehemaligen Mitschülerinnen doch weiter, und kurz darauf wusste die ganze Kleinstadt, was damals passiert war. Der Direktor war inzwischen pensioniert, und niemand wagte es, ihn darauf anzusprechen – ganz im Gegenteil, einige Männer waren sogar neidisch auf ihn, weil er mit der größten Diva ihrer Zeit intim gewesen war.
Von jenem Augenblick an war Sex für mich etwas Mechanisches, das mit Liebe nichts zu tun hatte.
Leiden war übrigens noch langweiliger als Leeuwarden. Es gab dort nur die bekannte Schule für Kindergärtnerinnen und jede Menge Menschen, die nichts Besseres zu tun hatten, als über ihre Mitbürger herzuziehen. Aus Langeweile fing ich darum an, die Kontaktanzeigen einer Nachbarstadt zu lesen. Da fand ich eines Tages folgende Annonce:
Offizier aus Niederländisch-Ostindien, zurzeit auf Heimaturlaub, sucht die Bekanntschaft eines netten Mädchens zwecks späterer Heirat.
Das war meine Rettung. Offizier. Niederländisch-Ostindien. Fremde Meere. Exotische Welten. Ich hatte dieses konservative, calvinistische Holland voller Vorurteile und Langeweile gründlich satt. Ich antwortete auf die Anzeige {31}und fügte ein Foto von mir bei, das beste und sinnlichste, das ich hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass die Idee mit der Anzeige ein Spaß eines Freundes dieses Offiziers war und mein Brief als letzter von sechzehn ankommen würde.
Als Rudolph MacLeod, so hieß der Offizier, mich aufsuchte, sah er aus, als würde er gleich anschließend in den Krieg ziehen – vollständige Uniform, mit einem Säbel, den er an seiner linken Seite trug. Er war Hauptmann und hatte einen langen geschwungenen Schnurrbart voller Bartpomade. Er sah nicht besonders gut aus, und seine Umgangsformen ließen zu wünschen übrig.
Bei unserem ersten Treffen plauderten wir ein wenig. Ich betete darum, dass er wiederkommen würde, und meine Gebete wurden erhört. Eine Woche später war er wieder da, was meine Freundinnen neidisch machte und den Schuldirektor zur Verzweiflung trieb, der möglicherweise davon träumte, mich ein weiteres Mal zu vergewaltigen. Mir fiel auf, dass Rudolph nach Alkohol roch, aber ich maß dem keine besondere Bedeutung bei, sondern dachte, dass er sich offenbar Mut antrinken musste, weil er es mit einer jungen Frau zu tun hatte, die ihren Freundinnen zufolge die Schönste in der Klasse gewesen war.
Beim dritten Treffen fragte er mich, ob ich ihn heiraten wolle. Niederländisch-Ostindien, Hauptmann der Streitkräfte, Reisen in die Ferne, was kann sich ein junges Mädchen vom Leben mehr erhoffen?