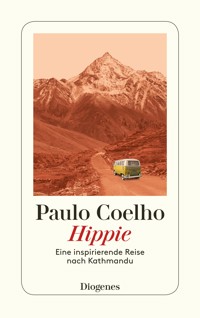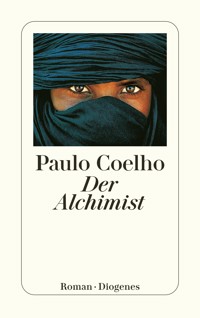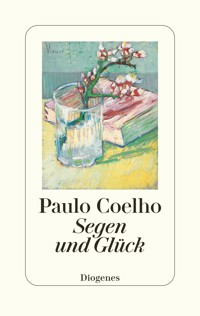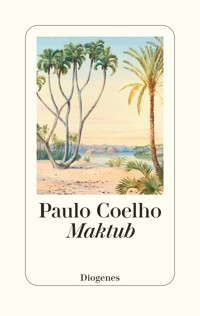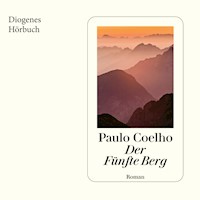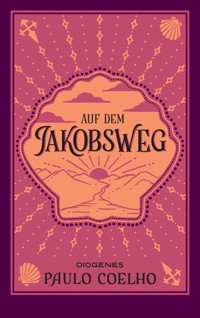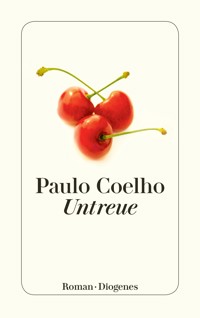
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
›Ich will dir treu sein und dich ewig lieben. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet.‹ Wenn es nur so einfach wäre! Linda hat alles, doch das Entscheidende fehlt. Hat sie den Mut, die Frage nach der Leidenschaft zu stellen? Denn zu einer großen Liebe ist man ein Leben lang unterwegs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Paulo Coelho
Untreue
Roman
Aus dem Brasilianischen vonMaralde Meyer-Minnemann
Titel der 2014 bei Editora Sextante, Ltda.,
Rio de Janeiro, erschienenen Originalausgabe: ›Adultério‹
Copyright © 2014 by Paulo Coelho
Mit freundlicher Genehmigung von Sant Jordi Asociados, Barcelona, Spanien
Alle Rechte vorbehalten
Paulo Coelho: www.paulocoelhoblog.com
Die deutsche Erstausgabe erschien 2014 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Copyright © Compañía (lookatcia)
Foto: Copyright © Ingram Publishing
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24348 2
ISBN E-Book 978 3 257 60431 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Gegrüßet seist du, Maria, ohne Sünde empfangen, bete für uns, die wir uns an dich wenden. Amen.
Gehe dorthin, wo die Wasser am tiefsten sind.
Lukas, 5:4
[7] Jeden Morgen, wenn ich die Augen zu einem »neuen Tag« öffne, wie man so schön sagt, möchte ich sie am liebsten gleich wieder schließen und noch etwas weiterschlafen. Aber es hilft nichts, ich muss aufstehen.
Ich habe einen wunderbaren Mann, der mich aufrichtig liebt. Er managt einen renommierten Investmentfonds und steht außerdem jedes Jahr auf der Liste der 300 reichsten Schweizer der Managerzeitschrift ›Bilanz‹.
Wir haben zwei Söhne, die (wie meine Freundinnen sagen würden) »mein ganzer Lebensinhalt« sind. Morgens mache ich ihnen das Frühstück und bringe sie dann zur Schule, die nur fünf Minuten zu Fuß entfernt liegt. Dort haben sie Ganztagsunterricht, was mir erlaubt, zu arbeiten und Zeit für mich zu haben. Nach der Schule kümmert sich unsere philippinische Haushalthilfe um sie, bis mein Mann und ich nach Hause kommen.
Ich mag meine Arbeit. Ich bin eine bekannte Journalistin bei einer angesehenen Tageszeitung, die in Genf, wo wir wohnen, praktisch an jeder Ecke verkauft wird.
Einmal im Jahr mache ich mit meiner Familie Urlaub. Normalerweise an paradiesischen Orten mit herrlichen Stränden, in »exotischen« Städten, deren arme Bevölkerung uns dankbar für alles sein lässt, was Gott uns gegeben hat.
[8] Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Linda, bin 31Jahre alt, 1,75 groß, wiege 68Kilo und kann mich dank der Großzügigkeit meines Mannes so attraktiv und teuer kleiden, wie ich nur will. Männer begehren mich, Frauen beneiden mich. Ich lebe in einer Welt, von der viele Menschen nur träumen können. Dennoch weiß ich jeden Morgen beim Aufwachen, dass der vor mir liegende Tag ein Desaster sein wird.
Bis zu Beginn dieses Jahres habe ich nichts in Frage gestellt, ich lebte einfach mein Leben, obwohl ich mich hin und wieder schuldig fühlte, weil ich so privilegiert bin. Doch eines schönen Tages kurz nach Frühlingsbeginn fragte ich mich plötzlich, während ich für meinen Mann und meine beiden Jungs das Frühstück zubereitete: Ist das alles?
Ich hätte diese Frage nicht stellen dürfen. Schuld daran war ein Schriftsteller, den ich am Vortag für meine Zeitung interviewt hatte und der irgendwann zu mir sagte: »Mir geht es überhaupt nicht darum, glücklich zu sein. Ich ziehe es vor, voller Leidenschaft zu leben, auch wenn es gefährlich ist, denn man weiß nie, wohin das führt.«
In dem Augenblick dachte ich noch: Der Arme, er ist nie zufrieden, er wird traurig und verbittert sterben.
Am Tag darauf wurde mir klar, dass mein Leben, so wie ich es lebe, keinerlei Gefahren birgt. Ich weiß immer, was mich am nächsten Tag erwartet, denn jeder ist wie der vorangegangene. Und Leidenschaft? Nun ja, ich liebe meinen Mann, was mich davor bewahrt, in Depressionen zu verfallen, weil ich nicht allein aus finanziellen Gründen, wegen der Kinder oder wegen des schönen Scheins mit ihm zusammenlebe.
Ich lebe im sichersten Land der Welt, mein Leben ist [9] geordnet, ich bin eine gute Ehefrau und Mutter. Ich habe eine streng protestantische Erziehung genossen und habe vor, diese an meine Kinder weiterzugeben. Ich weiche nie vom rechten Weg ab, weil ich weiß, dass ich sonst alles aufs Spiel setzen würde. Ich versuche bei allem, was ich tue, so effizient wie möglich zu sein, und sichere mich ab, indem ich mich so wenig wie möglich persönlich einbringe. Denn vor meiner Ehe war ich, was an sich nichts Ungewöhnliches ist, oft unglücklich verliebt. Aber seit ich verheiratet bin, ist meine Zeit gleichsam stehengeblieben.
Bis dieser verdammte Schriftsteller dieses Statement abgegeben hat.
Aber was ist denn falsch an Routine und Gleichförmigkeit?
Ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Nur…
…gibt es da die heimliche Angst, alles könnte sich von einem Augenblick zum anderen ändern und die Veränderung mich vollkommen unvorbereitet treffen.
Von dem Augenblick an, als ich an einem wunderschönen Morgen diesen ketzerischen Gedanken hatte, kam ich aus dem Takt. Und begann mein Leben zu hinterfragen. Wäre ich in der Lage, so grübelte ich, allein mit allem fertig zu werden, falls mein Mann sterben würde? Ja, antwortete ich mir selber, denn von dem Vermögen, das er hinterlassen würde, könnten mehrere Generationen leben. Und wenn nun ich sterben würde?, fragte ich mich weiter. Wer würde sich dann um meine Kinder kümmern? Mein geliebter Ehemann, war die Antwort. Aber nach einer gewissen Zeit würde er eine andere heiraten, denn er ist charmant, intelligent und außerdem reich. Wären meine Kinder dann in guten Händen?
[10] Ein erster Schritt ist gewesen zu versuchen, eine Antwort auf all meine nagenden Fragen zu finden. Doch mit jeder Antwort tauchten noch mehr Fragen auf. Würde er sich womöglich später, wenn ich älter bin, eine Geliebte nehmen? Hatte er womöglich jetzt schon eine, da wir nicht mehr so häufig miteinander schlafen wie früher? Glaubte er vielleicht, ich hätte jemand anderen, weil ich für ihn in den letzten Jahren nicht mehr so viel Interesse gezeigt habe?
Eifersucht war bei uns bisher nie ein Thema, und ich fand das immer großartig, aber von jenem Frühlingsmorgen an keimte in mir der Verdacht, dass fehlende Leidenschaft der Grund sein könnte.
Ich tat alles, um nicht weiter darüber nachdenken zu müssen.
Eine Woche lang habe ich auf dem Nachhauseweg von der Redaktion immer einen Abstecher in die Rue du Rhône gemacht und mir etwas gekauft. Eher aufs Geratewohl, eher Verlegenheitskäufe, wie zum Beispiel etwas für den Haushalt.
Spielzeugläden mied ich, um meine Kinder nicht zu verwöhnen. Und auch an den Geschäften für Herrenbekleidung ging ich vorbei, denn wenn ich meinen Mann aus heiterem Himmel mit Geschenken überrascht hätte, wäre er möglicherweise misstrauisch geworden.
Wenn ich dann zu Hause in meiner perfekten privaten Welt ankam, schien für drei oder vier Stunden alles wunderbar. Aber nachts, im Schlaf, suchten mich zunehmend Alpträume heim.
Wenn einem in meinem Alter die Leidenschaft abhandenkommt, ist das wahrscheinlich etwas ganz Normales, denn [11] Leidenschaft ist offenbar ein Privileg der Jugend. Das ist es nicht, das mir Angst macht.
Heute, ein paar Monate später, bin ich hin- und hergerissen zwischen der Angst, dass sich alles verändern könnte, und der Angst, dass alles bis zum Ende meiner Tage gleich bleibt. Manche meinen, dass mit dem Sommer die verrücktesten Gedanken kommen. Vielleicht liegt es an der Hitze, dass wir die Welt dann anders sehen und empfinden. Unser Haus wirkt dann größer, die Wolken und der Horizont scheinen weiter entfernt zu sein.
Sei’s drum. Jedenfalls kann ich nicht mehr richtig schlafen, und das liegt nicht an der Hitze. Wenn es Nacht wird und mein Mann schläft, bekomme ich Angst: Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, vor der Liebe und deren Abwesenheit; davor, dass alles Neue zur Gewohnheit wird und dass ich meine besten Jahre mit Routine vergeude. Und zugleich ist da die Panik vor dem Unbekannten, so aufregend und abenteuerlich es auch sein mag.
Natürlich relativiert das Leid anderer mein eigenes.
Wenn ich zum Beispiel den Fernseher einschalte und in den Nachrichten von Unfällen höre und von Flüchtlingen, die durch Naturkatastrophen obdachlos wurden. Wie viele kranke Menschen gibt es wohl in diesem Augenblick auf der Welt? Wie viele von ihnen haben unter Unrecht und Verrat zu leiden? Wie viele Menschen leben in Armut, sind arbeitslos oder im Gefängnis?
Ich schalte auf einen anderen Sender. Schaue mir eine Seifenoper oder einen Spielfilm an, um mich für ein paar Minuten oder gar Stunden abzulenken. Zugleich habe ich schreckliche Angst davor, mein Mann könnte aufwachen [12] und fragen: »Was ist mit dir, Liebling?« Weil ich dann antworten müsste, dass alles in Ordnung ist. Noch schlimmer wäre, was im vergangenen Monat schon drei- oder viermal vorgekommen ist, dass er im Bett sofort die Hand auf meinen Schenkel legen, sie ganz langsam hochwandern lassen und beginnen würde, mich dort zu berühren. Ich kann einen Orgasmus vortäuschen und habe das auch schon häufig getan, aber ich kann nicht einfach so beschließen, feucht zu werden.
Ich müsste ihm sagen, dass ich todmüde bin, und er würde sich, ohne seine Frustration zu zeigen, nach einem Gutenachtkuss auf die andere Seite drehen, die Spätausgabe der Tagesschau auf seinem Tablet-Computer ansehen und seine Hoffnungen auf den nächsten Abend setzen.
Aber das läuft nicht immer so. Hin und wieder muss ich die Initiative ergreifen. Ich darf ihn nicht Nacht für Nacht abweisen, sonst sucht er sich am Ende wirklich eine Geliebte, und ich will ihn doch auf gar keinen Fall verlieren. Wenn ich zuerst ein wenig masturbiere, gelingt es mir, vorher feucht zu werden, und alles nimmt wieder seinen normalen Lauf.
»Alles nimmt wieder seinen normalen Lauf« bedeutet: Nichts wird wieder sein wie früher, als wir füreinander noch ein Geheimnis waren.
Über zehn Jahre Ehe dasselbe Feuer bewahren zu können scheint mir unrealistisch. Und jedes Mal, wenn ich beim Sex Lust vortäusche, stirbt etwas in mir. Ich fühle mich immer leerer.
Meine Freundinnen sagen, ich hätte Glück – aber ich belüge sie, wenn ich sage, dass wir häufig miteinander schlafen, so wie sie mich belügen, wenn sie sagen, dass ihre [13] Ehemänner immer noch genauso viel Interesse an ihnen zeigen wie früher. Sie meinen, dass Sex in der Ehe nur in den ersten fünf Jahren wirklich gut sei und man danach mit etwas »Phantasie« nachhelfen müsse. Man brauche nur die Augen schließen und sich vorstellen, dass der Nachbar neben einem liege und Dinge mit einem mache, die der eigene Mann nie wagen würde – dirty talk und perverse Ideen. Oder man müsse sich vorstellen, dass man von ihm und vom Ehemann gleichzeitig genommen wird.
[14] Als ich heute die Kinder zur Schule brachte, sah ich mir meinen Nachbarn mal genauer an. Ihn habe ich mir noch nie auf mir vorgestellt, eher den jungen Reporter, der mit mir zusammenarbeitet und der immer so einsam und traurig wirkt. Er würde mich nie anmachen, und genau das macht ihn für mich interessant. Alle Frauen in der Redaktion haben schon mal gesagt, sie würden sich »gern um ihn kümmern, den Armen«. Ich glaube, das weiß er sehr wohl und genießt es, so begehrt zu sein. Vielleicht empfindet er aber auch das Gleiche wie ich: diese schreckliche Angst, einen falschen Schritt zu tun und damit alles aufs Spiel zu setzen – seine berufliche Stellung, seine Familie, seine Zukunft.
Ich hätte weinen können, als ich heute Morgen unserem Nachbarn begegnete. Er war gerade dabei, seinen Wagen zu waschen, und ich dachte: Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus, und die Eltern sind Rentner und waschen ihr Auto. Ab einem bestimmten Alter beschäftigt man sich eben mit weniger Wichtigem, um den Tag auszufüllen, um sich und anderen zu beweisen, dass man körperlich noch fit, im Kern bescheiden geblieben und sich nicht zu schade ist, gewisse Arbeiten weiterhin selbst zu erledigen.
Ein sauberes Auto ist an sich nichts Weltbewegendes. Aber an diesem Morgen schien es meinem Nachbarn das [15] Wichtigste. Er wünschte mir lächelnd einen guten Tag und polierte sein Auto so hingebungsvoll weiter, als wäre es eine Skulptur von Rodin.
[16] Ich lasse meinen Wagen in einem Parkhaus und fahre von dort weiter mit dem Bus zur Arbeit – »Fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum! Es reicht mit der Umweltverschmutzung!« Genf hat sich seit meiner Kindheit wenig verändert: Alte herrschaftliche Häuser stehen zwischen Bauwerken der sogenannten »neuen Architektur«, die von irgendeiner verrückten Baubehörde in den 1950er Jahren genehmigt wurden.
Immer wenn ich auf Reisen bin, habe ich Sehnsucht danach: nach dieser geschmacklosen Architektur, dem Fehlen von Wolkenkratzern oder von Stadtautobahnen; nach den Baumwurzeln, die den Asphalt aufbrechen und über die man ständig stolpert, nach den öffentlichen Parks mit den geheimnisvollen Holzzäunchen, hinter denen alle möglichen Kräuter und Unkräuter wachsen, weil »die Natur siegen soll«… Kurz, ich sehne mich nach einer Stadt, die anders ist als all die anderen Städte, die sich modernisieren und ihren Zauber verlieren.
Hier grüßt man sich noch auf der Straße und verabschiedet sich beim Verlassen eines Ladens. Man unterhält sich noch mit Fremden im Bus, obwohl alle Welt glaubt, dass die Schweizer diskret und zurückhaltend seien.
Was für ein Irrtum! Aber es ist gut, dass so über uns [17] gedacht wird, weil wir so unseren Lebensstil über mehr als fünf oder sechs Jahrhunderte bewahren konnten, ehe die Barbaren über die Alpen kamen und unser Land einnahmen: mit ihren elektronischen Wunderausrüstungen, den Appartements mit winzigen Schlafzellen und überdimensionierten Salons zu Repräsentationszwecken, mit ihren überschminkten Frauen, mit Männern, die mit ihrem lauten Gerede die Nachbarn stören, und mit Jugendlichen, deren Kleidungsstil Rebellion anzeigen soll, die aber eine Heidenangst vor dem haben, was Vater oder Mutter davon halten könnten.
Sollen doch alle weiterhin der Meinung sein, dass wir Schweizer nur Käse, Schokolade und Uhren produzieren. Sollen sie doch glauben, dass es in Genf an jeder Ecke eine Bank gibt. Wir sind nicht im mindesten daran interessiert, dieses Bild von uns zu korrigieren. Wir sind glücklich ohne die Invasionen der Barbaren. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet – da bei uns Militärdienst Pflicht ist, hat jeder wehrdienstpflichtige Schweizer ein Gewehr zu Hause, aber man hört nur relativ selten davon, dass jemand damit auf einen anderen geschossen hätte.
Wir haben seit Jahrhunderten nichts verändert und sind glücklich damit. Wir sind stolz darauf, neutral geblieben zu sein, während Europa seine Söhne in sinnlose Kriege geschickt hat.
Wir freuen uns, niemandem Erklärungen schuldig zu sein, warum in einigen Vierteln von Genf die Zeit offenbar stehengeblieben ist und weiterhin alte Damen ihre Tage in Cafés aus der Jahrhundertwende verbringen.
»Wir sind glücklich« trifft es nicht ganz. Richtiger wäre: [18] Alle sind glücklich, außer mir, die ich in diesem Augenblick auf dem Weg in die Redaktion bin und darüber nachdenke, was bloß mit mir los ist.
[19] Noch ein Tag, an dem wir uns auf der Lokalredaktion, für die ich arbeite, redlich bemühten, neben der Berichterstattung über die üblichen Unglücksfälle und Verbrechen (wie einen gewöhnlichen Verkehrsunfall, einen noch nicht einmal bewaffneten Raubüberfall und ein Großaufgebot der Feuerwehr, die wegen eines im Ofen vergessenen Bratens ausrücken musste und dabei ein ganzes Appartement unter Wasser setzte) Themen zu finden, über die es sich zu berichten lohnt.
Anschließend zurück nach Hause, kochen, Tisch decken, die Familie darum versammeln, gemeinsam das Tischgebet sprechen.
Noch ein Abend, an dem auch nach dem Abendessen jeder seinen Pflichten nachgeht – der Vater hilft den Kindern bei den Hausaufgaben, die Mutter räumt die Küche auf und legt das Geld für die Hausangestellte bereit, die früh am nächsten Morgen wiederkommt.
In den vergangenen Monaten gab es sehr wohl Momente, in denen ich mich wohl fühlte und den Eindruck hatte, ein sinnvolles Leben zu führen. Ich war mit mir im Reinen, mein Mann zeigte sich besonders liebevoll und aufmerksam, und unser Zuhause schien von einem ganz eigenen Licht erfüllt zu sein. Wir waren wie eine Bilderbuchfamilie.
[20] Und dennoch breche ich immer wieder grundlos unter der Dusche in Tränen aus. Ich weine im Bad, weil mich da niemand hören und mir die verhasste Frage stellen kann: »Ist bei dir alles in Ordnung?«
Ja, warum sollte es das nicht sein? Seht ihr denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass in meinem Leben etwas falschläuft?
Nichts dergleichen.
Tagsüber empfinde ich keine Begeisterung für mein Leben.
Und nachts macht mir mein Leben Angst.
Es gibt die glücklichen Bilder der Vergangenheit und alles das, was hätte sein können und nicht gewesen ist.
Da ist die unerfüllte Sehnsucht nach Abenteuern.
Die Angst, nicht zu wissen, was mit meinen Söhnen geschehen würde, wenn mir etwas zustoßen sollte.
Und dann beginnen die Gedanken um alles Negative zu kreisen, immer dasselbe, als würde in der Zimmerecke ein Dämon lauern, um sich bei erstbester Gelegenheit auf mich zu stürzen und mir zu sagen, dass das, was ich »mein Glück« nenne, nur ein vorübergehender Zustand sei. Aber wusste ich das denn nicht schon immer?
Ich möchte mich ändern. Ich muss mich ändern. Heute in der Redaktion reagierte ich übertrieben gereizt, nur weil ein Praktikant ein wenig zu lange brauchte, um das Material zu beschaffen, um das ich ihn gebeten hatte. Eigentlich bin ich gar nicht so, aber ganz allmählich verliere ich den Kontakt zu mir selber.
Es ist Unsinn, dem besagten Schriftsteller und dem Interview die Schuld zu geben. Das liegt Monate zurück. Er [21] hat nur den Schlund eines Vulkans geöffnet, der jetzt jeden Augenblick ausbrechen und Tod und Verderben über mich bringen kann. Wäre der Schriftsteller nicht gewesen, wären ein Film, ein Buch oder ein paar zufällig gewechselte Sätze die Auslöser für diese Krise geworden. Offenbar gibt es Menschen wie mich, in denen sich über Jahre immer mehr Druck aufbaut, bis eines Tages der Vulkan in ihnen ausbricht und sie durchdrehen.
Bis sie sagen: »Mir reicht’s. Ich will nicht mehr.«
Einige bringen sich um. Andere lassen sich scheiden. Wieder andere gehen nach Afrika, um den Armen zu helfen und die Welt zu retten.
Aber ich kenne mich. Ich weiß, dass meine einzige Reaktion sein wird, meine Gefühle zu ersticken, bis ein Krebs mich von innen auffrisst. Denn ich bin davon überzeugt, dass die meisten Krankheiten das Ergebnis unterdrückter Gefühle sind.
[22] Nachts um zwei Uhr wache ich auf und starre an die Decke, obwohl ich weiß, dass ich am nächsten Tag früh aufstehen muss (was ich auf den Tod nicht ausstehen kann). Anstatt an etwas Konstruktives zu denken, wie beispielsweise: »Was passiert da gerade mit mir?«, kann ich meine Gedanken einfach nicht ordnen. Manchmal, wenn auch nicht häufig, frage ich mich, ob ich nicht in psychiatrische Behandlung gehöre. Was mich davon abhält, mich einliefern zu lassen, sind weder mein Mann noch meine Arbeit, sondern die Kinder. Sie würden überhaupt nicht verstehen können, was in mir brodelt.
Meine Gefühle sind jetzt intensiver. Ich denke über meine Ehe nach, in der Eifersucht nie ein Thema war. Aber wir Frauen haben da einen sechsten Sinn. Möglicherweise hat mein Mann doch eine andere gefunden, und ich spüre es unbewusst. Allerdings gibt es keinen Grund, ihn zu verdächtigen.
Ist das nicht absurd? Habe ich von allen Männern der Welt nicht den einzigen absolut perfekten geheiratet? Er trinkt nicht, er geht abends nicht allein aus, trifft sich auch nie mit Freunden zu reinen Männerabenden. Der private Teil seines Lebens dreht sich ganz und gar um seine Familie.
Es könnte ein Traum sein, wäre es für mich nicht ein [23] Alptraum. Weil ich fürchte, den enormen Erwartungen, die mein Mann an mich stellt, nicht gerecht werden zu können.
Auch wird mir klar, dass Begriffe wie »Optimismus« und »Hoffnung« und vieles andere, was wir in Ratgebern lesen und das uns helfen soll, das Leben zu meistern, nichts als leere Worte sind. Vielleicht aber sind die Weisen, die diese Begriffe verbreiten, selber noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und benutzen uns als Versuchskaninchen, um zu sehen, wie wir reagieren.
[24] Heute bin ich mit einer Jugendfreundin zum Mittagessen verabredet.
Sie hat ein japanisches Restaurant vorgeschlagen, von dem ich noch nie gehört hatte, obwohl ich für japanisches Essen schwärme. Angeblich ist es ausgezeichnet, wenn auch etwas weit von der Redaktion entfernt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen. Ich musste zweimal umsteigen und mich zu der Einkaufspassage durchfragen, in der das »ausgezeichnete Restaurant« liegt. Ich finde alles grauenhaft – die Einrichtung, die Papiertischdecken, die fehlende Aussicht. Aber meine Freundin hat trotzdem recht. Es gibt dort eines der besten japanischen Essen, die ich je in Genf genossen habe.
»Ich habe immer im selben Restaurant gegessen, das ich ganz ordentlich, aber nicht besonders fand«, sagt meine Freundin gerade. »Bis mir von einem Bekannten, der bei der diplomatischen Vertretung Japans bei der UNO arbeitet, dieses hier empfohlen wurde. Ich fand die Location so geschmacklos wie du vermutlich auch. Aber die Pächter kochen selber, und das gibt den Ausschlag.«
Ich selbst gehe auch immer in dieselben Restaurants und bestelle immer dieselben Gerichte, denke ich. Nicht einmal da bin ich imstande, ein Risiko einzugehen.
[25] Meine Freundin nimmt Antidepressiva. Das Letzte, was ich möchte, ist, mit ihr über dieses Thema zu reden, denn heute früh bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich selbst nur einen Schritt weit von einer Depression entfernt bin und das nicht hinnehmen will.
Und gerade weil ich mir selber gesagt habe, dass dies das Letzte wäre, was ich gern tun würde, ist es das Erste, was ich mache. Das Unglück anderer hilft einem, wie gesagt, besser mit dem eigenen Leid fertig zu werden.
Oder, anders gesagt: Das Leid wird zu einem wichtigen Forschungs- und Produktbereich und damit natürlich auch zu einem wichtigen Umsatzträger der pharmazeutischen Industrie. Sind Sie traurig? Dann nehmen Sie diese Pille, und es lebt sich wieder leichter.
Ich frage meine Freundin, wie sie sich fühlt. »Es hat zwar lange gedauert, bis die Medikamente endlich wirkten, doch nach und nach gewann ich das Interesse an den Dingen zurück, und die hatten wieder Farbe und Geschmack.«
Ich sondiere vorsichtig, ob meine Freundin bereit wäre, bei einer Artikelserie über Depression für meine Zeitung mitzuarbeiten.
»Das lohnt sich doch nicht. Die Leute teilen heute alles, was sie fühlen, mit den anderen im Internet. Und es gibt Medikamente.«
»Was wird im Internet diskutiert?«, frage ich nach.
»Die Nebenwirkungen der Medikamente. An die Symptome der Krankheit rührt man lieber nicht, aus unbewusster Furcht, sie könnten etwas ›Ansteckendes‹ haben, das heißt, wir könnten plötzlich an uns selbst etwas feststellen, was wir vorher nicht wahrgenommen haben.«
[26] »Weiter nichts?«
»Meditationsübungen. Ich selbst glaube nicht daran. Ich habe sie alle schon ausprobiert, aber es ging mir erst besser, als ich akzeptierte, dass ich ein Problem hatte.«
»Aber hilft es denn nicht zu wissen, dass man nicht allein ist? Tut es nicht allen gut, darüber zu sprechen, was für Gefühle eine Depression auslösen kann?«, bohre ich weiter.
»Ganz und gar nicht. Wer der Hölle entronnen ist, hat überhaupt kein Interesse daran zu wissen, wie das Leben dort drin weitergeht.«
Warum hatte meine Freundin so lange in diesem Zustand verharrt?
»Weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich eine Depression hatte. Und weil meine Freunde, mit denen ich darüber sprach, und auch du, wenn ich dir davon erzählte, meinten, das sei Unsinn, denn Menschen mit wirklichen Problemen hätten keine Zeit, eine Depression zu spüren.«
Es stimmt, das hatte ich tatsächlich gesagt.
Ich lasse nicht locker: Ein Artikel oder ein Post in einem Blog könnte anderen Menschen vielleicht helfen, ihre Krankheit besser zu ertragen und Hilfe zu suchen. Da ich aber nicht depressiv sei und nicht wisse, wie sich das anfühle, könnte sie mir deshalb nicht etwas darüber erzählen?
Meine Freundin zögert. Aber sie kennt mich und ahnt vielleicht etwas.
»Es ist, als befinde man sich in einer Falle. Du weißt, dass du festsitzt, aber es gelingt dir nicht…«
Genau das hatte ich vor ein paar Tagen auch gedacht.
Meine Freundin beginnt, Gemeinsamkeiten zwischen denen aufzuzählen, die einen Besuch in der »Hölle«, wie sie es [27] nennt, bereits hinter sich haben: »Man kommt morgens nicht aus dem Bett. Die einfachsten Arbeiten werden zu Herkulesaufgaben. Man hat Schuldgefühle, weil kein nachvollziehbarer Grund besteht, depressiv zu sein, wo doch so viele andere Menschen auf der Welt wirklich leiden.«
Ich sollte das ausgezeichnete japanische Essen genießen, aber irgendwie schmeckt es mir jetzt nicht mehr so richtig. Meine Freundin fährt fort:
»Apathie. Fröhlichkeit vortäuschen, Traurigkeit vortäuschen, Orgasmen vortäuschen, vortäuschen, dass man sich amüsiert, vortäuschen, dass man gut geschlafen hat, vortäuschen, dass man lebt. Bis der Augenblick kommt, in dem man an eine imaginäre Grenzlinie gelangt und begreift, dass es, wenn man sie erst überschreitet, kein Zurück mehr gibt.
Wozu dann noch klagen, denn solche Klagen würden bedeuten, dass wir wenigstens noch gegen etwas ankämpfen. Besser, man akzeptiert den Zustand und versucht, ihn vor allen zu verbergen. Was ziemlich anstrengend ist!«
Was hatte die Depression meiner Freundin denn ausgelöst?
»Nichts, was ich benennen könnte. Aber warum so viele Fragen? Fühlst du etwas in der Richtung?«
Selbstverständlich nicht!
Besser das Thema wechseln.
Ich spreche über den Politiker, den ich in zwei Tagen interviewen werde: einen Exfreund von mir vom Gymnasium, an den sie sich wahrscheinlich nicht einmal mehr erinnert. Wir haben uns ein paarmal geküsst, und er hat meine Brüste berührt, die damals noch nicht ganz entwickelt waren. Mehr nicht.
[28] Meine Freundin reagiert ganz euphorisch. Ich dagegen möchte das Thema jetzt doch nicht vertiefen. Ich schalte den Autopiloten ein. Apathie. Diesen Zustand habe ich noch nicht erreicht. Noch beklage ich mich über das, was mir hier gerade widerfährt, aber ich fürchte, dass sich bei mir bald schon – es ist vielleicht nur eine Frage von Monaten, Tagen oder Stunden – Desinteresse an allem breitmachen und dies nur schwer zu überwinden sein könnte.
Mir ist, als würde meine Seele meinen Körper ganz allmählich verlassen und sich an einen mir unbekannten, »sicheren Ort« begeben, an dem ich mich selber und meine nächtlichen Ängste nicht mehr ertragen muss. Als befände ich mich nicht in einem hässlichen japanischen Restaurant mit köstlichem Essen und als wäre alles, was ich gerade erlebe, eine Szene in einem Film, den ich mir ansehe und in dessen Handlung ich nicht eingreifen möchte – und dies auch nicht kann.
[29] Ich wache auf und wiederhole die ewig gleichen Rituale – Zähneputzen, mich für den Arbeitstag fertigmachen, die Jungs wecken, Frühstück machen und mich ostentativ am Leben freuen. Dabei lastet auf mir ständig ein Gewicht, das ich nicht näher benennen kann, ähnlich einem Tier, das auch nicht genau versteht, wie es in eine Falle geraten konnte.
Beim Frühstück bringe ich keinen Bissen hinunter, lächle aber tapfer weiter (damit nur ja niemand Verdacht schöpft) und schlucke stattdessen die Tränen hinunter. Der Himmel draußen wirkt grau.
Das Gespräch gestern mit meiner Jugendfreundin hat mir ganz und gar nicht gutgetan: Es sieht so aus, als würde ich allmählich aufhören, mich zu wehren, und bald schon in Apathie verfallen.
Bemerkt das denn niemand?
Selbstverständlich nicht. Schließlich wäre ich die Letzte, die zugeben würde, dass sie Hilfe braucht.
Das ist mein Problem: Der Vulkan in mir ist offenbar ausgebrochen, und ich kann diesen Ausbruch nicht rückgängig machen und so tun, als sei nichts geschehen. Ich kann nicht einfach so weitermachen mit Bäume pflanzen, Rasen säen und mähen oder Schafe darauf weiden lassen.
Das alles habe ich nicht verdient. Ich habe immer [30] versucht, den Erwartungen aller zu entsprechen. Aber es ist nun mal geschehen, und mir bleibt kein anderer Ausweg, als zu Medikamenten zu greifen. Am besten erfinde ich gleich heute einen Vorwand, um einen Artikel über psychische Erkrankungen, ihre Therapiemöglichkeiten und die Kostenübernahme durch die Krankenkassen zu schreiben (die Leser lieben so was). Dies mit dem Hintergedanken, einen guten Psychiater zu finden, den ich ganz persönlich um Hilfe bitten kann, obwohl das gegen meine Berufsethik verstößt. Na ja: Nicht alles, was man tut, ist mit der Berufsethik vereinbar.
Ich leide nicht an Obsessionen – wie beispielsweise Diäten machen. Oder an einem Ordnungsfimmel. Ich kritisiere auch nicht ständig die Arbeit unserer philippinischen Haushaltshilfe, die um acht Uhr morgens kommt und um fünf Uhr nachmittags geht, nachdem sie gewaschen, gebügelt, das Haus aufgeräumt hatte und zwischendurch im Supermarkt einkaufen ging. Ich darf meine Frustrationen auch nicht dadurch kompensieren, eine Supermutter zu sein, denn die Kinder würden den Rest ihres Lebens darunter leiden.
Auf dem Weg in die Redaktion sehe ich unseren Nachbarn wieder seinen Wagen polieren. Hat er das nicht schon gestern erledigt?
Ich kann einfach nicht anders, als zu ihm zu gehen und ihn zu fragen, warum er auch heute wieder mit seinem Wagen zugange ist.
»Ich war noch nicht ganz fertig«, antwortet er, nachdem er mich begrüßt, sich nach meinen Kindern erkundigt und mir ein Kompliment über mein Kleid gemacht hat.
Ich schaue den Wagen an, einen Audi (Genf wird oft scherzhaft Audi-Land genannt). Für mich sieht er picobello aus. [31] Doch unser Nachbar zeigt mir diverse Stellen, die noch nicht so glänzen, wie sie es seiner Ansicht nach tun sollten.
Ich rede dann noch über dieses und jenes mit ihm und frage ihn schließlich, was seiner Meinung nach die Menschen vom Leben erwarten.
»Das ist ganz einfach. Sie wollen ihre Rechnungen bezahlen können. Ein Haus wie Ihres oder meines kaufen. Einen Garten mit Bäumen haben, die Kinder und Enkelkinder sonntags zum Mittagessen zu sich einladen. Nach der Pensionierung die Welt bereisen.«
Das also wünschen sich die Menschen vom Leben? Ist das alles? Etwas stimmt ganz und gar nicht mit dieser Welt, und schuld sind nicht die Kriege in Asien oder im Nahen Osten.
Bevor ich in die Redaktion gehe, muss ich noch Jacob interviewen, meinen Jugendschwarm. Aber nicht einmal die Aussicht darauf muntert mich auf – so weit ist es mit meinem allgemeinen Desinteresse schon gekommen.
[32] Ich höre mir an, was er spontan über das Regierungsprogramm zu sagen hat. Ich frage nach, stelle ihm Fangfragen, aber er windet sich elegant heraus.
Er ist ein Jahr jünger als ich, sieht aber mit seinen dreißig Jahren aus wie fünfunddreißig. Diese Beobachtung behalte ich allerdings für mich.
Natürlich finde ich es schön, ihn wiederzusehen, obwohl er mich bis jetzt noch nicht danach gefragt hat, wie ich lebe, seit sich nach der maturité unsere Wege getrennt haben. Er ist auf sich, seine Karriere, seine Zukunft konzentriert, während ich mich dabei erwische, wie ich stattdessen an die Vergangenheit denke, als ich noch ein Teenie mit Zahnspange war, der von den anderen Mädchen bewundert wurde, weil die Jungs sich für mich interessierten.
Ich höre ihm jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr zu. Immer dieselben Themen – Steuersenkung, Kriminalitätsbekämpfung, der Status der französischen frontaliers (Grenzgänger) in der Schweiz, die angeblich den Schweizern die Arbeitsplätze wegnehmen.
Jahraus, jahrein bleiben die Themen dieselben, die Probleme aber dennoch ungelöst, weil sich ihrer niemand wirklich annimmt.
Nach zwanzig Minuten beginne ich mich zu fragen, ob [33] mein Desinteresse eine Folge meiner gegenwärtigen ungewohnten Stimmungslage ist. Aber nein. Es gibt schlicht nichts Langweiligeres, als Politiker zu interviewen. Die Zeitung hätte mich besser losschicken sollen, um über ein Verbrechen zu berichten. Morde sind sehr viel authentischer.
Verglichen mit den Volksvertretern irgendeines anderen Landes auf diesem Planeten sind unsere die denkbar uninteressantesten und fadesten. Keiner schert sich um ihr Privatleben. Nur zwei Dinge können in Genf einen Skandal hervorrufen: Korruption und Drogen, was dann jeweils für unverhältnismäßig viel Wirbel sorgt, weil den Zeitungen schlichtweg andere interessante Themen fehlen.
Wir Schweizer interessieren uns nicht dafür, ob ein Politiker eine Geliebte hat, Bordelle besucht oder ein Coming-out hat. Wir wollen nur, dass er tut, wofür er gewählt wurde, und sein Budget nicht überzieht, damit wir in Frieden leben können.
Jedes Mal, wenn ich am Musée d’Art et d’Histoire vorbeikomme, sehe ich Parteiplakate mit Abstimmungsempfehlungen zu Volksinitiativen oder Volksreferenden. Das Schweizer Volk ist es gewohnt, zu vielem konsultiert zu werden: zur Farbe der Müllbeutel (Schwarz hat in meinem Kanton gewonnen), zur Erlaubnis, eine Waffe zu tragen (eine knappe Mehrheit hat dem zugestimmt, denn die Schweiz hat weltweit eine der größten Waffendichten pro Kopf – hinter den USA, dem Jemen und Serbien), zu Minarettbauvorhaben, zur Beschleunigung von Asylverfahren und zu Verschärfungen für vorläufig aufgenommene Asylsuchende.
»Monsieur König?«
Wir wurden bereits einmal unterbrochen. Höflich bittet [34] Jacob seinen Assistenten, seinen nächsten Termin zu verschieben. Meine Zeitung sei schließlich die bedeutendste der französischen Schweiz, und das Interview könne für die nächsten Wahlen entscheidend sein.
Er glaubt offenbar, mir damit schmeicheln und mich so dazu bewegen zu können, noch etwas zu bleiben.
Dennoch stehe ich auf, bedanke mich und sage, ich hätte bereits alles Material, das ich benötige.
»Fehlt noch was?«
Natürlich fehlt etwas. Aber es ist nicht an mir zu sagen, was.
»Wie wäre es, wenn wir uns mal nach Büroschluss treffen würden?«
Ich sage, dass ich meine Kinder von der Schule abholen muss. Hoffe, dass er den breiten goldenen Ehering an meinem Finger gesehen hat, murmle ein »Was geschehen ist, ist Vergangenheit«.
»Klar. Wollen wir dann irgendwann mal zusammen zu Mittag essen?«
Ich willige ein. Ich mache mir öfter gern etwas vor und rede mir daher ein, dass er mir ja vielleicht wirklich noch etwas Wichtiges zu sagen habe, so etwas wie ein Staatsgeheimnis, etwas von landesweiter Bedeutung, das, wenn es mir gelingt, es ihm zu entlocken, den Chefredakteur nachhaltig beeindrucken wird.
Er geht zur Tür, dreht den Schlüssel um, kommt zu mir, schließt mich in die Arme und küsst mich. Ich erwidere den Kuss, es ist schon lange her, dass wir uns zum letzten Mal geküsst haben. Jacob, den ich möglicherweise eines Tages hätte lieben können, ist inzwischen mit einer Professorin [35] verheiratet. Und ich bin ebenfalls verheiratet und außerdem zweifache Mutter.
Ich überlege noch, ob ich ihn wegschieben und ihm sagen soll, dass wir keine Teenager mehr sind. Gleichzeitig genieße ich seine Küsse. Heute habe ich nicht nur ein neues japanisches Restaurant entdeckt, sondern bin gerade dabei, eine »Dummheit« zu begehen. Obwohl ich gegen alle Regeln verstoßen habe, ist der Himmel nicht über meinem Kopf eingestürzt! Im Gegenteil: Ich habe mich schon lange nicht mehr so glücklich gefühlt.
Mit jedem Augenblick fühle ich mich besser, mutiger, freier. Und dann tue ich etwas, von dem ich schon seit meiner Schulzeit geträumt habe.
Ich knie nieder, öffne den Reißverschluss seiner Hose und beginne, seinen Schwanz zu lecken. Er hält mein Haar fest und kontrolliert den Rhythmus. Er kommt in weniger als einer Minute.
»Oh – das war – wunderbar.«
Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so schnell zum Höhepunkt bringen kann, auch wenn er es vielleicht als vorzeitigen Samenerguss empfunden hat.
[36] Nach der Sünde die Angst, dass herauskommt, was ich getan habe.
Auf dem Rückweg zur Zeitung kaufe ich Zahnbürste und Zahnpasta. In der Redaktion gehe ich immer wieder auf die Damentoilette, um Gesicht und Kleidung zu inspizieren – ich trage eine Versace-Bluse mit raffinierten Stickereien, in denen das Sperma sichtbare Spuren hinterlassen haben könnte. Wieder zurück an meinem Arbeitsplatz beobachte ich aus dem Augenwinkel meine Kollegen, aber nicht einmal die Frauen unter ihnen (und Frauen haben für solche Dinge bekanntlich einen sechsten Sinn) scheinen etwas bemerkt zu haben.
Wie konnte das passieren? Es war so, als wäre etwas über mich gekommen und hätte mich in diese Situation hineinmanövriert, die absolut nichts Erotisches hatte. Wollte ich Jacob gegenüber etwa die unabhängige, freie Frau spielen, die ihre Wünsche auslebt? Hatte ich ihn beeindrucken wollen oder einfach nur gehofft, auf diese Weise der »Hölle« (wie meine Freundin es ausdrückte) zu entfliehen?
Alles wird weitergehen wie vorher. Ich stehe nicht an einem Scheideweg. Ich weiß, wo’s langgeht, und hoffe, dass es weder mit mir noch mit meiner Familie je so weit kommt, dass etwas wie Autowaschen einen ähnlichen Stellenwert einnimmt, wie es bei unserem Nachbarn der Fall ist.
[37] Wenn bei mir dennoch große Veränderungen anstehen sollten, dann brauchen sie ihre Zeit – und Zeit habe ich genug.
Zumindest hoffe ich das.
Zu Hause angekommen, gebe ich mich betont gelassen, weder besonders fröhlich noch bedrückt. Was den Kindern sofort auffällt.
»Maman, du bist heute irgendwie komisch.«
Ich möchte am liebsten sagen: Ja, denn ich habe etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Dennoch habe ich keine Schuldgefühle, sondern nur Angst, dass es herauskommt.
Mein Mann küsst mich zur Begrüßung wie immer, fragt mich, wie mein Tag war und was es zum Abendessen gibt. Ich antworte so wie immer. Wenn bei mir alles ist wie sonst auch, wird er nicht im Traum auf den Gedanken kommen, ich hätte wenige Stunden zuvor Oralsex mit einem anderen Mann gehabt, und noch dazu mit einem bekannten Politiker. Obwohl mir dieses Erlebnis nicht die geringste körperliche Lust verschafft hat, bin ich jetzt ganz verrückt vor Begierde, brauche einen Mann, Küsse über Küsse, möchte die Lust eines Körpers auf meinem spüren.
[38] Als wir ins Schlafzimmer hinaufgehen, merke ich, dass ich total erregt bin, verrückt danach, mit meinem Mann zu schlafen. Aber ich muss es ruhig angehen lassen – keine Übertreibungen, sonst könnte er Verdacht schöpfen.
Ich dusche, lege mich neben ihn, nehme ihm den Tablet-Computer aus der Hand und lege ihn auf den Nachttisch. Ich beginne, seine Brust zu streicheln, und er ist gleich erregt. Wir schlafen miteinander, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben. Als ich etwas lauter stöhne, bittet er mich, leise zu sein, damit die Kinder nicht aufwachen, worauf ich ihm sage, nein, ich wolle meinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Ich habe mehrere Orgasmen nacheinander. Mein Gott, wie ich diesen Mann an meiner Seite liebe! Am Ende liegen wir erschöpft und verschwitzt nebeneinander, und ich stehe auf, um ein zweites Mal zu duschen. Er kommt mit und spielt mit mir, indem er den Duschkopf auf mein Geschlecht hält. Ich bitte ihn, das zu lassen, ich sei müde, wir müssten jetzt schlafen, so würde er mich nur erneut erregen.
Während wir uns gegenseitig abtrocknen, will ich meinen Seelenzustand plötzlich auf Teufel komm raus verändern und bitte meinen Mann, mich in einen Nachtclub [39] auszuführen. Ich glaube, in diesem Augenblick hat er vielleicht doch gemerkt, dass etwas nicht stimmt.
»Morgen?«
Morgen könne ich nicht, ich hätte Yoga. Am Freitag.
»Wo du es gerade erwähnst, darf ich dir eine ziemlich direkte Frage stellen?«
Mir bleibt das Herz stehen.
»Warum machst du eigentlich Yoga? Eine so ruhige, in sich ruhende Frau, die genau weiß, was sie will – hältst du Yoga denn nicht für Zeitverschwendung?«
Mein Herz schlägt wieder. Ich antworte nicht, streichle nur wortlos sein Gesicht.
[40] Ich falle ins Bett, schließe die Augen und denke, bevor ich einschlafe: Ich muss eine dieser für mein Alter typischen Krisen durchmachen. Sie wird vorübergehen.
Man kann nicht dauernd glücklich sein. Niemand kann das. Man muss lernen, mit den Realitäten des Lebens zurechtzukommen.
Liebe Depression, komm nicht näher, lass mich in Ruhe! Mach dich an andere heran, die mehr Gründe haben als ich, sich im Spiegel zu betrachten und sich zu sagen: »Was für ein nutzloses Leben ich doch führe!« Ob du willst oder nicht, ich weiß, wie ich dich besiegen kann.
Depression, mit mir vergeudest du definitiv deine Zeit!
[41] Das Treffen mit Jacob König verläuft genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir gehen in La Perle du Lac, ein teures Restaurant am Seeufer, früher für sein ausgezeichnetes Essen bekannt, inzwischen aber miserabel und völlig überteuert. Ich hätte das japanische Restaurant vorschlagen können, das ich eben erst dank meiner Jugendfreundin entdeckt hatte, sage aber nichts, da ich davon ausgehe, dass er es für genauso geschmacklos gehalten hätte wie ich anfangs auch. Für gewisse Leute ist das Dekor wichtiger als das Essen.
Schon sehe ich, dass mein Instinkt mich nicht getrogen hat, denn Jacob spielt sich als ausgewiesener Weinkenner auf, kommentiert »Bouquet«, »Textur« und sogar die »Tränen«, diese kirchenfensterähnlichen Spuren, die beim Schwenken an der Innenseite des Glases entstehen – seine Art, auszudrücken, dass aus dem ehemaligen Gymnasiasten ein erwachsener Mann geworden ist, der dazugelernt hat, im Leben aufgestiegen ist und jetzt die Welt, die Weine, die Politik, die Frauen kennt und womöglich bereits die eine oder andere Geliebte gehabt hat.
Was für ein Getue um den Wein! Wir trinken doch unser ganzes Leben lang Wein und können alle einen guten von einem schlechten Tropfen unterscheiden.
[42] Aber bis ich meinen Mann kennenlernte, haben alle Männer, mit denen ich ausging – und die sich für gebildet hielten –, die Wahl des Weines dazu benutzt, um Eindruck zu schinden. Sie machen alle das Gleiche: mit ernster Miene am Korken riechen, das Etikett lesen, sie lassen sich vom Kellner ein wenig einschenken, halten ihr Glas prüfend gegen das Licht, probieren vorsichtig einen Schluck und nicken schließlich zustimmend.