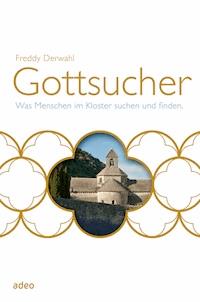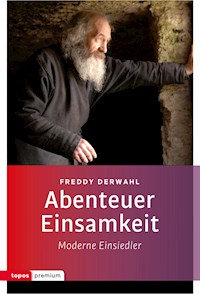Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
"Seit letztem Sommer habe ich täglich den Marktplatz in Augenschein genommen. Es sollte streng geschehen, wie mit der Lupe als Phänomen, das zu durchblicken, bestaunen und zu vertiefen ist. Ich wollte auf diesem Platz Lebensspuren finden." Die Autobiografie des Schriftstellers Freddy Derwahl (geb. 1946) erscheint zum 100. Jahrestag des Versailler Vertrages, der die Kreise Eupen-Malmedy Belgien zuschlug. Sein Leben beginnt in einer Zeit schmerzlicher Kriegsfolgen. Die deutsche Muttersprache ist im neuen Vaterland umkämpft. König Baudouin steht schüchtern auf dem Rathausbalkon von Eupen. Der junge Journalist engagiert sich inmitten von Bruderkrieg und Konspiration für eine tolerante Autonomie. Nach einer Sabbatzeit in einem Trappistenkloster in den USA führt ihn eine Begegnung mit dem Nobelpreisträger Heinrich Böll in die Literatur. Zahlreiche Bücher und Filme entstehen. Schwere Krankheiten und eine dadurch ausgelöste Lebenswende, die sich in spiritueller Lyrik und Tagebuchnotizen äußert, lassen seine Romane und Erzählungen persönlicher, intensiver werden. In der Stille des Hohen Venns, der Eifel und seines Gartens zieht Freddy Derwahl jetzt Resümee und nimmt uns mit auf den Marktplatz seines reichen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Freddy Derwahl wurde am 16. November 1946 in Eupen im deutschsprachigen Belgien geboren. Er studierte Literatur und Soziologie in Löwen, Aachen und Paris. Später arbeitete er als Journalist und Korrespondent der Aachener Volkszeitung in Brüssel und wurde Leiter der BRF-Kulturredaktion. Es folgten eine Sabbatzeit im Trappistenkloster Abbey of the Genesee (USA) und mehrere Stipendien und Auslandsaufenthalte: Stipendium der König-Baudouin-Stiftung, Studienaufenthalt in Rom, Literaturstipendium in Berlin, Frankreich-Aufenthalt und Literaturstipendium der Stadt München.
Er ist Mitglied im PEN-Club sowie Inhaber mehrerer Literatur- und Filmpreise.
Freddy Derwahl
Auf dem Marktplatz
Lebenserinnerungen
© 2019 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Autorenkontakt: [email protected]
Umschlagfoto: © David Hagemann
Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Ulrike Kloos
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-472-7
E-Book-ISBN 978-3-95441-473-4
Herrn Ritter Alfred Bourseaux in herzlicher Verbundenheitund im Dank für viele gute Gespräche gewidmet.
Wir bedanken uns herzlichfür die freundliche Unterstützung dieses Buchprojekts beider ostbelgischen Gemeinschaftsregierung,der Capaul AG, Eupen,der Creutz&Partners Global Asset Management S.A.,der Euroimmo GmbH Bruno Creutzund den Regionaldirektionen der Banken KBCsowie BNP Paribas Fortis.
Ihr kennt alle die wilde Schwermut,die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glücks ergreift.
ERNST JÜNGER
INHALT
NovemberkindDie Gräber der Nachkriegszeit
Zwischen Himmel und HölleIm Schatten von Kaplan Ernst
Das alte Haus am KaperbergLehrjahre am Collège Patronné
Nächte in LöwenStudent an der Katholischen Universität
Demos in AachenDie AVZ, die TH und ein alter Nazi
Frauengeschichten und ein AbtAuf der Flucht in die USA
Ostbelgische ÄngsteAufbruch in die Autonomie
Die Schlacht um EupenEine Grenzstadt im Wahlfieber
Von der Redaktion ins KabinettAttaché in der Rue de la Loi
Eine Saison in ParisDie Verliebten im Nachtcafé
Brüssel, die HauptstadtDie Flagge über dem Königspalast
Ein Soldat ohne WaffenDie Songs von Simon&Garfunkel
Abenteuer AthosDrei Glückliche auf dem Heiligen Berg
Unter FreundenDie Bar im verborgenen Garten
Nur die Toten wissen alles besserIm Grenz-Echo
Am MikrofonHöhen und Tiefen im BRF
Die Kasse von Onkel HermannIm Sturm der Niermann-Affäre
Die Tiefe der EifelDie Entdeckung einer Landschaft
Das RevolverblattSpannende Jahre beim »Report«
Begegnung mit Heinrich BöllEin Wintertag in Bad Münstereifel
Père Charles, Goethe und Serge ReggianiKirschbäume und ein Dämon
Zwischen Anselm Grün und Hans KüngKonflikte der Theologie
Eine Blume im MittelalterSuche nach Caterina von Siena
Oben in StockemWo ich zu Hause bin
Der Generalanwalt in HandschellenInmitten großer Affären
Nachts durch die WälderGedenken an meinen Freund Willy Emonts
Lebenspause, LebensflutNichts anderes als die Schönheit
Die kleine KapelleErfahrungen der Todesnähe
Über das SchreibenRomane, Erzählungen und Gedichte
Glücklich in FrankreichTaizé, La Trappe und Cîteaux
Intime Notizen aus der StilleTagebuch 2017
Letztes Jahr am MarktplatzMeine Abende mit Dimitri
NOVEMBERKIND
Wenn man am finsteren 16. November des Jahres 1946 geboren wurde, geschah dies noch im Kriegsschatten. Man hat nicht gelitten, doch hörte man noch Einschläge. Die vom »Führer« am 10. Mai 1940 »heim ins Reich« geholten Einwohner von Eupen hissten wieder die belgische Fahne. Das nur zwanzig Minuten entfernte Deutschland nannten sie »drüben«, anonym und beängstigend. Alles war möglich, der Puls der Davongekommenen schlug immer noch unruhig, das Bevorstehende war von Zweifeln belastet. Es herrschte eine Herbstzeit nicht verheilter Untergänge und riskanten Neubeginns. Niemand gerät unschuldig in dieses Tal kaum vertrockneter Tränen, niemand kommt heil heraus. Es beginnt ein Leben im Zwiespalt. Wer darin groß wird, ist ein unbeteiligt Beteiligter. Es kursierten späte Todesmeldungen, weiter wurden Gräber ausgehoben, die Suche nach Verwundeten, Vermissten und Kriegsgefangenen hörte nicht auf. In den Bittgottesdiensten brannten vor dem Gefallenen-Denkmal flächendeckend die Kerzen. Der Zeitbruch klaffte offen, die Nachbeben waren unheimlich.
Meine Eltern erzählten oft, dass die Hebamme, Frau Schieren, mich mit dem Ausruf ans Licht gezogen habe: »Jesses, da scheißt er och schon.« Ich habe später darüber nie gelacht, schlimmer noch: Ich vermutete, der Vorgang sei symbolisch, eine erste Gegenwehr aus dem kollektiv Unbewussten. Als Kind rätselte ich über den Vorgang und vermutete dahinter eine ausweglose Bestimmung. Älter werdend redete ich mir ein, sie verknüpfe Sigmund Freuds tiefenpsychologische Deutungen mit Martin Heideggers existenziellem Credo »in die Welt geworfen sein«. Bei diesem frühen Schiss im Entbindungsheim äußerte sich offenbar ein pränatal angestauter Widerstand gegen die Nachhut einer finsteren Vergangenheit. Es ist etwas verrückt, aber ich wollte nicht geworfen werden, erst recht nicht in diese Welt.
Unsere Kleinstadt Eupen bot für ein solches Schicksal einen zwielichtigen Hintergrund. Sie war schon immer Grenzstadt, seit der Schlacht von Worringen 1288 eine Etappe für Durchmarschierer aller Hoheitszeichen. Die vorübergehenden Sieger kamen und gingen. Neben den Folgen flüchtiger Liebesnächte führten sie in der kuschenden Bevölkerung zu lauen Arrangements. Die reihum »Heimgeholten« eilten zum Rathaus und jubelten, doch war die Freude noch größer, wenn die Fahnen gleich welcher Couleur wieder eingeholt wurden und die Diplomaten, ob Wiener Kongress oder Versailler Vertrag, für dieses lästige Städtchen an den alten Grenzsteinen noch einen akrobatischen Kompromiss ausgehandelt hatten. Im klein gedruckten Anhang fiel er meist dürftig aus, war von klammheimlich plündernder Qualität und nahm auf politische Sympathien der Einwohner keine Rücksichten. Das Vaterland war ein Stiefvaterland, die Muttersprache eine Tuschelsprache, die sich hinter einem sarkastischen Dialekt versteckte, so eine Mischung aus Trotz und Illusionslosigkeit. Gegen einen großen Backofen kannst du nicht gähnen, hieß es an den Tresen. »D’r Döövel es ägene Bosch«, der Teufel ist im Wald, so wurde vor drohender Gefahr gewarnt. Meine Vorfreude auf die Kirmes dämpfte mein Großvater mit den Worten: »Wat es da noch Keermess, veer hant jidder Dag Keermess.« Jeden Tag Kirmes, es herrschte der Ton gemütlicher Resignation. Nationalstolz war undenkbar, die Einwohner hielten sich für geübte Untertanen. Angebliche Patrioten waren die Kriegsgewinnler, Kaffee-, Tabak- und Pferdeschmuggler, sie hielten die Treue der Halunken.
Eupen in den späten 40er-Jahren war eine dunkle Stadt, als hockten ihre Bewohner noch immer in den Kellerlöchern. Von Kriegsschäden war man so gut wie verschont geblieben, doch lastete die unbewältigte Vergangenheit unter begeistert geschwenkten NS-Fahnen, als betrete man hier ein Ruinenfeld. Kleine Kinder haben einen untrüglichen Blick auf das erste Umfeld ihres Lebens. Er ist noch nicht selektiv, wittert jedoch bereits einen fatalen Hintergrund: kaum verschwindende Finsternis, bleibende Furcht. Das Geraune der Alten lehrte uns das Gruseln, die mir unbekannten Begriffe konnten nur Böses verheißen: KZ, Hakenkreuz, Gefallene, Front, Bunker, Nazi-Schweine, Besatzer-Hure, Verräter, Weiße Armee, Schutzhaft. Zwei Orte blieben brisant: das Franziskanerkloster Garnstock als Internierungslager für Mitläufer und das Gefängnis Heusy als Haftanstalt vermeintlicher Kollaborateure. Allmählich kam der Name »der König« hinzu. Ich stellte ihn mir wie im Märchenbuch vor: eine rettende Lichtgestalt.
Auf dem Friedhof, wo wir um Allerheiligen und Allerseelen vor den Gräbern unserer gefallenen Angehörigen drei Ave-Maria beteten, wurden am Ehrenmal die Helden umgebettet. Es gab Goldschrift und Kränze für belgische Kriegsopfer und Widerständler. In der äußersten Ecke am Kleinbahndepot wurden neben dem Abfallhaufen die Überreste der Nazis verscharrt. Dieses weitläufige Gräberfeld am Kirchhofs Weg wirkte zugleich faszinierend und erschütternd. Die ersten Bewegungen, die ich in der Stadt registrierte, waren Leichenzüge: von der Pfarrkirche bis zum Friedhofsportal appellierende Rosenkranzgebete. Hinter dem Vortragskreuz der Kaplan mit gregorianischen Schritten, schluchzende Frauen mit schwarzen Schleiern und wehrlose Kinder. Der Leichendiener mit Zylinder und langem Schal. Der Totenwagen wurde von zwei Rappen mit schweren Schabracken gezogen. Besonders tückisch waren die Schlitze, aus denen die dunklen Augen der Pferde funkelten, ein unberechenbares Blinzeln aus der Tierwelt. Der Sarg wurde auf ein Rollbrett gehievt. Jetzt sah man das blanke Holz zwischen den Tannenkränzen schimmern, deren Harzgeruch in die Nase stieg. Er stammte aus unseren Fichtenwäldern und barg eine Spur Trost. Auf einem Eingangspfosten waren die Worte »mox noster« gemeißelt, das so viel heißen sollte wie, »Gib acht, du könntest der nächste sein.« Jahre hindurch habe ich es beherzigt, dann klang es plötzlich wie eine bösartige Warnung. So spricht nicht der Herr über Leben und Tod.
Im markanten Mittelpunkt der Begräbnisse standen der Kutscher und der Friedhofswärter. Der alte Franz Bosten saß hoch auf dem schwarzen Wagen wie eine Sphinx. Unter dem Zylinder nicht die Spur einer Regung. Mit weißen Lederhandschuhen hielt er die Zügel, doch kannten die Pferde den Weg auswendig. An sich war er ein geselliger Mann, der sich im Alter noch sein Dienstmädchen angelacht hatte. Unbekümmert ließ er uns auf dem Heuboden des Pferdestalls spielen. Mein Lieblingsversteck war das Rollbrett auf dem Leichenwagen, dessen schwarze Vorhänge mit Silberfransen keinen Durchblick zuließen. Es roch nach Pferdeäpfeln und Stroh.
Der Friedhofswärter Herbert Koonen liebte die feierliche Pietät und begrüßte den zum Friedhof einbiegenden Leichenzug mit einem militärischen Gruß, als rücke eine Armee an. Im Reich der Toten war er der Ordonnanz-Offizier. Das liturgische Zeremoniell am offenen Grab geschah in routinierter Sachlichkeit, er reichte dem Kaplan das Weihwasser, das Weihrauchfass und das Kreuz, bevor er die Angehörigen an die Grube führte. Wie Bosten war er ein stämmiger Mann, beide hatten etwas Beruhigendes und die delikaten Dinge fest im Griff. Näherten sich die Leichenzüge, unterbrachen wir nebenan auf den Wiesen unser Fußballspiel, schlichen durch die Tujahecke und blickten auf die schluchzenden Frauen. Dramatischer Abschied, die heftigen Bilder sind geblieben. Zuletzt wurde für denjenigen in diesem Kreis gebetet, der dem Verstorbenen am nächsten folgen werde. Dann zuckt man zusammen und sieht sich um. Die Totengräber spuckten in die Hände, griffen nach den Schaufeln und ließen die braunen Lehmklumpen auf den Sarg poltern. Dieses Geräusch war wie ein letztes Gewittergrollen gegen den Tod.
An Trauer- und Gedenktagen erreichte der Trauerkult in dieser politischen Jahreszeit eine beängstigende Qualität. Bei Anbruch der Nacht flackerten auf den Gräbern Hunderte Kerzen, jedem sein »ewiges Licht«. Der Wind blies durch die kahlen Bäume und die hohen Zypressen neigten sich wie zum Abschiedsgruß. Ich rückte näher an Mutters Seite und fürchtete, sie werde wieder zu weinen beginnen. Der November war gekommen, der Monat meiner Sehnsucht, aus diesem riskanten Leben zu fliehen. Möglichst weit weg in ein fernes Land, wo es keine Gräber gab.
Geblieben sind all die Jahre hindurch, in denen sich das tägliche Leben mit den Ritualen des Kirchenjahres mischte, die Glocken der St. Nikolaus-Pfarrkirche. Schwere Schläge, die in der Frühe aus unsicheren Träumen weckten, und abends einen elegischen Klang erhielten. Die Glocke der protestantischen Friedenskirche begann nach einer kleinen ökumenischen Verspätung, holte sie jedoch, als sei es ein Konkurrenzlauf gegen die Uhr, bald wieder ein. Die helle Angelus-Glocke der Franziskanerinnen eilte im Rhythmus der Stundengebete. Die Glocke der Marien-Kirche, in deren Gruft die Gebeine der Kapuziner ruhten, hatte die Besonderheit, dass sie bei vorüberziehenden Begräbnissen geläutet wurde. Der Ton prägte sich ein wie eine Melodie vom Tod. Wenn um zwölf all diese Glocken die Mitte des Tages ankündigten, klang es wie ein concerto grosso drängender Appelle in alle Windrichtungen.
Die beiden grünen Türme von St. Nikolaus ragen fast grazil in den Himmel. Ihre Zwiebelform ist im Land zwischen Maas und Rhein eine Ausnahme, rund und spitz, fast etwas Bayerisches. Ich traute ihnen zu, gerecht über Gute und Böse zu wachen. Nach langen Reisen hatten sie auch für Nichtgläubige die bewährte Qualität von Heimat. Als im Sommer 1949 der Nordturm in Flammen aufging, konnte ich vom Balkon meiner Großmutter verfolgen, wie er sich langsam neigte und Funken sprühend zu Boden stürzte. Ich hielt mich an ihrer Schürze fest, während sie laut zur Muttergottes rief: »Maria hilf, Maria hilf.« Viele glaubten, der Großbrand sei zeichenhaft: Götterdämmerung und Sündenstrafe, nach dem Kriegsende für Freund und Feind ein letztes Fanal.
Die Worte »Venite ad me omnes« unter dem Christus mit ausgestreckten Armen wurden uns erst viel später bewusst. »Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen«, las ich später im Matthäus-Evangelium. Es war zugleich eine tröstende Geste, der man kaum zu glauben wagte und doch eine bleibende Aufgabe, mühselig und beladen waren wir alle. In der Taufkapelle ruhte unter der Marien-Ikone der im Felsengrab aufgebahrte Jesus. Der totale Tod, aus dem sich der verklärte Christus im Blitzschlag der Auferstehung aus der Höllenfahrt befreien sollte. Hier stieß ich auf die großen Fragen des Christentums, die bohrenden Zweifel und ein mysteriöses Urvertrauen. Beide sind geblieben, dem Geheimnis alles zuzutrauen.
Das Kircheninnere glühte in barockem Gold. Der Aachener Baumeister Johann Joseph Couven hatte sich hier ausgetobt. Uns Kindern nahm es den Atem, die Phantasie reichte nicht für all die Marien, Erzengel und Heiligen, die über dem Tabernakel auf- und abstiegen. Der Schutzpatron Nikolaus von Mira war ein bärtiger Kinderfreund, doch hing über Himmel und Herrlichkeit, inmitten der Sterne einer rätselhaften Nacht, erneut ein Todeszeichen, ein massives Kreuz mit Goldornamenten. Seit der Erstkommunion sind mir die österlichen Lieder in Erinnerung geblieben, die zum Durchbohrten so stürmisch hinauftönten, als solle er endlich hinabsteigen: »Das Grab ist leer« und »Erschalle laut Triumphgesang«. Mein Vater, der ansonsten nur am letzten Sonntag der österlichen Zeit die Sakramente empfing, sang auf vibrierende Weise mit, kannte sogar die zweite Strophe auswendig: »… und quält uns nicht des Todes Macht, vor der die Väter einst erbebten …«. Dieses Gotteshaus hatte eine besondere Akustik für das Flehen der Sünder. In der Anonymität der voll besetzten Kirche war es eine starke Hilfe gegen alle Schuld. Papa sagte mir nach dem Frühstück am Festtagstisch, der Kommunionstag sei der schönste in meinem Leben. Es klang wie ein Versprechen, doch hat er es nicht gehalten.
In den ersten Volksschuljahren hat mich allein die Schönschrift interessiert. Fein gezirkelte Buchstaben mit einem Griffel auf die Schiefertafel zu kratzen, sie dann und wann mit einem Schwämmchen auswischen und auf der feuchten Fläche neu beginnen, weicher und etwas blasser als zuvor, aber diszipliniert zwischen den Linien bleibend: Ich war darin vertieft. Neben mir auf der Holzbank saß Edgar Luchte, der Sohn des Friseurs aus der Gospertstraße, der es noch besser schaffte, gleichmäßiger und geschwungener, so, wie ihm sein Vater jeden Morgen die Stirnlocke einfettete. Ich bewunderte diesen Stil und war bemüht, es ihm gleich zu tun. So entstanden in dem Klassenzimmer, das nach Kreide und abgestandenem Wasser roch, kleine Meisterwerke, Miniaturen wie aus mittelalterlichen Skriptorien: »Die Mutter, der Mutter, der Mutter, die Mutter.«
Es waren kalligraphische Schreibversuche, meine erste Hommage an die Sprache. Tief über dem Täfelchen gebeugt entstanden Wechselwirkungen zwischen der gelingenden Form der Buchstaben und dem Inhalt der Worte. Die mütterliche Deklination geschah in besonderer Zärtlichkeit, weniger berührende Namen gerieten in leichte Schräglage; Respekt einflößende Bezeichnungen, wie Vater, Schule oder Herr Direktor, hatten manchmal brechende Konturen, als habe das Unterbewusstsein Gefahr gewittert und die Hand leicht gezittert. Als schwieriger erwiesen sich die Diktate, die künstlerische Versenkung wurde durch das aufmerksame Zuhören gestört, manche Worte gingen in der Eile unter, andere stürzten in orthografische Abgründe. Die Noten zwischen der Schönschrift und der Rechtschreibung erreichten ein bedenkliches Gefälle. Als wir im zweiten Schuljahr die Griffel gegen Federhalter eintauschten, häuften sich in den Klassenheften die roten Striche des Lehrers Stockaerts, einem kaum Deutsch sprechenden Wallonen mit schwarzem Schnurrbart. In der Aufregung produzierte Kleckse umrandete er besonders kräftig, als sei es ein Fall tödlicher Sünde. So wurde Rot schon in den frühen Jahren ein Warnzeichen, das ich durchs Leben zu schleppen begann: das sich erschreckend aufbäumende Rote Meer, die roten Blutspritzer der Kreuzritter, das flammende Rot sozialistischer Rosenfäuste, der Stechschritt der roten Armee auf dem Roten Platz, das Rot klaffender Wunden, das Rot verweigerter Liebe und ihrer dunklen Auswege.
Damit verbunden waren ständige Ordnungs-Appelle, sie schallten mir aus allen Unterrichtsfächern alarmierend entgegen, am schlimmsten in den Rechenstunden, denen ich mit Schuldgefühlen entgegensah. Es waren Erfahrungen immer tiefer sinkenden Scheiterns. Nach dem Einmaleins am Rechenschieber begann die Mühsal des Multiplizierens, die furchtbaren Zahlen hinter dem Komma, und später die Katastrophen algebraischer Symbolik und geometrischer Bilderrätsel. Noch im Alter verfolgen mich diese Phantome; wenn ich dann aus mathematischen Albträumen aufwache, jubele ich trotzig, noch immer nicht zu wissen was ein Integral ist.
So geriet die Schule von Jahr zu Jahr zu einer Falle. Sie hatte mir meine Kindheit geraubt. Kämpfte ich noch am ersten Schultag mit den Tränen, überfluteten sie mit zunehmender Zeit den verborgenen Teil der Seele. Ich wollte da raus, beobachtete in quälenden Klassenstunden Hausfrauen, die in der Hisselsgasse ihre Treppen schrubbten oder Arbeiter, die auf der Straße nach Nispert die Wasserleitung reparierten. Wie gerne hätte ich ihnen das Werkzeug aus der Hand genommen und mit ihnen getauscht. Tröstende Kompensationen waren dürftig: die Turnübungen in Sporthose und Unterhemd verschafften etwas Luft, für den Knabenchor reichte meine Stimme nicht, allein der Katechismus ließ mich träumen. Das Problem der Dreifaltigkeit, dargestellt am Beispiel der gemeinsamen Flamme dreier Streichhölzer, fand ich spannend. Die von schwarzen Flecken beschmutzte Seele des Todsünders war furchterregend, doch einleuchtend. Nur die Jungfrau Maria als Trösterin der Betrübten schien mich zu verstehen. Sie war die einzige Frau, die man uns zutraute. Auch das blieb, mit Höhen und Tiefen, lebenslang: Trost durch Frauen, unheilige inklusive.
ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE
Ein besonderer Beschützer in diesem Ringen zwischen knallharter Ordnung und verträumter Freiheit war unserer Religionslehrer Kaplan Robert Ernst. Kurzes, gewelltes graues Haar, die Gesichtszüge von klösterlicher Blässe, in einer schwarzen Soutane mit den 33 Jesus-Knöpfen, die seine hagere Gestalt noch schlanker machten. Der Kaplan war milde wie ein Lamm, lächelte verständnisvoll und verteilte Heiligenbildchen. Entscheidend war jedoch seine Stimme. Ob er jetzt vom Lamm Gottes, vom Himmelsreich oder vom ewigen Höllenfeuer sprach, es geschah stets in einer flüsternden Tonart, fast schon am Rande der Hypnose. Er kannte Beispiele aus dem Leben Jesu, die Wundersames offenbarten. Immer hat er ihn »der Herr« genannt, es war eine feste Größe. Im Gegensatz zu Grimms Märchen barg sein Unterricht eine Authentizität jenseits der Phantasie. Mit ihm nahten wir dem Fegefeuer und blickten in den Höllenschlund Satans. Die dramaturgischen Pausen, die er zu neuen Verkündigungen nutzte, steigerten die Spannung, die Stille wurde größer. Es gab keinen Zweifel: Noch ein Gebetsruf, noch ein Wunder und die Lichtgestalt des verklärten Herrn würde neben dem Wassereimer erscheinen.
Die Worte des Kaplans, der die Konzilsreformen strikt ablehnte, und vom Bischof auf ein Seitengleis abgeschoben wurde, haben mich die Jahrzehnte hindurch begleitet. Unter der Nummer 917L2 wurde mein Name in den Listen der Pfarrbibliothek eingetragen, die ihm ein Herzensanliegen war. Da stand er selbst an Wintertagen neben einem Bullerofen und strahlte, wenn man Werke seiner Neigung auswählte. Waren es zunächst die »Spur-Bücher« oder die Tintin-Bände von Hergé, kamen bald etwas mysteriösere Erzählungen, wie »Der letzte Mönch von Andechs« oder »Das Leben des heiligen Pfarrers von Ars« in Frage. Der Kaplan ließ diese Titel auf seiner Zunge zergehen, wiederholte sie mehrmals und mahnte, die darin berichteten Dämonen-Kämpfe nicht als spannende Zugaben zu unterschätzen. Ich fühlte mich zugleich verstanden und bestellte bald spirituelle und theologische Bände, nur weil mich die Titel beeindruckten, ohne vom Inhalt ein Wort zu verstehen. Der Bibliothekar kletterte auf das kleine Treppchen und reichte dem Halbwüchsigen Werke über die Seherin Therese von Konnersreuth oder die blutigen Wunden von Pater Pio.
Seine Sonntagsmessen in der benachbarten Klosterkirche waren »Singmessen«. Es entsprach seinem Verständnis von Liturgie, sie furios ausbrechen zu lassen. Erst mit weihevollen Gesten am Hochaltar, dann von der Kanzel orakelnd wie Savonarola, immer wieder angetrieben von strophenlangen Kirchliedern. In der bis zum letzten Platz besetzten Kapuziner-Kirche geschah es wie bei ansteigender Flut. Kaplan Ernst im alten, goldbesticktem Ornat, händeringend auf der Schiffsbrücke und sich erst bei der hl. Kommunion dem Volk zuwendend, die er den vor ihm Knienden zärtlich auf die Zunge legte. Nach einem Marienlied öffneten sich die schweren Kirchenportale und die Gläubigen strömten auf den Vorplatz, als seien sie einem Meeresbeben entkommen.
Auch als ich später begann, statt Heiligenleben Goethes »Die Leiden des jungen Werther« zu lesen, haben wir in seinem Studierzimmer intensive Gespräche über Erscheinungen und zweite Gesichter geführt. Weltende, Jenseits und Wiedergeburt waren seine bevorzugten Themen. Meine Erzählungen von Reisen zum Heiligen Berg Athos gingen ihm in ihren Berichten über wundersame Begegnungen mit Einsiedlern nicht weit genug. Erscheinungen wie in Lourdes oder Fatima hielt er für selbstverständlich, bevorzugte jedoch kaum bekannte noch mysteriösere Orte und stand mit Sehern aus aller Welt in Briefkontakt. Sonderbare Gäste suchten ihn auf. Beim Betreten »verdächtiger« Landschaften oder Gebäude, wie der Burg Reinhardstein im Wald von Ovifat, betete er den »Großen Exorzismus«. Die tödlich geendete Teufelsaustreibung von Anneliese Michel in Klingenberg verfolgte er in der Tagespresse wie ein Mitwisser. Mit mir machte er einen Pendel-Versuch über meine angeblich vorherigen Leben, dessen Ergebnisse ich für durchschaubar hielt. Mit dem Pendel erteilte er auch lebenden oder verstorbenen Nonnen und Mönchen mystische Noten. Über einen Abt des russischen Klosters Panteleimonos sagte er: »Das muss ein Teufel sein.« Über Sexualität haben wir nicht gesprochen. Nur am Ende der Beichte flüsterte er hinter dem Holzgitterchen: »Schließen wir alles ein.«
In der kleinen Pfarrbibliothek brannte eine einzige Funzel, das schaffte eine sonderbare Impression kontemplativer Stille. Die Bücher meist älteren Jahrgangs strömten einen speziellen Duft aus, es roch nach vergilbtem Papier. Ich empfand eine verführerische Bücherlust. Die Bände in Händen zu halten, darin zu blättern und zu schmökern, fesselte, man vergaß die Zeit. Es faszinierten allein schon die Titelseiten, sie ließen unbekannte Wesen erahnen. Die Namen der Lieblingsautoren des Kaplans begannen sich zu wiederholen. Vielleicht fand sich in den unteren Schichten der Bücherhaufen die Erklärung des großen Weltmysteriums.
In diesem dunklen Raum lag der Ursprung meiner Sucht nach bedrucktem Papier, nach Schriftzügen, Autorennamen und bibliographischen Daten. Bedruckte Blätter durch meine Finger gleiten zu lassen, wurde zu einer Obsession. Bald begann ich Buchläden zu besuchen, nur um diese erregende Glätte jungfräulicher Seiten zu berühren. Die Geruchsvariationen wechselten mit der Jahreszahl, ich streichelte die Bücherrücken und griff gespannt nach Neuerscheinungen. Dichter und Schriftsteller avancierten zu wahren Titelhelden. Hatten mich zu Hause Grimms Märchen, »Tom Sawyer« von Mark Twain und Erich Kästners »Emil und die Detektive« begeistert, suchte ich als 14-Jähriger schon nach anspruchsvollerer Literatur, oft reichte ein pointierter Name, es musste etwas Orakelndes sein. Während eines Urlaubs am Vierwaldstätter See schenkte mir meine Mutter in einer Bücherei von Schwyz zwei Bücher, und ich wählte ahnungslos, aber voller Lesefreude, eine Monografie von Paul Claudel und dessen Gedichtband »Strahlende Gesichter« aus. »Der weiß, was er will«, lobte der Buchhändler, doch wusste ich gar nichts, ich hatte nur eine dunkle Ahnung. Die beiden Bände verstand ich erst einige Jahre später, dann aber gebannt. Die plötzliche Bekehrung des jungen Claudel während einer gregorianischen Weihnachts-Vesper erschüttert mich immer noch. Bin ich in Paris, stelle ich mich in Notre-Dame an seinen Platz, neben einer Säule im Seitenschiff. Hier fing der Dichter des »Seidenen Schuh« Feuer.
Meinem Vater, einem überzeugten Sozialdemokraten, dem jeden Monat ein Prolet vom »Verband« die Mitglieds-Märkchen in das Heftchen der sozialistischen Gewerkschaft klebte, imponierte zwar mein Bildungshunger, doch gefiel ihm die starke Neigung für religiöse Literatur überhaupt nicht. Zunächst schaute er mir abends kritisch über die Schulter, dann bemühte er sich, mich für seine Weltkriegs-Geschichten zu begeistern, schließlich griff er zu einer Zwangsmaßnahme, die mich tief verletzt hat: Zensur, Buchverbot! Als ich mir dennoch im Lädchen des alten Heinen in der Paveestraße das Taschenbuch »Le Désespéré, der Verzweifelte« von Léon Bloy kaufte, gab es Ohrfeigen. Die lateinische Widmung »ad fratres in eremo« für seine Taufpaten Pieter Van der Meer de Walcheren und Jacques Maritain verriet mich. Der Zwischenfall hatte schwere Folgen: Léon Bloy wurde zu einer Schlüsselfigur, ich verschlang alles, was mir über ihn die Hände fiel. Selbst in einer amerikanischen Bibliothek fand ich seine Biografie. Als ich in den Tagebüchern von Ernst Jünger wiederholt Bloy-Zitate entdeckte, war es wie eine späte Würdigung all meiner Leiden für diesen Autor, der selbst ein großer Leidender war. Arm wie eine Kirchenmaus, mit einer Geisteskranken und, nach ihrem Tod, mit einer Prostituierten verheiratet, vom muffigen Katholizismus des späten 19. Jahrhunderts angewidert, und doch zugleich ein radikaler Zeitkritiker und Meister mystischer Sequenzen. Seine Worte: »Je mehr eine Frau heilig ist, umso mehr ist sie Frau«, begleiten mein Leben als wäre es eine Lösung für die Ewigkeit. Maria als die Verborgene in der Schöpfungsgeschichte und die Strahlende am Weltenende.
Die Lesebegeisterung meiner Jugendzeit reichte von Ludwig Thomas Dorfgeschichten und Felix Timmermans »Franzikus« bis zur dunklen Lyrik von Georg Trakl. Die homo-erotischen Reisebücher von André Gide verschlang ich in konspirativer Neugier. Gedichte von Francis Jammes habe ich übersetzt. Baudelaire- und Apollinaire-Gedichte kenne ich heute noch auswendig. Deutsche Autoren habe ich erst später entdeckt. Heinrich Böll sandte mir seine Erzählung »Abschied von der Truppe« mit einer persönlichen Widmung. Günter Grass war mir zu sarkastisch, und doch konnte ich von der »Blechtrommel« nicht lassen. Thomas Mann klang zu selbstverliebt, seine im Tagebuch erwähnten wollenen Unterhosen fand ich lächerlich. Bert Brechts »Galilei« packte, rüttelte und schüttelte, Stefan Andres’ »Wir sind Utopia« spielte hinter Klostermauern. Ernst Wicherts KZ-Erzählung »Totenwald« hat für Jahrzehnte mein Deutschlandbild geprägt, vielleicht sogar für immer. Rilkes »Stundenbuch« hütete ich wie einen Schatz, die Verse »Und die das Dorf verlassen wandern lang, und viele sterben vielleicht unterwegs«, stellte ich 1964 meinem ersten Gedichtbändchen voran. Das war mit 17 meine programmatische Stimmungslage: das Dorf verlassen, unauffindbar untertauchen, vorzugsweise in der Moorlandschaft des Hohen Venns, vielleicht sterben, doch aus Leidenschaften, die man mir verbot: die abenteuerliche Nähe Gottes und das Geheimnis der Lüste.
Das alles spielte sich in entscheidenden Jahren ab, dramatisch und im Untergrund eingebrannt. Der Gekreuzigte und Durchbohrte, dem ich mich nur im Versteck heranwagen durfte, und eine Sehnsuchtsfrau, an deren Nähe mich ein von den Eltern ignoriertes Handicap eines im Leistenkanal verwachsenen Hodens behinderte. Im Laufe der Jahrzehnte zogen sich diese Makel in die tieferen Schichten der Seele zurück, ohne je zu verschwinden. Ich war in allem, was ein Mensch sucht, getroffen und gezeichnet. Das machte mein Leben so riskant. Ich musste es ohne Sicherheit wagen und traute mich nicht, davon zu sprechen. Es war ein Rückzug in eine Höhlenwelt. Zum vorzeitigen Sterben fehlte mir der Mut. So war sehr früh eine schmerzhafte Einsamkeit, wie ein Augapfel gehütet, mehr noch: ein Trauerschleier über beide Augen, deren Licht sich erst im Schreiben zu lösen begann. Seitenlange Selbstgespräche, elegische Tagebuchnotizen, melancholische Gedichte von Abschied und Tod, immer wieder diese bohrende Lust auf Sprache, die sich berühren ließ und zögernd preisgab, immer wieder diese Suche nach Ausbruch vom enge Zuhause und Evasionen in eine andere Zeit. Ich lebte im Schutz einer Nebenwelt, wo der Heilige Berg Athos sich im Schatten der Nachtlokale von Montparnasse erhob. Die toten Dichter als treue Freunde und die Jungfrau Maria als einzige Zuflucht.
Im Kolleg, unserem katholischen Gymnasium, musste ich die »Judenbuche« von Annette von Droste-Hülshoff lesen und habe es nicht bereut. In den Tümpeln und Gräben ihres Gedichtes »Der Knabe im Moor« spiegelte sich mein Gesicht; oben hinter den Wäldern, im unwegsamen Hohen Venn, kannte ich einen Ort des Verschwindens: Reinartzhof, die Kapelle eines Klausners, einige abgelegene Höfe. Ganz anders wirkte Luise Rinser, sie schrieb verlockend sinnlich-religiöse Liebesgeschichten. Dann traute ich mir einen schwierigen Wälzer von Simone de Beauvoir zu, was kläglich scheiterte; nach einer Szene mit oralem Sex wechselte sie brüsk in marxistische Belehrungen. Doch war sie eine schöne Frau, mit ihrem Kopftuch etwas herrisch. Nach dem Tod von Jean-Paul Sartre hat sie sich noch eine Nacht zu ihm ins Bett gelegt; das fand ich stark. Deutschsprachige Frauenlyrik hatte einen Ton, der mich anzog, vor allem Ingeborg Bachmanns »Gestundete Zeit« oder ihr Bild einer verlassenen Geliebten in der von Max Frisch verfassten Erzählung »Montauk«. Ihren Feuertod in Rom nannte er »die schlimmste aller Todesarten«. Wie ein persönliches Bekenntnis habe ich aus diesem starken Buch notiert: »Bleibt das irre Bedürfnis nach Gegenwart durch eine Frau.« Nicht habgierig »nach einer Frau«, sondern »durch«, also in der ganzen Tiefe, vielleicht sogar ein Leben »hindurch«.
Was immer ich las, es musste an das geheimnisvoll Uferlose heranreichen, Welten öffnen, die tief in mir verborgen waren und nach Befreiung schrien. Ich suchte Bestätigungen für Sehnsüchte, fern jeder Ordnung. Nichts hat mich mehr empört als die Versuche, dieses Erlebnis von Freiheit zu stören, einzufangen und zu verbieten. Dass Ordnung »das halbe Leben« sei, war eine schreckliche deutsche Aussicht. Zur schulischen Zahlenwelt war mir jeder Zugang versperrt, Sprache hatte die Qualität von Rettung, Lebensrettung. Als wir begannen, die französischen Symbolisten und Hermann Hesse zu lesen, konnte ich mein Glück kaum fassen: All das mühselige Lernen, das man uns aufzwang, war ja nicht das wahre Leben. Die echten Helden scheiterten, Genies starben an der Lebenssucht, der Einsame blieb souverän allein. »Berauscht euch ohne Zögern«, schrieb Charles Baudelaire, »an Wein, an Poesie und an Tugend.« Die Dichtung »Das trunkene Schiff« und die Umarmungen von Arthur Rimbaud und Paul Verlaine faszinierten. Hermann Hesses Maler Klingsohr legte sich in seinem letzten Sommer zu seiner Geliebten auf den Waldboden, sein »Steppenwolf« eilte durch die Verführungen der Nacht. Es war eine Welt, von der ich immer geträumt hatte.
Heilige gehörten mit in diese tobende Abneigung alles Kleinlichen und Verordneten. Sie waren ja auch Berauschte und Verliebte. Paulus schrieb über heftige Sünde und mächtige Gnade. Die Wüstenväter kämpften bis zum letzten Atemzug mit den »Dämonen«. Tintoretto malte Maria Magdalena als rothaarige Hure. Der junge Augustinus ließ keinen Sündenfall aus. Das Porträt von Teresa von Avila zeigt eine leidenschaftliche Frau. Franziskus wollte nackt auf der Erde sterben. Der junge Offizier Charles de Foucauld genoss das Lotterbett. Thomas Morus betrat lächelnd das Schafott. Edith Stein hielt vor der Gaskammer in Auschwitz ein Kind an ihrer Hand. Es war keine schmachtende Heiligkeit, sondern immer wieder dieser irre Durchbruch ins andere Extrem, Gratwanderer hinauf zum Kreuz, zum Licht, Anarchisten im Labyrinth der Normalität, Verirrte in ungeahnter Barmherzigkeit, Sünder in den Armen des bis zuletzt wartenden Vaters. Dann weinten sie Tränen vor Glück, von denen mir Jahre später in Simonos Petras der Athosmönch Arsenios sagte, dass »sie das Steinherz auflösen«. Er sprach von der »Gabe der Tränen«. Noch bevor ich wusste, was Verlorenheit war, wollte ich ein verlorener Sohn sein.
Die Reise-Erzählung von Erhart Kästner »Die Stundentrommel vom Heiligen Berg Athos« war eine Offenbarung. Kein anderes Buch hat mich in diesen Jahren des Aufbruchs mehr gefesselt. Ich entdeckte den eigentlichen Raum für das Heilige: die Schönheit. In ihr lebten Männer am Rande der Heiligkeit, junge glühend und eifernd, uralte Weise voller Güte und Weltüberwindung. Das alles in einer grandiosen Natur, die vom Ägäis-Strand bis in die verschneite Gipfelregion der Halbinsel Chalkidiki reichte. Überall erster Schöpfungstag, meerumschlungen. Hier war die andere Welt, die ich suchte, allem Treiben und Getriebe entgegen. Stille, von deren Sprache wir keine Ahnung haben.
Meine Neigung zum Außenseitertum kam früh. Bereits als Kind war ein Bedürfnis nach einer Autonomie entstanden, wie sie nur die Künstler kennen. Ein Gespür, das »normale« Leben zu durchschauen, eine Lust, stromaufwärts zu schwimmen, nahe heran an die Quellen, in ihre Geheimnisse abtauchen. Der Wunsch, in das Trappistenkloster von Mariawald einzutreten, der mich seit dem 12. Lebensjahr heftig verfolgte, war eine extreme Variante dieser Sehnsüchte. Bald begannen ganz andere: Alkohol, umherirrender Sex oder Formen von Tag- und Nachtträumen, die von Spießern »Faulheit« genannt werden. Sie führten in anspruchsvolle »philosophische« Schichten und sollten Raum schaffen für die Präzision der Beobachtung, die hinter die Dinge drängt. Da gingen Abendrotwolken, Fernweh, Rausch, Mariengebete und erotische Umarmungen ineinander über. Das Verliebtsein schloss Freunde und Freundinnen ein, es war eine Frage des Widerstands gegen Zuchtmoral. Ich war mir sicher, sie alle würden weit führen. Deshalb ging ich das Risiko ein, bei Schulabschlüssen zu scheitern. Das Schreiben ließ ich mir nicht mehr nehmen, es würde mich retten.
DAS ALTE HAUS AM KAPERBERG
Wir mussten im Kolleg unsere Lehrer »Herr Professor« nennen, das hielt uns auf Distanz. Manche habe ich gefürchtet, einige verehrt, die meisten langweilten einfach, sie hatten ihren Beruf verfehlt. Die Schule war katholisch, immer schlich da auch eine wohlwollende Neigung für Priesterkandidaten durch den Unterricht. Die beiden Direktoren Joseph Thierron und Joseph Müllender mochte ich deshalb, weil sie nicht einschüchterten. Thierron war ein mitreißender Redner, neben dem heiligen Paulus las er Boris Pasternak und schwärmte für Picasso. Er wollte uns ins Leben helfen, doch hat er die Konzilswehen nicht überlebt und versank im Whisky. Wenn ich, nach dem Schulabschluss, spät nachts von unseren Gelagen heimkehrte, brannte in seinem Erker am Rotenberg noch Licht. Ich habe nicht zu schellen gewagt und zu sagen: »Komm, guter alter Mann.« Ich betrachte es als ein Versagen. Zu seiner Beerdigung bin ich nach Raeren gefahren.
Müllender hatte dagegen anarchische Züge, scheute keinen Konflikt mit dem bischöflichen Palais, besuchte schmunzelnd Bergmans Skandal-Film »Das Schweigen« und erschien nach dem Zeitalter der langen schwarzen Soutanen-Röcke als erster im Maßanzug. Im Religionsunterricht empfahl er, »das Staunen zu lernen« und betonte im vorgeschriebenen Vortrag über Priesterberufe, wir sollten bedenken, dass sich jeder von ihnen dafür in einem »Moment großer Hingabe« entschieden habe. Noch bevor in der Kirche die Zölibats-Krise begann, verliebte er sich in eine 17-jährige Schülerin und wurde von tobenden Kollegen in die Armut gejagt. Er hat gelitten wie ein Hund, doch war es für uns alle die Lektion einer anderen Freiheit, die in keinem unserer Lehrbücher stand. Er lebte bis zuletzt noch immer mit der viel jüngeren Frau in Lüttich. Es war seine Art der Treue und bleibt mein stärkstes Schul-Erlebnis. Vor einigen Jahren habe ich ihn an einem bitterkalten Dezembertag am Quai des Tanneurs besucht. Unter dem »Pont des Arches«, wo die Bars und Bordellchen des Viertels von Georges Simenon beginnen, floss schwarz die Maas. Als wir uns umarmten, haben wir geweint.
Kein anderer Lehrer wagte sich im alten Haus am Kaperberg so weit wie der geschasste Direktor. Doch bereits in den frühen Jahren war unser verehrter Klassenleiter Jean Poussin, ein Typ schön wie Jean Marais, wegen homosexueller Verbindungen entlassen worden. Ohne zu begreifen, was vorgefallen war, habe ich es sehr bedauert. Sein Nachfolger Charles Richter hatte das Charisma eines kommunistischen Marienverehrers. Händeringend erzählte er, wie ihn die Nazis im Eifeldorf Steffeshausen durch die eisige Our getrieben hatten. Noch 40-jährig erschien er bei Prozessionen in kurzer Pfadfinder-Hose. Der Lehrer Willy Boemer lebte als Junggeselle im dunklen Priestertrakt und schrieb meiner Schwester herzergreifende Liebesbriefe, die mein Vater, mit Rücksicht auf meine mittelmäßigen Noten, in verständnisvoller Milde tolerierte. Der Abbé Charles Wimbomont hortete in seinem Zimmer Kisten voller Silberpapier für die Missionare in Belgisch-Kongo; er war schwerhörig und versessen auf Beichtgeheimnisse über das sechste Gebot. Der Militärseelsorger Piet Boelen hatte cholerische Anfälle, er schlug eines Tages so heftig auf mich ein, dass ein Arzt konsultiert wurde und er bald vom Bischof in seine Luftwaffen-Einheit strafversetzt wurde.
Dem zwergenhaften Henri Dethier, der Geschichte und deutsche Literatur lehrte, habe ich immer begeistert zugehört; er hatte in Tübingen Philosophie studiert und kannte von dem Gedicht »Droben stehet die Kapelle« spannende Hintergründe über Erlköniginnen und Nachtgestalten. Walter Krott erteilte strengen Englischunterricht, wir nannten ihn »der kalte Wott«. Georges Schmits war der Nachfolger des Schriftstellers Arthur Nisin, der für sein im Verlag S. Fischer erschienenes »Russisches Tagebuch« den Preis der Büchergilde von Lausanne erhalten hatte. Danach überraschte er im Styria Verlag Graz die katholische Theologie mit einer »Geschichte von Jesus dem Christus«. Er hatte dem Prof. Deschamps an der Universität Löwen und Bischof Heuschen von Hasselt, das »Imprimatur«, die Druckerlaubnis abgerungen, die sie, nach schwerer Kritik, vergeblich wieder zurückverlangten … Schmits war ein Kontrast zu dem verschwiegenen Patriarchen, er hatte an der Sorbonne über Guillaume Apollinaire promoviert; jahrelang erschien er in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und dunkelroter Strickkrawatte. Wie ein Magier gestikulierend führte er uns in die tieferen Schichten der französischen Literatur vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Von Joachim du Bellay bis Max Jacob verdanke ich ihm in der Poesie den point vierge, das alles befreiende Sprachbild.
Dagegen war Dr. Michel Kohnemann, der uns mit dem altmodischen Lehrbuch »Wesen und Werden der deutschen Dichtung« vertraut machte, ein leiser Germanist, der sich in der Heimatkunde und der Kunst der Töpfermeister von Raeren besser auskannte und uns wochenlang mit Minna von Barnhelm quälte. Auf die Frage, ob man »Labyrinth« mit einem oder zwei »h« schreiben müsse, antworte er nachdenklich: »Ich würde sagen beides ist richtig.« Dennoch lasen wir in der Abitur-Klasse Brechts Schauspiel »Galilei«, das ich drei Jahre später im Berliner Schiller-Theater mit Hans-Georg Schröder in der Titelrolle beklatscht habe. Über die Deutungen von Hesses »Morgenlandfahrt« rätselte unser Lehrer selbst, doch habe ich die Kernaussage »Unser Morgenland war nicht nur etwas Geografisches, sondern die Heimat und Jugend der Seele, das Überall und Nirgends …« für immer beherzigt. Ich traute mich, Dr. Kohnemann meine ersten elegischen Gedichte über Liebesleid und Wintervesper zu präsentieren, die er wohlwollend kommentierte. Für meinen Aufsatz zum Thema »Sturm«, den ich an der heimatlichen Burg Stockem aufbrausen ließ, erhielt ich die Bestnote, er sagte: »Außer Konkurrenz.«
Für den Gesang war ich leider völlig ungeeignet und schmollte in der letzten Bank. Ich habe es unserem Lehrer Willy Mommer, einem Meisterdirigenten und Komponisten, böse heimgezahlt. Doch waren wir zu seelenverwandt, um es zu einem Bruch kommen zu lassen. Auf die Schallplatten-Hülle seines Königlichen Eupener Männerquartetts schrieb er mir die Widmung »In aller Verbundenheit«. Nach seinem letzten Konzert standen wir zusammen, sein Champagner-Glas zitterte, auf seiner Stirn Schweißtropfen, dann diese Worte: »Wir sehen uns. Danke.« Drei Wochen später starb er im Kreis seiner Familie.
Der Religionslehrer Willy Brüll und sein Mathematikkollege Jacques Keil haben meiner Journalisten-Karriere erste, wichtige Impulse verliehen. Der hochgewachsene Priester, ein Verehrer des hl. Thomas Morus, der lächelnd das Schafott betrat, hatte als junger Rekrut mit Gardemaß in einer Luftlande-Einheit von Rommels Afrika-Korps gedient und sich bei Tobruk mit der Cholera infiziert. Nach Kreta ausgeflogen, verliebte er sich im Lazarett in eine Pflegerin. Nach dem Kriegsende kehrte er ernüchtert heim und wollte in die Benediktinerabtei Maria Laach eintreten, wurde dann aber Weltpriester. Sein Vorbild war der Jesuitenpater Johannes Leppich, der im gedemütigten Nachkriegs-Deutschland die Massen begeisterte. Brüll, der Präses unserer Jugendgruppe »Estu«, richtete sich im Wohntrakt des Kollegs, im Gegensatz zu seinen vereinsamenden Mitbrüdern, großbürgerlich ein: Sitzgruppe, Picassos Mädchen mit Ball, frische Blümchen, spannend gefüllte Bücherregale, vor allem jedoch Foto- und Tonband-Elektronik auf dem neuesten Stand. Er liebte es, uns seine Schnappschüsse und Aufnahmen vorzuführen. Sein Traum: ein Hörspiel in eigener Produktion, ich in der Rolle eines fahnenflüchtigen Seminaristen. Auf Urlaub an der Côte d’Azur trug er schon Räuberzivil mit offenem Hemd. Um Karneval veranstaltete er im Speisesaal der Schule Kappensitzungen. Auf den Zeltlagern in Nidrum und Manderfeld tröstete er die geschockten Kleinen nach den nächtlichen Mutproben im Wald.
Wir hatten ihn alle ins Herz geschlossen, vor allem, wenn er sich bei Predigten im Pater-Leppich-Stil über schnöde Zeitmoden der Wirtschaftswunderjahre empörte. Wehe jedoch, wenn ihn die Nachwehen der Cholera heimsuchten. Dann begann der Herzensmensch zu toben, sein Gesicht wurde gefährlich grau, einem störenden Schüler schmiss er einen Wassereimer nach, an meinem Kopf landete sein in Leder gebundenes Brevier-Gebetbuch. Er war nicht mehr Herr seiner selbst. Es konnte Tage dauern, bis er wieder »Kinders« zu uns sagte.
Zwischen uns gab es eine heimliche Sympathie für das riskante Wort. Als ich einen Redevortrag mit dem provozierenden Namen der liberalen belgischen Wochenzeitung »Pourquoi pas?« (Warum nicht?) vorschlug, um auf Fehlplanungen in der Schule aufmerksam zu machen, stimmte er feixend zu. Es wurde ein Erfolg. Seine Lichtbilderserien für den Elternabend durfte ich kommentieren, das Mikrofon zog mich magisch an. In unserer Jugendzeitschrift, die er mit einem flotten Vorwort einleitete, schrieb ich erste Reportagen und begann mit gerade 15 einen an der DDR-Grenze bei Plauen spielenden Flüchtlings-Roman »Der Junge von drüben«, dessen Stoff allerdings nur für zwei Folgen reichte. Willy Brüll war ein Avantgarde-Priester mit Sinn für liturgische Moden. Als 1960 die langen Soutanen-Röcke verschwanden, hat er die seine mit der Schere in Stücke zerschnitten, um nur nie mehr in die Verlegenheit zu kommen, sie noch ein Mal anziehen zu müssen. Die »Rückversetzungen in den Laienstand«, mit denen Priester damals ihr Zölibat abbrachen, waren für ihn, der für den Rundfunk von der Hochzeitsmesse des Königspaares Baudouin und Fabiola berichten durfte, und, nach dem Konzil, im Bistum mitmischte, keine Frage. Vielleicht war das ein Fehler.
Auffallend war seine Schrift, sehr klein, fein und druckreif. Selbst seine gezirkelte Unterschrift blieb leserlich. Jahrzehnte später hat mich meine Frau auf dieses Dilemma aufmerksam gemacht. Es war ein kalligrafisches Krankheitsbild: der Riese mit der Kinderschrift. Über seine Probleme wollte er nicht sprechen und schüttelte nur, voller Abscheu, den Kopf. Doch vertraute er mir an, dass er in Situationen besonderer Niedergeschlagenheit an das Grab seiner Mutter eile. Ich habe diese schön gealterte starke Frau noch gekannt. Sie war seine letzte Zuflucht.
Als Pfarrer von Hergenrath lud er im Advent 1966 zu einer »Jazz-Messe« ein, über die ich für die »Aachener Volkszeitung« berichtete. Die Dixie-Eucharistie war dermaßen peinlich, dass ich dazu, ohne Rücksicht auf alte Freundschaft, eine Glosse mit dem Titel »Des Psalmisten swingende Erben« schrieb. Sie saß so sehr, dass der Zweispalter von der Lokalausgabe am nächsten Tag auf der überregionalen »Rhein-Maas-Seite« des Jazz-Fans Walter Queck erschien: 100.000 Auflage, grenzüberschreitendes Gelächter, ein Drama begann. Als er während der Weihnachtsmesse glaubte, jemand habe gegrinst, schmiss Pfarrer Brüll polternd das Messbuch hin. Erste von ihm diktierte Leserbriefe erschienen. Mit den Berufsbezeichnungen »Bischöflicher Berater für Liturgie« und »Mitglied der bischöflichen Kommission für Ökumene« unterzeichnete er ein Protestschreiben, in dem er meine sofortige Entlassung verlangte. Das waren ostbelgische Sitten, in Aachen längst überholt. Mein Chefredakteur Dr. Konrad Simons, legte den Brief für sechs Wochen auf Eis, und antwortete schließlich mit dem Rat, es sei »kein Fehler jung zu sein«. Mein guter Präses hat jahrelang kein Wort mehr mit mir gewechselt.
Doch passte dieser Streit nicht zu uns. Ohne ein Wort über das nie mehr wiederholte Jazz-Experiment zu verlieren, haben wir uns versöhnt. Zu Kalbsbraten und Spargel tranken wir weißen Elsässer, berichteten gemeinsam in einer zweistündigen Direktsendung über den Papstbesuch von Johannes Paul II. im Marien-Wallfahrtsort Banneux und übten uns als Redenschreiber, er für den Bischof, ich für Politiker gleich welcher Couleur. Als er im Frühjahr 1999 eine Einladung zu einem Essen ausschlug, fand ich es sonderbar. Als ich sie später wiederholte, zeigte er kopfschüttelnd auf seinen Bauch. Dann bekamen wir ihn nicht mehr zu Gesicht, bis sich plötzlich rumsprach, dass er im Krankenhaus liege.
Kurioserweise hatte ich Hemmungen, ihn zu besuchen, Willy im Pyjama, das passte nicht zu dem milden Paukenschläger. Als ich dennoch im Mai 2000 sein Zimmer betrat, hat er sich dermaßen gefreut, dass ich ihm versprach, jetzt jeden Abend zu kommen. Es ist mir nicht schwer gefallen, ich las zwei Psalmen und wünschte ihm eine gute Nacht. Als ich bei einem heftigen Gewitter sagte, es regne draußen »wie eine Sau«, antwortete er: »Aber irgendwo scheint die Sonne.« Der Internist hatte ihm am Vortag mitgeteilt, dass es zu Ende gehe. Am Morgen des 17. August 2000 war es so weit. Ich erhielt einen Anruf der Krankenschwester und eilte in sein Zimmer. Da lag der große, starke Mann in den letzten Zügen. Der Tod kam schnell und ich drückte ihm eine Gebetsschnur von Heiligen Berg Athos in die Hand. Es war sein Wunsch gewesen, dass ich in der Totenmesse die Abschiedsrede halte. Ich habe es sehr gerne getan, ich glaube, sie hätte ihm gefallen. Da ich fast zwei Monate jeden Abend an sein Sterbebett getreten war, rechne ich noch immer fest damit, dass er das irgendwie zurückgeben könnte. Ganz gewiss, er ist so ein Typ. Wenn es schlecht um mich steht rufe ich: »Willy, Willy, Willy.« Das reicht.
Die beiden Jahre in der Klasse des Mathematik-Lehrers Jacques Keil waren eine Gratwanderung zwischen Leiden und Bewunderung. Da ich in seinen Fächern Geometrie, Algebra und Trigonometrie eine Null war, hat mich das schlechte Gewissen tagtäglich begleitet. Keine einzige Hausaufgabe habe ich allein geschafft. Wenn ich rechnete, dann mit himmlischer Hilfe. Immer wurde abgepinselt, ich musste zwischen den besser begabten Freunden hin und her pendeln, es war demütigend. Für das Kopieren von Übungen der darstellenden Geometrie benutzten wir einen beleuchteten Glastisch. Die Zeit vor dem Abitur war ein Leidensweg. Aber: Keil blieb ein fairer Partner, er wusste, dass ich nichts wusste. Bei einer unausweichlichen Nachprüfung drückte er beide Augen zu und verdonnerte mich dazu, ihm gegenüber im Emma-Laden von Tante Finchen eine Tüte »Tabador«-Tabak zu besorgen … An die Tafel wurde ich schon gar nicht mehr aufgerufen. Und doch war es spannend, denn ich musste ihm in der ersten Reihe unmittelbar gegenübersitzen, so nahe, dass ich seine Nasenhaare zählen konnte. In dieser brisanten Stellung habe ich all die Zeit ausgehalten. Keils Gesichtszüge, sein krauser Haarkranz, seine Speichelspritzer und wechselnden Gerüche, waren mir intim vertraut. Ich wusste mehr über das Genie als all seine Rechenkünstler auf den anderen Bänken.
Begeisterte er sich für Euklids Lehrsätze, legte er seinen Rock ab und begann zu tanzen: ein Stück Kreide in der Hand, die Pfeife im Mundwinkel, sah man unter seiner Weste die Schweißflecken. Die Hemdsärmel hatte er hochgekrempelt, hohe Rechenkunst war für ihn ein Gemisch aus Handwerk und Akrobatik. Dann hob er sein Hosenbein und hervortrat ein hoher schwarzer Schuh und schneeweiße Haut, die nie die Sonne gesehen hatte. Schließlich tönte sein überraschender Kommentar: »Ist das nicht schön, katholisch zu sein.« Da jubelte ein seltener Meister konfessioneller Mathematik.
Keil war in dieser Schule ein Fast-Alleskönner. Niemand nahm ihm übel, dass er über Philosophen verachtenden Spott ausgoss oder statt der ungeliebten Chemie weiter Physik lehrte. Hier brillierte er auf eine Weise, die ich als poetisch empfand. Er schaffte es, selbst mich auf die Milchstraßen von Newton und Einstein mitzunehmen. Dabei bestand seine besondere Spezialität darin, Nuklearphysik mit theologischer Apologetik zu verbinden. Doch da schieden sich die Geister, die meisten Herzen schlugen höher, doch empörte er die Minderheit unserer Jung-Atheisten. Der Exaltierte war auf höchstem Niveau subjektiv und liebte die Provokation, politische inklusive.
Frankreich, das er in den Ferien mit seiner Norton-Maschine durchquerte, nannte er »das Land, in dem Gott seine Ferien verbringt«. Dann zeichnete er die Landkarte der »douce France« auf die Tafel und behauptete: »Seht, hier ist das einzige Land der Welt, das die Konturen eines menschlichen Gesichts hat.« Dennoch war Keil ein belgischer Patriot. Seit der Nacht zum 10. Mai 1940 wusste er genau, was beim bevorstehenden Einmarsch der Hitler-Armee auf dem Spiel stand. Sein Vater arbeitete als Telegraph am Eupener Postamt und konnte frühzeitig wegen der sich überstürzenden Meldungen im Grenzraum die beginnende Invasion voraussagen. Sofort alarmierte er seinen Sohn Jacques, der mit einem Moped zur Aachener Straße eilte, um den gefährdeten Chefredakteur der Tageszeitung »Grenz-Echo«, Henri Michel, zu warnen. Kurz vor seiner Verhaftung gelang es Michel, mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern auf Umwegen nach Brüssel zu flüchten. Seine Nachbarin Frau Bredohl aus dem »Bund deutscher Mädchen« erzählte mir 1988 bei Recherchen über die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie: »Ja, ich erinnere mich genau, fast hätten wir den Drecksack noch erwischt, die Betten waren noch warm.«
Ich habe Jacques Keil nicht geliebt, aber verehrt. Im Gegensatz zu fast allen Kollegen war er eine herausragende Persönlichkeit, die keinen unberührt ließ. Selbst von den hartnäckigen Gegnern, die er förmlich anlockte, versagte ihm keiner den Respekt. Mich hat seine Neigung für das Risiko fasziniert. Sein Wissen und die brillante Rhetorik hatten stets eine jubilierende oder gnadenlose Konsequenz. Wenn er uns die Mondlandung der Amerikaner erklärte, leuchtete in seinen Augen etwas Engelhaftes, aus seinen Äußerungen über die spektakulären Physik-Vorlesungen des Aachener Professors Fucks triefte der Spott. Das nahe Deutschland war ihm fremder als jedes andere Land, Israel und dem Schicksal des jüdischen Volkes galt seine ganze Kompassion. Die Nachbarstadt Aachen hat er nie mehr betreten.
Als ich ihn am Vortag der Abitur-Entscheidungen aufsuchte, blätterte er in seinen Unterlagen und sagte: »Bei mir hast du deine Punkte.« Diesmal hatte er nicht mit Zahlen gerechnet. Dieses befreiende Geschenk habe ich ihm nie vergessen. Zu groß war meine Angst, dieses Jahr wiederholen zu müssen, es hätte nichts gebracht. Ohne meine an die Universitäten reisenden Freunde allein zurückbleiben zu müssen, brachte mich in die Nähe von Suizid-Gedanken. All das fiel jetzt weg, nur Jacques Keil hatte ich das zu verdanken. Als zwei Jahre später bei einem Studentenjob in der Eupener »Grenz-Echo«-Redaktion meine Theaterkritik abgelehnt wurde, war es erneut Keil, der für mich einsprang. Der Text war keineswegs provokativ, sondern für das Provinzblatt nur zu flott geschrieben. Chefredakteur Heinrich Toussaint bekam seine empörten roten Ohren, der Lokalredakteur Joseph Gerckens nuschelte, ich hätte »wohl zu viel den ›Spiegel‹ gelesen«, in dem er selbst heimlich blätterte … Doch wollte ich nicht aufgeben. Die Ostbelgien-Ausgabe der »Aachener Volkszeitung«, die AVZ, hatte bereits eine eigene Besprechung, so bot ich meinen Text Keil an, der für den deutschsprachigen Belgischen Rundfunk in Brüssel die Ostbelgien-Berichterstattung produzierte. Ich saß erstmals in seinem Arbeitszimmer am Mikrofon. Das Studio hatte er selbst eingerichtet, mit Haken und Ösen, aber es funktionierte. Er war von meinem Beitrag so beeindruckt, dass er mir nach der Aufnahme sagte: »Ich kann dir das nicht bezahlen, aber stelle doch einen Antrag bei der Sendeleiterin Irene Janetzky und dann sehen wir weiter.« Frau Janetzky war eine Dame von Welt und hat über die Reaktion des »Grenz-Echo« nur geschmunzelt. Ich wurde fester Mitarbeiter für kulturelle Beiträge. Das bedeutete den Beginn einer journalistischen Laufbahn. Keil und ich waren jetzt Kollegen und enge Freunde, Jahre später schrieb ich ihm aus einem Fischerkaff in der Bretagne: »Ich danke dir für deine gute Hand in meinem Leben.«
Einige Tage vor dem Wechsel zur Universität haben wir im engen Freundeskreis eine Wanderung durch die Moorlandschaft des Hohen Venns unternommen. Es war ein Lichttag im Altweibersommer, von der Hillquelle ging es vorbei an den verkrüppelten Bäumen von Noir Flohay hinab ins Tal. Zunächst noch glucksendes schwarzes Wasser, dann, an der Biegung des Flüsschens, glatte Steine, die Büsche der Preiselbeeren. Wir marschierten barfuß, der Wind strich durch das Wollgras. Die Weite, bis hinauf in die deutsche Eifel, glich einer Savanne. Da kam plötzlich eine Leichtigkeit des Lebens, ein Gefühl großer Freiheit. Es war die Wende von den dunklen Schuljahren in die Studentenzeit. Spannung lag in der Luft. Aber mehr noch, diese Landschaft hatte etwas Metaphysisches, zwischen Heide und Fichtenwänden schimmerte das »Eigentliche«, mächtige Schönheit, nacktes einfaches Glück. Am Wegesrand Kreuze, die an den Tod verirrter Wanderer erinnerten; die Winternächte können lebensgefährlich sein. Hier herrschte das Rauschen der Wälder wie eine Sehnsucht der Stille, sich hörbar zu machen. Fünf Stunden darin unterwegs machten erstmals deutlich, wo Eupen eigentlich lag: eine Frontstadt am Rande grandioser Wälder. Ein Rückzugsgebiet für Sucher, Abenteurer der Einsamkeit, die sich weit hinaus wagten, etwas Heilendes jenseits der lärmenden Welt zu finden. So gingen wir erschöpft am Ufer des sprudelnden Flusses zurück. Es war gut zu wissen, unmittelbar in solch einer Nachbarschaft zu wohnen. Die Dinge beginnen in diesen Stunden zu leuchten. Abend am Waldsaum, noch etwas Farn, noch etwas Moos, dann war es geschafft. Die Unterstadt, wo sich die Venn-Flüsse Hill und Soor vereinen, feierte Kirmes. Noch immer ohne Schuhe, stießen wir an auf das Fest des Lebens.
NÄCHTE IN LÖWEN
Erstmals mit einem kleinen Koffer den Bus zu besteigen und im alten kaiserlichen Grenzbahnhof Herbesthal den Zug in die Universitätsstadt Löwen zu nehmen, war eine große Stunde. Mit 17 auf einer weltberühmten Uni, das hatte selbst meinen kritischen Vater tief beeindruckt, der sich beim Abschied eine Träne wegwischte. Es war der erste Sonntag im Oktober 1964. Mit im Zug saßen der über James Joyces’ Klassiker »Ulysses« promovierende Theologe Jean, »Schäng«, Schoonbroodt und der Philosophie-Student Werner Mießen. Zwei Typen der Sonderklasse: der eine strenger Anhänger der tridentinischen Liturgie, der andere ein platonischer Frauenverehrer, Jahre später ein akribischer Bibliograph auch meiner Bücher. Es war eine exzellente Eskorte.
Die Kinos auf dem Bahnhofsplatz der flämischen Stadt leuchteten in grellen Farben, ringsum Wirtshäuser, Frittenbuden, in den Seitenstraßen kleine Rotlicht-Bars. Unübersehbar ein Kriegerdenkmal, das mächtig in den Abendhimmel ragte. Die Stadt war in den beiden Weltkriegen von den Deutschen zwei Mal brutal überfallen worden, es blieb unvergessen. So trug die Hauptstraße den Namen der Alliierten und die niedergebrannte Universitätsbibliothek sowie ihr Glockenturm die Namen der amerikanischen Spender für den Wiederaufbau. Im Mittelpunkt jedoch das alte, unversehrt gebliebene Rathaus im brabantischen Glanz.
Die aus dem Mittelalter stammende katholische Universität trug die Namen »Alma mater« (nährende Mutter) und »Sedes sapientiae« (Sitz der Weisheit). Wegen ihrer theologischen und medizinischen Fakultäten hatte sie Weltruf, ihr nach dem Widerständler Kardinal Mercier benanntes Philosophische Institut barg das von Pater Herman Van Breda gerettete Husserl-Archiv. Auf dem Weg zu den Vorlesungen traf man Kommilitonen aller Nationalitäten und Hautfarben, allen voran die amerikanischen Jesuiten in langen schwarzen Soutanen und Hirtenhüten mit breiter Krempe. Der Beginn des neuen akademischen Jahres wurde mit einer feierlichen Prozession eröffnet, die Professoren aller Fakultäten in den ihnen eigenen Talaren. Seine Magnifizenz, der Rektor, umgeben von Honoratioren auf dem Weg zum feierlichen Hochamt in der Basilika Sint Pieters. Hier war alles an akademischem Pomp vertreten, was einige Jahre später in Paris die Studentenrevolution und europaweit Feuer auslösen sollte.