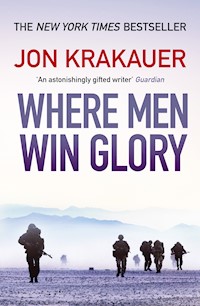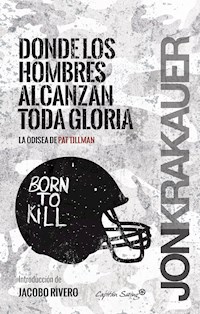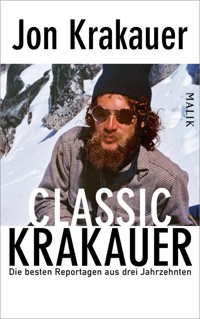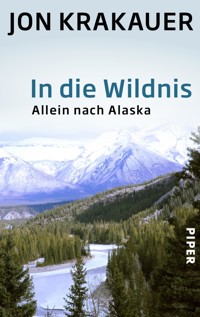13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Eiger-Nordwand und andere Träume. Der Autor des Weltbestellers »In eisige Höhen« berichtet in zwölf brillanten Reportagen von seinen gefährlichen Leidenschaften: dem Mount Everest und dem K2, dem Montblanc und der berüchtigten Eiger-Nordwand, vom Canyoning in wilden Schluchten und von seiner erfolgreichen Solobesteigung des Devils Thumb in Alaska. Er erzählt von berühmten Bergsteigern, die für ihre Passion ihr Leben aufs Spiel setzen, und macht verständlich, worin die Faszination der Berge besteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Linda, in Erinnerung an die Green Mountain Falls, die Wind Rivers und die Roanoke Street
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Wolfgang Rhiel
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
10. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95973-5
© 1990 Jon Krakauer Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Eiger Dreams«, Lyons & Burford, New York 1990 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 1999, erschienen im Verlagsprogramm Malik Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, www.kohlhaas-buchgestaltung.de Covermotiv: Kolja Brandt/photoselection Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Die ältesten und weitverbreitetsten Geschichten der Welt sind Geschichten von Abenteuern, von Helden, die in sagenhafte Länder aufbrechen, dabei ihr Leben aufs Spiel setzen und mit Berichten von der jenseitigen Welt zurückkommen… Man könnte anführen … daß die Kunst des Erzählens selbst aus dem Bedürfnis entstanden ist, Abenteuer zu erzählen, daß der Mensch, der in gefahrvollen Begegnungen sein Leben wagt, die ursprüngliche Definition dessen begründet, was wert ist, berichtet zu werden.
Paul ZweigThe Adventurer, London 1974
In einem Abenteuer zu stecken beweist, daß jemand unfähig ist, daß jemand sich vertan hat. Ein Abenteuer ist rückblickend recht interessant, vor allem für den, der es nicht bestehen mußte; in dem Augenblick, wo es geschieht, ist es meistens ein höchst unangenehmes Erlebnis.
Vilhjalmur StefanssonDas Geheimnis der Eskimos
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Die meisten Nichtbergsteiger haben, wenn überhaupt, vom Bergsteigen eine verschwommene Vorstellung. Bergsteigen ist ein beliebtes Thema für schlechte Filme und falsche Bilder. Ein Traum von der Ersteigung irgendeines gewaltigen, zerschrundenen Alpengipfels – da kann sich ein Seelendoktor so richtig austoben. Die Tätigkeit ist verpackt in Geschichten von Kühnheit und Tragödien, gegen die sich andere Sportarten vergleichsweise harmlos ausnehmen. Klettern bringt in der Phantasie der Öffentlichkeit die Saite zum Klingen, die am ehesten mit Haien und Killerbienen assoziiert wird.
Es ist das Ziel dieses Buches, diesen mystischen Wildwuchs ein wenig zu stutzen – damit etwas Licht hineinkommt. Die meisten Kletterer sind nicht wirklich gestört, sondern lediglich infiziert von einem besonders virulenten Zug menschlicher Veranlagung.
Damit dies keine Mogelpackung wird, sollte ich gleich hier feststellen, daß dieses Buch nirgendwo richtig Farbe bekennt und frontal die eigentliche Frage angeht: Warum macht ein geistig normaler Mensch solche Sachen? Ich umkreise das Thema ununterbrochen, stupse es dann und wann mit einem langen Stock von hinten an, aber ich springe niemals mitten in den Käfig, um direkt mit dem Ungeheuer zu ringen, sozusagen Auge in Auge. Trotzdem denke ich, daß der Leser oder die Leserin am Ende des Buches nicht nur besser versteht, warum Kletterer klettern, sondern auch, warum sie oft so verdammt besessen sind.
Die Ursprünge meiner eigenen Besessenheit führe ich auf das Jahr 1962 zurück. Ich wuchs als ganz normaler Junge in Corvallis in Oregon auf. Mein Vater war ein vernünftiger, strenger Mann, der seine fünf Kinder ständig nervte, Mathematik und Latein zu lernen, ordentlich zu büffeln und frühzeitig und unbeirrt eine Karriere als Arzt oder Rechtsanwalt anzustreben. Unerklärlicherweise schenkte mir dieser unnachsichtige Zuchtmeister zu meinem achten Geburtstag einen kleinen Eispickel und nahm mich zu meiner ersten Bergtour mit. Ich kann mir, wenn ich zurückdenke, nicht vorstellen, was der alte Herr sich dabei gedacht hat; hätte er mir eine Harley und das Recht auf Mitgliedschaft bei den Hell’s Angels geschenkt, er hätte seine erzieherischen Bestrebungen nicht nachhaltiger sabotieren können.
Als ich achtzehn war, gab es für mich nur noch eins: Klettern – Arbeit, Schule, Freundschaft, Berufspläne, Sex, Schlafen, das alles hatte sich dem Klettern unterzuordnen oder wurde, was noch häufiger vorkam, einfach nicht beachtet. 1974 nahm meine Vernarrtheit noch krassere Formen an. Das Schlüsselereignis war meine erste Alaska-Expedition, ein einmonatiger Trip mit sechs Kameraden zu den Arrigetch Peaks, einer Gruppe schlanker Granittürme, von strenger, betörender Schönheit. An einem Junimorgen früh um halb drei stand ich nach zwölfstündiger Kletterei auf dem Gipfel eines Berges, der Xanadu hieß. Die Spitze war ein beängstigend schmaler Felszacken, wahrscheinlich der höchste Punkt der ganzen Gegend. Und wir waren die ersten, die ihre Füße auf ihn setzten. Weit unter uns erglühten orangefarben die Spitzen und Wände der Gipfel ringsum, wie von innen erleuchtet in der unheimlichen, die ganze Nacht andauernden Dämmerung des arktischen Sommers. Vom Beaufortsee heulte ein grimmiger Wind über die Tundra und verwandelte meine Hände in Holz. Ich war so glücklich wie noch nie zuvor im Leben.
Im September 1975 schaffte ich mit Ach und Krach den Collegeabschluß. Die nächsten acht Jahre verbrachte ich als wandernder Zimmermann und Berufsfischer in Colorado, Seattle und Alaska, lebte in Einzimmerwohnungen mit Backsteinwänden, fuhr ein Hundert-Dollar-Auto und arbeitete nur so viel, daß ich die Miete und die nächste Klettertour finanzieren konnte. Irgendwann wurde es eintönig. Ich lag nachts wach und machte noch einmal all die heiklen Situationen durch, die ich in den Bergen überstanden hatte. Wenn ich auf irgendeiner schlammigen Baustelle im Regen Balken sägte, wanderten meine Gedanken immer häufiger zu Mitschülern, die eine Familie gründeten, sich ein Haus kauften, Gartenmöbel erwarben und unverdrossen Reichtümer anhäuften.
Ich beschloß, das Klettern an den Nagel zu hängen, und sagte das auch der Frau, mit der ich damals zusammen war. Diese Ankündigung überraschte sie so, daß sie einwilligte, mich zu heiraten. Ich hatte allerdings die Macht, mit der das Klettern mich gepackt hatte, weit unterschätzt; es aufzugeben erwies sich als sehr viel schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Meine Enthaltsamkeit hatte nur knapp ein Jahr Bestand, und als sie endete, sah es eine Weile so aus, als wäre das gleichzeitig auch das Ende unserer ehelichen Abmachungen. Obwohl alles dagegensprach, schaffte ich es irgendwie, verheiratet zu bleiben und weiter zu klettern. Ich empfand allerdings nicht mehr den Zwang, bis an meine Grenzen zu gehen, in jedem Gipfel Gott zu sehen, immer extremere Klettertouren zu wählen. Heute komme ich mir wie ein Alkoholiker vor, dem es gelungen ist, statt tagelang zu saufen, am Samstagabend ein paar Bier zu trinken. Ich bin zufrieden ins alpine Mittelmaß gerutscht.
Mein Ehrgeiz als Kletterer war umgekehrt proportional zu meinen Bemühungen als Autor. 1981 verkaufte ich meinen ersten Artikel an eine heimische Zeitschrift; im November 1983 erwarb ich einen Computer, legte den Klettergurt zum, wie ich hoffte, letzten Mal ab und begann, mir mit dem Schreiben mein Geld zu verdienen. Und das mache ich seitdem hauptberuflich. Inzwischen geht es bei meiner Arbeit, wie es scheint, immer mehr um Architektur oder Naturgeschichte oder Popkultur – ich habe für den Rolling Stone über das Laufen über glühende Kohlen geschrieben, für Smithsonian über Perücken, für den Architectural Digest über Neo-Regency –, doch Geschichten über das Bergsteigen sind meinem Herzen nach wie vor am nächsten und liebsten.
Elf der zwölf zwischen diesen Buchdeckeln gesammelten Artikel wurden ursprünglich für Zeitschriften geschrieben (die letzte Geschichte, »Der Teufelsdaumen«, habe ich eigens für dieses Buch verfaßt). Daher haben sie von der Aufmerksamkeit einer kleinen Schar von Redakteuren und Rechercheuren profitiert, die sie druckreif gemacht haben – und gelegentlich auch darunter gelitten. Besonderen Dank schulde ich Mark Bryant und John Rasmus von Outside sowie Jack Wiley, Jim Doherty und Don Moser von Smithsonian für das, was sie an unschätzbarer Arbeit zu diesen Artikeln beigetragen haben. Alle fünf sind hervorragende Autoren und auch exzellente Redakteure, was in der Einfühlsamkeit und Zurückhaltung zum Ausdruck kam, mit der sie mich ein ums andere Mal auf den richtigen Weg führten, wenn ich mich verstiegen hatte.
Zu Dank verpflichtet bin ich außerdem Larry Burke, Mike McRae, Dave Schonauer, Todd Balf, Alison Carpenter Davis, Marilyn Johnson, Michelle Stacey, Liz Kaufmann, Barbara Rowley, Susan Campbell, Larry Evans, Joe Crump, Laura Hohnhold, Lisa Chase, Sue Smith, Matthew Childs und Rob Story von Outside; Caroline Despard, Ed Rich, Connie Bond, Judy Harkison, Bruce Hathaway, Tim Foote und Frances Glennon von Smithsonian; Phil Zaleski und David Abramson vom New Age Journal; H. Adams Carter vom The American Alpine Journal; Michael Kennedy und Alison Osius von Climbing; Ken Wilson von Mountain; Peter Burford für seine Hilfe bei der Gestaltung dieser Sammlung; Deborah Shaw und Nick Miller für ihre Gastfreundschaft; meinem Agenten John Ware sowie meinem freischaffenden Kollegen Greg Child, mit dem ich an einer frühen Fassung von »Ein schlechter Sommer am K2« zusammengearbeitet habe.
Für gemeinsame und denkwürdige Tage am Seil in den Bergen danke ich Fritz Wiessner, Bernd Arnold, David Trione, Ed Trione, Tom Davies, Mark Francis Twight, Mark Fagan, Dave Jones, Matt Hale, Chris Gulick, Laura Brown, Jack Tackle, Yvon Chouinard, Lou Dawson, Roman Dial, Kate Bull, Brian Teale, John Weiland, Bob Shelton, Nate Zinsser, Larry Bruce, Molly Higgins, Pam Brown, Bill Bullard, Helen Apthorp, Jeff White, Holly Crary, Ben Reed, Mark Rademacher, Jim Balog, Mighty Joe Hladick, Scott Johnston, Mark Hesse, Chip Lee, Henry Barber, Pete Athans, Harry Kent, Dan Cauthorn und Robert Gully.
Ganz besonders danken aber möchte ich Lew und Carol Krakauer für ihr schlechtes Urteilsvermögen, ihren achtjährigen Sohn mit auf die South Sister zu nehmen; Steve Rottler, daß er mich so viele Jahre hindurch in Boulder, Seattle und Port Alexander immer wieder angestellt hat; Ed Ward, dem größten Naturtalent unter den Kletterern, das ich je erlebt habe, der mir gezeigt hat, wie man schwere Routen klettert und dabei am Leben bleibt; David Roberts, der mir Alaska erschlossen und mir das Schreiben beigebracht hat; und schließlich Linda Mariam Moore, meiner besten Lektorin und meinem vertrauten Kumpel.
KAPITEL EINS
Eiger-Träume
Gleich zu Beginn des Films »Im Auftrag des Drachen« schlendert Clint Eastwood in die schwach erleuchtete Zentrale von C-2, um sich zu erkundigen, wen er als nächstes ausschalten soll. Dragon, der finstere Albino, der die CIA-ähnliche Organisation leitet, erklärt Eastwood, daß man zwar noch nicht den Namen der Zielperson kenne, aber schon herausgefunden habe, daß »unser Mann diesen Sommer in den Alpen klettern wird. Und wir wissen auch schon, an welchem Berg: am Eiger.«
Für Eastwood ist gleich klar, welche Route er nehmen wird – »Die Nordwand selbstverständlich« –, und er läßt einfließen, daß er mit dieser Wand vertraut ist. »Ich habe zweimal versucht, sie zu durchsteigen, und sie hat zweimal versucht, mich umzubringen … Wenn die Zielperson beabsichtigt, den Eiger zu besteigen, habe ich gute Chancen, daß der Berg die Arbeit für mich erledigt.«
Das Problem beim Durchsteigen der Eiger-Nordwand ist, daß man nicht nur senkrechte 1800 Meter brüchigen Kalkstein und schwarzes Eis hinauf, sondern auch einige furchterregende Legenden überwinden muß. Die schwierigsten Schritte bei jedem Aufstieg sind immer die mentalen, die psychischen Verrenkungen, die die Angst in Schach halten sollen, und die grimmige Aura des Eiger ist einschüchternd genug, jeden aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Dramen, die sich in der Nordwand abgespielt haben, sind durch mehr als 2000 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel in allen gräßlichen Details ins kollektive Unterbewußtsein der Welt eingegangen. Die Umschläge von Büchern wie Todeswand Eiger erinnern uns daran, daß die Nordwand »Hunderte besiegt und vierundvierzig getötet hat«. Diejenigen, die abgestürzt sind, wurden – manchmal erst nach Jahren – ausgetrocknet und zerschmettert gefunden. Der Körper eines italienischen Bergsteigers hing unerreichbar, aber für die Neugierigen im Tal gut sichtbar, drei Jahre im Seil, abwechselnd in den Eispanzer der Wand eingefroren, dann wieder im Sommerwind hin und her schwingend.
Die Geschichte der Berge ist voll von Kämpfen solch heroischer Gestalten wie Buhl, Bonatti, Messner, Rebuffat, Terray, Haston und Harlin, von Eastwood ganz zu schweigen. Die Namen einiger Passagen der Wand – Hinterstoisser-Quergang, Eisschlauch, Todesbiwak, Weiße Spinne – sind für aktive Alpinisten wie für Flachlandtouristen von Tokio bis Buenos Aires geläufige Begriffe, deren bloße Erwähnung die Hände jedes Kletterers feucht werden läßt. Die Steinschläge und Lawinen, die pausenlos durch die Nordwand poltern, sind berüchtigt. Und das ist auch das Wetter: Selbst wenn der Himmel über dem übrigen Europa wolkenlos ist, brauen sich über dem Eiger heftige Stürme zusammen, jenen düsteren Wolken ähnlich, die in Vampirfilmen immer über den transsylvanischen Schlössern schweben.
Überflüssig zu sagen, daß all das die Eiger-Nordwand zu einer der begehrtesten Kletterrouten der Welt gemacht hat.
Die Nordwand wurde 1938 zum ersten Mal vollständig durchstiegen und hat seitdem über 150Begehungen erlebt, darunter eine Solobegehung im Jahr 1983, die ganze fünfeinhalb Stunden dauerte, aber erzählen Sie um Gottes willen Staff Sergeant Carlos J. Ragone von der amerikanischen Luftwaffe nicht, daß der Eiger zu einem landschaftlich reizvollen Spaziergang geworden sei. Im letzten Herbst saß ich mit Marc Twight vor unseren Zelten oberhalb der Kleinen Scheidegg, der Ansammlung von Hotels und Restaurants am Fuß des Eiger, als Ragone unter einem prallgefüllten Rucksack ins Lager spazierte und verkündete, daß er die Nordwand durchsteigen wolle. In dem Gespräch, das sich nun ergab, erfuhren wir, daß er sich unerlaubt von der Truppe, einem Luftstützpunkt in England, entfernt hatte. Sein Kommandeur hatte sich geweigert, Ragone Urlaub zu geben, als er erfahren hatte, wie Ragone ihn verbringen wollte, aber Ragone war trotzdem losgezogen. »Diese Tour kostet mich wahrscheinlich meine Uniform«, meinte er, »aber andererseits, wenn ich die Mutter hier hochkomme, vielleicht befördern sie mich dann.«
Unglücklicherweise kam Ragone die Mutter nicht hoch. Der September war als der nasseste seit 1864 in die schweizerischen Annalen eingegangen, und die Wand befand sich in einem erbärmlichen Zustand, noch schlimmer als üblich, mit einer Eiskruste überzogen und vollgepackt mit Lockerschnee. In der Wettervorhersage war von anhaltenden Schneefällen und Sturm die Rede. Zwei Gefährten, mit denen Ragone hatte zusammentreffen wollen, waren aufgrund der widrigen Umstände ausgestiegen. Ragone hatte jedoch nicht vor, aufzugeben, nur weil er keine Begleiter mehr hatte. Am 3. Oktober ging er die Tour allein an. Noch im unteren Wandbereich, nahe dem Kopf des Ersten Pfeilers, unterlief ihm ein Fehltritt. Seine Eispickel und Steigeisen brachen aus dem spröden Eis, und Ragone flog aus der Wand. 150 Meter weiter unten schlug er auf.
Unglaublich, aber sein Sturz wurde durch eine Ansammlung von Pulverschnee am Fuß der Wand so abgefangen, daß Ragone mit lediglich ein paar Schrammen und einer leichten Prellung am Rücken davonkam. Er humpelte durch den Schneesturm ins Bahnhofsbuffet, fragte nach einem Zimmer, ging nach oben und schlief sofort ein. Irgendwo auf seinem Sturz zum Wandfuß hatte er einen Eispickel und sein Portemonnaie verloren, in dem sich all seine Papiere und sein Geld befanden. Als es am nächsten Morgen Zeit war, die Zimmerrechnung zu begleichen, konnte Ragone nur seinen verbliebenen Eispickel als Bezahlung anbieten. Der Chef vom»Bahnhof« war nicht sehr erbaut. Bevor er sich aus der Scheidegg stahl, kam Ragone noch bei uns im Lager vorbei und fragte, ob wir daran interessiert wären, seine restliche Kletterausrüstung zu erstehen. Wir machten ihm klar, daß wir ihm zwar gerne geholfen hätten, aber selbst gerade etwas klamm seien. Ragone, der den Eindruck machte, für eine Weile keine sonderlich große Lust zum Klettern zu haben, erklärte daraufhin, daß er uns das Zeug schenken wolle. »Dieser Berg ist ein Monster«, giftete er und warf einen letzten Blick auf die Nordwand. Dann trottete er durch den Schnee davon Richtung England, um sich dem Strafgericht seines Kommandeurs zu stellen.
Wie Ragone waren auch Marc und ich in die Schweiz gekommen, um die Nordwand zu durchsteigen. Marc, acht Jahre jünger als ich, trägt zwei Ringe im linken Ohr und hat purpurne Haare, die jedem Punker zur Ehre gereichen würden. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Kletterer. Ein Unterschied zwischen uns war der, daß Marc unbedingt die Eigerwand durchsteigen wollte, während ich nur unbedingt die Eigerwand in meiner Erfolgsbilanz haben wollte. Marc ist in dem Alter, in dem die Hypophyse im Überfluß Hormone ausschüttet, die differenziertere Emotionen wie etwa Angst unterdrücken. Er neigt dazu, Dinge wie Klettern um Leben oder Tod mit Spaß zu verwechseln. Ich bin ein freundlicher Mensch und beabsichtigte, Marc an all den besonders spaßigen Passagen der Nordwand vorsteigen zu lassen.
Im Gegensatz zu Ragone waren Marc und ich nicht bereit, in die Wand einzusteigen, wenn sich die Bedingungen nicht besserten. Da die Nordwand leicht konkav geformt ist, sind bei Schneefall nur wenige Abschnitte nicht lawinengefährdet. Im Sommer, wenn alles gutgeht, braucht eine starke Seilschaft normalerweise zwei oder drei Tage, um die Wand zu durchsteigen. Im Herbst, wenn die Tage kürzer und die Bedingungen eisiger sind, sind drei bis vier Tage die Norm. Um möglichst gute Chancen zu haben, den Eiger ohne unangenehme Zwischenfälle hinauf- und wieder herunterzukommen, brauchten wir, wie wir meinten, mindestens vier Tage gutes Wetter am Stück: einen Tag, damit der Neuschnee als Lawinen abgehen konnte, und drei Tage für die Durchsteigung der Wand sowie den Abstieg über die Westflanke.
Jeden Morgen krochen wir aus unseren Zelten an der Scheidegg, pflügten durch die Schneewehen hinunter zum Bahnhof und riefen in Genf und Zürich an, um uns eine Wettervorhersage für vier Tage geben zu lassen. Jeden Tag bekamen wir das gleiche zu hören: weiterhin unbeständiges Wetter, in den Tälern Regen, in den Bergen Schnee. Uns blieb nichts als zu fluchen und zu warten, und das Warten war schrecklich. Das sagenumwobene Gewicht des Eiger lastete vor allem an den verlorenen Tagen schwer auf uns, und man wurde leicht veranlaßt, zuviel nachzudenken.
An einem Nachmittag fuhren wir, um uns abzulenken, mit der Bahn zum Jungfraujoch, einer Zahnradbahn, die von der Kleinen Scheidegg zu einem Sattel oben im Eiger- und Jungfraumassiv führt. Das erwies sich als ein Fehler. Die Bahn durchquert die Eingeweide des Eiger in einem Tunnel, der 1912 in den Berg gesprengt wurde. Auf halbem Weg liegt eine Zwischenstation mit ein paar riesigen Fenstern, durch die man in die senkrechte Nordwand blickt.
Der Blick aus diesen Fenstern ist so schwindelerregend, daß auf den Fensterbänken Spucktüten liegen – die gleichen, die im Flugzeug in den Sitzlehnen stekken. Direkt vor den Scheiben wirbelten die Wolken. Der schwarze Fels der Nordwand, der dort, wo er überhing, mit filigranen Reifgebilden und Eiszapfen überzogen war, verschwand lotrecht in den Nebelschwaden. Kleine Lawinen zischten vorbei. Falls wir während unserer Tour in ähnliche Verhältnisse geraten sollten, würden wir in größte Schwierigkeiten kommen. Unter solchen Bedingungen zu klettern würde katastrophal, wenn nicht unmöglich sein.
Am Eiger vermischen sich Phantasiegebilde irgendwie mit der Wirklichkeit, und die Station in der Eigerwand ähnelte etwas zu sehr der Szene aus einem Traum, den ich seit Jahren immer wieder träume und in dem ich bei Sturm in einer nicht enden wollenden Bergtour um mein Leben kämpfe und schließlich an eine Tür im Fels komme. Die Tür führt in einen warmen Raum mit einer Feuerstelle, Tischen, auf denen dampfendes Essen steht, und einem bequemen Bett. In diesem Traum ist die Tür immer verschlossen.
Etwa vierhundert Meter unterhalb der großen Fenster der Mittelstation gibt es tatsächlich eine kleine hölzerne – immer unverschlossene – Tür, die hinaus in die Nordwand führt. Die Normalroute durch die Wand kommt ganz nahe an dieser Tür vorbei, und schon mancher Kletterer hat sich durch sie vor einem Sturm geflüchtet.
Ein solcher Fluchtweg birgt aber auch seine Gefahren. 1981 rettete sich Mugs Stump, einer der besten Bergsteiger Amerikas, durch diese Tür, nachdem ein Sturm ihn gezwungen hatte, eine Solobegehung der Nordwand abzubrechen, und lief in Richtung Tunneleingang, der etwa eineinhalb Kilometer unterhalb liegt. Bevor er das Tageslicht erreichen konnte, stieß er auf eine von unten kommende Bahn. Das Innere des Eiger besteht aus hartem, schwarzem Kalkstein, was den Tunnelbau sehr erschwerte, und als der Tunnel gebaut wurde, machten die Techniker ihn nicht breiter als unbedingt nötig. Stump wurde rasch klar, daß zwischen den Wagen und der Tunnelwand vielleicht dreißig Zentimeter Platz waren, plus oder minus ein paar Zentimeter. Die Schweizer sind sehr stolz darauf, daß ihre Bahnen pünktlich sind, und es wurde auch klar, daß dieser Bahnführer nicht vorhatte, seinen Fahrplan umzuwerfen, nur weil irgend so ein dämlicher Kletterer auf den Schienen herumturnte. Stump blieb folglich nichts anderes übrig, als die Luft anzuhalten, sich an den Fels zu pressen und sich so schmal wie möglich zu machen. Er überlebte die Vorbeifahrt der Bahn, doch das Erlebnis war genauso haarsträubend wie jede einzelne der kritischen Situationen, die er schon draußen am Berg überstanden hatte.
In der dritten Woche, in der wir auf einen Wetterumschwung warteten, fuhren Marc und ich mit der Bahn nach Wengen und Lauterbrunnen, um einmal etwas anderes als Schnee zu sehen. Nach einem angenehmen Tag, an dem wir die Landschaft und einige Biere genossen hatten, gelang es uns, die letzte Bahn zurück zur Scheidegg zu verpassen, und so stand uns ein langer Marsch in unser Lager bevor. Marc legte ein mörderisches Tempo vor, um vor Einbruch der Dunkelheit dort anzukommen, aber ich beschloß, keine Eile zu haben, zurück in den Schatten des Eiger und die Schneeregion zu kommen, und meinte, daß ein, zwei weitere Bierchen den Weg erträglicher gestalten würden.
Als ich Wengen hinter mir ließ, war es schon dunkel, doch die Wege im Oberland sind zwar steil (die Schweizer glauben offenbar nicht an Serpentinen), aber breit, gut gepflegt und nicht zu verfehlen. Noch wichtiger aber war, daß es auf diesem Weg keine Elektrozäune gab, wie Marc und ich sie an einem regnerischen Abend auf dem Weg von Grindelwald zur Scheidegg in der Woche zuvor erlebt hatten (nachdem wir wieder einmal eine Bahn verpaßt hatten). Diese Zäune sollen Rindviecher am Ausreißen hindern und sind im Dunkeln nach ein paar Bier nicht mehr zu sehen. Sie erwischen einen 1,75 Meter großen Menschen an einer höchst empfindlichen Stelle genau 15 Zentimeter unterhalb der Gürtellinie, und wenn man durchnäßte Turnschuhe anhat, teilen sie einen Schlag aus, der ausreicht, sich zu Vergehen zu bekennen, die man noch gar nicht begangen hat.
Der Marsch von Wengen verlief ohne Zwischenfälle, bis ich mich der Baumgrenze näherte und ein immer wieder unterbrochenes Röhren hörte, das so klang, als würde jemand einer Boeing 747 die Sporen geben. Der erste Windstoß traf mich, als ich um die Schulter des Lauberhorns kam und mich in Richtung Wengernalp wandte. Ein Schlag kam aus dem Nichts, und schon saß ich auf dem Hintern. Es war der Föhn, der vom Eiger herunterblies.
Der Föhn im Berner Oberland – ein Vetter der Santa-Ana-Winde, die in Abständen immer wieder Südkalifornien in Brand setzen, und der Chinooks, die sich brüllend aus den Rocky Mountains hinunter nach Colorado stürzen – kann eine erstaunliche Kraft entwickeln. Er soll unverhältnismäßig viele positive Ionen enthalten und die Menschen verrückt machen. »In der Schweiz«, schreibt Joan Didion in Slouching Towards Bethlehem, »steigt die Selbstmordrate bei Föhn, und die Gerichte einiger Schweizer Kantone erkennen den Wind als mildernden Umstand bei Verbrechen an.« Der Föhn spielt in vielen Eiger-Sagen eine wichtige Rolle. Er ist ein trockener, relativ warmer Wind, der, da er den Schnee und das Eis am Eiger zum Schmelzen bringt, furchtbare Lawinen auslöst. Unmittelbar auf einen Föhnsturm folgt normalerweise ein starker Kälteeinbruch, der die Wand mit einer tückischen dünnen Eisglasur überzieht. Viele Unglücksfälle in der Nordwand sind direkt auf den Föhn zurückzuführen; in dem Film Im Auftrag des Drachen wird ein Föhn Clint Eastwood fast zum Verhängnis.
Ich konnte auf dem Weg durch die Viehweiden kaum etwas gegen den Föhn machen. Ich schauderte bei dem Gedanken, von einem solchen Sturm oben in der Wand überrascht zu werden. Der Wind trieb mir Sand in die Augen und blies mich immer wieder um. Ein paarmal mußte ich schlicht in die Knie gehen und eine Flaute zwischen den Böen abwarten. Als ich schließlich durch die Tür vom Bahnhof an der Scheidegg torkelte, wimmelte es in der Halle von Bahnarbeitern, Köchen, Dienstmädchen, Bedienungen und Touristen, die der Sturm dort festgehalten hatte. Der Föhn, der draußen tobte, hatte alle auf der Scheidegg in eine Art irrsinnigen Rausch versetzt, und es war eine ausgelassene Party im Gange. In einer Ecke wurde zur Musik aus einer plärrenden Musikbox getanzt, in einer anderen standen die Leute auf den Tischen und grölten deutsche Stimmungslieder; und überall wurde nach der Bedienung gerufen und Bier und Schnaps bestellt.
Ich wollte mich schon in das Getümmel stürzen, als ich Marc entdeckte, der mit einem wirren Ausdruck in den Augen auf mich zukam. »Jon«, platzte er heraus, »die Zelte sind weg!«
»Du, das ist mir im Moment egal«, erwiderte ich und versuchte, die Bedienung herzuwinken. »Wir nehmen uns hier heute ein Zimmer und stellen die Zelte morgen wieder auf.«
»Nein, nein, du kapierst nicht. Sie sind nicht zusammengefallen, die Scheißdinger sind richtig weg. Das gelbe hab ich fünfzig Meter von seinem Platz entfernt wiedergefunden, aber das braune ist weg, Mensch. Ich hab überall gesucht, aber nichts gefunden. Wahrscheinlich ist es inzwischen in Grindelwald.«
Die Zelte waren an Baumstümpfen, Betonklötzen und einer Eisschraube befestigt gewesen, die wir in den gefrorenen Grasboden gedreht hatten. In den Zelten waren mindestens zwei Zentner Proviant und Geräte gewesen. Sie konnten unmöglich vom Sturm weggeweht worden sein, aber trotzdem war es so. Das eine Zelt, das vermißt wurde, hatte unsere Schlafsäcke, Kleidung, meine Kletterschuhe, den Kocher und Töpfe, etwas Proviant und weiß Gott was sonst noch enthalten. Wenn wir es nicht wiederfanden, war die wochenlange Warterei umsonst gewesen. Ich machte meinen Anorak zu und stürzte mich wieder hinaus in den Föhnsturm.
Durch reinen Zufall fand ich das Zelt etwa vierhundert Meter vom Standort entfernt mitten auf den Bahngeleisen nach Grindelwald, wo es der Sturm hingeweht hatte. Es war ein wüster Haufen aus zerfetztem Nylon und geknickten, verbogenen Stangen. Nachdem wir es zum Bahnhof zurückgeschleppt hatten, stellten wir fest, daß aus dem Kocher Butan gelaufen war und alles durchtränkt hatte. Außerdem hatte ein Dutzend Eier die Kleidung und die Schlafsäcke mit einer ekligen gelben Sauce überzogen, aber offensichtlich war bei dem Ausflug von der Scheidegg kein wichtiges Gerät verlorengegangen. Wir schmissen alles in eine Ecke und gingen zu der Party zurück, um zu feiern.
Die Windgeschwindigkeit an jenem Abend an der Scheidegg wurde mit 170 Stundenkilometern gemessen. Außer der Verwüstung in unserem Lager knickte der Sturm das große Teleskop auf dem Balkon des Geschenkeladens ab und beförderte eine LKW-große Liftgondel auf die Geleise vor dem Bahnhof. Gegen Mitternacht flaute der Sturm ab. Es folgte ein Temperatursturz, und am Morgen hatten dreißig Zentimeter frischer Pulverschnee den Schnee ersetzt, den der Föhn zuvor weggeschmolzen hatte. Als wir aber dann den Wetterdienst in Genf anriefen, hörten wir fassungslos, daß in ein paar Tagen eine ausgedehnte Schönwetterperiode eintreffen sollte. »Gütiger Gott«, dachte ich, »wir werden tatsächlich noch durch die Wand steigen müssen.«
Die Sonne meldete sich am 8. Oktober zurück, und die Meteorologen versprachen mindestens fünf Tage ohne Niederschläge. Wir ließen der Nordwand noch den Morgen, um sich von dem Schnee zu befreien, der sich nach dem Föhn angesammelt hatte, und marschierten dann durch hüfthohe Verwehungen hinüber zum Einstieg, wo wir ein hastig zusammengeflicktes Zelt aufstellten. Wir lagen früh im Schlafsack, aber ich war so aufgeregt, daß ich nicht einmal so tat, als würde ich schlafen.
Um drei Uhr früh, als wir in die Wand einsteigen wollten, regnete es, und von oben kam ein Bombardement aus Eis und Steinen. Die Tour war gelaufen. Mit heimlicher Erleichterung legte ich mich wieder hin und fiel sofort in tiefen Schlaf. Um neun Uhr morgens wachte ich bei Vogelgezwitscher auf. Das Wetter hatte sich wieder zum Guten gewendet. Hastig packten wir unsere Sachen zusammen. Als wir in die Nordwand einstiegen, hatte ich ein Gefühl im Magen, als ob ein Hund die ganze Nacht darauf herumgekaut hätte.
Von Freunden, die die Nordwand schon durchstiegen hatten, hatten wir erfahren, daß das erste Drittel der Normalroute »ziemlich locker« sei. Das stimmt nicht, zumindest nicht unter den Bedingungen, die wir vorfanden. Auch wenn nur einige Passagen technisch anspruchsvoll waren, war die Situation doch ständig unsicher. Eine dünne Eisschicht überzog den tiefen, lockeren Pulverschnee. Es war leicht nachzuvollziehen, wie Ragone gestürzt war; man hatte das Gefühl, als könnte jeden Moment der Untergrund zusammenbrechen. Wo die Wand steiler wurde, war auch die Schneeauflage dünner, und unsere Pickel prallten ein paar Zentimeter unter der Eiskruste vom Fels ab. Es war unmöglich, in oder unter dem morschen Schnee und Eis irgendeinen Halt zu finden, so daß wir auf den ersten sechshundert Metern die Seile im Rucksack ließen und gemeinsam »solo« gingen.
Unsere Rucksäcke waren lästig und drohten uns jedesmal nach hinten zu ziehen, wenn wir uns zurücklehnten, um die Route über uns zu sondieren. Wir hatten uns bemüht, das Gepäck auf das Wesentlichste zu beschränken, aber der schlechte Ruf des Eiger hatte uns veranlaßt, noch zusätzlich etwas Proviant, Brennstoff und Kleidung einzupacken für den Fall, daß uns ein Sturm in der Wand festhielt, und so viel Kletterausrüstung, um ein Schiff zu versenken. Es war schwierig gewesen zu entscheiden, was mitkommen und was zurückbleiben sollte. Marc entschloß sich schließlich, statt des Schlafsacks einen Walkman und seine beiden Lieblingskassetten mitzunehmen, mit der Begründung, daß, wenn die Lage hoffnungslos würde, der Seelenfrieden, den man beim Anhören der Dead Kennedys und der Angry Samoans empfinde, wichtiger sei, als nachts warm zu bleiben.
Als wir gegen vier Uhr nachmittags die Rote Fluh erreichten, eine überhängende Wand, konnten wir endlich ein paar solide Haken setzen, die ersten während des Anstiegs. Der Überhang bot Schutz vor den unbekannten fallenden Objekten, die gelegentlich vorbeisausten, und so beschlossen wir, dort zu biwakieren, obwohl wir noch über eine Stunde Tageslicht gehabt hätten. Wir schaufelten dort, wo der Schneehang auf den Fels traf, eine lange, schmale Plattform frei und konnten relativ bequem liegen, Kopf an Kopf, den Kocher zwischen uns.
Am nächsten Morgen standen wir um drei Uhr auf und hatten unseren kleinen Absatz eine Stunde vor Tagesanbruch verlassen. Wir kletterten mit Stirnlampe. Eine Seillänge oberhalb des Biwaks stieg Marc eine Passage mit Schwierigkeitsgrad 5.4 (IV+) vor. Marc war ein 5.12-Kletterer (IX. Grad), und deshalb wurde ich etwas unruhig, als er anfing, vor sich hin zu murmeln, und schließlich nicht weiterstieg. Er versuchte, nach links auszuweichen, dann nach rechts, doch eine eierschalendünne Eisschicht auf dem senkrechten Fels verdeckte jeden Griff, den es eventuell gegeben hätte. Quälend langsam schob er sich nach oben, immer nur wenige Zentimeter, indem er die Spitzen der Steigeisen und die Hauen seiner Eispickel an winzigen Felsvorsprüngen aufsetzte, die unter dem Eispanzer gar nicht zu erkennen waren. Fünfmal rutschte er weg, fing sich aber jedesmal nach nur ein, zwei Metern wieder.
Zwei Stunden vergingen, in denen Marc über mir auf die Wand einschlug. Die Sonne kam heraus. Ich wurde ungeduldig. »Marc«, schrie ich, »wenn du das Stück nicht vorsteigen willst, dann komm runter, und ich versuch’s mal.« Der Bluff wirkte: Marc bearbeitete das Steilstück mit neuer Entschlossenheit und hatte es bald überwunden. Als ich jedoch zu seinem Standplatz nachstieg, kamen mir Bedenken. Wir hatten für 25 Meter fast drei Stunden gebraucht. An der Nordwand sind 2400 Meter zu klettern (wenn man alle Traversen mit einrechnet), und davon waren einige ein gutes Stück schwieriger als diese paar Meter.
Das nächste Problem war der berüchtigte Hinterstoisser-Quergang, eine 42 Meter lange Umgehung einiger unüberwindlicher Überhänge und die Schlüsselstelle, um in den oberen Teil der Nordwand zu kommen. Er wurde erstmals 1936 von Andreas Hinterstoisser überwunden, dessen Querung der glatten Platten ein klettertechnisches Meisterstück war. Oberhalb der Passage wurden er und seine drei Gefährten jedoch von einem Sturm überrascht und zur Umkehr gezwungen. Der Sturm hatte die Traverse jedoch total vereist, und die Bergsteiger waren nicht in der Lage, die heikle Stelle im Abstieg zu passieren. Alle vier kamen um. Seit diesem Unglück achten die Bergsteiger darauf, ein Fixseil am Quergang zurückzulassen, um sich den Rückweg zu sichern.
Die Platten des Hinterstoisser-Quergangs waren fünf Zentimeter dick mit Eis überzogen. So dünn es war, es war doch fest genug für unsere Eispickel, wenn wir sie gefühlvoll einsetzten. Außerdem schaute an einigen Stellen ein altes, zersplissenes Fixseil aus dem Eis. Behutsam tasteten wir uns auf den Frontalzacken der Steigeisen über das Eis, wobei wir keine Hemmungen hatten, wann immer möglich das alte Seil zu pakken, und überwanden so den Quergang ohne Probleme.
Nach dem Quergang führte die Route steil aufwärts, über Stellen, die im Mittelpunkt meiner Alpträume standen, seit ich zehn war: Schwalbennest, Erstes Eisfeld, Eisschlauch. Die Kletterei erreichte nie mehr die Schwierigkeit der Passage, die Marc vor dem Hinterstoisser-Quergang geführt hatte, aber es gelang uns selten, einen Haken zu setzen. Wenn einer von uns ausglitt, würden wir beide am Wandfuß landen.
Der Tag schleppte sich dahin, und ich merkte, wie mein Nervenkostüm immer dünner wurde. An einer Stelle, als wir über verkrustetes, brüchiges Steileis im Eisschlauch stiegen, überwältigte mich urplötzlich der Gedanke, daß das einzige, was mich daran hinderte, hinauszufliegen, zwei feine Stahlhauen waren, die ein, zwei Zentimeter tief in einer Substanz steckten, die jener in meinem Gefrierschrank ähnelte, wenn er abgetaut werden mußte. Ich blickte hinunter zum Boden mehr als 900 Meter unter mir und fühlte mich benommen, als ob ich kurz davor wäre, ohnmächtig zu werden. Ich mußte die Augen schließen und mehrere Male tief durchatmen, bevor ich weitersteigen konnte.
Ein 50 Meter langer Abschnitt nach dem Eisschlauch brachte uns zum unteren Rand des Zweiten Eisfelds, knapp oberhalb der Wandmitte. Der erste geschützte Platz, wo wir die Nacht verbringen konnten, war das Todesbiwak, das Band, wo Max Sedlmayer und Karl Mehringer 1935 beim ersten Versuch, die Nordwand zu durchsteigen, in einem Sturm umgekommen waren. Trotz des furchterregenden Namens ist das Todesbiwak wahrscheinlich der sicherste und bequemste Platz zum Biwakieren in der Wand. Um dorthin zu gelangen, mußten wir jedoch noch 540 Meter schräg über das Zweite Eisfeld aufsteigen und dann noch mehrere zig tückische Meter zum höchsten Punkt eines Pfeilers, dem sogenannten Bügeleisen.
Es war ein Uhr mittags. In den acht Stunden, seit dem Verlassen des Biwaks an der Roten Fluh, hatten wir nur etwa 420 Höhenmeter geschafft. Das Zweite Eisfeld machte zwar einen leichten Eindruck, das Bügeleisen darüber aber nicht, und ich hatte erhebliche Zweifel, ob wir in den fünf uns noch verbleibenden Stunden Tageslicht bis zum Todesbiwak kommen würden, das über 600 Meter entfernt war. Wenn es dunkel würde, bevor wir das Todesbiwak erreichten, würden wir gezwungen sein, die Nacht an einem Platz zu verbringen, der schutzlos den Lawinen und Steinen ausgeliefert war, die aus der berüchtigtsten Stelle der Nordwand in die Tiefe rauschten: dem Eisfeld der Spinne.
»Marc«, sagte ich, »wir sollten absteigen.«
»Was?!« rief er entgeistert. »Warum?«
Ich zählte ihm meine Gründe auf: unser langsames Tempo, die Entfernung zum Todesbiwak, der schlechte Zustand der Wand, die steigende Lawinengefahr aufgrund der zunehmenden Tageserwärmung. Noch während wir miteinander sprachen, rieselten kleine Lawinen aus Schneestaub aus der Spinne über uns ins Tal. Nach einer Viertelstunde räumte Marc widerstrebend ein, daß ich recht hatte, und wir begannen mit dem Abstieg.
Wo immer wir Haken finden konnten, seilten wir ab, wo nicht, kletterten wir ab. Als die Sonne unterging, fand Marc unter einer Stelle, die der Schwierige Riß heißt, eine Höhle, in der wir biwakierten. Zu dem Zeitpunkt spielten wir insgeheim schon mit dem Gedanken, ganz aufzugeben, und wir sprachen an dem Abend wenig miteinander.
Bei Tagesanbruch, als wir gerade den Abstieg begonnen hatten, hörten wir Stimmen in der Wand unter uns. Bald tauchten zwei Kletterer auf, ein Mann und eine Frau, die zügig in den Stufen hinaufstiegen, die wir vor zwei Tagen getreten hatten. Aus ihren flüssigen, sicheren Bewegungen war ersichtlich, daß beide außerordentlich gute Kletterer sein mußten. Der Mann war, wie sich herausstellte, Christophe Profit, ein berühmter französischer Alpinist. Er bedankte sich bei uns, daß wir all die Stufen getreten hatten, dann gingen die beiden in einem erstaunlichen Tempo weiter Richtung Schwieriger Riß.
Einen Tag, nachdem wir das Handtuch geworfen hatten, weil die Wand »in schlechtem Zustand« war, sah es so aus, als ob zwei französische Bergsteiger den Aufstieg wie einen Sonntagsspaziergang angingen. Ich blickte kurz zu Marc hinüber, und es hatte den Anschein, als würde er jeden Augenblick losheulen. Wir trennten uns an dieser Stelle und setzten unseren unersprießlichen Abstieg auf getrennten Wegen fort.
Zwei Stunden später stand ich auf dem Schnee am Fuß der Wand. In Wellen überkam mich die Erleichterung. Der Schraubstock, der mir die Schläfen und die Eingeweide zusammengepreßt hatte, war urplötzlich nicht mehr da. Bei Gott, ich hatte überlebt! Ich setzte mich in den Schnee und fing an zu lachen.
Marc saß ein paar hundert Meter entfernt auf einem Felsen. Als ich ihn erreichte, sah ich, daß er weinte, aber nicht vor Glück. Nach Marcs Einschätzung reichte es nicht, die Nordwand nur zu überleben. »Also«, hörte ich mich sagen, »wenn die Franzmänner da hochkommen, können wir immer noch nach Wengen fahren, neuen Proviant kaufen und es dann noch mal versuchen.« Bei diesem Vorschlag hob Marc augenblicklich den Kopf, und bevor ich etwas zurücknehmen konnte, rannte er zum Zelt, um den Weg der französischen Kletterer mit dem Fernglas zu verfolgen.
Dann nahm mein Glück mit der Nordwand jedoch eine Wendung zum Besseren: Christophe Profit und seine Partnerin kamen nur bis zur Roten Fluh, wo wir unser erstes Biwak eingerichtet hatten. Dort ging eine riesige Lawine nieder, die sie so beeindruckte, daß auch sie umkehrten. Einen Tag später, bevor sich mein Eiger-Glück erneut hätte wenden können, saß ich in einem Flugzeug Richtung Heimat.
KAPITEL ZWEI
Gill
Gleich westlich von Pueblo im Bundesstaat Colorado weicht die weite Ebene der Great Plains den ersten hügeligen Ausläufern der Rocky Mountains. Hier, zwischen den Zwergeichen und Kakteen, erhebt sich ein mächtiger Felsbrocken von der Farbe und Beschaffenheit eines verwitterten Ziegelsteins etwa fünf Meter aus dem verdorrten Gras. Der Klotz ist sehr viel länger als hoch und hat eine leicht überhängende Flanke, die wie der rostige Rumpf eines seit langem gestrandeten Schiffes aus dem Sand ragt. Für das Auge des Laien ist die Oberfläche des Blocks fast völlig glatt: Da und dort eine rundliche Ausbuchtung, ein paar winzige Löcher, gelegentlich ein bleistiftschmales Band. Es scheint unmöglich, diesen Sandsteinklotz zu erklettern. Und genau das ist es, was John Gill anzieht.
Gill bestäubt seine Finger mit Magnesia und tritt entschlossen an den Fuß des Felsens. Er klammert sich an kleine Einkerbungen in der Oberfläche und balanciert auf erbsengroßen Vorsprüngen und schafft es irgendwie, den Körper vom Boden hochzuziehen, als würde er frei schweben. Für Gill ist die steile Wand ein Puzzle, das mit Fingerkraft, phantasievollen Bewegungsabläufen und Willenskraft zu lösen ist. Stück für Stück setzt er das Puzzle zusammen, verlagert vorsichtig das Körpergewicht von einem winzigen Griff oder Tritt zum nächsten, bis er schließlich einen Meter unter der oberen Kante des Blocks an den Fingerspitzen hängt. Dort scheint er am Ende zu sein; die Beine baumeln schlaff in der Luft, und seine Stellung ist so vertrackt, daß er mit keiner Hand loslassen kann, um höher zu greifen, ohne zu stürzen.
Mit einem Ausdruck verzückter Ruhe, der nichts von der furchtbaren Anspannung ahnen läßt, unter der seine Muskeln stehen, richtet Gill den Blick nach oben, zieht die Schultern etwas an und schnellt sich dann urplötzlich aus seiner erbarmungswürdigen Position zur Kante hoch. Frei bewegt sich sein Körper wenige Zentimeter durch die Luft empor, bevor der höchste Punkt seines Fluges erreicht ist, aber genau in dem Augenblick, als er wieder erdwärts gezogen wird, stößt seine linke Hand wie eine Schlange, die sich auf eine Ratte stürzt, hinauf zur Kante und krallt sich sicher dort fest. Ein paar Sekunden später steht er oben.
John Gill ist für Kletterer in drei Kontinenten eine lebende Legende, ein Mann, dem die Besten dieses Sports mit Achtung begegnen. Normalerweise erlangt jemand durch todesverachtende Besteigungen im Himalaja, in Alaska, den Alpen oder an den mächtigen Granitwänden des Yosemite Eingang in die Geschichte des Bergsteigens. Gills Ruf beruht dagegen ausschließlich auf Anstiegen, die nicht einmal zehn Meter hoch sind: Er hat sich in die erlesene Gesellschaft von Hermann Buhl, Sir Edmund Hillary, Royal Robbins und Reinhold Messner eingereiht, indem er lediglich auf Felsbrocken steigt.
Damit keine Irrtümer aufkommen: Gills Anstiege mögen sehr kurz sein, aber sie sind in keiner Hinsicht einfach, wie immer man es wendet. Die Felsen, die er erklettert, sind meistens überhängend und weisen keinerlei Risse oder Wülste auf, die so markant wären, daß ein schlechterer Kletterer sie erkennen, geschweige denn an ihnen Halt finden könnte. Gills Routen bieten tatsächlich alle Schwierigkeiten eines ganzen Berges in einem einzigen Klotz aus Granit oder Sandstein von der Größe eines Müllwagens oder Einfamilienhäuschens. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, daß die meisten Bergsteiger eher den Gipfel des Mount Everest erreichen könnten als den höchsten Punkt der meisten Felsblöcke, an denen Gill klettert.
Für Gill sind Gipfel denn auch gar nicht so wichtig. Der eigentliche Spaß des »Boulderns« – der Felsblock heißt im Englischen boulder – liegt mehr im Tun als im Erreichen des Ziels. »Beim Bouldern geht es fast ebensosehr um den Stil wie um den Erfolg«, sagt Gill. »Bouldern ist eigentlich kein Sport. Es ist eine Klettertätigkeit mit metaphysischen, mystischen und philosophischen Bezügen.«
Ende der Leseprobe