
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Im September 2013, 100 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes der "Recherche"? begann bei Reclam eine neue Übersetzung von Marcel Prousts Meisterwerk zu erscheinen, die erste komplett aus einer Hand, die erste auch, die von dem erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts edierten endgültigen französischen Text ausgeht. Die Ausgabe bietet in jedem Band einen ausführlichen Anmerkungsapparat, der jene historischen und kulturhistorischen Informationen enthält, die der Leser erwartet. "Die wiedergefundene Zeit" ist der letzte Band des insgesamt siebenbändigen Romanwerks. Im Frühjahr 1922 setzt Marcel Proust das Wort ›Fin‹ – Ende – unter seinen Roman. Das Erscheinen von "Le temps retrouvé" 1927 wird er nicht mehr erleben; Proust stirbt am 18. November 1922. Mit der "Wiedergefundenen Zeit" schließt sein großes Romanwerk, und zugleich schließt sich der Kreis; am Beginn und am Ende steht: die Zeit. Und auch die beiden Seiten – Swanns Seite und die Seite der Guermantes – sind, wie sich herausstellt, nur noch zwei Aspekte ein und derselben Sache. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 915
Ähnliche
Marcel Proust
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Band 7 Die wiedergefundene Zeit
Übersetzung und Anmerkungen von Bernd-Jürgen Fischer
Reclam
2016 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll und Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961169-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-010906-9
www.reclam.de
Inhalt
Die wiedergefundene Zeit
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Anhang
Zum siebten Band der Ausgabe
Anmerkungen
Literaturhinweise
Inhaltsübersicht
Namenverzeichnis
[7]Erstes Kapitel*
Tansonville
1Den ganzen Tag in diesem etwas zu ländlichen Anwesen, das nur wie ein Ort zum Ausruhen zwischen zwei Spaziergängen oder während eines Regenschauers wirkte, einer dieser Behausungen, in denen jeder Salon wie eine Gartenlaube wirkt und in dem auf den Tapeten der Zimmer im einen die Rosen des Gartens, im anderen die Vögel aus den Bäumen zu einem gekommen sind und einem Gesellschaft leisten – ein jedes für sich –, denn es handelte sich um eine jener alten Wandbespannungen, bei denen jede einzelne Rose so klar ausgearbeitet war, dass man sie hätte pflücken können, wäre sie lebendig gewesen, jeden Vogel in einen Käfig hätte setzen und zähmen können*, und die nichts von der großflächigen Ausstaffierung heutiger Zimmer an sich hatte, bei der sich vor einem silbernen Hintergrund sämtliche Apfelbäume der Normandie in japanischem Stil aufreihen und die Stunden, die man im Bett verbringt, mit Halluzinationen füllen; den ganzen Tag also verbrachte ich in meinem Zimmer, das auf die schönen Grünflächen des Parks hinaussah, auf den Flieder am Eingang, das grüne Laub der hohen, in der Sonne funkelnden Bäume am Ufer des Teichs und auf den Wald von Méséglise. Im großen und ganzen betrachtete ich all das nur deshalb mit Vergnügen, weil ich mir sagte: »Es ist schön, dass ich so viel Grün vor meinem Zimmerfenster habe«, bis ich dann in dem weitläufigen, sattgrünen Gemälde den ganz einfach aufgrund der größeren Entfernung im Gegensatz dazu tiefblau gemalten Glockenturm der Kirche von Combray erkannte. Nicht etwa eine Darstellung dieses Turms, sondern der Turm selbst hatte sich inmitten des leuchtenden Grüns in einem ganz anderen, derart düsteren Ton, dass es fast schien, als sei er nur gezeichnet, in das [8] Rechteck meines Fensters eingeschrieben und führte mir so die Entfernung in Meilen und in Jahren vor Augen. Und wenn ich einen Augenblick mein Zimmer verließ, bemerkte ich am Ende des Flurs, da er in die entgegengesetzte Richtung führte, gleich einem scharlachroten Band die Wandbespannung eines kleinen Salons, die nur aus einfachem, aber rotem Mousselin bestand und bereit war, sich zu entzünden, sobald ein Sonnenstrahl sie treffen würde.
2Während dieser Spaziergänge sprach Gilberte mit mir über Robert, als wende er sich von ihr ab, um sich mit anderen Frauen abzugeben. Und tatsächlich war sein Leben etwas übervoll von ihnen, und zwar, wie auch gewisse Männerkameradschaften bei Männern, die Frauen lieben, mit jenem Charakter überflüssigen Aufwands und unnützer Platzverschwendung, der in den meisten Haushalten Gegenständen eigen ist, die für nichts gut sind. Er kam mehrmals nach Tansonville, während ich dort war. Er war jetzt ganz anders, als ich ihn bisher gekannt hatte. Sein Leben hatte ihn nicht fett und behäbig werden lassen wie Monsieur de Charlus, sondern hatte vielmehr die entgegengesetzte Veränderung in ihm bewirkt und ihm – obwohl er bei seiner Verehelichung seinen Abschied genommen hatte – das flotte Äußere eines Kavallerieoffiziers verliehen, wie er es in dieser Weise nie besessen hatte. In dem Maße, in dem Monsieur de Charlus dicker geworden war, war Robert (der zwar weitaus jünger war, bei dem man aber merkte, dass er sich diesem Ideal mit den Jahren nur desto weiter annähern würde, so wie gewisse Frauen, die finster entschlossen ihr Gesicht ihrer Taille opfern und sich von einem bestimmten Augenblick an nicht mehr aus Marienbad wegrühren, weil sie, da sie nicht mehrere Jugenden zugleich festhalten können, annehmen, dass die der Gestalt noch am ehesten in der Lage sei, für die anderen einzuspringen), in einer entgegengesetzten Auswirkung desselben Lasters, schlanker und behender geworden. Diese Fixigkeit hatte übrigens [9] verschiedene psychologische Ursachen, nämlich die Furcht, gesehen zu werden, den Wunsch, diese Angst nicht merken zu lassen, und die Fieberhaftigkeit, die aus der Unzufriedenheit mit sich selbst und aus dem Überdruss entspringt. Er hatte die Gewohnheit, gewisse üble Örtlichkeiten zu besuchen, von denen er nicht wollte, dass man ihn hinein- oder hinausgehen sah, und in die er sich deshalb, um den scheelen Blicken eventueller Passanten möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, hineinstürzte, als wollte er sie im Sturm erobern. Und diese Windstoßattitüde war ihm geblieben. Vielleicht war sie auch das Verhaltensschema scheinbarer Unerschrockenheit bei jemandem, der nicht zeigen will, dass er Angst hat, und sich keine Zeit lassen will, nachzudenken. Der Vollständigkeit halber sollte man noch den sich mit zunehmendem Alter verstärkenden Wunsch berücksichtigen, jung zu erscheinen, und sogar die Ungeduld jener stets gelangweilten, immer über alles erhabenen Männer, die für das müßige Leben, das sie führen, zu intelligent sind, und in dem ihre Fähigkeiten nicht zum Tragen kommen. Zweifellos kann auch bei diesen der Müßiggang in Lässigkeit seinen Ausdruck finden. Doch vor allem seit Leibesübungen in so hoher Gunst stehen, hat der Müßiggang selbst jenseits der eigentlichen Sportausübung eine sportliche Form angenommen, die sich nicht mehr in Lässigkeit niederschlägt, sondern in einer fiebrigen Lebhaftigkeit, die meint, sie lasse der Langeweile weder Zeit noch Raum genug, sich zu entwickeln.
3Meinem Gedächtnis, sogar meinem unwillkürlichen Gedächtnis, war die Liebe zu Albertine abhandengekommen. Aber es scheint, dass es ein unwillkürliches Gedächtnis der Gliedmaßen gibt, die blasse, unfruchtbare Imitation des anderen, das länger lebt, so wie auch gewisse Tiere oder Pflanzen, die nicht vernunftbegabt sind, längere Zeit leben als der Mensch. Die Beine, die Arme stecken voller schlummernder Erinnerungen. Einmal, als ich [10] ziemlich früh von Gilberte weggegangen war, erwachte ich mitten in der Nacht in diesem Zimmer in Tansonville und rief, noch halb im Schlaf: »Albertine«. Nicht, weil ich an sie gedacht oder von ihr geträumt oder weil ich sie mit Gilberte verwechselt hätte: Eine in meinem Arm sich entfaltende Erinnerung hatte mich nämlich wie in meinem Zimmer in Paris hinter meinem Rücken nach der Klingel suchen lassen. Und als ich sie nicht fand, hatte ich gerufen: »Albertine«, da ich glaubte, meine verstorbene Freundin liege neben mir, wie sie es abends oft tat, und wir seien zusammen eingeschlafen, wobei wir dann beim Erwachen auf die Zeit vertrauten, die Françoise brauchen würde, um herbeizukommen, damit Albertine bedenkenlos die Klingelschnur ziehen könnte, die ich nicht fand.
4Er wurde – zumindest während dieser unerfreulichen Phase – sehr viel harscher und brachte seinen Freunden, mir zum Beispiel, so gut wie keine Empfindungen mehr entgegen. Dagegen zeigte er gegenüber Gilberte Anfälle von Empfindelei*, die er bis ins Komödiantische trieb und die irritierten. Nicht etwa, dass Gilberte ihm tatsächlich gleichgültig geworden wäre. Nein, Robert liebte sie. Aber er belog sie die ganze Zeit; seine Unaufrichtigkeit, wenn nicht sogar der Beweggrund für seine Lügen, kam ständig ans Licht. Und dann glaubte er sich nicht anders herauswinden zu können, als dass er in geradezu lächerlicher Weise das Ausmaß seines durchaus empfundenen Kummers darüber, Gilberte weh getan zu haben, übertrieb. Er kam in Tansonville an und sagte, er müsse schon am nächsten Morgen wegen eines bestimmten Herrn aus der Gegend wieder abfahren, der ihn angeblich in Paris erwartete und der, wenn man ihm just an demselben Abend in Combray begegnete, die Lüge – weil Robert versäumt hatte, ihn vorab zu instruieren – unabsichtlich an den Tag brachte, indem er erzählte, dass er für vier Wochen aufs Land gekommen sei, um sich zu erholen, und so [11] lange auch nicht nach Paris zurückfahren werde. Robert errötete, sah das melancholische, stolze Lächeln Gilbertes, ließ den Tolpatsch unter Verwünschungen brüsk stehen, ging noch vor seiner Frau nach Hause, ließ ihr ein verzweifeltes Briefchen überbringen, in dem er ihr sagte, er habe diese Lüge nur erfunden, um ihr keinen Kummer zu machen, damit sie, wenn sie ihn aus einem Grund wegfahren sah, den er ihr nicht sagen könne, nicht etwa glaube, er liebe sie nicht (was alles letztlich, auch wenn es als Lüge gemeint war, zutraf), bat schließlich, zu ihr kommen zu dürfen, wo er dann teils aus echter Betrübnis, teils aus Überdruss an diesem Leben, teils in einer täglich dreister werdenden Simulation aufschluchzte, sich geißelte, von seinem baldigen Tod sprach und zuweilen aufs Parkett sackte, als würde er ohnmächtig. Gilberte, die ihn zwar in jedem einzelnen Punkt für einen Lügner hielt, sich ganz allgemein jedoch geliebt wähnte, wusste nicht, inwieweit sie ihm glauben sollte, und ängstigte sich wegen dieser Vorahnung eines baldigen Todes und fürchtete, er habe womöglich eine Krankheit, von der sie nichts wusste, weshalb sie auch nicht wagte, seine Pläne zu durchkreuzen und ihn zu bitten, auf seine Reisen zu verzichten.
5Ich verstand übrigens umso weniger, weshalb er sie unternahm, als Morel mit Bergotte* überall dort, wo die Saint-Loups sich aufhielten, ob in Tansonville oder in Paris, empfangen wurde wie ein Sohn des Hauses. Morel konnte Bergotte hinreißend nachahmen. Nach einiger Zeit brauchte man ihn nicht einmal mehr zu bitten, eine Imitation von ihm zum besten zu geben. Wie manche Hysteriker, die man gar nicht erst in Trance zu versetzen braucht, damit sie zu dieser oder jener Person werden, schlüpfte er ganz plötzlich von sich aus in die Rolle.
6Françoise, die bereits all das mit angesehen hatte, was Monsieur de Charlus für Jupien getan hatte, und nun sah, was Saint-Loup für Morel tat, schloss daraus nicht, dass dies ein Zug war, der in [12] bestimmten Generationen der Guermantes immer wieder auftrat, sondern gelangte schließlich – da auch Legrandin viel für Théodore tat – zu der Überzeugung, sie, eine so moralische Person voller Vorurteile, dass es sich um einen Brauch handle, der dank seiner weiten Verbreitung vollkommen respektabel sei. Sie sagte von einem jungen Mann, ob es sich nun um Morel oder Théodore handelte, stets: »Er hat einen Herrn gefunden, der sich schon immer für ihn interessiert und ihm viel geholfen hat.« Und da in einem solchen Fall die Gönner diejenigen sind, die lieben, leiden und verzeihen, zögerte Françoise bei der Wahl zwischen ihnen und den Minderjährigen, die sie verführten, keinen Augenblick, ersteren die edlere Rolle zuzubilligen und sie »gutherzig« zu finden. Ohne zu fackeln, machte sie Théodore Vorwürfe, der Legrandin allerhand üble Streiche gespielt hatte, und sie schien zudem kaum Zweifel über die Natur ihrer Beziehung zu hegen, denn sie fügte hinzu: »Da hat der Kleine begriffen, dass auch er etwas beisteuern muss, und gesagt: ›Nehmen Sie mich zu sich, ich werde Sie lieben, ich werde Sie verwöhnen‹, und meiner Treu, dieser Herr hat so viel Herz, dass Théodore ganz gewiss sicher sein kann, bei ihm vielleicht sehr viel mehr zu finden, als er verdient, denn er ist ein Wirrkopf, aber dieser Herr ist so gut, dass ich oft zu Jeannette (Théodores Verlobter) gesagt habe: ›Mein Kleines, wenn Sie jemals Kummer haben, dann gehen Sie zu diesem Herrn. Er würde glatt auf der Erde schlafen, um Ihnen sein Bett zu lassen. Er hat den Kleinen (Théodore) zu sehr geliebt, um ihn vor die Tür zu setzen. Ganz gewiss wird er ihn niemals im Stich lassen.‹«
7Aus Höflichkeit fragte ich seine Schwester nach dem Familiennamen von Théodore, der inzwischen im Süden lebte. »Aber dann ist er ja derjenige, der mir zu meinem Artikel im Figaro geschrieben hat!« rief ich aus, als ich erfuhr, dass er Sautton* hieß.
8Ebenso schätzte sie Saint-Loup mehr als Morel und war der [13] Auffassung, dass der Marquis trotz all der Streiche, die der Kleine (Morel) ihm gespielt hatte, diesem niemals seine Hilfe verweigern würde, außer er geriete selbst in große Schwierigkeiten, denn er sei ein Mann mit zu viel Herz.
9Er bestand darauf, dass ich in Tansonville blieb, und ließ einmal durchblicken, obwohl ihm offensichtlich nicht mehr daran gelegen war, mir zu schmeicheln, dass mein Eintreffen seiner Frau ein solches Vergnügen bereitet habe, dass sie, nach ihren eigenen Worten, noch den ganzen Abend lang außer sich vor Freude gewesen sei, und das an einem Abend zudem, an dem sie so traurig gewesen war, dass ich sie mit meinem unangekündigten Erscheinen wie durch ein Wunder aus der Verzweiflung gerissen hatte, »vielleicht noch Schlimmerem«, wie er anfügte. Er bat, ich möge versuchen, sie davon zu überzeugen, dass er sie liebe, und sagte, die andere Frau, die er ebenfalls liebe, liebe er weniger, und er werde bald mit ihr brechen. »Und doch«, fügte er mit einer solchen Blasiertheit und einer solchen Vertrauensseligkeit hinzu, dass ich vorübergehend glaubte, der Name Charlie werde wider Roberts Willen »herauskommen« wie eine Lotterie-Nummer, »hatte ich etwas, worauf ich stolz sein kann. Diese Frau, die mir so viele Beweise ihrer Zuneigung schenkt und die ich Gilberte opfern werde, hat sich zuvor niemals etwas aus einem Mann gemacht, sie glaubte selbst, sie sei außerstande, sich zu verlieben. Ich bin der erste. Ich wusste, dass sie sich dermaßen aller Welt verweigert hatte, dass ich es, als ich diesen wundervollen Brief erhielt, in dem sie mir sagte, Glück könne es für sie nur mit mir zusammen geben, kaum fassen konnte. Natürlich müsste ich völlig benebelt sein, wenn mir der Gedanke, die arme kleine Gilberte in Tränen zu sehen, nicht gänzlich unerträglich wäre. Findest du nicht auch, dass sie etwas von Rachel hat?« fragte er mich. Und in der Tat war ich von der unbestimmten Ähnlichkeit verblüfft gewesen, die man jetzt bei genauerer [14] Betrachtung zwischen den beiden allenfalls feststellen konnte. Vielleicht rührte sie von einer tatsächlichen Ähnlichkeit bestimmter Züge her (der zum Beispiel die hebräische Herkunft zugrunde liegen mochte, auch wenn diese Gilberte kaum anzusehen war), derentwegen Robert sich, als seine Familie auf einer Heirat bestand, bei sonst gleichen Vermögensvoraussetzungen stärker zu Gilberte hingezogen gefühlt hatte. Sie rührte außerdem daher, dass Gilberte, die auf Fotografien von Rachel gestoßen war, die sie nicht einmal dem Namen nach gekannt hatte, versuchte, Robert zu gefallen, indem sie gewisse Eigenheiten nachahmte, die der Schauspielerin lieb waren, wie etwa, ständig rote Schleifen im Haar und ein schwarzes Samtband am Arm zu tragen, und sich die Haare färbte, um brünett zu wirken. Dann, als sie merkte, dass all der Kummer ihr Aussehen verdarb, versuchte sie, dem abzuhelfen. Manchmal tat sie das über alle Maßen. Eines Tages, als Robert am Abend für vierundzwanzig Stunden nach Tansonville kommen sollte, war ich so verblüfft, als ich sie ganz merkwürdig verändert – nicht nur anders als früher, sondern anders als an gewöhnlichen Tagen – zu Tisch kommen sah, dass ich aus meiner Verblüffung gar nicht herauskam, als hätte ich eine Schauspielerin vor mir, eine Art von Théodora*. Ich merkte, dass ich sie in meiner Neugier, herauszufinden, was genau sich an ihr verändert hatte, unbewusst allzu sehr anstarrte. Diese Neugier wurde übrigens trotz Gilbertes Vorsichtsmaßnahmen bald befriedigt, als sie sich schneuzte. Denn an all den Farben, die auf dem Taschentuch zurückgeblieben waren und darin eine reiche Palette bildeten, sah ich, dass sie sich über und über angemalt hatte. Daher also dieser blutigrote Mund, den sie zu einem Lächeln zu zwingen suchte in der Annahme, das stehe ihr gut, während die Stunde der Ankunft der Eisenbahn, die näher rückte, ohne dass Gilberte gewusst hätte, ob wirklich ihr Mann oder nicht eine dieser Depeschen eintreffen würde, deren Grundmodell [15] Monsieur de Guermantes geistreich in den Worten »KOMMEN UNMÖGLICH, LÜGE FOLGT« zusammengefasst hatte, ihre Wangen unter dem von der Schminke violett gefärbten Schweiß erbleichen ließ und ihre Augen schwarz umrandete.
10»Ah!, weißt du«, sagte er mit einer aufgesetzt herzlichen Miene, die in schroffem Gegensatz zu seiner spontanen Herzlichkeit von früher stand, und mit alkoholisierter Stimme und in schauspielerhaftem Ton zu mir, »Gilberte glücklich zu sehen, dafür gäbe ich alles! Sie hat so viel für mich getan. Du machst dir keine Vorstellung.« Das Unangenehmste an dem Ganzen war seine Eitelkeit, denn es schmeichelte ihm, von Gilberte geliebt zu werden, und ohne dass er nun zu sagen wagte, er dagegen liebe Charlie, gab er doch über die Liebe, die der Violinist angeblich für ihn empfand, Einzelheiten preis, von denen Saint-Loup sehr wohl wusste, dass sie aufgebauscht, wenn nicht sogar von Grund auf erfunden waren, wo ihn doch Charlie täglich um noch mehr Geld anging. Und dann vertraute er mir Gilberte an und fuhr zurück nach Paris.
11Ich hatte übrigens einmal Gelegenheit – um ein wenig vorzugreifen, denn noch bin ich in Tansonville –, ihn dort in Gesellschaft zu sehen, und zwar aus einer Distanz, die es mir ermöglichte, in seiner trotz allem noch immer lebhaften und charmanten Ausdrucksweise die Vergangenheit wiederzufinden; ich war verblüfft, wie sehr er sich veränderte. Er wurde seiner Mutter immer ähnlicher, doch das hochmütig-ungezwungene Auftreten, das er von ihr geerbt und das sie bei ihm mit Hilfe der vorzüglichsten Erziehung zur Perfektion gebracht hatte, wirkte nun übertrieben und erstarrt; der den Guermantes eigene durchdringende Blick vermittelte den Eindruck, als inspiziere er jegliche Umgebung, in der er sich bewegte, jedoch auf eine nahezu unbewusste Art und Weise, so, als handle es sich eher um eine Gewohnheit oder eine angeborene Eigenheit. Selbst wenn er reglos dastand, wurde er durch die [16] Färbung, die bei ihm noch ausgeprägter war als bei allen anderen Guermantes und die nicht weniger als der Körper gewordene Sonnenschein eines goldenen Tages zu sein schien, mit einem so fremdartigen Gefieder versehen, zu einer so seltenen, so kostbaren Spezies gemacht, dass jede ornithologische Sammlung ihn gern besessen hätte; doch wenn sich obendrein dieses in einen Vogel verwandelte Licht in Bewegung, in Tätigkeit setzte, wenn ich zum Beispiel Robert de Saint-Loup bei einer Soiree, bei der auch ich mich aufhielt, eintreten sah, dann hatte er eine Art, den so seidenweich und hochmütig von der goldenen Federhaube seiner ein wenig gelichteten Haare gekrönten Kopf aufzurichten, den Hals so sehr viel gewandter, anmaßender und koketter zu bewegen als irgendein menschliches Wesen, dass man sich bei all der halb gesellschaftlich, halb zoologisch motivierten Neugier und Bewunderung, die er erregte, fragen musste, ob man sich im Faubourg Saint-Germain oder im Zoologischen Garten befand und ob man einen Edelmann einen Salon durchschreiten oder einen Vogel in seinem Käfig umherstolzieren sah. Dieser Rückfall in die vogelhafte, spitzschnäblige, scharfäugige Eleganz der Guermantes stand jetzt übrigens ganz im Dienste seines neuen Lasters, das sie dazu benutzte, sich gefasst zu zeigen. Und je mehr Gebrauch es davon machte, desto mehr glich er, wie Balzac sagen würde, einer Tante. Wenn man ein wenig Phantasie aufwendete, passte sein Geplapper nicht weniger als sein Gefieder zu dieser Deutung. Er begann, Phrasen von sich zu geben, von denen er glaubte, sie klängen nach »Grand Siècle«*, und imitierte damit die Manierismen des Herzogs von Guermantes*. Doch eine nicht zu bestimmende Winzigkeit bewirkte, dass sie zugleich zu Manierismen des Monsieur de Charlus wurden. »Ich lasse dich einen Moment allein«, sagte er zu mir bei dieser Soiree, als Madame de Marsantes etwas weiter entfernt von uns stand. »Ich will meiner Mutter ein bisschen den Hof machen.«*
[17]12Was seine Liebe betraf, über die er pausenlos redete, so ging es dabei übrigens nicht nur um die zu Charlie, auch wenn diese als einzige für ihn zählte. Von welcher Art die Liebe eines Mannes auch sein mag, man täuscht sich immer in der Zahl der Personen, mit denen er eine Liaison hat, weil man Freundschaften fälschlich für Liebesaffären hält, ein Irrtum im Addieren, aber auch, weil man glaubt, eine erwiesene Liaison schließe eine andere aus, ein Irrtum ganz anderer Art. Zwei Personen mögen sagen: »Die Mätresse von X***, ja, die kenne ich«, dann unterschiedliche Namen nennen und sich doch beide nicht täuschen. Eine Frau, die man liebt, genügt nur selten allen unseren Bedürfnissen, und man betrügt sie mit einer Frau, die man nicht liebt. Was nun also die Art von Liebe angeht, die Saint-Loup von Monsieur de Charlus geerbt hatte, so macht für gewöhnlich ein Ehemann, der dazu neigt, seine Frau glücklich. Das ist eine allgemeine Regel, doch die Guermantes brachten es fertig, davon eine Ausnahme zu machen, weil diejenigen unter ihnen, die diese Neigung hatten, glauben machen wollten, sie hätten im Gegenteil jene zu Frauen. Sie stellten sich ostentativ mit dieser und jener zur Schau und brachten ihre eigene zur Verzweiflung. Die Courvoisiers waren da klüger. Der junge Vizegraf von Courvoisier glaubte, er sei seit Anbeginn der Welt der einzige auf diesem Erdenrund, der sich von jemandem des gleichen Geschlechts in Versuchung gebracht fühlte. In der Annahme, diese Neigung habe der Teufel ihm eingeflößt, kämpfte er dagegen an, heiratete eine hinreißende Frau und machte ihr Kinder. Dann klärte ihn einer seiner Vettern darüber auf, dass diese Neigung ziemlich verbreitet sei, und ging in seiner Güte so weit, ihn zu Örtlichkeiten zu führen, wo er ihr nachgehen konnte. Monsieur de Courvoisier liebte seine Frau deshalb nur umso mehr, verdoppelte seinen Zeugungseifer, und er und sie wurden bald das beste Ehepaar in ganz Paris genannt. Man konnte nichts dergleichen von [18] Saint-Loups Ehe behaupten, weil Robert, statt sich mit seiner Inversion abzufinden, seine Frau tödlich eifersüchtig machte, indem er – ohne jegliches Vergnügen – Mätressen unterhielt.
13Es mag sein, dass Morel, der außerordentlich dunkel war, zu Saint-Loup so notwendig gehörte wie der Schatten zum Sonnenstrahl. Man kann sich in dieser alten Familie sehr gut einen goldblonden, intelligenten, hochangesehenen Landedelmann vorstellen, der in seinem untersten Deck* eine heimliche Neigung, von der keiner etwas weiß, zu Negern birgt.
14Robert ließ übrigens niemals das Gespräch auf jene Art von Liebe kommen, der er huldigte. Wenn ich darüber eine Bemerkung machte, erwiderte er: »Ah!, ich weiß nicht«, mit einem so umfassenden Desinteresse, dass er sogar sein Monokel fallen ließ, »von diesen Dingen habe ich keine Ahnung. Wenn du darüber Informationen suchst, mein Lieber, dann rate ich dir, dich an eine andere Adresse zu wenden. Ich bin Soldat, punktum. So gleichgültig mir solche Sachen sind, so leidenschaftlich verfolge ich den Balkankrieg. Früher hat dich das interessiert, die Etymologie der Schlachten. Ich sagte dir damals, dass wir, wenn auch unter völlig anderen Umständen, die typischen Schlachten wiedersehen würden, zum Beispiel den weiträumigen Einschluss vom Flügel her, also die Schlacht von Ulm. Nun gut!, so anders diese Balkankriege auch sonst sein mögen, Lüleburgaz* ist abermals Ulm, der Einschluss vom Flügel her. Das sind Themen, über die du dich mit mir unterhalten kannst. Aber von dieser Sorte Sachen, auf die du angespielt hast, verstehe ich so viel wie vom Sanskrit.« Ich fragte Robert wegen dieses mysteriösen: »Wir hätten einander sehr gut verstanden.«* Er behauptete, sich nicht daran erinnern zu können, und dass es in jedem Fall nichts Besonderes zu bedeuten gehabt habe.
15Auf diese Themen, die Robert so entschieden von sich wies, kam dagegen Gilberte, sobald er wieder fort war, im Gespräch mit [19] mir gern zurück. Gewiss nicht mit Blick auf ihren Mann, denn sie wusste von nichts, oder tat zumindest so. Aber sie verbreitete sich gern darüber, soweit es andere betraf, entweder, weil sie darin eine Art indirekter Entschuldigung für Robert sah, oder weil dieser sie, wie sein Onkel hin und her gerissen zwischen strengster Verschwiegenheit über diese Themen und dem Bedürfnis, sich auszusprechen und über andere herzuziehen, über vieles in Kenntnis gesetzt hatte. Neben allen anderen wurde auch Monsieur de Charlus nicht geschont; zweifellos, weil Robert, ohne Gilberte etwas über Charlie zu sagen, es doch nicht unterlassen konnte, ihr in der einen oder anderen Form weiterzuerzählen, was er von dem Violinisten erfahren hatte. Und dieser verfolgte seinen einstigen Wohltäter mit seinem Hass. Diese Gespräche, für die Gilberte eine Vorliebe hatte, ermöglichten es mir, sie zu fragen, ob in paralleler Weise Albertine, deren Namen ich einst durch sie zum ersten Mal gehört hatte, als sie noch Schulfreundinnen waren, solche Neigungen hatte. Gilberte konnte mir da keine Auskunft geben. Freilich war es für mich schon seit langer Zeit von keinem Interesse mehr. Doch wie ein Greis, dem das Gedächtnis abhandengekommen ist und der sich von Zeit zu Zeit erkundigt, wie es seinem verstorbenen Sohn geht, fuhr ich mechanisch fort, mich danach zu erkundigen.
16Das Merkwürdige ist, worüber ich mich hier aber nicht verbreiten kann, in welch hohem Ausmaß zu jener Zeit alle Personen, die Albertine geliebt hatte, all jene, die von ihr hätten erlangen können, was sie wollten, wenn schon nicht um meine Freundschaft, so doch darum baten, flehten, ich wage fast zu sagen: bettelten, meine Bekanntschaft zu machen. Es wäre nun nicht mehr nötig gewesen, Madame Bontemps Geld anzubieten, damit sie Albertine zu mir zurückschicken würde. Diese Wende des Lebens, die eintrat, als sie nichts mehr nützte, betrübte mich zutiefst, nicht etwa wegen Albertine, die ich ohne große Freude aufgenommen hätte, wenn [20] sie mir nun nicht mehr aus der Touraine, sondern aus dem Jenseits zurückgebracht worden wäre, sondern wegen einer jungen Frau, die ich liebte und der ich nicht zu begegnen vermochte. Ich sagte mir, dass mir, wenn sie stürbe oder ich sie nicht mehr lieben würde, alle jene, die mich mit ihr hätten zusammenbringen können, zu Füßen* liegen würden. Währenddessen versuchte ich vergeblich, auf sie einzuwirken, denn ich war nicht durch die Erfahrung geheilt, die mich doch hätte lehren sollen – falls sie überhaupt jemals irgendetwas lehrte –, dass zu lieben einem bösen Zauber gleicht, wie man ihn aus Märchen kennt und gegen den man nichts machen kann, bis der Bann gebrochen ist.
17»Just das Buch, das ich hier habe, handelt von solchen Dingen«, sagte sie zu mir. »Es ist ein alter Balzac, den ich durchackere, um mich auf die Höhe meiner Onkel zu bringen, Das Mädchen mit den Goldaugen*. Aber es ist absurd, völlig unglaubwürdig, ein schöner Albtraum. Außerdem kann ja vielleicht eine Frau von einer anderen Frau in dieser Weise überwacht werden, aber niemals von einem Mann.« – »Da täuschen Sie sich, ich habe eine Frau gekannt, die ein Mann, der sie liebte, schließlich regelrecht eingekerkert hat; sie durfte sich mit niemandem treffen und nur mit zuverlässigen Dienstboten rausgehen.« – »Na, das muss ja bei jemandem, der so gut ist wie Sie, Entsetzen hervorrufen. Noch eben meinten Robert und ich, dass Sie heiraten sollten. Ihre Frau würde Sie gesundpflegen, und Sie würden sie glücklich machen.« – »Nein, ich habe einen zu schlechten Charakter.« – »Ach, Unsinn!« – »Bestimmt! Übrigens bin ich einmal verlobt gewesen, aber ich habe mich nicht entschließen können, sie zu heiraten (und schließlich hat sie selbst wegen meines wankelmütigen und pedantischen Charakters verzichtet).« Tatsächlich beurteilte ich inzwischen in dieser allzu simplizistischen Form mein Abenteuer mit Albertine, jetzt, wo ich es nur noch von außen sah.
[21] Als ich in mein Zimmer hinaufging, betrübte mich der Gedanke, dass ich mir nicht ein einziges Mal die Kirche von Combray wieder angesehen hatte, die mich inmitten von Grün in einem violett überhauchten Fenster zu erwarten schien. Ich sagte mir: »Was soll’s, vielleicht in einem anderen Jahr, wenn ich bis dahin nicht gestorben bin«, denn ich sah keinen anderen Hinderungsgrund als meinen Tod und dachte nicht an den der Kirche, die mir nach meinem Tod noch lange Zeit überdauern zu müssen schien, wie sie auch vor meiner Geburt schon lange Zeit bestanden hatte.
18Eines Tages unterhielt ich mich jedoch mit Gilberte über Albertine und fragte sie, ob diese Frauen geliebt habe. »Aber nein!, überhaupt nicht.« – »Aber Sie sagten damals, sie habe eine zweifelhafte Art an sich.« – »Das soll ich gesagt haben?, da müssen Sie sich irren.* Jedenfalls habe ich, falls ich das wirklich gesagt habe, aber Sie irren sich ganz gewiss, im Gegenteil Flirts mit jungen Männern gemeint. Im übrigen geht so etwas in dem Alter wahrscheinlich sowieso nicht sehr weit.« Sagte Gilberte das, um zu vertuschen, dass sie dem zufolge, was Albertine mir erzählt hatte, selbst Frauen liebte und Albertine Avancen gemacht hatte? Oder weil sie (denn die anderen sind oft besser über unser Leben informiert, als wir glauben) wusste, dass ich Albertine geliebt hatte, dass ich ihretwegen eifersüchtig gewesen war (denn die anderen mögen zwar die Wahrheit über uns besser kennen, als wir glauben, überstrapazieren sie aber und begehen durch allzu weitreichende Vermutungen Irrtümer, während wir vielmehr gehofft hatten, sie begingen sie aufgrund des völligen Fehlens von Vermutungen), sich nun dachte, ich sei es noch immer, und mir deshalb aus reiner Güte jene Binde über die Augen legen wollte, die man für Eifersüchtige stets zur Hand hat? Jedenfalls beschritten die Worte Gilbertes von jener »zweifelhaften Art« von damals bis zu dem heutigen Zeugnis eines untadeligen Lebenswandels den entgegengesetzten Weg, dem Albertines [22] Behauptungen gefolgt waren und die praktisch mit dem Geständnis einer mehr oder weniger intimen Beziehung zu Gilberte geendet hatten. Ich hatte darüber nicht weniger gestaunt als über das, was Andrée mir gesagt hatte, denn diese ganze kleine Bande hatte ich zwar anfangs, bevor ich sie kennenlernte, für vollkommen verdorben gehalten; anschließend hatte ich mir klargemacht, dass meine Vermutungen falsch waren, wie es so oft geschieht, wenn man ein ehrbares junges Mädchen, das von den Tatsachen der Liebe nichts weiß, in einem Milieu antrifft, das man zu Unrecht als das verkommenste angesehen hatte. Später dann hatte ich diesen Weg in umgekehrter Richtung zurückgelegt und meine anfänglichen Vermutungen wieder für zutreffend gehalten. Doch vielleicht hatte Albertine mir das nur in der Absicht gesagt, erfahrener zu wirken, als sie war, und um mich in Paris mit einem Nimbus von Sittenlosigkeit zu beeindrucken, ähnlich wie bei meinem ersten Balbec-Besuch mit dem ihrer Tugendhaftigkeit. Und vielleicht auch ganz einfach, weil ich mit ihr über Frauen gesprochen hatte, die Frauen lieben, und sie nicht den Eindruck erwecken wollte, als sei sie gänzlich schimmerlos, ähnlich wie man in einer Unterhaltung ein verständiges Gesicht aufsetzt, wenn die Rede auf Fourier oder Tobolsk* kommt, obwohl man keine Ahnung hat, wer oder was das ist. Sie hatte vielleicht in der Nähe der Freundin von Mademoiselle Vinteuil und von Andrée gelebt, jedoch getrennt von diesen durch eine undurchlässige Wand, weil die beiden meinten, dass sie »nicht dazugehöre«, und sich erst nachträglich – wie eine Frau, die einen Literaten geheiratet hat, anschließend versucht, sich zu bilden – kundig gemacht, um mir gefällig und in der Lage zu sein, meine Fragen zu beantworten, bis ihr eines Tages aufgegangen war, dass sie meiner Eifersucht entsprangen, und sie die Maschinen auf volle Kraft zurück gestellt hatte. Zumindest, sofern nicht Gilberte mich belog. Mir kam sogar der Gedanke, dass Robert im Verlaufe eines [23] Flirts, den er in die Richtung gelenkt hatte, die ihn interessierte, über sie erfahren hatte, dass sie Frauen nicht abgeneigt war, und er sie in der Hoffnung auf Sinneslüste geheiratet hatte, die er dann aber zu Hause offenbar nicht hatte finden können, da er sie anderswo genoss. Keine dieser Hypothesen war absurd, denn unter Frauen wie der Tochter Odettes oder den jungen Mädchen der kleinen Bande gibt es eine solche Vielfalt, eine solche Anhäufung einander ablösender, wenn nicht gar nebeneinander bestehender Neigungen, dass sie mühelos von einer Liaison mit einer Frau zur großen Liebe zu einem Mann übergehen können, so mühelos, dass es schwierig wird, die wirkliche oder vorherrschende Neigung zu bestimmen.
19Ich wollte mir von Gilberte das Mädchen mit den Goldaugen nicht ausleihen, da sie es gerade las. Sie borgte mir aber als Lektüre vor dem Einschlafen an diesem letzten Abend, den ich bei ihr zu Hause verbrachte, ein Buch, das einen ziemlich lebhaften und gemischten Eindruck in mir hervorrief, der aber nicht lange vorhalten sollte. Es war ein Band der unveröffentlichten Tagebücher* der Brüder Goncourt.
Als ich, bevor ich mein Licht löschte, die Seiten las, die ich weiter unten wiedergebe, erschien mir meine mangelnde Eignung zum Schriftsteller, die ich einst schon auf der Seite von Guermantes geahnt hatte und die mir während des Urlaubs, der mit diesem Abend zu Ende ging, bestätigt worden war – einem dieser Abende vor einer Abreise, an denen sich die Erstarrung in Gewohnheiten, die ein Ende finden, löst, und man versucht, sich selbst zu beurteilen –, als etwas weniger Betrübliches, als ob die Literatur ohnehin keine tieferliegende Wahrheit aufdecken würde; und zur gleichen Zeit kam es mir traurig vor, dass die Literatur nicht sein sollte, was ich geglaubt hatte. Andererseits erschien mir der Krankheitszustand, der mich in ein Sanatorium verbannen würde, weniger [24] bedauerlich, wenn die schönen Dinge, von denen die Bücher sprechen, nicht schöner sein sollten als das, was ich zu sehen bekommen hatte. Doch in einem seltsamen Widerspruch bekam ich jetzt, wo das Buch von ihnen sprach, größte Lust, sie wiederzusehen. Hier also die Seiten, die ich las, bis mir die Müdigkeit die Augen schloss:*
20»Vorgestern platzt* hier, um mich zu einem Diner bei sich zu Hause abzuholen, Verdurin herein, der ehemalige Kritiker der Revue und Autor dieses Werkes über Whistler, in dem durchaus gelegentlich die Machart, die künstlerische Kolorierung dieses originären Amerikaners mit großer Empfindsamkeit von diesem Liebhaber all der Raffinessen, all der Hübschigkeiten* gemalter Dinge, wie Verdurin einer ist, verdeutlicht wird. Und während ich mich ankleide, um ihm zu folgen, beginnt er von sich aus mit einem langen Vortrag, den er streckenweise so verschüchtert abstottert wie eine Beichte, über seinen Verzicht zu schreiben, den er gleich nach seiner Vermählung mit der ›Madeleine‹* von Fromentin geleistet hat, ein Verzicht, dem die Gewohnheit zugrunde liege, Morphium zu nehmen, und der den Worten Verdurins zufolge die Wirkung gehabt habe, dass die meisten Gäste im Salon seiner Frau nicht einmal wüssten, dass der Ehemann jemals geschrieben hat, und mit ihm von Charles Blanc, Saint-Victor, Sainte-Beuve und Burty* als Personen sprächen, denen er, ihrer Meinung nach, weit unterlegen sei. ›Jedoch, nicht wahr, Sie Goncourt* wissen sehr wohl, und Gautier* wusste es auch, dass meine Salons* von ganz anderem Kaliber waren als diese erbärmlichen Meister von einst*, die in der Familie meiner Frau für ein solches Meisterwerk gelten.‹ Und dann setzt sich in einer Dämmerung, in der um die Türme des Trocadéro so etwas wie das letzte Flackern eines Lichts liegt, das aus ihnen Türme genau wie jene johannisbeergeleeglasierten Türme der Feinbäcker von [25]einst macht*, die Unterhaltung im Wagen fort, der uns zum Quai Conti bringen soll, wo sie ihre Stadtvilla haben, die ihr Besitzer als den ehemaligen Sitz der venezianischen Botschaft ausgibt und in der es ein Rauchzimmer geben soll, einen Raum, von dem Verdurin mir in einer Weise erzählt, als sei er in der Manier von Tausendundeiner Nacht im Handumdrehen und so, wie er war, aus einem berühmten Palazzo, dessen Namen ich vergessen habe, herbeigeschafft worden, einem Palazzo, dessen Brunneneinfassung eine Marienkrönung darstellt und von der Verdurin behauptet, sie gehöre absolut zu den schönsten Werken Sansovinos* und diene seinen Gästen zum Abstreifen der Zigarrenasche. Und beim Zeus, als wir in der Blaugrüne, der Verschwommenheit eines Mondlichts anlangen, die jenen wahrhaft gleichen, mit denen die klassische Malerei Venedig schützend umhüllt und vor dem die Silhouette der Kuppel des Instituts an die Salute in Guardis* Gemälden gemahnt, habe ich für einen Augenblick die Illusion, mich am Ufer des Canal Grande zu befinden. Und die Illusion wird durch die Konstruktion des Hauses unterstützt, von dessen erstem Stockwerk aus man den Quai nicht sieht, und durch das anregende Sagen des Gastgebers, der Name der Rue du Bac* – Teufel auch, wenn ich je daran gedacht habe – leite sich von der Barke her, mit der einst die Nonnen, die Miramionen, zum Gottesdienst nach Notre-Dame übergesetzt hätten. Ein ganzes Stadtviertel, in dem meine Kindheit herumschlenderte, als meine Tante de Courmont* dort wohnte, und zu dem ich eine Wiederliebe* fasse, als ich nahezu direkt neben der Villa der Verdurins das Schild des Petit Dunkerque* entdecke, eines der wenigen Läden, die noch außerhalb der Bleistift- und Frottis-Vignetten von Gabriel de Saint-Aubin* überleben und in denen das neugierige 18. Jahrhundert seine müßigen Augenblicke dem Feilschen um französische und ausländische Hübschheiten* widmete und ›all dem, was die Künste an Neuestem hervorbringen‹, wie [26] eine Rechnung des Petit Dunkerque uns mitteilt, eine Rechnung, von der, wie ich glaube, Verdurin und ich als einzige noch ein Exemplar besitzen und die mit der Darstellung eines wogenden, schiffsbeladenen Meeres, eines Meeres ganz aus Wellen, das aussieht wie eine Illustration in der Ausgabe der Fermiers généraux von Die Auster und die Kläger*, im Briefkopf durchaus eines jener flüchtigen Meisterwerke aus ornamentalem Papier repräsentiert, auf denen die Regierungszeit Ludwigs XV. ihre Rechnungen zu erstellen pflegte. Die Hausherrin, die mich neben sich Platz zu nehmen aufforderte, erklärte mir liebenswürdigerweise, ihren Tisch lediglich mit japanischen Chrysanthemen geschmückt, diese Chrysanthemen jedoch auf Vasen verteilt zu haben, bei denen es sich um die erlesensten Meisterwerke handle, insbesondere bei einer aus Bronze gefertigten unter ihnen, auf der die Blütenblätter aus rotem Kupfer den Anschein der leibhaftigen Entblätterung der Blume erwecken. Der Arzt Cottard und seine Frau sind anwesend, der polnische BildhauerViradobetski*, der Sammler Swann, eine russische Dame höherer Stände, eine Prinzessin, deren Name auf ›-of‹ mir entfallen ist, und Cottard flüstert mir ins Ohr, dass sie eben diejenige sei, die aus nächster Nähe auf den ErzherzogRudolf* geschossen habe, und nach deren Worten ich in Galizien und im ganzen nördlichen Polen eine absolut exzeptionelle Stellung einnehme, da dort ein junges Mädchen niemals seine Hand zum Ehebund reicht, bevor es nicht weiß, ob ihr Verlobter ein Bewunderer von LaFaustin* ist. ›Ihr Westeuropäer, ihr könnt das nicht verstehen‹schleudert* wie zum Abschluss der Debatte die Prinzessin hin, die mir, beim Zeus, den Eindruck eines wahrlich überlegenen Geistes macht, ›diese Durchdringung der intimsten Bereiche der Frau durch einen Schriftsteller‹. Kinn und Lippen ausrasiert und mit Koteletten wie ein Oberkellner, gibt ein Mann in herablassendem Ton Scherzhaftigkeiten eines Unterprimalehrers von sich, der sich [27] bei den Besten seiner Klasse für die Charlemagne-Preisverleihung beliebt zu machen sucht, und es ist Brichot, der Universitätsprofessor. Als Verdurin meinen Namen nennt, findet er kein Wort, das unsere Bücher kennen würde, und in mir erwacht eine wütende Entmutigung ob dieser Konspiration, die von der Sorbonne gegen uns ins Werk gesetzt wird und die bis in diese liebenswürdige Herberge, in der ich gefeiert werde, den Widerspruch, die Feindseligkeit entschlossenen Schweigens trägt. Wir gehen zu Tisch, und da findet nun ein ganz außerordentliches Defilee von Tellern statt, die allesamt ganz einfach Meisterwerke des Porzellankünstlers sind, dem während eines delikaten Mahles die geschmeichelte Aufmerksamkeit eines Liebhabers bereitwilligst bei seinem künstlerischen Geplauder lauscht – Yung-Tsching-Teller* mit kapuzinerkressefarbener Bordüre, mit dem Bläulichen, mit dem schwellenden Geblätter ihrer Wasserschwertlilien, dem wahrlich dekoratistischen Durchzug eines Fluges Eisvögel und Schnepfen im Morgenrot, einem Morgenrot in ganz und gar eben jenen matutinalen Tönen, die täglich am Boulevard Montmorency* mein Erwachen begrüßen – Meißner Teller, gezierter noch in der Anmutigkeit ihrer Machart, in der Schläfrigkeit, der Blutleere ihrer ins Violette gewelkten Rosen, dem weinroten Zackenrand einer Tulpe, dem Rokoko einer Nelke oder eines Vergissmeinnicht – Sèvres-Teller, texturiert mit den feinen Guillochen ihrer weißen, quirlständigen, oder mit dem artigen Relief eines goldenen Bandes auf der makellos crèmefarbenen Glätte des Porzellangrundes gebundenen Kannelüren – schließlich noch ein komplettes Tafelsilber, auf dem sich jene Myrten von Luciennes* ranken, die der Dubarry nicht unbekannt wären. Und was womöglich nicht minder selten ist, das ist die wirklich ganz und gar bemerkenswerte Qualität der Dinge, die darin serviert werden, ein fein zubereitetes Essen, ein wahrer Schmaus*, wie ihn die Pariser, und das muss einmal laut gesagt [28] werden, auch bei ihren größten Diners niemals bieten und der mich an gewisse Cordons bleus in Jean d’Heurs* erinnert. Selbst die Leberpastete steht in keinerlei Beziehung zu dem faden Brei, den man für gewöhnlich unter dieser Bezeichnung serviert, und ich kenne nicht viele Lokale, in denen ein einfacher Kartoffelsalat in dieser Weise aus Kartoffeln bereitet wird, die die Festigkeit japanischer Elfenbeinknöpfe, die Patina jener kleinen chinesischen Elfenbeinlöffel aufweisen, mit denen die Chinesinnen Wasser über ihren soeben gefangenen Fisch zu gießen pflegen. Das venezianische Glas, das ich vor mir habe, wird mit einem edlen, rotfunkelnden Geschmeide in Form eines außergewöhnlichen Léoville* gefüllt, der bei der Auktion von Monsieur de Montalivet* erstanden wurde, und es ist eine amüsante Unterhaltung für das Vorstellungsvermögen des Auges und, ich scheue nicht davor zurück, es zu sagen, auch für das Vorstellungsvermögen dessen, was einst das Maul genannt wurde, einen Butt hereingetragen zu sehen, der nichts mit dem unfrischen Butt gemein hat, wie man ihn auf den luxuriösesten Tafeln serviert und bei denen sich nach ihrer langwierigen Reise die Konturen ihrer Gräten auf dem Rücken abzeichnen, einen Butt, den man nicht mit dem breiigen Leim serviert, den die Küchenchefs so vieler großer Häuser unter der Bezeichnung weiße Sauce produzieren, sondern mit der genuinen, mit Butter zu fünf Franc das Pfund bereiteten weißen Sauce, diesen Butt also auf einer wundervollen Tching-Hon-Platte* hereingetragen zu sehen, auf der die purpurnen Strahlen eines Sonnenuntergangs über ein Meer hinstreifen, in dem die drollige Seereise einer Bande Langusten* in einer so außergewöhnlichen Wiedergabe ihrer körnigen Punktiertheit stattfindet, dass sie nach lebendigen Panzern geformt zu sein scheinen, einer Platte, deren Innenrand von der Angelschnur eines kleinen Chinesen mit einem Fisch gebildet wird, der mit der himmelblauen Silberung* seines Bauches einen Zauberreigen [29] perlmuttener Farben entfaltet. Als ich zu Verdurin sage, welch erlesenes Vergnügen dies für ihn sein müsse, dieser raffinierte Fraß in diesen Sammlerstücken, wie kein Prinz sie heutzutage mehr in seinen Vitrinen besitzt: ›Man merkt, dass Sie ihn nicht kennen‹, schleudert mir die Herrin des Hauses melancholistischerweise* hin. Und sie spricht zu mir von ihrem Mann als einem waschechten Maniker, dem alle diese Hübschheiten gleichgültig seien, ›ein Maniker‹, wiederholt sie, ›ja, absolut‹, als einem Maniker, der eher Lust hätte, eine Flasche Apfelwein in der ein wenig vulgären Frische eines normannischen Bauernhofes zu trinken. Und diese reizende Frau erzählt uns in ihren wahrhaft in die Farbtönungen eines Landstrichs verliebten Worten mit überschäumendem Enthusiasmus von jener Normandie, in der sie gewohnt haben, eine Normandie*, die wie eine immense englische Parkanlage sei mit dem Wohlgeruch ihrer Hochwälder à la Lawrence*, mit dem Kryptomeria-Samt* in seiner porzellanenen Einfassung von rosaroten Hortensien ihrer natürlichen Rasenflächen, mit dem knittrigen Faltenwurf schwefelgelber Rosen, deren Niederfall über der Tür eines Landmanns, auf der die Inkrustation zweier verschlungener Birnbäume ein ganz und gar ornamentales Wappenschild zu sein vorgibt, an den freien Niederfall eines Blütenzweiges an einem bronzenen Wandleuchter von Gouthière* gemahne, eine Normandie, von der die urlaubenden Pariser absolut nichts ahnten und die von der Schranke eines jeden ihrer Hage geschützt werde, Schranken, die sämtlich anzuheben die Verdurins, wie sie mir gestehen*, sich nicht haben nehmen lassen. Zum Ende des Tages hin traten sie im schlaftrunkenen Verlöschen sämtlicher Farben, in dem das Licht einzig noch von einem in dem Bläulich von Molke nahezu geronnenen Meer herrühre (›Aber nein, nichts von dem Meer, wie Sie es kennen‹, protestiert meine Nachbarin frenetisch in Antwort auf mein Sagen, dass Flaubert uns, meinen Bruder und mich, nach Trouville geführt hatte, [30] ›nichts, absolut nichts, Sie müssen mit mir kommen, sonst werden Sie es niemals erfahren‹), den Heimweg an durch wahre Wälder von Rhododendren voll rosafarbener Blüten aus Tüll, ganz und gar benommen vom Geruch der Sardinenräuchereien, die dem Gatten entsetzliche Asthmaanfälle bescherten – ›ja‹, beharrt sie, ›wie ich sage, regelrechte Asthmaanfälle‹. Darauf kehrten sie im folgenden Sommer zurück und quartierten eine ganze Künstlerkolonie in einem bewundernswürdigen mittelalterlichen Domizil ein, das ihnen ein altes Kloster bot, von ihnen gemietet, für nichts. Und beim Zeus, als ich dieser Frau zuhöre, die sich, während sie durch so viele vornehme Milieus hindurchgegangen ist, dennoch in ihrer Redeweise ein wenig von der Deftigkeit der Sprache einer Frau aus dem Volke bewahrt hat, einer Sprache, die einem die Dinge in der Farbe zeigt, die unsere Phantasie darin sieht, läuft mir das Wasser im Munde zusammen ob des Lebens, das sie ihrem Geständnis zufolge dort unten geführt hat, bei dem jeder in seiner Zelle arbeitete, bei dem vor der Mittagsmahlzeit alle Welt in einem derart großen Salon, dass er zwei Kamine besaß, zu ganz und gar anspruchsvollem Geplauder, untermischt mit kleinen Gesellschaftsspielen, zusammenkam, und das mich an jenes gemahnte, welches dieses Meisterwerk von Diderot*, die Briefe an Mademoiselle Volland*, heraufbeschwört. Dann, nach dem Essen, gingen alle selbst an Hageltagen hinaus in einen Durchbruch der Sonne, die Schraffur eines Platzregens, eines Platzregens, der mit seinem schimmernden Filtrat die Knorren einer wundervollen Flucht jahrhundertealter Buchen umsäumte, die vor den Hintergrund des Eingangstores das dem 18. Jahrhundert so teure vegetabile Schöne* setzten, und Sträucher, deren Blütenknospen an den Bögen ihres Gezweigs von Regentropfen gebildet wurden. Man hielt inne, um dem zarten, von der Frische beschwingten Geplansche eines Gimpels zu lauschen, der sich in der allerliebsten und winzigen Badewanne von [31] Nymphenburger Porzellan der Blütenkrone einer weißen Rose badet. Und als ich zu Madame Verdurin von den Landschaften und den Blumen dort unten spreche, die Elstir so einfühlsam in Pastell wiedergibt: ›Aber durch mich erst hat er das alles kennengelernt‹, schleudert sie mit einem zornigen Zurückwerfen ihres Kopfes hin, ›alles, verstehen Sie mich recht, alles, die wunderlichen Winkel, alle diese Motive, ich habe ihm das auch ins Gesicht geschleudert, als er sich von uns getrennt hat, nicht wahr, Auguste*?, alle Motive, die er gemalt hat. Gegenstände hat er schon immer gekannt, da muss man gerecht sein, das muss man anerkennen. Aber Blumen hatte er noch nie gesehen, er konnte noch nicht einmal eine Althea von einer Stockrose* unterscheiden. Ich habe ihm erst beibringen müssen, Sie werden es nicht glauben, wie Jasmin aussieht.‹ Und man muss zugeben, dass der Gedanke etwas irgendwie Merkwürdiges hat, dass dieser Blumenmaler, den uns die Kunstliebhaber heute als den vorzüglichsten nennen, als besser sogar denn Fantin-Latour, ohne diese Frau hier vielleicht niemals einen Jasmin zu malen verstanden hätte. ›Ja, auf mein Wort, Jasmin; alle diese Rosen, die er gemalt hat, hat er hier gemalt, oder ich habe sie ihm gebracht. Man nannte ihn bei uns nur Herrn Tiche; fragen Sie Cottard, Brichot, alle anderen, ob man ihn hier als einen großen Mann behandelt hat. Er selbst hätte darüber nur gelacht. Ich habe ihm beigebracht, seine Blumen anzuordnen, zu Anfang kriegte er auch das Einfachste nicht hin. Er hat es niemals wirklich verstanden, einen Strauß zusammenzustellen. Ihm fehlte bei der Auswahl der natürliche Geschmack, ich musste ihm immer sagen: ‚Nein, malen Sie nicht das, das ist der Mühe nicht wert, malen Sie dies.‘ Ah!, wenn er ebenso beim Arrangement seines Lebens auf uns gehört hätte wie beim Arrangement seiner Blumen, er wäre nicht diese grässliche Ehe eingegangen!‹ Und die Augen von dieser Hingabe an eine Vergangenheitsträumerei fiebrig erregt, ist mit dem nervösen Gefoppe [32] ihrer manisch sich streckenden Fingerglieder am Flausch ihres Blusenärmels plötzlich in der Verdrehung ihrer leiderfüllten Pose etwas von einem wundervollen Gemälde, das, wie ich meine, niemals gemalt worden ist und aus dem sich all die mühsam zurückgehaltene Auflehnung, alle die wütenden Empfindlichkeiten einer in den zarten Gefühlen, dem Schamgefühl einer Frau verletzten Freundin ablesen ließen. Darauf erzählt sie uns von dem wundervollen Porträt, das Elstir für sie angefertigt hat*, dem Porträt der Familie Cottard, ein Porträt, das sie dem Luxembourg geschenkt hat, als sie sich mit dem Maler überwarf, und gesteht, dass sie es war, die dem Maler die Idee eingegeben hat, den Mann im Frack darzustellen, um dieses ganze schöne Wallen der Weißwäsche einzufangen, und die das Samtkleid für die Frau ausgewählt hat, ein Kleid, das inmitten des Geflimmers der hellen Farbtöne der Tapeten, der Blumen, der Früchte, der den Tutus von Tänzerinnen gleichenden Gazekleider der Töchterchen einen Ruhepol bildet. Es sei ebenfalls sie gewesen, die ihm die Idee zu diesem Kämmen eingegeben habe, eine Idee, für die man anschließend den Künstler gerühmt hat, eine Idee, die letztlich darin bestand, die Frau nicht wie in einer Präsentation wiederzugeben, sondern als überrascht in der Häuslichkeit ihres Alltags. ›Ich sagte ihm: ‚Aber in der Frau, die sich kämmt, die sich das Gesicht abwischt, die sich die Füße anwärmt, wenn sie glaubt, man sehe sie nicht, liegt ein Haufen interessanter Bewegungen, von Bewegungen einer ganz und gar leonardesken Anmut!‘*‹
21Doch auf ein Zeichen Verdurins hin, mit dem er das Wiedererwachen dieser Empörung als unzuträglich für die große Nervöse bedeutet, die seine Frau im Grunde sei, lenkt Swann meine Aufmerksamkeit auf das Collier schwarzer Perlen, das die Hausherrin trägt und das von ihr in noch völlig weißem Zustand bei der Auktion einer Nachfahrin der Madame de La Fayette erworben wurde, [33] die sie von Henrietta von England* zum Geschenk erhalten habe, Perlen, die späterhin schwarz geworden waren aufgrund einer Feuersbrunst, die einen Teil des Hauses zerstörte, in dem die Verdurins wohnten in einer Straße, deren Namens ich mich nicht mehr entsinne, einer Feuersbrunst, nach welcher die Schatulle wiedergefunden wurde, in der sich diese Perlen befanden, doch nunmehr gänzlich schwarz geworden.* ›Und ich kenne ihr Porträt, das dieser Perlen, auf der Schulter besagter Madame de La Fayette, ja, definitiv, ihr Porträt‹, beharrt Swann angesichts der ein klein wenig perplexen Ausrufe der Gästeschar, ›ihr authentisches Porträt in der Sammlung des Herzogs von Guermantes.‹ Eine Sammlung, die nicht ihresgleichen in der Welt besitze, erklärt Swann, und die ich mir ansehen müsse, eine Sammlung, die der berühmte Herzog, der ihr Lieblingsneffe war, von Madame de Beausergent erbte, seiner Tante, der Madame de Beausergent, jetzigen Madame d’Hatzfeldt* und Schwester der Marquise von Villeparisis und der Prinzessin von Hannover*, bei der mein Bruder und ich ihn einst so sehr unter den Zügen des bezaubernden Bübleins namens Basin geliebt haben und welches in der Tat der Vorname des Herzogs ist. Darauf springt der Doktor Cottard noch einmal mit einer Feinsinnigkeit, die den ganz und gar distinguierten Mann in ihm offenbart, auf die Geschichte mit den Perlen zurück und lehrt uns, dass Katastrophen dieser Art im Hirn der Menschen Veränderungen hervorrufen, die ganz und gar jenen ähneln, die man in unbelebter Materie bemerkt, und zitiert in einer wahrhaft noch philosophischeren Weise, als es die meisten Ärzte tun würden, den eigenen Kammerdiener der Madame Verdurin, der in den Schrecknissen dieser Feuersbrunst, bei der er selbst um ein Haar umgekommen wäre, ein anderer Mann geworden war, dessen Handschrift sich so sehr verändert hatte, dass bei dem ersten Brief, den seine noch in der Normandie weilenden Dienstherren von ihm empfingen und der ihnen [34] Mitteilung von dem Vorkommnis machte, diese an das Hirngespinst eines Spaßvogels glaubten. Und nicht nur eine andere Handschrift, Cottard zufolge, der behauptet, aus diesem nüchternen Mann sei ein so abscheulicher Trunkenbold geworden, dass Madame Verdurin genötigt war, ihn zu entlassen. Und die anregende Abhandlung verlagert sich auf ein graziöses Zeichen der Hausherrin hin aus dem Speisesaal in das venezianische Rauchzimmer, in dem Cottard uns berichtet, Zeuge regelrechter Persönlichkeitsspaltungen* geworden zu sein, und den Fall eines seiner Patienten zitiert, den mir vorzuführen er sich liebenswürdigerweise erbietet und den er lediglich an den Schläfen zu berühren brauche, um ein zweites Leben zu erwecken, ein Leben, während dessen er sich an nichts aus dem ersten erinnert, so dass man den in diesem so sehr ehrenwerten Mann mehrere Male bei Diebstählen ergriffen habe, die er in jenem anderen beging, in dem er ganz einfach ein abgefeimter Halunke sei. Woraufhin Madame Verdurin feinsinnig bemerkt, dass die Medizin wirklichkeitsnähere Themen einem Theater liefern könne, in dem die Komik der Verwicklungen auf pathologischen Missverständnissen beruhen würde, was wiederum Madame Cottard veranlasst, den Faden fortzuspinnen und zu erzählen, dass eine ganz ähnliche Grundidee von einem Erzähler ins Werk gesetzt worden ist, dem Liebling der Abendstunden ihrer Kinder und Schotten Stevenson*, ein Name, der über Swanns Lippen diese entschiedene Bestätigung treten lässt: ›Aber Stevenson, das ist ein ganz und gar großer Schriftsteller, ich versichere Ihnen, Monsieur Goncourt, ein sehr großer, den größten ebenbürtig.‹ Und da, als ich in meiner Bewunderung der wappengeschmückten Kassettendecke aus dem alten Palazzo Barberini* in dem Raum, wo wir rauchen, mein Bedauern über die fortschreitende Schwärzung einer gewissen Brunnenschale durch die Asche unserer ›Londres‹* durchblicken lasse, Swann erzählt, ähnliche Flecken auf Büchern, die einst Napoleon I. [35] gehörten und sich nun trotz seiner antibonapartistischen Gesinnung im Besitz des Herzogs von Guermantes befänden, bewiesen, dass der Kaiser Priemtabak kaute, erklärt Cottard, der sich als ein den Dingen wahrhaft auf den Grund gehender Wissensbegieriger erweist, diese Flecken rührten ganz und gar nicht daher – ›aber nein, ganz und gar nicht‹, beharrt er mit Autorität –, sondern von dieser Gewohnheit, die er hatte, stets, sogar auf dem Schlachtfeld, Lakritzpastillen zur Hand zu haben, um seine Leberschmerzen zu beruhigen.* ›Denn er hatte ein Leberleiden, und daran ist er gestorben‹, schließt der Doktor.«
22Hier hielt ich inne, denn am nächsten Tag fuhr ich ab; und im übrigen war die Stunde gekommen, zu der jener andere Herr nach mir verlangte, dem wir täglich die Hälfte unserer Zeit dienstbar sind. Die Aufgabe, die er uns zuerteilt, erledigen wir mit geschlossenen Augen. Jeden Morgen übergibt er uns dann unserem anderen Herrn, da er weiß, dass wir sonst seinem Dienst nur schlecht nachkommen würden. Da wir, wenn unser Geist seine Augen wieder geöffnet hat, neugierig sind zu erfahren, was wir wohl bei dem Herrn getan haben mögen, der seine Sklaven sich hinlegen lässt, bevor er sie überstürzt an die Arbeit setzt, versuchen die größten Schlauköpfe, kaum dass das Werk beendet ist, heimlich zurückzublicken. Doch der Schlaf läuft mit ihnen um die Wette, um die Spuren all dessen verschwinden zu lassen, was sie gern sehen würden. Und seit Jahrhunderten wissen wir nicht allzu viel darüber.*
23Ich schloss also das Tagebuch der Goncourts. Die Bannkraft der Literatur! Ich hätte gern die Cottards wiedergesehen, sie nach vielen Einzelheiten über Elstir gefragt, mir den Laden des Petit Dunkerque angesehen, falls es ihn noch gab, um Erlaubnis nachgesucht, die Villa der Verdurins zu besuchen, wo ich so oft diniert hatte. Doch mir war dabei in unbestimmter Weise nicht wohl. Sicher, ich [36] hatte mir selbst niemals Illusionen darüber gemacht, dass ich weder hinzuhören verstand noch, sobald ich nicht mehr allein war, hinzusehen. Eine alte Frau zeigte meinen Augen nichts in der Art eines Perlencolliers, und was man darüber sagte, ging nicht in meine Ohren ein. Und doch hatte ich diese Menschen im alltäglichen Leben gekannt, oft bei ihnen gegessen, das waren die Verdurins, der Herzog von Guermantes, die Cottards, von denen mir jeder so gewöhnlich vorgekommen war wie meiner Großmutter dieser Basin, von dem sie nicht im geringsten ahnte, dass er der Lieblingsneffe, der junge bezaubernde Heros der Madame de Beausergent war, die ich allesamt für öd und fad gehalten hatte; ich erinnerte mich an die Vulgaritäten ohne Zahl, aus denen ein jeder von ihnen bestand …
Und dass all dieses ein Stern werden sollte in der Nacht!*
24Ich beschloss, die Vorbehalte gegenüber der Literatur, die die Lektüre jener Seiten der Goncourts am Vorabend meiner Abreise aus Tansonville in mir geweckt haben mochte, vorerst beiseitezulassen. Selbst wenn ich das individuelle Merkmal von Naivität ausklammerte, das bei diesem Memoirenautor so frappierend ist, konnte ich ansonsten unter verschiedenen Gesichtspunkten beruhigt sein. Zuerst einmal war hinsichtlich dessen, was mich persönlich anging, meine Unfähigkeit, hinzusehen und hinzuhören, die das erwähnte Tagebuch mir so schmerzhaft verdeutlicht hatte, doch nicht vollkommen. Es gab in mir eine Persönlichkeit, die mehr oder weniger gut hinzusehen verstand, doch diese war eine intermittierende Persönlichkeit, die ihr Leben erst dann wiedergewann, wenn sich irgendein allgemeiner, mehreren Dingen gemeinsamer Wesenszug manifestierte, der ihre Nahrung und Freude ausmachte. Dann sah und hörte diese Persönlichkeit hin, jedoch [37] nur in einer gewissen Tiefe, so dass die Beobachtung keinen Gewinn daraus zog. So wie ein Geometer die Dinge ihrer wahrnehmbaren Eigenschaften entkleidet und nur ihr lineares Substrat sieht, so entging mir, was die Leute erzählten, denn das, was mich interessierte, war nicht, was sie sagen wollten, sondern die Art und Weise, wie sie es sagten, insoweit sie etwas über ihren Charakter oder ihre lächerlichen Seiten verriet; oder vielmehr war dies ein Gegenstand, der immer ganz besonders das Ziel meiner Recherche gebildet hatte, da mir der Punkt, der einem Wesen und einem anderen gemeinsam ist, ein ganz spezifisches Vergnügen schenkte. Nur wenn ich diesen wahrnahm, machte sich mein – selbst hinter meiner scheinbaren Aktivität in der Konversation, deren Lebhaftigkeit vor den anderen eine völlige geistige Lähmung verbarg, bis dahin schlummernder – Geist plötzlich freudig auf die Jagd, doch was er dann verfolgte – wie zum Beispiel die Identität des Salons Verdurin an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten –, lag unter der Oberfläche, jenseits der Erscheinung selbst, in einem etwas zurückgezogeneren Bereich. Daher entging mir der äußerliche, leicht nachzuahmende Charme von Menschen, weil ich nicht die Fähigkeit hatte, mich bei ihm aufzuhalten, so wie ein Chirurg unter einem glatten Frauenleib die innere Erkrankung sieht, die ihn zerfrisst. Wenn ich zum Essen eingeladen war, sah ich die anderen Gäste nicht, weil ich sie, wenn ich glaubte, sie zu betrachten, durchleuchtete.
25Daraus ergab sich, dass, wenn ich all die Beobachtungen zusammenbrachte, die ich während eines Diners an den Gästen hatte machen können, das Muster der von mir nachgezeichneten Linien ein Gefüge psychologischer Gesetzmäßigkeiten zeigte, in dem das Eigeninteresse, das der Gast während seiner Ausführungen verfolgt hatte, so gut wie keinen Platz beanspruchte. Doch nahm dies meinen Porträts jedes Verdienst, wo ich sie doch gar nicht als solche [38] anfertigte? Wenn eines, im Bereich der Malerei, gewisse Wahrheiten über Volumen, Licht, Bewegung augenfällig macht, ist es dann notwendigerweise einem anderen Porträt derselben Person unterlegen, das dem ersten in nichts ähnelt und in dem tausend Details, die in jenem ausgelassen sind, minutiös wiedergegeben wären – einem zweiten Porträt, aus dem man schließen könnte, dass das Modell, das man nach dem ersten für hässlich gehalten hätte, hinreißend gewesen sei, was ja eine dokumentarische und sogar historische Bedeutung haben mag, aber nicht notwendigerweise eine künstlerische Wahrheit darstellt.
26Zudem machte mich meine Eitelkeit begierig zu gefallen, sobald ich nicht allein war, begieriger, mit Geschwätz zu amüsieren, als durch Zuhören zu lernen, zumindest solange ich nicht mit der Absicht in Gesellschaft gegangen war, irgendeiner künstlerischen Fragestellung oder irgendeinem eifersüchtigen Verdacht nachzugehen, der vorher meinen Geist mit Beschlag belegt hatte. Doch ich war unfähig, das zu sehen, wonach nicht zuvor irgendeine Lektüre mein Verlangen geweckt hatte, wovon ich nicht selbst zuvor eine Skizze angefertigt hatte, die ich anschließend mit der Wirklichkeit zu konfrontieren begehrte. Wie oft, und ich wusste das sehr gut, selbst wenn diese Seiten von den Goncourts es mir nicht deutlich gemacht hätten, bin ich unfähig geblieben, meine Aufmerksamkeit auf Dinge oder Leute zu richten, für die ich später, nachdem mir ihr Bild erst einmal in aller Stille vom Künstler präsentiert worden war, Meilen zurückgelegt und mein Leben riskiert hätte, um sie wiederzufinden! Nunmehr hatte sich meine Phantasie in Bewegung gesetzt, begonnen zu malen. Und von dem, wovor ich im vorangegangenen Jahr gegähnt hatte, sagte ich mir mit Bangigkeit, wenn ich es herbeisehnte und im voraus darüber nachdachte: »Sollte es wirklich unmöglich sein, es zu sehen? Was würde ich nicht dafür geben!«
[39]27Wenn man Artikel über Leute liest, sogar einfach über Leute aus der Gesellschaft, in denen sie als »die letzten Repräsentanten einer Welt« apostrophiert werden, »für die es keine Augenzeugen mehr gibt«, so kann man zweifellos ausrufen: »Ist es die Möglichkeit, dass hier von einem so unbedeutenden Menschen derart überschwenglich und lobhudlerisch gesprochen wird!, da hätte ich jetzt sicherlich bedauert, ihn nicht gekannt zu haben, hätte ich nur die Zeitungen und Zeitschriften gelesen und den Mann selbst niemals zu Gesicht bekommen!« Ich aber war vielmehr versucht zu denken, wenn ich solche Passagen in den Journalen las: »Was für ein Unglück, dass ich – damals, als ich mit meinen Gedanken ausschließlich bei dem nächsten Treffen mit Gilberte oder Albertine war – diesem Herrn nicht mehr Beachtung geschenkt habe! Ich hatte ihn für eine gesellschaftliche Niete gehalten, für eine simple Randfigur, aber er war eine Hauptfigur!«
28Die Seiten von Goncourt, die ich gelesen hatte, ließen mich diese Neigung bedauern. Denn vielleicht hätte ich aus ihnen schließen können, dass das Leben lehrt, den Wert der Literatur geringer zu veranschlagen, und uns zeigt, dass das, was der Schriftsteller rühmt, nicht viel wert war; doch ich konnte ebenso gut aus ihnen schließen, dass uns die Lektüre ganz im Gegenteil lehrt, den Wert des Lebens höher anzusetzen, einen Wert, den wir nicht zu würdigen gewusst haben und dessen Größe uns allein durch das Buch klar wird. Zur Not können wir uns darüber trösten, dass wir an der Gesellschaft eines Vinteuil, eines Bergotte wenig Gefallen gefunden haben. Die prüde Bürgerlichkeit des einen, die unsäglichen Fehltritte des anderen, sogar die anmaßende Vulgarität eines Elstir in seinen Anfängen (denn durch das Journal der Goncourts hatte ich herausgefunden, dass er niemand anders war als der »Herr Tiche«, der einst Swann bei den Verdurins so irritierende Vorträge gehalten hatte)* beweisen nichts gegen sie, denn ihr Genie hat sich [40]







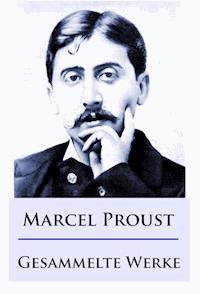


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)


















