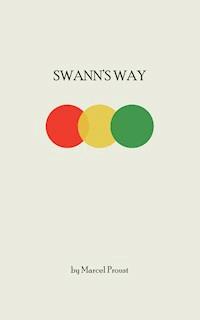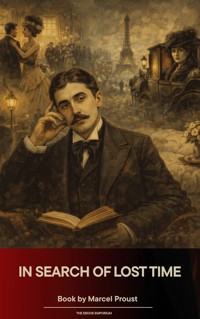0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Der Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (frz. Originaltitel: À la recherche du temps perdu, geschrieben 1908/09 bis 1922 und erschienen zwischen 1913 und 1927) ist das Hauptwerk von Marcel Proust. Enthält den 1919 mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichneten zweiten Band ›Im Schatten junger Mädchenblüte‹ (›À l'ombre des jeunes filles en fleurs‹) sowie den kompletten dritten Band in der Übersetzung von Walter Benjamin und Franz Hessel. Das Buch wurde in die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher aufgenommen. "Um verzweifelt zu sein, muß man am Leben, auch wenn es nur noch unglücklich sein kann, gleichwohl und trotz allem hängen." [Marcel Proust] Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marcel Proust
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Teilausgabe
Marcel Proust
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Teilausgabe
(A la recherche du temps perdu)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Franz Hessel, Walter Benjamin 2. Auflage, ISBN 978-3-954186-42-6
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Buch und Autor
Im Schatten der jungen Mädchen
Die Herzogin von Guermantes
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
Die Erziehung des Herzens
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Buch und Autor
Der Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (frz. Originaltitel: À la recherche du temps perdu, geschrieben 1908/09 bis 1922 und erschienen zwischen 1913 und 1927) ist das Hauptwerk von Marcel Proust.
Enthält den 1919 mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis ausgezeichneten zweiten Band ›Im Schatten junger Mädchenblüte‹ (›À l’ombre des jeunes filles en fleurs‹) sowie den kompletten dritten Band in der Übersetzung von Walter Benjamin und Franz Hessel.
Das Buch wurde in die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher aufgenommen.
*
»Um verzweifelt zu sein, muß man am Leben, auch wenn es nur noch unglücklich sein kann, gleichwohl und trotz allem hängen.« [Marcel Proust]
Im Schatten der jungen Mädchen
1.
Meine Mutter sprach, als davon die Rede war, Herrn von Norpois zum erstenmal einzuladen, ihr Bedauern aus, daß Professor Cottard auf Reisen und sie selbst außer allem Verkehr mit Swann sei, denn beide wären ohne Zweifel für den ehemaligen Botschafter interessant gewesen; mein Vater antwortete, ein Gast von der Bedeutung, ein Gelehrter vom Range Cottards sei bei einem Diner immer am Platze, aber Swann mit seinem hochfahrenden Wesen, der aufdringlichen Art, seine belanglosesten gleichgültigsten Beziehungen auszuposaunen, sei ein gewöhnlicher Wichtigtuer, den der Marquis von Norpois, wie er sich ausdrückte, »übel« finden würde. Diese Erwiderung meines Vaters erfordert ein paar erklärende Worte, da sich mancher wohl noch eines recht mittelmäßigen Cottard und eines Swann entsinnen wird, der in gesellschaftlichen Dingen zurückhaltend diskret und äußerst taktvoll war. Allein, es war mit diesem alten Freunde meiner Eltern dahin gekommen, daß er »Swann junior« und den Swann vom Jockeyklub um eine neue Persönlichkeit vermehrt hatte (und es sollte die letzte nicht sein), um den Gatten Odettes. Wenn er den schlichten Ambitionen dieser Frau Instinkt, Begier und Umsicht, wie sie immer ihm geeignet hatten, anpaßte, so geschah, es in der Absicht, weit unter seiner alten Stellung eine neue anzulegen, die der Gefährtin, die sie mit ihm teilen sollte, entsprach. Er zeigte sich als ganz neuer Mensch. Da er (ohne seinen eigenen Verkehr mit persönlichen Freunden aufzugeben, denen er Odette nicht aufdrängen wollte, soweit sie sich nicht aus eigenem Antrieb um ihre Bekanntschaft bemühten) ein zweites Leben in Gemeinschaft mit seiner Frau mitten unter neuen Wesen begann, hätte man noch verstehen können, daß er, um den Rang dieser Leute und dementsprechend seine persönliche Genugtuung an ihrem Besuch abzuschätzen, als Vergleichspunkt zwar nicht die glänzendsten Erscheinungen der Gesellschaft, in derer vor seiner Ehe verkehrte, aber doch Odettes frühere Beziehungen genommen hätte. Allein selbst wenn man wußte, daß er jetzt mit uneleganten Beamten und zweifelhaften Frauen, den Blüten der Ministerbälle, anzuknüpfen wünschte, mußte man sich doch wundern, ihn, der ehedem und auch heute noch eine Einladung nach Twickenham oder Buckingham Palace so anmutig zu verheimlichen verstand, laut verkünden zu hören, die Frau eines stellvertretenden Kabinettchefs habe Frau Swann ihren Besuch abgestattet. Man wird das vielleicht so verstehen: die Einfachheit des eleganten Swann sei nur eine besonders raffinierte Form der Eitelkeit gewesen, und der alte Freund meiner Eltern habe nach Art gewisser Israeliten abwechselnd die verschiedenen Zustände darzustellen verstanden, welche die Leute seiner Rasse vom naivsten Snobismus und der flegelhaftesten Formlosigkeit bis zur vollendeten Höflichkeit nacheinander durchgemacht haben. Aber der Hauptgrund war einer, der sich auf Menschen im allgemeinen anwenden läßt: unsere Tugenden besitzen nicht an sich selbst die freie Beweglichkeit, die uns beständig über sie verfügen ließe; sie gehen in uns im Laufe der Zeit so enge Verbindung mit den Gelegenheiten ein, bei denen sie aus Pflicht von uns geübt werden, daß eine abweichende Wirksamkeit uns unvorbereitet findet und wir gar nicht auf den Gedanken kommen, sie gestatte die Anwendung eben dieser Tugenden. Bei seinem Eifer um die neuen Beziehungen, die er mit Stolz erwähnte, hatte Swann etwas von der Bescheidenheit und Hochherzigkeit großer Künstler, die sich am Ende ihres Lebens mit Küche und Gartenbau abgeben und eine naive Zufriedenheit über die Komplimente sehen lassen, die man ihren Gerichten oder Gartenbeeten spendet, in dieser Sache aber sich Kritik nicht bieten lassen würden, die sie, wo es um ihre Meisterwerke geht, gern hinnehmen; so geben sie auch eines ihrer Bilder für nichts her, werden aber gleich schlechter Laune, wenn sie im Domino zwei Franken verlieren.
Dem Professor Cottard wird man viel später, wenn wir auf dem Schlosse La Raspelière sind, mit Muße nähertreten. Für den Augenblick mögen, was ihn betrifft, einige Bemerkungen genügen. Bei Swann hat die Veränderung, streng genommen, etwas Überraschendes, da sie bereits vollzogen war und ich sie nicht vermutet hatte zur Zeit, als ich Gilbertes Vater in den Champs-Élysées sah, wo er mich übrigens nie anredete und somit seine politischen Beziehungen vor mir nicht zur Schau tragen konnte (nun, und selbst wenn er es getan hätte, wäre mir seine Eitelkeit vielleicht auch nicht gleich aufgefallen, denn die Vorstellung, die man sich längere Zeit von jemandem gemacht hat, blendet die Augen und verstopft die Ohren; drei Jahre hindurch bemerkte meine Mutter nicht die Schminke, die eine ihrer Nichten auf die Lippen tat, sie schien sich unsichtbar in etwas Flüssigem gelöst zu haben, bis dann eines Tages ein wenig Neuaufgelegtes oder sonst irgendeine Ursache das Phänomen der sogenannten Übersättigung herbeiführte, die ganze nie wahrgenommene Schminke kristallisierte, und meine Mutter angesichts dieses plötzlichen lasterhaften Übermaßes an Farbe erklärte, wie man in Combray getan hätte, es sei eine Schande, und fast ganz den Verkehr mit ihrer Nichte abbrach). Für Cottard aber lag die Epoche, da er Swanns erstem Auftreten im Hause Verdurin beigewohnt hatte, schon ziemlich weit zurück; nun kommen Ehren und öffentliche Auszeichnungen mit den Jahren; ferner kann man ungebildet sein, alberne Witze machen und dabei eine besondere Begabung besitzen, die durch keine allgemeine Kultur zu ersetzen ist, wie etwa die Begabung des großen Strategen oder des großen Chirurgen. In der Tat betrachteten seine Kollegen den Doktor Cottard nicht einfach als einen praktischen Arzt, der mit der Zeit eine europäische Größe geworden war. Die klügsten unter den jungen Medizinern erklärten -- wenigstens ein paar Jahre hindurch, denn die Moden wechseln, da sie selber aus dem Bedürfnis nach Wechsel entstehen --, daß Cottard der einzige Meister sei, dem sie ihre Haut anvertrauen wollten, wenn sie jemals krank würden. Im gesellschaftlichen Verkehr bevorzugten sie allerdings gewisse andere Professoren, die gebildeter und kunstsinniger waren, mit denen sich von Nietzsche und Wagner sprechen ließ. Wenn Frau Cottard musikalische Abende veranstaltete, bei denen sie die Kollegen und Schüler ihres Gatten empfing in der Hoffnung, daß er eines Tages Dekan der Fakultät werde, so zog Cottard es vor, im anstoßenden Salon Karten zu spielen, statt zuzuhören. Jedoch der schnelle, gründliche und sichere Blick seiner Diagnosen war berühmt. Was endlich die Gesamtwirkung von Professor Cottards Benehmen auf einen Mann wie meinen Vater betrifft, so ist zu bemerken, daß die Natur, die wir in der zweiten Hälfte unseres Lebens sehen lassen, wohl oft, aber nicht immer eine Weiterentwicklung oder Entstellung, Vergröberung oder Verkümmerung unserer ursprünglichen Natur ist; bisweilen ist sie deren Umkehrung, das nach allen Regeln der Kunst gewendete Kleid. Außer bei den Verdurin, die nun einmal eine Vorliebe für ihn fühlten, hatte Cottards unsicheres Auftreten, seine übertriebene Liebenswürdigkeit und Schüchternheit ihm in seiner Jugend beständige Sticheleien eingetragen. Welcher barmherzige Freund riet ihm dann, eine eisige Miene aufsetzen? Das wurde ihm durch das Ansehen seiner Stellung leichter gemacht. Überall, außer im Hause Verdurin, wo er instinktiv wieder er selbst wurde, gab er sich kalt, absichtlich schweigsam, abweisend, schneidend, wenn er sprechen mußte, und vergaß nie, Unangenehmes mit einfließen zu lassen. Die neue Haltung konnte er an seinen Patienten ausprobieren, die ihn nicht von früher her kannten und deshalb außerstande waren, Vergleiche zu ziehen; sie hätten sich gewundert zu erfahren, daß er von Natur gar nicht grob war. Vor allem bemühte er sich, den Gefühllosen zu spielen, und selbst, wenn er in der Klinik einen seiner Witze zum besten gab, über die alle Welt, vom Oberarzt bis zum jüngsten Externen, lachte, zuckte kein Muskel in seinem Gesicht, das übrigens, seit er Schnurrbart und Backenbart hatte abnehmen lassen, nicht wiederzuerkennen war.
Und schließlich wollen wir noch sagen, wer der Marquis von Norpois war. Nachdem er vor dem Kriege bevollmächtigter Minister und am 16. Mai Botschafter gewesen, wurde er doch zum Erstaunen vieler zu wiederholten Malen beauftragt, Frankreich in außerordentlichen Missionen zu vertreten, unter anderm sogar mit der Kontrolle der ägyptischen Staatsschuldzahlung, wobei er dank seinen großen finanziellen Fähigkeiten wichtige Dienste leistete; diese Aufträge erteilten ihm radikale Kabinette, denen ein einfacher bürgerlicher Reaktionär seine Dienste verweigert haben würde und bei denen Herrn von Norpois’ Vergangenheit, seine Beziehungen und Anschauungen von Rechts wegen Verdacht erregen mußten. Aber offenbar gaben sich diese weit links stehenden Minister darüber Rechenschaft, daß sie mit einer solchen Wahl ihre besondere Aufgeschlossenheit, sobald es um die höheren Interessen Frankreichs ging, bewiesen, sie überragten das Gros der Politiker (erwarben sie doch das Verdienst, selbst vom Journal des Débats als Staatsmänner anerkannt zu werden) und zogen aus dem Prestige, das sich an einen adligen Namen knüpft, und aus dem Aufsehen, das der Theatercoup einer Wahl, die keiner voraussah, erweckt, ihren Nutzen. Sie wußten, dieser Vorteil war ihnen sicher, wenn sie den Herrn von Norpois beriefen; von ihm war ein Mangel an politischer Loyalität nicht zu befürchten: seine Herkunft war ihnen nicht eine Warnung, sondern eine Garantie. Und darin sollte sich die Regierung der Republik nicht täuschen. Denn zunächst ist eine bestimmte Adelsschicht von Kindheit an erzogen, ihren Namen als einen inneren Vorteil anzusehen, den ihr nichts rauben kann (als einen Wert, den ihresgleichen und die, welche an Geburt über ihr stehen, genau schätzen können), und sie weiß, sie kann sich die -- nachträglich so gut wie resultatlosen -- Bemühungen vieler Bürgerlicher, nur wohlgelittene Meinungen zu bekennen und nur mit wohlgesinnten Leuten zu verkehren, ersparen, da sie ja doch ihrem Werte damit nichts hinzufügen würde. Hingegen ist diese Adelsklasse bestrebt, in den Augen der fürstlichen und herzoglichen Familien, an welche ihre eigene Stellung sie sehr nah heranrückt, zu gewinnen, und zwar, indem sie wohlweislich das Ansehen ihres Namens vermehrt um etwas, das nicht in ihm lag, etwas, das ihm unter ihresgleichen ein Plus gibt: politischer Einfluß, literarischer oder künstlerischer Ruhm oder ein großes Vermögen. Und die Unkosten, die sie dem nutzlosen Krautjunker gegenüber, um den sich die Bürger bemühen, erspart (ein Fürst von Geblüt würde dessen unfruchtbare Freundschaft ihr gar nicht anrechnen), die wendet sie an Politiker, und seien es auch Freimaurer, durch die man in der Gesandtschaftskarriere vorwärtskommt und bei Wahlen poussiert wird, an Künstler und Wissenschaftler, die einen dabei unterstützen, sich in dem Fach, in dem sie die ersten sind, ›durchzusetzen‹, an alle endlich, die neuen Ruhm zu verleihen oder zu einer reichen Heirat zu verhelfen imstande sind.
Was nun Herrn von Norpois persönlich betrifft, so hatte er sich in langer diplomatischer Praxis vor allem mit jenem negativen Geist konservativer Routine vollgesogen, den man ›Regierungsmentalität‹ nennen könnte und der in der Tat allen Regierungen und unter allen Regierungen insbesondere wieder den Kanzleien eigen ist. Seine Laufbahn hatte ihm Abneigung, Vorsicht und Mißachtung gegenüber den mehr oder weniger revolutionären, zumindest inkorrekten Maßnahmen eingegeben, zu denen die Opposition ihre Zuflucht nimmt. Außer bei einigen Ungebildeten aus der Masse und der Gesellschaft, für die der Unterschied der Lebensarten toter Buchstabe bleibt, besteht das ausgleichende Moment überall nicht in der Gemeinschaft der Überzeugungen, sondern in der Blutsverwandtschaft der Geister. Ein Akademiker vom Schlage Legouvés, der etwa Anhänger des Klassizismus wäre, würde eher dem Lobe Victor Hugos von Seiten eines Maxime Ducamp oder Mézières Beifall gespendet haben als dem Boileaus von Seiten Claudels. Gemeinsamer Nationalismus genügt, um Barrès seinen Wählern nahe zu bringen, die vermutlich keinen großen Unterschied zwischen ihm und Herrn Georges Berry machen, genügt aber nicht denjenigen seiner Kollegen von der Akademie gegenüber, die seine politischen Meinungen teilen, aber eine andere Geistesart haben und ihm sogar Gegner wie Ribot und Deschanel vorziehen, denen sich wiederum manche treuen Monarchisten viel näher fühlen als einem Maurras oder Léon Daudet, obwohl diese gleichfalls die Rückkehr des Königs wünschen. Da Herr von Norpois mit Worten geizte, nicht nur aus Vorsicht und Zurückhaltung (Gewohnheiten seines Berufes), sondern auch, weil Worte mehr Gewicht und größeren Reichtum an Nuancen für die haben, die ihre zehnjährigen Bemühungen um die Annäherung zweier Länder -- in einer Rede oder einem Protokoll -- durch ein einfaches scheinbar banales Adjektiv, in dem aber für sie eine ganze Welt liegt, zusammenfassen und wiedergeben --, so galt er für sehr kalt in der Kommission, wo er seinen Sitz neben meinem Vater hatte, den jedermann zu der Freundschaft, die ihm der ehemalige Botschafter bewies, beglückwünschte. Mein Vater war selbst der erste, der sich über sie wunderte. Im allgemeinen nicht eben liebenswürdig, war er gar nicht gewohnt, daß man sich außerhalb seines engern Freundeskreises um ihn bemühte, und schlicht und aufrichtig gestand er das. Ihm war ganz klar, daß in dem Entgegenkommen des Diplomaten der ganz individuelle Standpunkt zutage trat, von dem aus jeder sich zu seinen Sympathien entscheidet, und alle geistigen Vorzüge oder eine Feinfühligkeit, die manchen von uns ärgert und reizt, keine so gute Empfehlung sind wie munteres offenes Sich-Geben, das wiederum in den Augen vieler anderer für leer, leichtfertig und nichtig gilt. »Norpois hat mich wieder zum Essen eingeladen; merkwürdig! Alle sind ganz verblüfft in der Kommission, wo er zu niemand persönlich Beziehungen hat. Ich bin sicher, er wird mir wieder Aufregendes vom Kriege Siebzig erzählen.« Mein Vater wußte, daß Herr von Norpois vielleicht als einziger den Kaiser auf die wachsende Macht und die kriegerischen Absichten Preußens aufmerksam gemacht hatte und daß Bismarck seine Klugheit besonders hoch einschätzte. Letzthin noch bei Gelegenheit der Galavorstellung in der Oper zu Ehren des Königs Theodosius nahmen die Zeitungen Notiz von dem ausgedehnten Gespräch, in das der Monarch Herrn von Norpois gezogen. »Ich muß doch herausbekommen, ob der Besuch des Königs wirklich wichtig ist«, sagte mein Vater, der sich sehr für äußere Politik interessierte, zu uns. »Ich weiß ja, daß der alte Norpois sehr zugeknöpft ist, aber mit mir kann er von reizender Offenheit sein.«
Für meine Mutter hatte der geistige Habitus des Botschafters an sich wohl nichts besonders Anziehendes. Und ich muß sagen, die Ausdrucksweise des Herrn von Norpois gab ein so vollständiges Repertoire der überlebten Redewendungen, wie sie zu einer bestimmten Karriere, Klasse und Epoche -- einer Epoche, die für diese Klasse und Karriere vielleicht wirklich noch nicht erledigt ist -- passen, daß es mir manchmal leid tut, nicht ganz rein und unverändert die Worte behalten zu haben, die ich von ihm hörte. Damit hätte ich das Altmodische höchst effektvoll und ebenso leicht und treffend herausgebracht wie jener Schauspieler vom Palais-Royal, den man fragte, wo er denn seine überraschenden Hüte fände, und der antwortete: »Ich finde meine Hüte nicht; ich behalte sie.« Mit einem Wort, ich glaube, meine Mutter fand Herrn von Norpois ein bißchen vieux jeu, was ihr in bezug auf seine Manieren beileibe nicht mißfiel, sie aber weniger entzückte im Bereiche nicht gerade der Ideen -- denn die des Herrn von Norpois waren sehr modern -- sondern der Ausdrucksweise. Allein sie fühlte, daß es ihrem Gatten in zarter Weise schmeichelte, wenn sie ihm mit Bewunderung von dem Diplomaten sprach, der eine so seltene Vorliebe für ihn bezeugte. Wenn sie meinen Vater in seiner guten Meinung von Herrn von Norpois bestärkte und ihn so dazu brachte, auch von sich selbst eine gute Meinung zu bekommen, war sie sich bewußt, eine ihrer Pflichten zu erfüllen, nämlich die, ihrem Gatten das Leben angenehm zu machen, wie sie es tat, wenn sie darüber wachte, daß die Küche gepflegt war und die Bedienung sich schweigsam vollzog. Und da sie außerstande war, meinen Vater zu belügen, trainierte sie sich innerlich, den Botschafter zu bewundern, um ihn aufrichtig loben zu können. Übrigens hatte sie ein natürliches Wohlgefallen an seiner gütigen Miene und seiner altmodischen zeremoniösen Höflichkeit (wenn er hochaufgerichtet des Weges kam und sah meine Mutter im Wagen vorbeifahren, so warf er die kaum angerauchte Zigarre weg, ehe er den Hut zog), ferner an seiner gemessenen Konversation: er sprach so wenig wie möglich von sich selbst und zog immer in Betracht, was seinem Unterredner angenehm sein konnte; endlich an seiner Pünktlichkeit im Beantworten von Briefen; die war erstaunlich: wenn mein Vater ihm geschrieben hatte und einen Brief erhielt, auf dessen Umschlag er Herrn von Norpois’ Handschrift erkannte, so war seine erste Regung, anzunehmen, ihre Briefe hätten sich durch einen unglücklichen Zufall gekreuzt; es war, als fänden für Herrn von Norpois auf der Post Extra-Luxus-Leerungen statt. Meine Mutter fand es wunderbar, daß er trotz so gehäuften Beschäftigungen so genau, trotz ausgedehntem Verkehr so liebenswürdig war, und bedachte nicht, daß diese ›Trotz‹ eigentlich lauter ›Weil‹ waren und -- wie Greise für ihr Alter erstaunlich, Könige schlicht, Kleinstädter immer auf dem laufenden sind -- gerade seine Lebensgewohnheiten Herrn von Norpois gestatteten, soviel Beschäftigungen gerecht zu werden und zugleich so ordentlich in seinen Antworten zu sein, in Gesellschaft zu gefallen und uns liebenswürdig entgegenzukommen. Überdies beruhte der Irrtum meiner Mutter wie der aller zu Bescheidenen darauf, daß sie, was sie selbst betraf, den Angelegenheiten der andern unterordnete und somit von ihnen absonderte. Die schnelle Antwort, die sie dem Freunde meines Vaters hoch anrechnete und die doch nur deshalb umgehend eintraf, weil er tagtäglich viele Briefe schrieb, nahm sie von der großen Anzahl seiner Briefe aus, obwohl es nur einer unter vielen war; sie kam nicht darauf, daß ein Diner bei uns für Herrn von Norpois einer der zahllosen Akte seines sozialen Lebens war, sie erwog nicht, daß der Botschafter von seiner diplomatischen Tätigkeit her gewohnt war, Dinereinladungen als Teil seiner Funktionen anzusehen, und daß es zuviel von ihm verlangt gewesen wäre, die eingewurzelte Grazie, die er bei solcher Gelegenheit entfaltete, eigens abzutun, wenn er zu uns essen kam.
Sein erstes Diner bei uns nahm Herr von Norpois zu einer Zeit ein, als ich noch in den Champs-Élysées spielte, und es ist in meinem Gedächtnis geblieben, weil ich am Nachmittage des gleichen Tages endlich die Berma in einer Matinée als Phèdre hören sollte, auch, weil mir im Gespräch mit Herrn von Norpois plötzlich und auf besondere Art bewußt ward, daß alles, was Gilberte Swann und ihre Eltern betraf, bei mir ganz andere Gefühle erweckte als diese Familie bei jedwedem sonst auslöste.
Sicherlich hatte meine Mutter die Niedergeschlagenheit bemerkt, in die mich die Nähe der Neujahrsferien versenkte, in denen ich, wie sie mir selbst angezeigt hatte, Gilberte nicht sehen sollte, und, um mich zu zerstreuen, sagte sie eines Tages zu mir: »Wenn du noch immer so große Lust hast, die Berma zu hören -- der Vater wird, glaube ich, vielleicht erlauben, daß du hingehst; die Großmutter könnte dich mitnehmen.«
Daran war Herr von Norpois schuld, der meinem Vater gesagt hatte, er solle mich doch die Berma hören lassen, das gäbe einem jungen Menschen einen Eindruck fürs ganze Leben; und mein Vater, bisher sehr dagegen, daß ich mit Dingen meine Zeit verlöre, die er zum Ärger meiner Großmutter nutzloses Zeug nannte, das meiner Gesundheit schlecht anschlagen könne, war nun nahe daran, den von dem Botschafter angepriesenen Theaterbesuch von ungefähr in die Gesamtheit der Rezepte einzufügen, die für eine glänzende Laufbahn von Wert sind. Für die Großmutter war es ein großes Opfer gewesen, mich auf den Nutzen verzichten zu lassen, den es nach ihrer Meinung für mich hatte, die Berma spielen zu sehn, ein Opfer, das man der Rücksicht auf meine Gesundheit bringe, und nun mußte sie mitansehen, daß diese Rücksicht auf ein bloßes Wort des Herrn von Norpois vernachlässigt werden sollte. Als unverbesserliche Rationalistin setzte sie ihre Hoffnung in das mir verordnete Regime der freien Luft und des Früh-zu-Bett-Gehens, beklagte die Verletzung dieser Vorschriften, die ich begehen würde, als ein Ungemach und sagte ganz betrübt zu meinem Vater: »Wie leichtsinnig Sie sind!« Wütend erwiderte er: »Wie? Jetzt wollen mit einmal Sie nicht mehr, daß er hingeht! Das ist doch stark! Nachdem Sie uns immer wiederholt haben, es könne ihm von Nutzen sein.«
Aber in einem für mich noch viel wichtigeren Punkte hatte Herr von Norpois die Absichten meines Vaters geändert. Dieser hatte immer gewünscht, ich solle Diplomat werden; mir aber war, auch für den Fall, daß ich eine Zeitlang einem Ministerium angegliedert bliebe, der Gedanke unerträglich, man könne eines Tages als Botschafter mich in Hauptstädte schicken, die Gilberte nicht bewohnen würde. Da wäre ich lieber auf die literarischen Pläne von früher zurückgekommen, die ich im Verlauf meiner Spaziergänge in der Gegend um Guermantes aufgegeben hatte. Allein mein Vater hatte beständig dagegen Einspruch erhoben, daß ich der literarischen Laufbahn mich zuwende; er stellte sie tiefer als die Diplomatie und sprach sogar den Namen ›Laufbahn‹ ihr ab,-- bis zu dem Tage, da Herr von Norpois, der die diplomatischen Beamten neuen Schlages nicht besonders liebte, ihm versicherte, man könne als Schriftsteller ebenso hohes Ansehen gewinnen, eine nicht geringere Wirksamkeit ausüben und mehr Unabhängigkeit bewahren als in den Botschaften.
»Das hätte ich nicht gedacht: der alte Norpois hat gar nichts gegen den Gedanken, daß du Literatur treibst«, hatte mein Vater zu mir gesagt. Und da er selber ziemlich einflußreich war, meinte er, es gäbe nichts, das sich nicht im Gespräche unter Männern von Gewicht arrangieren und zu einer glücklichen Lösung führen ließe. »Ich werde ihn einen dieser Abende aus der Kommission zum Essen mitbringen. Du wirst ein bißchen mit ihm plaudern, damit er dich schätzen lerne. Schreib etwas Hübsches, das du ihm zeigen kannst; er steht sehr gut mit dem Direktor der Revue des Deux-Mondes, da wird er dich hineinbringen, das schafft er, er ist schlau; er scheint wahrhaftig zu finden, daß die Diplomatie heutzutage ...!« Der Gedanke an das Glück, nicht von Gilberte getrennt zu werden, machte mich begierig, nicht aber fähig, etwas Schönes, das man Herrn von Norpois zeigen könne, zu schreiben. Nach einigen vorläufigen Seiten fiel mir vor Überdruß die Feder aus der Hand, ich weinte vor Wut darüber, daß ich nie Talent haben würde, daß ich unbegabt sei und nicht einmal den Glücksfall, den Herrn von Norpois’ bevorstehender Besuch bot, nützen könne, um auf die Dauer in Paris zu bleiben. Einzig der Gedanke, man werde mich die Berma hören lassen, lenkte mich von meinem Kummer ab. Aber wie ich mir nicht wünschte, Stürme an anderer Stätte als an den Küsten zu erleben, wo sie am heftigsten sind, so wollte ich die große Schauspielerin auch nur in einer der klassischen Rollen hören, in denen sie, wie mir Swann gesagt hatte, an das Erhabene grenze. Denn da wir in unserm Verlangen nach gewissen Eindrücken der Natur oder Kunst der Hoffnung leben, etwas Kostbares zu entdecken, haben wir Bedenken, unsere Seele statt ihrer geringere Eindrücke aufnehmen zu lassen, die uns über den genauen Wert des Schönen irreführen könnten. Die Berma in Andromaque, in Les Caprices de Marianne, in Phèdre, das gehörte zu den großartigen Dingen, die meine Phantasie so sehr begehrt hatte. Ich würde das gleiche Entzücken erleben wie an dem Tage, da mich die Gondel zu Füßen des Tizian der Frari-Kirche oder der Carpaccio von San Giorgio dei Schiavoni absetzen werde, wenn ich jemals von der Berma würde die Verse sagen: ›Man sagt, Euch nimmt von uns ein rascher Abschied fort, o Herr usw.‹ Ich kannte sie in der einfachen Wiedergabe Schwarz auf Weiß, welche die gedruckten Ausgaben bieten, aber, als sollte eine Reise wirklich werden, schlug mir das Herz bei dem Gedanken, diese Verse tatsächlich endlich baden zu sehen in Luft und Sonne der goldenen Stimme. Ein Carpaccio in Venedig, die Berma in Phèdre, diese Meisterwerke bildender und dramatischer Kunst waren für mich von einem Nimbus umgeben, der ihnen eine besondere Lebendigkeit und Unablösbarkeit gab: hätte ich einen Carpaccio in einem Saal des Louvre oder die Berma in einem Stücke, von dem ich noch nie gehört hatte, sehen sollen, es hätte mich nicht so herrlich bestürzt, endlich die Augen aufzuheben zu dem unfaßbaren einzigen Gegenstand meiner tausend Träume. Ferner erwartete ich von dem Spiel der Berma Offenbarungen über bestimmte Erscheinungsformen des Adels, des Schmerzes, und so mußte für mich das Große und Wahrhafte ihres Spieles noch größer und wahrhafter werden, wenn die Künstlerin es über ein Werk von wirklichem Wert ausbreitete statt Wahres und Schönes in ein mittelmäßiges und gewöhnliches Gewebe zu sticken.
Schließlich würde es mir, wenn ich die Berma in einem neuen Stück zu hören bekäme, nicht leicht sein, ihre Kunst, ihre Diktion zu beurteilen, denn ich könnte nicht scheiden zwischen einem mir noch nicht bekannten Text und dem, was Tonfall und Gebärde hinzutäten, sie würden für mich eine Einheit mit ihm bilden; die alten Werke hingegen, die ich auswendig konnte, erschienen mir wie weite Spielräume, die der Künstlerin zur Verfügung waren, ihr offenstanden, und ich konnte bei ihnen gewiß die Gestaltungskraft der Berma uneingeschränkt würdigen, die sie gewissermaßen al fresco mit immer neuen Eingebungen ihrer Inspiration bedecken würde. Nun hatte sie leider seit Jahren die großen Bühnen verlassen, machte das Glück eines Boulevardtheaters, wo sie der Star war, und spielte nichts Klassisches mehr; umsonst sah ich die Anzeigen durch, die immer nur moderne Stücke ankündigten, eigens für sie von beliebten Autoren verfertigt, -- bis ich eines Morgens auf der Anschlagsäule die Matineen der Neujahrswoche studierte und zum erstenmal -- als zweiten Teil einer Vorstellung nach einem vermutlich unwesentlichen Einakter, dessen Titel mir dunkel blieb, weil er auf eine mir ganz unbekannte Handlung hindeutete, -- zwei Akte Phèdre mit Frau Berma entdeckte und an den folgenden Matineen Le Demi-Monde und Les Caprices de Marianne, Titel, die wie Phèdre für mich durchsichtig waren, ganz von Klarheit erfüllt, -- so gut kannte ich die Werke --, bis auf den Grund erleuchtet vom Lächeln der Kunst. Es schien mir Frau Berma einen neuen Adel zu geben, als ich in den Zeitungen las, sie selbst habe sich entschlossen, in einigen ihrer früheren Schöpfungen vor das Publikum zu treten. Die Künstlerin wußte, daß gewisse Rollen ein Interesse haben, das ihr erstes Erscheinen oder den Erfolg ihrer Wiederaufnahme überdauert; sie betrachtete deren Darstellung als Vorführung von Museumsstücken, Modellen für die Generation, die sie darin bewundert, und die, welche sie noch nicht darin gesehen hatte. Und wenn sie nur mitten unter Stücken, die nur dazu bestimmt waren, einen Abend lang die Zeit zu vertreiben, Phèdre anzeigte, ein Titel, nicht länger als der der andern und in den gleichen Lettern gedruckt, gab sie damit etwa dasselbe zu verstehen wie eine Hausfrau, die uns, wenn man zu Tische geht, den Gästen vorstellt und mitten unter den Namen von Eingeladenen, die nur Eingeladene sind, im gleichen Tonfall, mit dem sie die anderen nennt, sagt: Herr Anatole France.
Der Arzt, der mich behandelte -- der, welcher mir das Reisen ganz verboten hatte -- riet meinen Eltern davon ab, mich ins Theater gehen zu lassen; ich würde krank davon werden, vielleicht für lange Zeit, und schließlich und endlich mehr Leiden als Vergnügen davon haben. Solch eine Besorgnis hätte mich gehemmt, wenn das, was ich von der Aufführung erwartete, nur ein Vergnügen gewesen wäre, das durch spätere Leiden einfach im Ausgleich aufgehoben werden kann. Aber -- gerade wie von der Reise nach Balbec oder der nach Venedig, die ich so sehr ersehnte -- wollte ich von der Matinee etwas ganz anderes als ein Vergnügen: Wahrheiten wollte ich, die einer Welt angehörten, wirklicher als die, in der ich lebte, und die, einmal erworben, mir nicht mehr von unbedeutenden, ob auch für meinen Körper schmerzhaften Zufällen meines müßigen Daseins entrissen werden konnten. Mindestens erschien mir das bevorstehende Vergnügen bei der Aufführung als im Erfassen dieser Wahrheit vielleicht unumgängliche Form, und so konnte ich meine Wünsche darauf beschränken, die vorhergesagten Unpäßlichkeiten sollten erst nach Schluß der Vorstellung einsetzen, damit mein Eindruck durch sie nicht beeinträchtigt oder verfälscht würde. Flehentlich bat ich meine Eltern, die es seit dem Besuche des Arztes nicht mehr wollten, mich zu Phèdre gehen zu lassen. Beständig sagte ich mir die Rede auf: ›Man sagt, Euch wird von uns ein rascher Abschied trennen‹ und suchte dabei nach allen Betonungen, die man hineinlegen konnte, um besser das Unerwartete der einen zu ermessen, welche die Berma finden werde. Verborgen wie das Allerheiligste vom verhüllenden Vorhang, hinter dem ich ihr jeden Augenblick einen neuen Aspekt verlieh -- im Anschluß an Bergottes Worte, in der von Gilberte entdeckten Broschüre, die mir in den Sinn kamen: ›Plastischer Adel, christliches Bußhemd, jansenistische Blässe, Prinzessin von Trözen und von Cleve, mykenisches Drama, delphisches Symbol, Sonnenmythos‹ --, so thronte die göttliche Schönheit, welche das Spiel der Berma mir offenbaren sollte, Tag und Nacht über beständig flammendem Altar in der Tiefe meines Geistes, -- meines Geistes, der je nach der Entscheidung meiner strengen und leichtfertigen Eltern für immer die Vollkommenheiten der Göttin, die sich auf derselben Stätte enthüllt, wo ihre unsichtbare Gestalt sich erhob, umschließen sollte oder nicht. Und so kämpfte ich, die Augen auf das unfaßbare Bild geheftet, von morgens bis abends gegen die Widerstände, die meine Familie mir entgegensetzte. Allein als diese fielen, als meine Mutter -- obwohl die Matinee gerade an dem Tage stattfand, an dem mein Vater Herrn von Norpois nach der Kommissionssitzung zum Essen mitbringen wollte -- mir sagte: »Höre, wir wollen dich nicht betrüben; wenn du glaubst, es wird dir solches Vergnügen machen, dann mußt du hingehen«, als dieser bisher verbotene Theatertag nur noch von mir abhing, jetzt zum erstenmal, da ich mich nicht mehr mit der Aufhebung seiner Unmöglichkeit zu befassen brauchte, fragte ich mich, ob es denn wünschenswert sei, ob nicht andere Gründe als das Verbot der Eltern dafür sprächen, daß ich verzichte. Hatte ich zuvor die Grausamkeit der Eltern verabscheut, so machte ihre Zustimmung sie mir nun so teuer, daß der Gedanke, sie zu bekümmern, mir selber Kummer bereitete, durch den hindurch mir als Sinn des Lebens nicht mehr die Wahrheit, sondern die Liebe erschien und das Leben nur noch gut oder schlecht, je nachdem meine Eltern glücklich oder unglücklich sein würden. »Lieber möchte ich nicht hingehen, wenn es euch betrübt«, sagte ich meiner Mutter; sie hingegen bemühte sich, mich von dem Hintergedanken, sie könne sich darum betrüben, zu befreien, der, meinte sie, nur mein Vergnügen an Phèdre stören würde, und um dieses Vergnügens willen seien doch sie und der Vater von ihrem Verbot zurückgekommen. Da aber kam mir diese Art Verpflichtung, Vergnügen zu empfinden, recht schwer vor. Und dann: würde ich, wenn ich krank nach Hause käme, schnell genug genesen, um nach den Ferien in die Champs-Élysées zu gehen, sobald Gilberte wieder hinkäme? Allen diesen Gründen stellte ich zum Entscheidungskampf die hinter ihrem Schleier unsichtbare Idee der Vollkommenheit der Berma entgegen. In die eine Wagschale legte ich: »Fühlen, daß Mama traurig ist, riskieren, nicht in die Champs-Élysées gehen zu können, in die andere ›jansenistische Blässe, Sonnenmythos‹, aber diese Worte verdunkelten sich schließlich selbst vor meinem Geist, sagten mir nichts mehr, verloren alles Gewicht; nach und nach wurde das Zögern zu schmerzlich: hätte ich jetzt für das Theater entschieden, so wäre es nur geschehen, um diesem Zögern ein Ende zu machen und es ein für allemal los zu sein. Nur noch, um meine Leiden abzukürzen, nicht in der Hoffnung mehr auf geistigen Gewinn, noch in der Hingabe an den Reiz des Vollkommenen hätte ich mich zu der Göttin geleiten lassen, die nun nicht mehr die weise Göttin war, sondern die unerbittliche Gottheit ohne Antlitz und Namen, die ihr heimlich hinter dem Schleier untergeschoben worden. Da wurde plötzlich alles anders. Mein Verlangen, die Berma zu hören, erhielt von neuem einen Schlag mit der Peitsche, der mir erlaubte, in freudiger Ungeduld die Matinee zu erwarten: als ich nämlich vor der Anschlagsäule meine tägliche, seit kurzem so qualvolle Stylitenstation machte, sah ich, noch ganz feucht, die detaillierte Anzeige der Phèdre, die man gerade zum erstenmal aufgeklebt hatte (und auf der, die Wahrheit zu sagen, die übrigen Einzelheiten keinen neuen entscheidenden Reiz auf mich ausübten). Aber sie gab dem einen der Ziele, zwischen denen meine Unentschiedenheit schwankte, eine konkretere Form, die -- da die Anzeige nicht das Datum des Tages trug, an dem ich sie las, sondern dessen, an dem die Aufführung stattfinden sollte und noch dazu die Stunde des Beginns -- etwas Näherrückendes, auf dem Wege der Verwirklichung Begriffenes hatte, so daß ich freudig vor der Säule hüpfte bei dem Gedanken, ich werde an diesem Tage, genau zu dieser Stunde auf meinem Platze sitzen und bereit sein, die Berma zu hören; und aus Furcht, meine Eltern könnten nicht mehr Zeit haben, für die Großmutter und mich zwei gute Plätze zu beschaffen, war ich mit einem Satz wieder zu Hause, gehetzt von den neuen Zauberworten, die in meinem Geist ›jansenistische Blässe‹ und ›Sonnenmythos‹ ersetzt hatten, den Worten: ›die Damen müssen im Parkett die Hüte abnehmen, die Saaltüren werden um zwei Uhr geschlossen‹.
Ach, diese erste Matinee war eine große Enttäuschung. Mein Vater schlug vor, die Großmutter und mich auf seinem Wege zur Kommission vor dem Theater abzusetzen. Vorm Weggehen sagte er zu meiner Mutter: »Sieh zu, daß wir etwas Gutes zum Essen haben; du weißt doch, ich soll Norpois mitbringen.« Die Mutter hatte es nicht vergessen. Und schon seit gestern war Françoise glücklich, sich der Kochkunst hingeben zu können, für die sie sicherlich Begabung besaß, und noch besonders feuerte sie die Ankündigung eines neuen Tischgastes an; sie wußte, sie sollte nach Methoden, die nur ihr eigen waren, den Boeuf à la gelée komponieren, und lebte ganz in der Glut des Schaffens; da sie besonderen Wert auf die Qualität des Materials legte, das notwendig zur Herstellung ihres Werkes gehörte, ging sie selbst in die Hallen und ließ sich die schönsten Stücke Rumsteak, Rindsbug und Kalbsfuß geben, dem Michelangelo ähnlich, der acht Monate in den Bergen von Carrara verbrachte, um die vollkommensten Marmorblöcke für das Denkmal Julius’ II. auszuwählen. Bei ihrem Hin und Her legte Françoise sich derart ins Zeug, daß Mama, als sie das erhitzte Gesicht unserer alten Dienerin sah, fürchtete, sie könne krank werden von Überanstrengung wie der Schöpfer der Mediceergräber in den Steinbrüchen von Pietrasanta. Schon am Vorabend hatte sie den rosa Marmor dessen, was sie Nev-Yorkschinken nannte, zum Bäcker geschickt, um ihn in schützender Brotteighülle in den Ofen schieben zu lassen. Da sie den Reichtum der Sprache unterschätzte und sich nicht auf ihre Ohren verließ, hatte sie gewiß, als sie zum erstenmal von Yorkschinken reden hörte -- in der Meinung, es sei eine unwahrscheinliche Verschwendung, daß im Vokabular York und New-York zugleich existieren sollten -- geglaubt, sie habe schlecht verstanden und man habe ihr den Namen sagen wollen, den sie schon kannte. So blieb denn für ihre Ohren und, wenn sie eine Anzeige las, für ihre Augen vor dem Worte York das New, welches sie ›Nev‹ aussprach. Und in aller Treuherzigkeit sagte sie zum Küchenmädchen: »Holen Sie mir Schinken von Olida. Die gnädige Frau hat mir eingeschärft, daß es Nev-Yorker sein soll.« Hatte an diesem Tage Françoise die glühende Sicherheit des großen Schöpfers, so war mein Teil die quälende Unruhe des Suchenden. Wohl empfand ich Freude, solange ich die Berma noch nicht gehört hatte, Freude auf dem kleinen Square vor dem Theater, wo zwei Stunden später die kahlen Kastanienbäume mit metallischen Reflexen aufstrahlen sollten, sobald die Laternen angesteckt und die einzelnen Blätter des Astwerks beleuchtet sein würden; Freude vor den Kontrollbeamten, deren Wahl, Beförderung und Schicksal von der großen Künstlerin abhingen -- sie behielt sich in der Verwaltung alle Entscheidungen vor, deren jeweilige rein nominelle Direktoren unbeachtet wechselten. Die Beamten nahmen unsere Billette, ohne uns anzusehen, sie waren zu aufgeregt und besorgt, ob auch alle Vorschriften der Berma dem neuen Personal richtig übermittelt seien, ob man verstanden habe, daß die Claque nie für sie klatschen dürfe, daß die Fenster offen sein sollten, solange sie nicht auf der Bühne war, dann aber auch jede Tür geschlossen und in ihrer Nähe ein Topf mit heißem Wasser versteckt, um den Staub am Aufsteigen zu verhindern; nun mußte ja gleich ihr Wagen mit den beiden langmähnigen Pferden vor dem Theater halten und sie selbst, in Pelze gehüllt, aussteigen, mit etwas mürrischer Geste die Grüße erwidern und eine aus ihrer Gefolgschaft entsenden, um sich über die Proszeniumslogen, die für ihre Freunde reserviert waren, über die Temperatur des Saales, die Besetzung der Logen, die Kleidung der Logenschließerinnen zu informieren; Theater und Publikum waren für sie nur ein zweites weiteres Gewand, in welches sie glitt, ein besserer oder schlechterer Wärmeleiter ihres Talentes. Auch im Saale selbst war ich glücklich; seit ich -- im Gegensatz zu der Vorstellung, die lange Zeit in meiner kindlichen Phantasie bestanden hatte -- wußte, daß es für alle Welt nur eine Bühne gab, dachte ich mir, die andern Zuschauer müßten einen wie eine umgebende Straßenmenge am guten Sehen hindern, nun aber stellte ich fest, daß vielmehr jedermann dank einer Anordnung, die gleichsam das Symbol aller Wahrnehmung ist, sich als Mittelpunkt des Theaters empfindet; und so erklärte ich mir, daß Françoise, die einmal zu einem Singspiel auf den dritten Rang geschickt wurde, nachher zu Hause versichern konnte, ihr Platz sei der allerbeste gewesen, und statt sich zu weit ab zu fühlen, sei sie eingeschüchtert worden durch die geheimnisvolle lebendige Nähe des Vorhangs. Meine Freude wuchs noch, als ich begann, wirre Geräusche, wie man sie unter der Eierschale hört, wenn das Kücken heraus will, hinter dem Vorhang zu unterscheiden; diese Geräusche wurden stärker, und plötzlich richteten sie sich aus jener unseren Augen undurchdringlichen Welt, die uns doch mit den ihren sah, unzweifelhaft an uns selbst in der gebieterischen Form dreier Schläge, erregend wie Signale vom Planeten Mars. Und als dann der Vorhang aufging und auf der Bühne ein ganz gewöhnlicher Schreibtisch und ebensolcher Kamin andeuteten, die gleich auftretenden Personen werden keine Schauspieler sein, die Verse aufsagen kämen, wie ich das von einer Abendvorstellung her kannte, sondern Leute, die bei sich zu Hause einen Tag ihres Lebens leben würden, in den ich eindrang, einbrach, ohne daß sie mich sahen --, da hielt meine Freude immer noch vor; sie wurde unterbrochen durch eine kurze Unruhe: gerade als ich die Ohren spitzte, weil nun das Stück beginnen sollte, traten zwei Männer auf die Bühne, die recht zornig waren, sie sprachen so laut, daß man im ganzen Saal, der mehr als tausend Menschen faßte, jedes Wort verstand, während man doch in einem kleinen Café den Kellner fragen muß, was denn die beiden Individuen da drüben, die sich an den Kragen geraten, eigentlich sagen; aber da gleichzeitig zu meiner Verwunderung das Publikum, ohne zu protestieren, zuhörte und ganz in einmütiges Schweigen versunken war, auf welchem hier und da ein Lachen plätscherte, begriff ich, die beiden Unverschämten waren Schauspieler, und mit ihrem Gespräch hatte das kleine Stück begonnen, das man lever de rideau nennt. Ihm folgte eine ziemlich lange Pause: die Zuschauer, die wieder ihre Plätze einnahmen, wurden ungeduldig und stampften mit den Füßen. Das erschreckte mich; es erging mir wie bei Lektüre eines Prozeßberichtes, in dem ich einen Mann von edler Gesinnung unter Nichtachtung der eigenen Interessen zugunsten eines Unschuldigen zeugen sah und fürchten mußte, man werde nicht freundlich genug zu ihm sein, ihm nicht dankbare Anerkennung genug erweisen, nicht nach Verdienst ihn reich belohnen, so daß er sich schließlich angeekelt auf die Seite der Ungerechtigkeit schlagen werde; so hatte ich auch jetzt, Genie und Tugend gleichsetzend, Angst, die Berma könne sich ärgern der schlechten Manieren eines unerzogenen Publikums halber -- unter dem ich sie doch so gern einige Berühmtheiten hätte erkennen sehen, auf deren Urteil sie Wert legen würde -- und es ihre Unzufriedenheit, ihre Verachtung fühlen lassen, indem sie schlecht spiele. Flehentlich blickte ich auf die brutalen Stampfer: sie sollten nicht mit ihrer Wut den gefährdeten kostbaren Eindruck zerstören, den ich hier suchte. Die letzten Augenblicke meiner Freude begleiteten die ersten Szenen von Phèdre. Im Anfang des zweiten Aktes erscheint noch nicht Phèdre selbst; und doch trat, sobald der Vorhang aufgegangen war und ein zweiter aus rotem Samt sich geteilt hatte, der in allen Stücken, in denen der Star spielte, die Tiefe der Bühne abtrennte, durch die Mitte eine Schauspielerin auf mit einem Gesicht und einer Stimme, wie man mir die Berma beschrieben hatte. Man hatte wohl die Szenenfolge geändert: alle Sorgfalt, die ich auf das Studium der Rolle von Theseus’ Gattin verwendet hatte, wurde nutzlos. Dann aber gab eine zweite Schauspielerin der ersten das Stichwort. Ich mußte mich getäuscht haben, als ich die erste für die Berma hielt, die zweite glich ihr noch mehr, hatte mehr als die andere ihre Diktion. Beide begleiteten übrigens die Worte ihrer Rolle mit edlen Gebärden, die ich deutlich wahrnahm und in ihrer Beziehung zum Texte genau erfaßte; sie ließen ihre schönen Pepla wallen; auch an sinnreichem Tonfall, bald leidenschaftlich, bald ironisch, ließen sie es nicht fehlen, und ich begriff die Bedeutung manches Verses, über den ich zu Hause weggelesen hatte, ohne genügend zu beachten, was er besagen wollte. Aber plötzlich erschien in der Öffnung des roten Vorhangs des Heiligtums wie in einem Rahmen eine Frau, und an der Angst, die mich befiel -- viel banger als die der Berma sein mochte, Öffnen eines Fensters könne sie stören, das Rascheln eines Programms den Klang eines ihrer Worte beeinträchtigen, man könne sie verstimmen, indem man ihren Kameraden Beifall spende und ihr nicht genug -- und an der Art, wie ich, noch unbedingter als die Berma selbst, von diesem Augenblick an Saal, Publikum, Schauspieler, Stück und meinen eigenen Körper als akustischen Empfangsapparat ansah, der nur in dem Maße Bedeutung hatte, als er sich den Modulationen dieser Stimme anpaßte, begriff ich, daß die beiden seit einigen Minuten von mir bewunderten Schauspielerinnen gar keine Ähnlichkeit mit der hatten, die zu hören ich gekommen war. Aber zugleich war es mit all meiner Freude vorbei; umsonst heftete ich Augen, Ohren und Sinn auf die Berma, damit mir von den Gründen, die sie mir geben würde, sie zu bewundern, auch nicht das kleinste Teilchen verloren ginge: es gelang mir nicht, einen einzigen zu gewinnen. Ich konnte nicht einmal wie bei ihren Kolleginnen in der Diktion und im Spiel sinnreichen Tonfall und schöne Gebärden wahrnehmen. Ich hörte sie, wie ich Phèdre gelesen oder wie Phèdre selbst im gegebenen Augenblick die Dinge gesagt hätte, die ich vernahm, ohne daß das Talent der Berma ihnen für mich etwas hinzutat. Ich hätte jeden Tonfall der Künstlerin, jeden Ausdruck ihres Gesichtes, um ihn tiefer zu ergründen, um seine besondere Schönheit zu entdecken, festhalten, lange Zeit bannen mögen; zum mindesten gedachte ich, meine geistige Beweglichkeit darein zu setzen, auf jeden Vers eine ganz gesammelte, gereifte Aufmerksamkeit zu richten, von der Dauer jedes Wortes, jeder Geste kein Bruchteil über vorbereitenden Anstalten zu verlieren und dank meiner Anspannung so tief in Worte und Gesten einzudringen, als hätte ich dafür noch lange Stunden zur Verfügung. Aber wie kurz war diese Dauer! Kaum hatte mein Ohr einen Ton aufgenommen, so ersetzte ihn schon ein anderer. Bei einer Szene, in der die Berma einen Augenblick vor der Dekoration, die das Meer darstellt, unbewegt steht, den Arm zu Gesichtshöhe erhoben und durch einen Beleuchtungseffekt in grünliches Licht getaucht, brach der Saal in lauten Beifall aus, aber schon hatte die Schauspielerin die Stellung wieder gewechselt, und das Bild, das ich studieren wollte, existierte nicht mehr. Ich sagte meiner Großmutter, ich sähe nicht gut. Sie gab mir ihr Opernglas. Allein, wenn man an die Wirklichkeit der Dinge glaubt, gibt der Gebrauch eines künstlichen Mittels, sie sich zeigen zu lassen, nicht das äquivalente Gefühl ihrer Nähe. Ich dachte, das sei nicht mehr die Berma, was ich sah, sondern nur ihr Bild im vergrößernden Glase. Ich legte das Glas weg; aber war nun das Bild, das mein Auge durch die Entfernung verkleinert empfing, exakter? Welche der beiden Berma war die richtige? Auf die Liebeserklärung an Hippolyt hatte ich sehr gerechnet; aus der sinnreichen Bedeutung, die ihre Kolleginnen mir in weniger schönen Partien immer wieder aufzeigten, schloß ich, daß die Berma sicher einen Tonfall finden werde viel überraschender als alles, was ich mir zu Hause bei der Lektüre vorzustellen versucht hatte; aber sie erreichte nicht einmal, was Önone und Aricie gefunden hätten. Sie leierte die ganze Tirade gleichmäßig herunter, in der doch so scharfe Gegenüberstellungen sich verschmelzen, daß eine nur einigermaßen intelligente Tragödin, und wäre es auch nur eine Lyzeumsschülerin, die Wirkung nicht vernachlässigt hätte; übrigens sagte sie das Ganze so schnell auf, daß mir erst, als sie beim letzten Verse angelangt war, die gewollte Monotonie bewußt wurde, die sie in die ersten gelegt hatte. Endlich brach mein erstes Gefühl der Bewunderung aus: es wurde hervorgerufen durch den frenetischen Beifall der Zuschauer. Ich klatschte mit und suchte durch heftiges Weiterapplaudieren den Beifallssturm zu verlängern, damit die Berma aus Dankbarkeit sich heute selbst überträfe und ich sicher sei, sie an einem ihrer besten Tage gehört zu haben. Merkwürdig ist übrigens, daß gerade an der Stelle, die den Beifall des Publikums entfesselte, die Berma, wie ich später erfahren habe, einen ihrer schönsten Einfälle hat. Es senden offenbar bestimmte transzendente Wirklichkeiten Strahlen um sich aus, für welche die Menge empfänglich ist. So erregen ja auch, bei gewissen Ereignissen, wenn zum Beispiel ein Heer an der Grenze in Gefahr, geschlagen oder siegreich ist, die ziemlich dunklen Nachrichten, die eintreffen und aus denen der Gebildete nicht viel zu schließen weiß, in der Menge eine Bewegung, die ihn überrascht und in der er, wenn ihn inzwischen die Sachverständigen über die wahre militärische Lage unterrichtet haben, die Fähigkeit des Volkes erkennt, jene ›Aura‹ rings um die großen Ereignisse wahrzunehmen, sie auf Hunderte von Kilometern zu sehen. Man erfährt einen Sieg entweder nachträglich, wenn der Krieg zu Ende ist, oder umgehend durch die Freude des Portiers. Einen genialen Zug im Spiel der Berma entdeckt man acht Tage, nachdem man sie gehört, durch die Kritik oder umgehend durch den Beifall des Parterres. Da aber diese unmittelbare Erkenntnis der Menge mit hundert anderen irrigen vermengt ist, geht der Applaus meistens fehl, ganz abgesehen davon, daß er mechanisch von der Kraft früherer Beifallsstürme erregt wird, wie das Meer, das ein Sturm genügend aufgewühlt hat, fortfährt anzuschwellen, auch wenn der Wind nicht mehr wächst. Wie dem auch sei, in dem Maße als ich Beifall klatschte, schien mir, die Berma habe besser gespielt. Neben mir sagte eine ziemlich gewöhnlich aussehende Frau: »Die gibt sich wenigstens aus, macht sich’s sauer, rackert sich ab, das nenne ich mir noch Theater spielen.« Ich war ganz glücklich, diese Erklärungen für die Überlegenheit der Berma zu bekommen, obwohl ich ahnte, daß sie sie nicht mehr erklärten als den Perseus von Benvenuto Cellini oder die Gioconda der Ausruf eines Bauern: »Gut gemacht ist das schon! Gediegen und sauber! Und welche Arbeit!«, und trunken teilte ich den derben Trank dieser volkstümlichen Begeisterung. Als aber der Vorhang fiel, fühlte ich doch eine Enttäuschung, daß die so sehr ersehnte Lust nicht größer gewesen, zugleich das Bedürfnis, sie zu verlängern und nicht mit dem Verlassen des Saales für immer dies Theaterleben aufzugeben, das für ein paar Stunden mein eigenes geworden war. Wie bei einer Abreise ins Exil hätte ich mich losreißen müssen, und wie sollte ich jetzt direkt nach Hause gehen können, wenn ich nicht hätte hoffen dürfen, dort viel über die Berma zu erfahren von ihrem Bewunderer, dem ich die Erlaubnis zu Phèdre zu gehen, verdankte, Herrn von Norpois. Ich wurde ihm vor dem Essen von meinem Vater vorgestellt, der mich dazu in sein Arbeitszimmer rief. Bei meinem Eintritt erhob sich der Botschafter, reichte mir die Hand, neigte seine hohe Gestalt und heftete aufmerksam die blauen Augen auf mich. Da die durchreisenden Fremden, die ihm zur Zeit, als er Frankreich repräsentierte, vorgestellt wurden, mehr oder weniger -- und waren es auch nur bekannte Tenöre -- Personen von Bedeutung waren, von denen er später, wenn in Paris oder Petersburg ihr Name fiel, sagen konnte, er erinnere sich sehr wohl des Abends, den er in München oder Sofia mit ihnen verbracht habe, so hatte er die Gewohnheit angenommen, neu Vorgestellten durch liebenswürdiges Entgegenkommen Zufriedenheit über die Bekanntschaft auszudrücken; mehr noch: er war überzeugt, daß man im Leben der Hauptstädte durch die Berührung sowohl mit den interessanten Individualitäten, die sie durchqueren, als mit den Gebräuchen des Volkes, das sie bewohnt, eine vertiefte Kenntnis, die Bücher nicht geben können, von Geschichte, Geographie, den Sitten der verschiedenen Nationen und der geistigen Bewegung Europas gewinnt, und so übte er an jedem Ankömmling seine scharfen Beobachtungsgaben, um sogleich zu merken, mit was für einer Art Mensch er zu tun habe. Seit langem hatte ihm die Regierung keinen Posten im Auslande mehr anvertraut; sobald man ihm aber jemand vorstellte, begannen seine Augen, als seien sie von seinem Austritt aus dem aktiven Dienst nicht amtlich benachrichtigt worden, mit Nutzen zu beobachten, während er durch seine ganze Haltung auszudrücken suchte, daß ihm der Name des Fremden nicht unbekannt sei. So sprach er denn auch zu mir gütig und mit der imposanten Miene eines Mannes, der sich des weiten Feldes seiner Lebenserfahrung bewußt ist; dabei erforschte er mich unaufhörlich mit scharfsinniger, ihm nutzbringender Neugier, als wäre ich eine exotische Sitte, ein lehrreiches Denkmal oder ein auf der Tournee begriffener Star. Er bewies an meiner Person gleichzeitig die erhabene Freundlichkeit des weisen Mentor und die eifrige Wißbegier des jungen Anacharsis.
Er bot mir keinerlei Empfehlungen an die Revue des Deux-Mondes an, stellte aber eine Reihe Fragen über mein Leben, meine Studien und meine Neigungen, von denen ich zum erstenmal in einer Art sprechen hörte, als könne man ihnen vernünftigerweise nachgehen, während ich bisher geglaubt hatte, es sei Pflicht, ihnen zu widerstreben. Da diese Neigungen auf seiten der Literatur lagen, suchte er mich nicht von dieser abzubringen; vielmehr sprach er mit höflicher Achtung von ihr wie von einer verehrungswürdigen charmanten Person aus erlesenem Kreise, der man in Rom oder Dresden das beste Andenken bewahrt hat und die man bedauerlicherweise durch den Zwang der Verhältnisse so selten wiedertrifft. Mit einem fast schlüpfrigen Lächeln neidete er mir die angenehmen Stunden, die sie mir Glücklicherem und Freierem verschaffe. Aber die Wendungen, deren er sich bediente, zeigten mir die Literatur sehr verschieden von dem Bilde, das ich mir in Combray von ihr gemacht hatte; und ich sah ein, daß ich doppelt recht gehabt hatte, ihr zu entsagen. Bisher war mir nur zum Bewußtsein gekommen, daß ich keine Begabung zum Schreiben habe, jetzt nahm mir Herr von Norpois auch das Verlangen danach. Ich wollte ihm ausdrücken, was ich mir erträumt hatte; in meiner zitternden Erregung hätte ich mir Skrupel gemacht, wenn meine Worte nicht das denkbar aufrichtigste Äquivalent dessen, was ich fühlte und bisher noch nie zu formulieren versucht hatte, gewesen wären, und so wurden diese Worte natürlich ganz unklar. Vielleicht aus Berufsgewohnheit, vielleicht kraft der jedem hochgestellten Mann eigenen Ruhe (denn, wenn man ihn um Rat fragt, ist er sicher, den Gang des Gespräches zu beherrschen, und läßt den Unterredner sich aufregen, abmühen und nach Herzenslust schuften), vielleicht auch, um den Charakter seines Kopfes zur Geltung zu bringen (der, nach seiner Meinung trotz der großen ›Favoris‹ griechisch war), pflegte Herr von Norpois, während man ihm etwas darlegte, eine absolut unbewegliche Miene zu bewahren: man sprach wie zu einer tauben antiken Büste in einer Glyptothek. Plötzlich erklang dann wie der fallende Hammer des Auktionators oder wie ein delphisches Orakel die Stimme des Botschafters, und seine Antwort war um so eindrucksvoller, als nichts in seiner Miene hatte vermuten lassen, was für einen Eindruck er von dem andern empfangen habe, noch was für eine Meinung er wohl äußern werde.
Mit einmal sagte er, als sei die Sache entschieden, nachdem er mich angesichts der unbewegten Augen, die keinen Augenblick von mir abließen, lange hatte schwatzen lassen: »Gerade ist mir der Sohn eines meiner Freunde gegenwärtig, dem es ›mutatis mutandis‹ geht wie Ihnen« (und er nahm, um von unsern gemeinsamen Anlagen zu sprechen, einen begütigenden Ton an, als handle es sich nicht um Anlagen zur Literatur, sondern zum Rheumatismus, und als wolle er mir zeigen, daß man nicht daran stirbt). »Dieser junge Mann hat es vorgezogen, den Quai d’Orsay zu verlassen, wo ihm doch der Weg durch den Vater geebnet war, und ohne sich um das Gerede der Leute zu kümmern, hat er sich angeschickt zu produzieren. Sicherlich hat er keinen Anlaß, es zu bereuen. Er hat vor zwei Jahren -- er ist, nebenbei bemerkt, natürlich bedeutend älter als Sie -- ein Werk veröffentlicht, das sich mit dem Gefühl des Unendlichen vom westlichen Ufer des Viktoria-Nyassa-Sees befaßt, und dies Jahr ein weniger wichtiges, aber mit hurtiger, bisweilen sogar ziemlich scharfer Feder geschriebenes Büchlein über das Repetiergewehr in der bulgarischen Armee, Arbeiten, die ihm bereits einen besonderen Platz gesichert haben. Er hat schon eine hübsche Strecke zurückgelegt und ist nicht der Mann, auf halbem Wege stehen zu bleiben. Wie ich weiß, hat man, ohne den Gedanken einer Kandidatur ins Auge zu fassen, in der Académie des Sciences Morales im Laufe des Gesprächs seinen Namen zwei-, dreimal fallen lassen, und zwar in einer durchaus nicht ungünstigen Art. Kurzum, wenn man auch noch nicht behaupten kann, daß er bereits den Gipfel des Parnaß erklommen habe, er hat mit kühnem Angriff eine recht hübsche Stellung erobert, und der Erfolg, der denn doch nicht immer nur den Stürmern, Wirrköpfen und Wichtigtuern, deren Wesen eben meist nur Getu ist, zufällt, der Erfolg hat seine Mühe gelohnt.«
Meinem Vater, der mich nun schon in einigen Jahren Akademiker werden sah, war deutlich eine Genugtuung anzumerken, die Herr von Norpois auf die Spitze trieb, indem er mir nach kurzem Zögern und in sichtlicher Berechnung der Folgen, die sein Schritt haben könnte, seine Karte reichte und sagte: »Besuchen Sie ihn doch mit meiner Empfehlung, er wird Ihnen nützliche Ratschläge geben können.« Diese Worte verursachten mir eine so peinliche Erregung wie etwa die Mitteilung, ich sollte mich morgen als Schiffsjunge auf einem Segler einschiffen.
2.
Meine Tante Leonie hatte mir zusammen mit vielen lästigen Gegenständen und Möbeln fast ihr ganzes flüssiges Vermögen vererbt und so nach ihrem Tode eine Zuneigung offenbart, die ich zu ihren Lebzeiten durchaus nicht vermutete. Mein Vater, der dies Vermögen bis zu meiner Mündigkeit zu verwalten hatte, befragte Herrn von Norpois über die Anlage einiger Werte. Der Botschafter riet zu schwachverzinsten Papieren, die er für besonders solide erachtete, namentlich zu Englischen Konsols und vierprozentigen Russen. »Mit diesen erstklassigen Werten«, sagte er, »sind Sie, wenn der Zinsfuß auch nicht so hoch ist, wenigstens sicher, Ihr Kapital nie gefährdet zu sehen.« Danach berichtete ihm mein Vater im großen ganzen, was er für den Rest des Geldes gekauft habe. Auf Herrn von Norpois’ Zügen erschien ein kaum merkliches Glückwunschlächeln: wie alle Kapitalisten sah er in einem Vermögen etwas immer Beneidenswertes, fand es aber zartfühlend, sein Kompliment zu solch einem Besitz nur durch eine kaum eingestandene Gebärde des Verständnisses auszudrücken; da er selbst kolossal reich war, hielt er es andererseits für geschmackvoll, mit einem immerhin behaglich-munteren Rückblick auf die eigenen höheren Einkünfte die geringeren der anderen nicht unbeträchtlich zu schätzen. Er nahm keinen Anstand, meinem Vater zu der »wohlabgewogenen, überlegenen Sicherheit«, mit der er sein Portefeuille ›komponiert‹ habe, zu gratulieren. Es war, als schriebe er den Beziehungen der Börsenpapiere zueinander und auch den einzelnen Papieren eine Art ästhetischen Rang zu. Über ein ziemlich neues unbekanntes, das mein Vater erwähnte, äußerte Herr von Norpois, ähnlich den Leuten, die ein Buch, das wir allein zu kennen glauben, auch gelesen haben: »Oh doch, ich habe mich eine Zeitlang damit unterhalten, es auf dem Kurszettel zu verfolgen, es war interessant«, und hatte dabei das retrospektiv gefesselte Lächeln eines Abonnenten, der den letzten Roman einer Revue in Fortsetzungen gelesen hat. »Ich will Ihnen nicht davon abraten, sich bei der bevorstehenden Lancierung an der Subskription zu beteiligen. Das Papier hat etwas Anziehendes, die Anteilscheine werden Ihnen zu verführerischen Preisen angeboten.« Als auf bestimmte ältere Effekten die Rede kam, an deren Namen mein Vater sich nicht genau erinnerte, da sie leicht mit denen ähnlicher Aktien zu verwechseln waren, öffnete er eine Schublade und zeigte die Papiere selbst dem Botschafter. Ihr Anblick entzückte mich: sie waren verziert mit Kathedralenpfeilern und allegorischen Figuren, wie gewisse alte Publikationen aus der Zeit der Romantik, die ich früher durchblättert hatte. Alles, was der gleichen Epoche entstammt, sieht sich ähnlich; den Künstlern, die Dichtungen einer Zeit illustrieren, geben auch die zeitgenössischen Finanzgesellschaften Aufträge: und nichts erinnert mehr an gewisse Lieferungen von Notre-Dame de Paris und von Gérard de Nervals Werken, wie ich sie im Schaufenster des Krämers von Combray gesehen, als, in ihrer rechtwinkligem, beblümten, von Flußgottheiten gestützten Einfassung, eine Aktie der Gesellschaft der Wasserwerke.
Mein Vater hatte für meine Art, mich zu den Dingen zu stellen, eine Verachtung, die durch Zuneigung genugsam gemildert war, um meinem Tun und Treiben gegenüber eine blinde Nachsicht walten zu lassen. So trug er denn keinen Anstand, mich ein kleines Gedicht in Prosa holen zu lassen, das ich früher einmal in Combray nach einem Spaziergang verfaßt hatte. Ich hatte es in einem Zustand von schwärmerischer Begeisterung geschrieben, der, wie ich wähnte, sich den Lesern mitteilen müßte. Aber Herrn von Norpois teilte er sich nicht mit; ohne ein Wort zu sagen, gab er mir das Gedicht zurück.
Schüchtern trat meine Mutter, die voller Ehrfurcht für des Vaters Beschäftigungen war, ins Zimmer und fragte, ob sie anrichten lassen dürfe. Sie fürchtete, eine Unterhaltung zu unterbrechen, in die sie nicht einzubeziehen war. In der Tat sprach der Vater zu Herrn von Norpois immer wieder von allerhand nützlichen Maßnahmen, die sie beide bei der nächsten Kommissionssitzung befürworten wollten, und zwar in dem besonderen Ton, den zwei Kollegen in einer ungewohnten Umgebung haben: darin sind sie zwei Gymnasiasten ähnlich: ihre beruflichen Gewohnheiten schaffen ihnen gemeinsame Erinnerungen und sie entschuldigen sich, wenn sie vor andern, denen diese Dinge unzugänglich sind, darauf zurückkommen.
Aber die vollkommene Unabhängigkeit der Gesichtsmuskeln, zu der Herr von Norpois gelangt war, erlaubte ihm zuzuhören, ohne daß er zu verstehen schien. Mein Vater verwirrte sich schließlich: »Ich hatte gedacht, die Meinung der Kommission zu befragen ...«, sagte er nach langen Umschweifen zu Herrn von Norpois. Da kamen aus dem Gesicht des adligen Virtuosen, der bisher starr wie ein Orchestermusiker verharrt hatte, der seinen Einsatz abwartet, scharf und gleichmäßig im Vortrag, eben nur das Ende des angefangenen Satzes, doch in einem neuen Tonfall, die Worte: »-- deren Stimmen Sie selbstverständlich unverzüglich zusammenbringen werden, um so mehr als die Mitglieder Ihnen als Individuen bekannt sind und sich leicht zusammenbringen lassen.« Das war an und für sich nicht gerade erstaunlich als Abschluß des Satzes; aber die vorhergegangene Unbeweglichkeit ließ es kristallen, frappant, fast spöttisch sich ablösen, wie gewisse musikalische Phrasen, die in einem Konzerte von Mozart das bisher schweigsame Klavier dem Cello einwirft.
»Nun, bist du von deiner Matinee befriedigt gewesen?« fragte mein Vater mich, während wir zu Tisch gingen: er wollte mich zur Geltung bringen und hoffte, Herr von Norpois werde meine Begeisterung zu schätzen wissen. »Er hat gerade die Berma gehört, Sie erinnern sich, wir haben darüber miteinander gesprochen«, wandte er sich dann an den Diplomaten im Tone der retrospektiven, vertraulichen Anspielung unter Fachleuten, als handle es sich um eine Sitzung der Kommission.
»Da werden Sie entzückt gewesen sein, zumal wenn Sie die Künstlerin zum erstenmal gehört haben. Ihr Herr Vater machte sich Gedanken wegen der eventuellen Rückwirkung dieses kleinen Seitensprunges auf Ihren Gesundheitszustand, denn Sie sind, glaube ich, etwas zart, ein wenig sensibel. Aber da habe ich ihn beruhigt. Die Theater sind heut nicht mehr das, was sie vor zwanzig Jahren noch gewesen sind. Sie finden leidlich angenehme Sitze vor und einen gut durchgelüfteten Raum, obgleich wir noch viel zu tun haben, um Deutschland und England einzuholen, die uns in diesem Punkte wie in manchen andern erschreckend voran sind. Ich habe Frau Berma in Phèdre



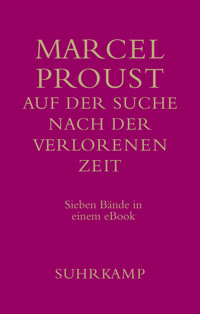

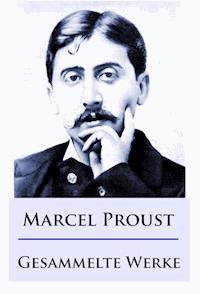


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)