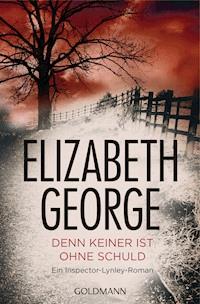9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen Spannungsromans." New York Times
Ein Elite-Internat: Tradition, Ehre und Leistung bestimmen das Leben der Schüler. Ausgerechnet hier wird eines Tages die Leiche des kleinen Matthew Whateley gefunden, und damit beginnt die Fassade von Moral und Kameradschaft zu bröckeln. Bei ihren Nachforschungen treffen Inspector Lynley und Sergeant Barbara Havers von Scotland Yard allerdings auf eine Mauer des Schweigens ...
Der vierte Fall für Inspector Lynley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Bredgar Chambers ist ein englisches Elite-Internat, wie es im Buche steht. Tradition, Disziplin, Ehre und Leistung bestimmen das Leben der Schüler, denen eine spätere glanzvolle Karriere so gut wie garantiert ist. Doch dann ist eines Tages der kleine Matthew Whateley verschwunden. Wenig später wird seine Leiche nackt und entstellt auf einem Friedhof gefunden – und die glänzende Fassade von Moral und Kameradschaft beginnt zu bröckeln.
Inspector Thomas Lynley möchte sich zunächst nicht in den Fall einmischen, der außerhalb seines Zuständigkeitsgebiets liegt. Als aber John Contrel, Lehrer in Bredgar Chambers und Hausvater des ermordeten Jungen, ihn um Hilfe bittet, kann er den Wunsch nicht ausschlagen. Denn John Contrel und Thomas Lynley verbindet eine gemeinsame Schulzeit in Eton. Und so sieht sich der Inspector im Laufe seiner Nachforschungen in mehrfacher Hinsicht zunehmend in das fragwürdige System althergebrachter Moralgesetze verstrickt ...
Autorin
Akribische Recherche, präziser Spannungsaufbau und höchste psychologische Raffinesse zeichnen die Bücher der Amerikanerin Elizabeth George aus. Ihre Fälle sind stets detailgenaue Porträts unserer Zeit und ihrer Gesellschaft. Elizabeth George, die lange an der Universität »Creative Writing« lehrte, lebt heute auf Whidbey Island im Bundesstaat Washington, USA. Ihre Bücher sind allesamt internationale Bestseller, die sofort nach Erscheinen nicht nur die Spitzenplätze der deutschen Verkaufscharts erklimmen. Ihre Lynley-Havers-Romane wurden von der BBC verfilmt und auch im deutschen Fernsehen mit großem Erfolg ausgestrahlt. Weitere Informationen unter www.elizabeth-george.de
Inhaltsverzeichnis
For Arthur,Who wanted to write
TIMSHEL
1
Der Garten hinter dem kleinen Haus in der Lower Mall von Hammersmith war ein Ort künstlerischen Bemühens. Drei Bretter astiges Fichtenholz, über sechs verwitterte Sägeböcke gelegt, dienten als Arbeitsplatte, auf der mindestens ein Dutzend Skulpturen in unterschiedlichen Stadien der Bearbeitung standen. Ein verbeulter Metallschrank an der Gartenmauer enthielt das Werkzeug des Künstlers: Bohrer, Meißel, Zahneisen, Hohlbeitel, Schmirgel und ein Sortiment Sandpapiere. Ein farbverschmierter Malerlappen, der durchdringend nach Terpentin roch, lag als armseliges Häufchen unter einem zerbrochenen Gartenstuhl.
Es war ein schmuckloser Garten. Die Mauern, die ihn vor der Neugier der Nachbarn schützten, schirmten ihn auch gegen die immerwährenden, großenteils von Maschinen verursachten Geräusche des Bootsverkehrs auf dem Fluß, der Great West Road und der Hammersmith Bridge ab. So fachmännisch waren die hohen Mauern rund um den Garten gebaut, so glücklich der Standort des Häuschens an der Lower Mall gewählt, daß höchstens gelegentlich ein über das Anwesen hinwegfliegender Wasservogel die kostbare Stille störte.
Diese Abschirmung hatte allerdings auch einen Nachteil. Reinigende Flußwinde fanden keinen Zugang. Die Folge war, daß der ganze Garten mit einer feinen Schicht weißen Steinstaubs überzogen war: das kleine Oval welkenden Rasens, die Rabatten rostfarbenen Goldlacks, die es umgrenzten, die quadratisch angelegte Terrasse. Selbst auf den Fenstersimsen des Häuschens und auf seinem Giebeldach hatte der Staub sich festgesetzt. Und der Künstler trug ihn wie eine zweite Haut. Aber Kevin Whateley machte das nichts aus. Er hatte sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt, und selbst wenn er es nicht gewöhnt gewesen wäre, in einer Staubwolke zu arbeiten, hätte er sich nicht davon stören lassen. Der kleine Garten war seine Zuflucht, ein Ort kreativer Versunkenheit, wo Annehmlichkeit und Sauberkeit nicht erforderlich waren. Bloße Unbequemlichkeit war ohne Bedeutung für Kevin, wenn er sich seiner Kunst widmete.
Zu seinem jüngsten Werk, einem weiblichen Marmorakt, hatte er eine ganz besondere Liebe entwickelt. Er strich mit der Hand über den Arm, über die Wölbung des Gesäßes und die Schenkel hinunter, um nach rauhen Stellen zu suchen und ihnen den letzten Schliff zu geben. Er nickte befriedigt; der Stein fühlte sich unter seinen Fingern wie kühle Seide an.
»Bißchen albern siehst du schon aus, Kev. Mich hast du noch nie so angelächelt.«
Kevin richtete sich mit einem leisen Lachen auf und sah zu seiner Frau hinüber, die an der offenen Haustür stand. Sie trocknete sich die Hände an einem verwaschenen Geschirrtuch und lachte dabei, so daß um ihre Augen tiefe Fältchen entstanden.
»Dann komm doch her und stell mich auf die Probe, Schatz. Du hast nur das letzte Mal nicht richtig aufgepaßt.«
Patsy Whateley wehrte mit einer Handbewegung ab. »Ach, du bist doch ein verrückter Kerl, Kev!«
Aber er sah ihr freudiges Erröten.
»So, so, verrückt bin ich?« fragte er. »Heute morgen hast du aber was anderes gesagt. Oder warst das vielleicht nicht du, die sich da morgens um sechs an mich rangemacht hat?«
»Kev!« Sie lachte laut heraus.
Kevin betrachtete sie liebevoll. Er wußte, daß sie sich seit einiger Zeit heimlich die Haare färbte, um den Anschein der Jugend zu bewahren, und er sah, daß sie deutlich gealtert war, das Gesicht von feinen Linien durchzogen, um Kinn und Wangen nicht länger glatt und straff, der Körper aufgegangen, wo früher die lockendsten Rundungen gewesen waren. Aber diese Veränderungen konnten an seiner Liebe nichts ändern.
»Jetzt denkst du nach, Kev. Ich seh’s dir am Gesicht an. Sag schon, was denkst du?«
»Schmutzige Gedanken, Schatz. Bei denen du rot werden würdest.«
»Das kommt nur von deinen Kunstwerken, stimmt’s? Am heiligen Sonntagmorgen nackte Frauen streicheln! Das ist einfach unanständig.«
»Das, was ich jetzt am liebsten mit dir tun würde, ist unanständig, mein Schatz. Komm her! Spiel mir kein Theater vor, ich weiß doch, wie du wirklich bist.«
»Also, jetzt ist er wirklich verrückt geworden«, verkündete Patsy dem Himmel über ihr.
»Ja, aber so wie du’s magst.« Er lief durch den Garten zur Tür, nahm seine Frau in die Arme und küßte sie herzhaft.
»Puh! Kevin, du schmeckst ja nur nach Sand!« protestierte Patsy, als er sie losließ. Ein Streifen grauen Puders zog sich seitlich über ihr Haar und Gesicht, ein zweiter lag auf ihrer linken Brust. Leise vor sich hinschimpfend, klopfte sie ihre Bluse ab, aber als sie aufblickte und das Lächeln ihres Mannes sah, wurde ihr Gesicht weich. »Total verrückt«, sagte sie. »Aber das warst du ja immer.«
Er zwinkerte ihr zu und kehrte zu seiner Arbeit zurück. Sie blieb an der Tür stehen und sah ihm zu.
Aus dem Metallschrank holte Kevin das Bimssteinpulver, mit dem er den Marmor zu glätten pflegte, ehe er ein Werk als vollendet betrachtete. Nachdem er das Pulver mit Wasser gemischt hatte, verschmierte er es üppig über seine liegende Nackte und rieb es mit kräftiger Hand in den Stein. Er bearbeitete Beine und Bauch, Brüste und Füße und ging bei der Feinarbeit am Gesicht mit besonderer Sorgfalt zu Werke.
Er merkte, daß seine Frau unruhig zu werden begann, und sah, daß sie hinter sich in die Küche schaute, wo über dem Herd die rote Blechuhr hing.
»Halb elf«, sagte sie nachdenklich.
Es sollte wohl so klingen, als spräche sie mit sich selbst, aber Kevin ließ sich nicht täuschen.
»Komm, Patsy«, beruhigte er sie. »Du machst dir unnötige Gedanken. Reg dich nicht auf. Der Junge ruft bestimmt an, sobald er kann.«
»Halb elf«, wiederholte sie, ohne auf seine Worte zu achten. »Matt hat gesagt, sie würden spätestens zur Eucharistiefeier zurück sein, Kev. Und die war sicher um zehn vorbei. Jetzt ist es halb elf. Wieso hat er noch nicht angerufen?«
»Wahrscheinlich hat er ’ne Menge zu tun. Auspacken. Den anderen von seinem tollen Wochenende erzählen. Lernen muß er sicher auch noch. Dann gibt’s Mittagessen. Na und da hat er eben ganz vergessen, seine Mama anzurufen. Aber nach dem Mittagessen hören wir bestimmt von ihm. Mach dir doch jetzt keine Sorgen, Schatz.«
Kevin wußte, daß dieser gute Rat etwa die gleiche Wirkung hatte, wie wenn er der Themse, die dicht vor ihrer Haustür vorbeiströmte, befohlen hätte, ihr regelmäßiges An- und Abschwellen im Wechsel der Gezeiten zu unterlassen. Seit zwölfeinhalb Jahren gab er ihr diesen Rat in allen möglichen Variationen; aber selten half er auch nur das Geringste. Patsy ließ es sich nicht nehmen, sich um jede Kleinigkeit, die Matts Leben anging, zu sorgen. Sie las jeden seiner Briefe aus dem Internat so gründlich und so oft, bis sie ihn auswendig konnte, und wenn sie nicht wenigstens einmal die Woche von ihm hörte, steigerte sie sich in Ängste hinein, die niemand außer Matthew selbst beruhigen konnte. Im allgemeinen meldete er sich zuverlässig, und gerade darum war sein Schweigen nach seinem Wochenendausflug in die Cotswolds um so unverständlicher. Das jedoch gab Kevin seiner Frau gegenüber nicht zu.
Die Pubertät, dachte er. Jetzt kommt’s auf uns zu, Patsy. ’Der Junge wird erwachsen.
Patsys Bemerkung verblüffte ihn; er hatte nicht geglaubt, daß er so leicht zu durchschauen war.
»Ich weiß, was du denkst, Kev«, sagte sie. »Er wird älter. Er will nicht mehr, daß seine Mutter sich dauernd um ihn kümmert. Und das ist ja auch richtig. Ich weiß es.«
»Und?«
»Und drum warte ich noch ein bißchen, ehe ich in der Schule anrufe.«
Es war, das wußte Kevin, der beste Kompromiß, den sie zu bieten bereit war.
»Na also. Das find ich gut, Schatz.« Er wandte sich wieder seiner Skulptur zu.
Seine Frau müßte ihn später zweimal beim Namen rufen, um ihn aus der fremden Welt zurückzuholen, in die seine Muse ihn entführt hatte. Sie stand wieder an der Tür, doch diesmal hielt sie statt des Geschirrtuchs eine schwarze Kunstlederhandtasche, und sie trug ihre neuen schwarzen Schuhe und den guten marineblauen Wollmantel. An den Kragen hatte sie eine funkelnde Straßbrosche gesteckt – eine anmutige Löwin mit zum Schlag erhobener Pranke. Die Augen waren kleine grüne Punkte.
»Er ist auf der Krankenstation.« Das letzte Wort sprach sie im schrillen Ton beginnender Panik.
Kevin blinzelte verwirrt, und sein Blick fiel, vom Spiel des Lichts angezogen, auf die angreifende Löwin. »Krankenstation?« wiederholte er.
»Matt ist auf der Krankenstation, Kev. Er war das ganze Wochenende dort. Ich hab eben in der Schule angerufen. Er ist überhaupt nicht zu den Morants gefahren. Er liegt krank auf der Station. Und der kleine Morant wußte nicht einmal, was er hat. Er hat ihn seit Freitag beim Mittagessen nicht mehr gesehen.«
»Und was willst du jetzt tun, Pats?« fragte Kevin, obwohl er genau wußte, wie die Antwort lauten würde. Aber er wollte einen Moment Zeit gewinnen, um zu überlegen, wie er sie am besten zurückhalten konnte.
»Mattie ist krank, Kev. Wer weiß, was ihm fehlt. Fährst du jetzt mit mir zur Schule oder willst du vielleicht den ganzen Tag hier rumstehen und diesem blöden Weibsbild die Hände auf den Schoß halten?«
Hastig zog Kevin seine Hände von dem anstößigen Körperteil seiner Skulptur und wischte sie an seiner Arbeitshose ab, wo sich der schmierige weiße Brei mit dem Schmutz und dem Staub mischte, die sich bereits an den Nähten festgesetzt hatten.
»Warte, Pats!« sagte er. »Überleg doch erst mal.«
»Was gibt’s da zu überlegen? Mattie ist krank. Er hat bestimmt Sehnsucht nach seiner Mutter.«
»Meinst du wirklich, Schatz?«
»Überleg, Pats«, sagte er wieder, in dem Bemühen, sie zu beschwichtigen. »Welcher Junge will schon, daß gleich die Mama angerannt kommt, wenn er eine Erkältung hat? Er geniert sich doch höchstens zu Tode, meinst du nicht, wenn du da angetanzt kommst, als wär er noch ein kleines Kind, dem du die Windeln wechseln mußt.«
»Soll das heißen, daß ich nichts tun soll?« Patsy drohte ihm mit der Handtasche, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. »Als ob mich das Wohlergehen unseres Jungen nicht interessierte?«
»Nein, das meinte ich nicht.«
»Was dann?«
Kevin faltete seinen Polierlappen zu einem sauberen, kleinen Quadrat. »Laß uns doch erst mal überlegen. Was hat die Schwester auf der Krankenstation gesagt? Was fehlt dem Jungen?«
Patsy senkte die Lider. Kevin wußte, was die Reaktion zu bedeuten hatte. Er lachte leise.
»Auf der Krankenstation ist immer eine Schwester, Patsy, und du hast nicht mit ihr gesprochen? Mattie hat sich die große Zehe angeschlagen, und Mama saust nach West Sussex, ohne vorher nachzufragen, was dem Jungen fehlt? Also hör mal, was ist denn in dich gefahren?«
Heiße Röte der Verlegenheit breitete sich von Patsys Hals zu ihrem Gesicht aus. »Ich ruf jetzt an«, sagte sie, so würdevoll ihr das möglich war, und ging in die Küche, um von dort aus zu telefonieren.
Kevin hörte, wie sie wählte. Einen Augenblick später vernahm er ihre Stimme. Dann hörte er, wie sie den Hörer fallenließ. Sie schrie einmal laut auf. Es war ein schrecklicher Schrei der Klage, ein flehentlicher Ruf nach ihm. Er warf seinen Lappen weg und rannte ins Haus.
Im ersten Moment glaubte er, Patsy hätte einen Anfall. Ihr Gesicht war grau, und die zusammengekniffenen Lippen schienen darauf hinzuweisen, daß sie mit äußerster Willenskraft Schmerzensschreie unterdrückte. Als sie beim Klang seiner Schritte den Blick hob, sah er wilde Verzweiflung in ihren Augen.
»Er ist nicht dort. Mattie ist verschwunden, Kevin. Er war nicht auf der Krankenstation. Er ist überhaupt nicht in der Schule.«
Kevin hatte Mühe, das Entsetzliche zu begreifen, das diese wenigen Worte beinhalteten. Er konnte nur Patsys Worte wiederholen. »Mattie – verschwunden?«
Sie schien wie erstarrt. »Seit Freitag mittag.«
Die ungeheure Zeitspanne von Freitag bis Sonntag füllte sich auf einen Schlag mit jenen unbeschreiblichen Bildern, denen sich alle Eltern ausgesetzt sehen, wenn sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß ihr Kind vermißt ist. Entführung, Vergewaltigung, religiöse Sekten, Kinderhandel, Sadismus, Mord. Patsy zitterte und würgte. Ihre Haut überzog sich mit einem Schweißfilm.
Kevin, der Angst hatte, sie würde ohnmächtig werden oder auf der Stelle tot umfallen, faßte sie bei den Schultern, um ihr den einzigen Trost zu spenden, der ihm zur Verfügung stand.
»Wir fahren sofort zur Schule, Patsy«, sagte er eindringlich. »Wir kümmern uns um unseren Jungen. Darauf kannst du dich verlassen. Wir fahren sofort los.«
»Mattie!« Es klang wie ein Stoßgebet.
Kevin versuchte sich einzureden, daß Gebete überflüssig seien, daß Matthew nur schwänze, daß es für seine Abwesenheit von der Schule eine simple Erklärung gebe, über die sie später einmal gemeinsam lachen würden. Noch während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, begann Patsy heftig zu zittern und stieß noch einmal flehend den Namen ihres Sohnes aus. Kevin ertappte sich dabei, daß er wider alle Vernunft hoffte, es gebe irgendwo einen Gott, der seine Frau hörte.
Sergeant Barbara Havers von der Kriminalpolizei ging ihren Beitrag zu dem gemeinsamen Bericht ein letztes Mal durch und war zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Wochenendarbeit. Sie klammerte die fünfzehn mühselig erarbeiteten Seiten zusammen, stand von ihrem Schreibtisch auf und machte sich auf die Suche nach ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, Inspector Thomas Lynley.
Er war dort, wo sie ihn kurz vor Mittag an diesem Tag zurückgelassen hatte, allein in seinem Büro, den Kopf in die Hand gestützt, seine Aufmerksamkeit scheinbar auf seinen Teil des Berichts konzentriert, der vor ihm auf dem Schreibtisch ausgebreitet lag. Die Sonne des späten Sonntagnachmittags warf lange Schatten auf Wände und Boden, so daß es fast unmöglich war, ohne künstliches Licht zu lesen. Und da Lynley die Lesebrille bis zur Nasenspitze hinuntergerutscht war, trat Barbara leise ins Zimmer, gewiß, daß er eingeschlafen war.
Gewundert hätte es sie nicht. In den letzten zwei Monaten hatte Lynley mit seiner Gesundheit groben Raubbau getrieben. Seine beinahe ständige Anwesenheit im Yard – die zu ihrem Leidwesen im allgemeinen auch die ihre erforderlich machte – hatte ihm bei seinen Kollegen in der Abteilung den Spitznamen Mr. Immerda eingetragen.
»Marsch, nach Hause mit Ihnen, Freundchen«, pflegte Inspector MacPherson mit seiner dröhnenden Stimme zu sagen, wenn er ihm im Korridor, bei einer Besprechung oder in der Kantine begegnete. »Sie stellen uns andere ja als Faulpelze hin! Haben Sie’s so eilig, Superintendent zu werden? Gut werden Sie auf Ihren Lorbeeren schlafen, wenn Sie an Überarbeitung gestorben sind.«
Lynley pflegte auf seine ihm eigene herzliche Art zu lachen und der Frage nach dem Grund seines unermüdlichen Fleißes auszuweichen. Aber Barbara wußte, warum er bis spät in die Nacht hinein arbeitete, sich freiwillig für den Notdienst zur Verfügung stellte und auf die erste Bitte hin den Dienst für andere übernahm. Sie nahm die Ansichtskarte zur Hand, die fast am Rand seines Schreibtischs lag.
Sie war fünf Tage alt, reichlich mitgenommen von beschwerlicher Reise quer durch Europa vom Ionischen Meer nach England. Das Bild zeigte einen merkwürdigen Zug von Weihrauchschwenkern, Zepterträgern und goldgewandeten griechisch-orthodoxen Priestern mit wallenden Bärten, die eine von Edelsteinen funkelnde Sänfte trugen, deren Seitenwände aus Glas waren. Drinnen ruhte, den verhüllten Kopf an das Glas gelehnt, als schliefe er nur und wäre nicht schon seit über tausend Jahren tot, der heilige Spyridon, oder besser, seine sterbliche Hülle. Barbara drehte die Karte um und las unverfroren den Text, obwohl sie sich den Tenor des Geschriebenen auch so denken konnte.
»Tommy, mein Schatz – stell Dir vor, man würde Deine armen Gebeine viermal im Jahr so durch die Straßen von Korfu schleppen! Bei diesem Anblick fragt man sich wirklich, ob es sich lohnt, ein heiliges Leben zu führen, nicht? Es wird Dich freuen zu hören, daß ich der Förderung meiner Allgemeinbildung mit einem Besuch des Zeus-Tempels in Kassiope Rechnung getragen habe. Ich bin sicher, Du findest ein so ehrgeiziges Unterfangen lobenswert. H.«
Barbara wußte, daß dies die zehnte Karte dieser Art war, die Lynley in den letzten zwei Monaten von Lady Helen Clyde erhalten hatte. Eine war wie die andere, freundlicher und witziger Kommentar zu diesem oder jenem Aspekt griechischen Lebens, der Helen Clyde erheiterte, während sie das Land auf einer anscheinend endlosen Reise durchstreifte, die sie im Januar angetreten hatte, nur wenige Tage, nachdem Lynley sie gebeten hatte, seine Frau zu werden. Ihre Antwort war ein entschiedenes Nein gewesen, und die Ansichtskarten, die sie alle nach New Scotland Yard sandte und nicht an Lynleys Privatadresse, unterstrichen ihre Entschlossenheit, ungebunden zu bleiben.
Daß Lynley täglich, wenn nicht gar stündlich, an Helen Clyde dachte, daß er sie begehrte und liebte, das waren, wie Barbara wußte, die unausgesprochenen Gefühle hinter seiner nicht erlahmenden Bereitschaft, ohne Protest einen Fall nach dem anderen zu übernehmen. Alles war ihm recht, um den heulenden Wölfen der Einsamkeit zu entfliehen, um zu verhindern, daß der Schmerz eines Lebens ohne Helen sich in ihm festfraß wie ein giftiges Geschwür.
Barbara legte die Karte wieder hin, trat ein paar Schritte zurück und ließ ihren Berichtteil mit gekonntem Schwung in seinen Eingangskorb segeln. Der nachfolgende Luftzug, der sein Gesicht streifte, und das Rascheln seiner Papiere, die zu Boden flatterten, weckten ihn. Er fuhr hoch, quittierte die Tatsache, daß er im Schlaf ertappt worden war, mit einem entwaffnenden Lächeln, rieb sich das Genick und nahm seine Brille ab.
Barbara ließ sich seufzend in den Sessel neben seinem Schreibtisch fallen und fuhr sich so kräftig durch die kurzen Haare, daß sie hinterher wie die Borsten einer Bürste von ihrem Kopf abstanden. »Ach ja«, sagte sie, »die Schotten haben’s gut.«
Er unterdrückte ein Gähnen. »Die Schotten, Havers? Was um alles in der Welt –«
»Na, die sitzen doch direkt an der Quelle. Wenn ich an das köstliche Aroma denke...«
Lynley streckte seine langen Glieder und bückte sich, um seine Papiere aufzusammeln. »Ach, so ist das gemeint«, sagte er. »Gehe ich recht in der Annahme, daß Sie heute Ihr gewohntes Quantum Alkohol noch nicht genossen haben, Sergeant?«
Sie lachte. »Gehen wir doch rüber ins King’s Arms, Inspector. Sie dürfen mich einladen. Zwei vom MacAllan, und wir singen beide ein Loblied auf Malz und Gerste. Das werden Sie sich doch nicht entgehen lassen wollen. Ich hab eine verdammt gute Altstimme, mit soviel Seele, daß es Ihnen die Tränen in die schönen braunen Augen treibt.«
Lynley polierte seine Brille, setzte sie auf und nahm sich ihre Arbeit vor. »Ich fühle mich hochgeehrt von Ihrer Einladung. Glauben Sie mir. Ihr Anerbieten, mir etwas vorzuträllern, rührt mich bis ins Herz, Havers. Aber es muß doch heute noch jemand hier sein, den Sie nicht so regelmäßig geschröpft haben wie mich. Wo ist Constable Nkata? Den habe ich heute nachmittag gar nicht im Haus gesehen.«
»Er mußte weg. Zu einem Fall.«
»Wie schade. Da haben Sie aber wirklich Pech. Ich habe Webberly nämlich diesen Bericht für morgen früh versprochen.«
Barbara spürte einen Anflug von Erbitterung. Er war ihrer Einladung äußerst geschickt ausgewichen. Aber sie hatte andere Waffen.
»Sie haben ihn Webberly zwar für morgen versprochen, Sir, aber wir wissen doch beide, daß er ihn frühestens nächste Woche braucht. Machen Sie endlich einen Punkt, Inspector. Finden Sie nicht, es wird langsam Zeit, daß Sie unter die Lebenden zurückkehren?«
»Havers.« Lynley machte keine Bewegung. Er hob nicht einmal den Kopf von den Schriftstücken in seiner Hand. Sein Ton war Warnung genug. Er zog die Grenze, und er stellte klar, wer der Vorgesetzte war. Barbara hatte lange genug mit ihm zusammengearbeitet, um zu wissen, was es bedeutete, wenn er ihren Namen mit so ausgesuchter Distanz aussprach: Zutritt verboten. Ihre Einmischung war nicht erwünscht und würde nicht ohne Kampf zugelassen werden.
Aber einen letzten Ausfall in die sorgsam gehüteten Regionen seines Privatlebens konnte sie sich nicht verkneifen.
Mit dem Kopf wies sie auf die Ansichtskarte. »Viel Hoffnung macht Ihnen die gute Helen ja nicht, wie?«
Mit einem Ruck hob er den Kopf. Er legte den Bericht weg. Aber das durchdringende Läuten des Telefons schnitt ihm die Antwort ab.
Eines der Mädchen, die im unfreundlichen, mit schwarzgrauem Marmor ausgelegten Foyer von New Scotland Yard am Empfang arbeiteten, war am Telefon, als Lynley abhob. Unten warte ein Besucher, erklärte sie mit ihrer nasalen Stimme ohne Umschweife. Ein gewisser John Corntel, der nach Inspector Asherton gefragt habe. Das sind doch Sie, oder? Fürchterlich, diese Leute, die sich keinen Namen richtig merken können. Sie mit Ihren vielen Namen und Titeln, schlimmer als die Königin persönlich. Eine Zumutung ist das, und von uns hier unten am Empfang wird erwartet, daß wir sie alle kennen und gleich wissen, wer gemeint ist, wenn ein alter Schulkamerad aufkreuzt und –
Lynley unterbrach den Klagegesang. »Corntel? Sergeant Havers kommt gleich hinunter.«
Er legte auf, als das Mädchen mit Märtyrerstimme fragte, wie er nächste Woche gern genannt werden würde. Vielleicht hätte er ja außer Lynley und Asherton noch einen verstaubten Familiennamen auf Lager, den er gern mal ein, zwei Monate ausprobieren würde?
Havers, die nach dem, was sie von dem Gespräch mitbekommen hatte, ihren nächsten Auftrag voraussah, war schon auf dem Weg zur Tür. Lynley sah ihr nach, eine rundliche Gestalt mit kurzen Beinen, und überlegte, was dieser unerwartete Besuch von Corntel zu bedeuten haben konnte.
Ein Geist aus der Vergangenheit. Sie waren zusammen in Eton gewesen. Corntel, einer der Besten, wie Lynley sich erinnerte, war unter den Schülern der Oberstufe eine beeindruckende Erscheinung gewesen; ein hochgewachsener, grüblerischer junger Mann, der immer etwas schwermütig wirkte, mit rabenschwarzem Haar und aristokratisch geschnittenen Gesichtszügen. Wie um den Erwartungen gerecht zu werden, die seine äußere Erscheinung hervorrief, hatte Corntel sich darauf vorbereitet, sein A-level in Literatur, Musik und Kunst abzulegen. Was nach Eton aus ihm geworden war, wußte Lynley nicht.
Dieses Bild John Corntels vor Augen, das Teil seiner eigenen Geschichte war, sah Lynley den Mann, der Sergeant Havers keine fünf Minuten später in sein Büro folgte, mit einiger Überraschung. Nur die Körpergröße war geblieben – gut über einen Meter achtzig groß, stand er Auge in Auge mit Lynley. Aber die gerade, selbstsichere Haltung des exzellenten Etonschülers, der sich seiner Qualitäten bewußt war, hatte sich völlig verloren. Die Schultern waren gekrümmt und nach vorn gezogen, als wolle er sich vor jeder Möglichkeit körperlichen Kontakts schützen. Und das war nicht die einzige Veränderung, die mit dem Mann vorgegangen war.
Statt der jugendlichen Locken trug er sein Haar jetzt sehr kurz geschnitten, und das glänzende Schwarz war von vorzeitigem Grau gesprenkelt. Das gutgeschnittene Gesicht, dessen Züge Sinnlichkeit und Intelligenz ausgedrückt hatten, war von einer fahlen Blässe, die an Krankenzimmer denken ließ, und die Haut spannte sich gummiartig über den Knochen. Die dunklen Augen waren blutunterlaufen.
Gewiß gab es eine Erklärung für die Veränderung, die John Corntel in den siebzehn Jahren, seit Lynley ihn zum letztenmal gesehen hatte, durchgemacht hatte. Kein Mensch veränderte sich ohne schwerwiegende Ursache auf so drastische Weise.
»Lynley. Asherton. Ich wußte nicht, welchen Namen ich angeben sollte«, sagte Corntel zaghaft. Aber die Zaghaftigkeit wirkte künstlich, vorherbedacht. Er bot Lynley die Hand. Sie war heiß und fühlte sich fiebrig an.
»Ich benutze den Titel selten. Einfach Lynley.«
»Ganz nützlich, so ein Titel. In der Schule nannten wir dich den wankelmütigen Vicomte. Woher kam das eigentlich? Ich erinnere mich nicht mehr.«
Lynley wollte keine Erinnerungen. Sie drohten verschlossene Türen zu sprengen. »Vicomte Vacennes.«
»Richtig. Der Zweittitel. Eine der Freuden, die man als ältester Sohn eines Earl genießt.«
»Allenfalls eine zweifelhafte Freude.«
»Vielleicht.«
Lynley beobachtete, wie Corntels Blick durch das Zimmer schweifte, von den Schränken und Regalen voller Bücher zum unordentlichen Schreibtisch und den beiden Bildern an der Wand, die Szenen aus dem amerikanischen Südwesten darstellten. Er blieb schließlich an dem einzigen Foto hängen, das im Zimmer stand, und Lynley wartete auf einen Kommentar. Corntel und Lynley waren beide mit Simon Allcourt-St. James zusammen in Eton gewesen, und da diese Fotografie von ihm mehr als dreizehn Jahre alt war, würde Corntel zweifellos das triumphierende Gesicht des wild zerzausten jungen Cricketspielers erkennen, der hier in zerrissener Hose, die Ärmel seines Pullovers über die Ellbogen hochgeschoben, einen Schmutzfleck auf dem Arm, in der ungetrübten, strahlenden Lebensfreude der Jugend eingefangen war. Auf seinen Cricketschläger gestützt, stand er da und lachte in reinem Entzücken. Drei Jahre danach hatte Lynley ihn zum Krüppel gefahren.
»St. James.« Corntel nickte. »Ich habe seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht. Lieber Gott, wie die Zeit vergeht.«
»Ja.« Lynley betrachtete den alten Schulkameraden aufmerksam, sah, wie sein Lächeln aufblitzte und wieder verschwand, wie seine Hände zu den Jackentaschen glitten und sie flachklopften, als wolle er sich des Vorhandenseins irgendeines Gegenstands vergewissern, den er vorzulegen beabsichtigte.
Sergeant Havers machte Licht, um die Schatten des späten Nachmittags zu vertreiben. Sie sah Lynley an. Bleiben oder gehen? fragte ihr Blick. Er wies mit dem Kopf auf einen der Sessel. Sie setzte sich, griff in ihre Hosentasche, zog eine Packung Zigaretten heraus.
»Rauchen Sie?« Sie bot Corntel die Packung an. »Der Inspector hat sich entschlossen, auch diesem Laster zu entsagen, und ich rauche nicht gern allein.«
Corntel schien überrascht, daß sie noch im Zimmer war; doch er nahm ihr Angebot dankend an und zog ein Feuerzeug heraus.
»Ja. Ich nehme gern eine. Danke.« Sein Blick schweifte zu Lynley und wieder weg. Er drehte die Zigarette in der Hand. Flüchtig biß er sich auf die Unterlippe. »Ich bin hergekommen, weil ich dich um deine Hilfe bitten möchte, Tommy«, sagte er hastig. »Ich hoffe, du kannst etwas tun. Ich bin in ernsten Schwierigkeiten.«
2
»Ein Junge ist aus der Schule verschwunden, und ich bin sein Hausvater. Ich bin also für ihn verantwortlich. Wenn ihm etwas passiert ist...«
Corntel erklärte in knappen Worten, zog zwischen abgerissenen Sätzen immer wieder an seiner Zigarette. Er war Hausvater und Leiter des englischen Fachbereichs in Bredgar Chambers, einer Privatschule in der Gegend zwischen Crawley und Horsham in West Sussex, etwas über eine Stunde von London entfernt. Der Junge, um den es ging – dreizehn Jahre alt, ein Sextaner, somit also neu auf der Schule –, stammte aus Hammersmith. Der Gesamtsituation nach zu urteilen, schien es sich hier um einen ausgeklügelten Plan zu handeln, den der Junge sich ausgedacht hatte, um zu einem Wochenende in ungebundener Freiheit zu kommen. Aber irgendwo und irgendwie war etwas schiefgegangen, und nun war der Junge verschwunden, wurde schon seit mehr als achtundvierzig Stunden vermißt.
»Ich könnte mir denken, daß er durchgebrannt ist.« Corntel rieb sich die Augen. »Tommy, ich hätte sehen müssen, daß den Jungen etwas bedrückte. Ich hätte es wissen müssen. Das gehört zu meinen Aufgaben. Wenn er so wild entschlossen war durchzubrennen, wenn er all die Monate so unglücklich war, und ich das nicht bemerkt habe ... Die Eltern kamen völlig hysterisch in der Schule an, ein Mitglied unseres Verwaltungsrats war zufällig zur selben Zeit da, und der Schulleiter war den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, die Eltern zu beruhigen, festzustellen, wer den Jungen zuletzt gesehen hat, und herauszubekommen, warum er ohne ein Wort auf und davon gegangen ist. Er will die Sache auf keinen Fall der zuständigen Polizei übergeben. Ich weiß nicht, was ich den Leuten sagen soll, was ich zu meiner Entschuldigung vorbringen kann, wie ich das wiedergutmachen soll.«
Er fuhr sich mit der Hand über das kurze Haar und versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht. »Im ersten Moment wußte ich nicht, wohin ich mich wenden sollte. Dann fielst du mir ein. Es schien mir geradezu eine Eingebung. Schließlich waren wir in Eton gute Freunde. Und – lieber Gott, ich quaßle wie ein Schwachsinniger, ich weiß. Ich kann nicht mal mehr klar denken.«
»Das ist eine Angelegenheit für die Polizei von West Sussex«, sagte Lynley. »Wenn es überhaupt eine Angelegenheit für die Polizei ist. Warum hat man sie noch nicht benachrichtigt, John?«
»Wir haben in der Schule eine Gruppe, die sich die freiwilligen Helfer nennt, und diese Schüler sind jetzt unterwegs, um den Jungen zu suchen – in der Annahme, daß er nicht weit gekommen sein kann. Oder in der Annahme, daß ihm in der Nähe der Schule etwas zugestoßen ist. Die Polizei nicht einzuschalten, war der Entschluß des Schulleiters. Er und ich haben das abgesprochen. Ich habe ihm erzählt, daß ich eine Verbindung zum Yard hätte.«
Lynley konnte sich die Einzelheiten der Situation, in die Corntel da geraten war, leicht ausmalen. Ganz abgesehen von seiner berechtigten Sorge um den Jungen mußte sich John Corntel auch um seine eigene Stellung – vielleicht sogar seine Karriere – sorgen; alles hing davon ab, daß der Junge rasch und wohlbehalten wiedergefunden wurde. Es kam vor, daß ein Kind im Internat Heimweh bekam und vielleicht den Versuch machte, zu seinen Eltern oder seinen alten Freunden zurückzukehren; meistens wurde der kleine Delinquent schon nach kurzer Zeit und ganz in der Nähe der Schule wieder gefaßt. Aber dies war eine ernste Sache. Corntels stockend vorgetragener Schilderung zufolge war der Junge am Freitagnachmittag das letzte Mal gesehen worden, und seitdem hatte niemand auch nur einen Gedanken an seinen Verbleib verschwendet. Was die Entfernung anbetraf, die er in der Zeit seiner Abwesenheit möglicherweise hatte zurücklegen können – die Lage war wirklich mehr als ernst für Corntel. Sie war gewissermaßen der Auftakt zur beruflichen Katastrophe. Kein Wunder, daß er dem Schulleiter versichert hatte, er könne sie allein bereinigen, rasch und diskret.
Aber Lynley konnte nichts tun. Scotland Yard konnte nicht einfach Fälle übernehmen, die von Privatpersonen unterbreitet wurden, und man hütete sich beim Yard davor, ohne förmliches Ansuchen der zuständigen Regionalpolizei in fremdes Revier einzudringen. Corntels Reise nach London war also nichts als Zeitverschwendung, und je eher er auf die Schule zurückkehrte und den Fall den zuständigen Behörden übergab, desto besser würde es für alle Beteiligten sein. Davon gedachte Lynley ihn zu überzeugen, sammelte daher alle ihm zur Verfügung stehenden Fakten, um sie in der Weise einzusetzen, daß sie Corntel zu der unausweichlichen Schlußfolgerung führen mußten, daß die zuständige Polizeidienststelle eingeschaltet werden mußte.
»Was genau ist denn eigentlich geschehen?« fragte er.
Sergeant Havers griff bei der Frage ihres Vorgesetzten automatisch nach einem Spiralblock auf Lynleys Schreibtisch und begann auf gewohnt kompetente Weise Fragen und Antworten zu notieren. Sie kniff die Augen zusammen, als ihr der Rauch ihrer Zigarette ins Gesicht stieg, hustete, drückte die Zigarette an der Schuhsohle aus und warf sie in den Papierkorb.
»Der Junge – Matthew Whateley – hatte für dieses Wochenende einen Urlaubsschein. Er wollte mit einem anderen Schüler, Harry Morant, zu dessen Eltern fahren. Morants Familie hat in Lower Slaughter ein Landhaus, und dort sollte Harrys Geburtstag gefeiert werden. Fünf von unseren Schülern waren eingeladen. Sie hatten alle die Erlaubnis der Eltern.«
»Wer sind die Morants?«
»Erstklassige Familie«, antwortete Corntel. »Die drei älteren Söhne waren auch schon in Bredgar Chambers. Eine Tochter ist jetzt bei uns in der Oberstufe. Für die zwei letzten Jahre nehmen wir auch Mädchen auf«, fügte er überflüssigerweise hinzu. »In der Oberstufe. Meiner Ansicht nach bekam Matthew deswegen kalte Füße. Ich meine, wegen der Familie – den Morants –, nicht weil wir Mädchen aufnehmen.«
»Das verstehe ich nicht. Was hat die Familie damit zu tun?«
Corntel warf einen Blick des Unbehagens auf Sergeant Havers. Dieser kurze, nervöse Blick verriet Lynley, was als nächstes kommen würde. Corntel hatte an Havers’ ausgeprägtem Akzent gehört, daß sie aus der Arbeiterklasse stammte. Wenn die Morants als Kern des Problems bezeichnet wurden und, wie Corntel gesagt hatte, eine erstklassige Familie waren, dann konnte das nur heißen, daß Matthew genau wie Havers aus einer ganz anderen Klasse kam.
»Ich glaube, Matthew bekam kalte Füße«, wiederholte Corntel. »Er ist ein Kleinstadtkind und ist jetzt das erste Jahr auf einer Privatschule. Bisher hat er nur öffentliche Schulen besucht. Er hat immer zu Hause gelebt. Jetzt kommt er mit ganz anderen Leuten zusammen – so etwas braucht Zeit. Die Umstellung ist nicht einfach.« Er streckte wie um Verständnis bittend die geöffnete Hand aus. »Du weißt, was ich meine.«
Lynley sah, wie Havers den Kopf hob, wie ihre Augen sich verengten bei dem, was unausgesprochen hinter Corntels Worten stand. Er wußte, daß sie ihre Herkunft aus dem Arbeitermilieu immer wie ein Schild vor sich hergetragen hatte.
»Und als Matthew am Freitag nicht mitkam?« fragte er. »Die Jungen hatten sich doch sicherlich irgendwo verabredet, um gemeinsam ins Wochenende zu fahren. Haben sie sich über sein Ausbleiben keine Gedanken gemacht? Haben sie es dir nicht gemeldet, als er nicht kam?«
»Sie glaubten ja, sie wüßten, wo er ist. Wir hatten am Freitagnachmittag Sport, und danach wollten die Jungen losfahren. Sie sind alle im selben Hockeyteam. Matthew kam nicht zum Spiel, aber niemand dachte sich etwas dabei, weil der Sportlehrer der Sexta – Cowfrey Pitt, einer unserer Lehrer – einen Zettel von der Krankenstation bekommen hatte, der besagte, daß Matthew erkrankt sei und am Spiel nicht teilnehmen könne. Als die Jungen das hörten, nahmen sie automatisch an, er würde auch nicht mit ihnen ins Wochenende fahren. Das war durchaus logisch.«
»Was war das für ein Zettel?«
»Eine Befreiung. Ein Standardformular von der Krankenstation mit Matthews Namen darauf. Offen gestanden, mir sieht es danach aus, als hätte Matthew das alles im voraus inszeniert. Von zu Hause holte er sich die Erlaubnis, das Internat zu verlassen, um angeblich mit zu den Morants zu fahren. Gleichzeitig besorgte er sich eine Befreiung, der zu entnehmen war, daß er auf der Krankenstation lag. Aber da die Befreiung gefälscht war, bekam ich keine Kopie von der Krankenstation. Folglich mußte ich annehmen, Matthew sei mit den Jungen zu den Morants gefahren. Und die Morants andererseits mußten annehmen, er sei im Internat geblieben. Auf diese Weise wollte er sich offenbar ein freies Wochenende verschaffen, wo er tun und lassen konnte, was ihm beliebte. Und genau das hat er ja getan, der kleine Bengel.«
»Du hast nicht nachgeprüft, wo er war?«
Corntel beugte sich vor und drückte seine Zigarette aus. Seine Hand zitterte. Asche fiel auf Lynleys Schreibtisch. »Ich glaubte doch, ich wüßte, wo er war. Ich dachte, er sei bei den Morants.«
»Und der Hockeylehrer – wie hieß er gleich? Cowfrey Pitt? –, informierte der dich nicht, daß der Junge auf der Krankenstation lag?«
»Cowfrey nahm an, die Krankenstation würde mich informieren. So wird das im allgemeinen gehandhabt. Und wenn ich erfahren hätte, daß Matthew krank war, wäre ich selbstverständlich auf die Station gegangen, um nach ihm zu sehen. Das ist doch ganz klar.« Der Nachdruck, mit dem Corntel seine Beteuerungen hervorbrachte, war merkwürdig.
»Ihr habt doch sicher auch einen Hausältesten für jedes Haus. Was hat der denn die ganze Zeit getan? War er über das Wochenende in der Schule?«
»Brian Byrne. Ja. Ein Schüler der Oberstufe. Die meisten älteren Schüler hatten Urlaubsscheine und waren weg – wenigstens die, die nicht zu dem Hockeyturnier oben im Norden gefahren waren –, aber er war da. Im Haus. Er glaubte genau wie wir alle, Matthew sei bei den Morants. Nachgeprüft hat er das so wenig wie ich. Es lag ja auch kein Anlaß dazu vor. Im übrigen wäre eine Überprüfung meine Aufgabe gewesen und nicht Brians. Ich möchte mein Versäumnis, wenn es eines war, keinesfalls auf meinen Hausältesten abwälzen. Das kommt nicht in Frage.«
Wie bei den vorhergehenden Beteuerungen verlieh Corntel auch jetzt wieder seinen Worten einen seltsamen Nachdruck, der dem Bedürfnis zu entspringen schien, alle Schuld auf die eigene Kappe zu nehmen. Lynley wußte, daß es im allgemeinen nur einen Grund für ein solches Bedürfnis gab. Wenn Corntel die Schuld auf sich nehmen wollte, dann verdiente er sie zweifellos auch.
»Er wird gewußt haben, daß er bei den Morants ganz und gar nicht in seinem Element sein würde. Er wird es gefühlt haben«, sagte Corntel.
»Du scheinst da ja ziemlich sicher zu sein.«
»Er war Stipendiat.« Corntel schien zu glauben, damit sei alles erklärt. Dennoch fügte er hinzu: »Ein netter Junge. Fleißig.«
»Er war bei den anderen Schülern beliebt?«
Als Corntel zögerte, meinte Lynley: »Nun, wenn einer von ihnen ihn sogar zu sich nach Hause eingeladen hat, ist das doch eigentlich die logische Schlußfolgerung.«
»Ja, ja. Sicher. Ich bin nur – Siehst du jetzt, wie ich dem Jungen gegenüber versagt habe? Ich weiß es nicht. Er war immer so still. Hat immer nur brav gearbeitet. Er hatte nie ein Problem. Oder hat jedenfalls nie etwas dergleichen gesagt. Und seine Eltern hatten sich sehr über diese Wochenendeinladung gefreut. Sein Vater sprach das ganz offen aus, als er uns die Erlaubnis schickte. ›Schön, daß Mattie jetzt ein bißchen in die große Welt hinauskommt‹ oder so ähnlich, schrieb sein Vater.«
»Wo sind die Eltern jetzt?«
Corntel machte ein unglückliches Gesicht. »Ich weiß es nicht. In der Schule vielleicht. Oder sie sitzen zu Hause und warten auf Nachricht. Wenn es dem Schulleiter nicht gelungen ist, sie davon abzuhalten, sind sie vielleicht direkt zur Polizei gegangen.«
»Wo ist bei euch die nächste Polizeidienststelle?«
»In Cissbury – das ist das nächste Dorf – gibt es einen Constable. Ansonsten ist Horsham für uns zuständig.«
»Ja, und leider nicht Scotland Yard.«
Corntels Schultern krümmten sich noch etwas mehr bei dieser Bemerkung. »Aber irgend etwas wirst du doch tun können, Tommy! Irgendwas wirst du doch ins Rollen bringen können!«
»Auf diskretem Weg?«
»Ja. Meinetwegen. Du kannst es nennen, wie du willst. Ich weiß, es wäre eine rein persönliche Gefälligkeit. Ich kann hier keinerlei Ansprüche stellen. Aber um Gottes willen, wir waren doch zusammen in Eton.«
Es war ein Appell an die Loyalität; an alte Bindungen; der eine immerwährende Bereitschaft, dem Ruf der Vergangenheit zu folgen, als selbstverständlich voraussetzte. Gern hätte sich Lynley mit aller Rigorosität darüber hinweggesetzt. Der Polizeibeamte in ihm drängte ihn dazu. Aber der Junge, der einmal die Freuden und Nöte des Internatslebens mit Corntel geteilt hatte, war noch lebendiger, als es Lynley lieb war.
»Wenn er durchgebrannt sein sollte«, sagte er darum, »vielleicht in der Absicht, nach London zu gelangen, dann hätte er doch ein Transportmittel gebraucht. Wie weit seid ihr von der nächsten Bahnlinie entfernt? Von der Autobahn oder einer der größeren Straßen?«
Corntel schien in dieser Frage die hilfreich dargebotene Hand zu sehen, die er sich wünschte. Er antwortete bestimmt, eifrig bemüht, Nützliches beizusteuern.
»Wir sind von allen Verkehrsverbindungen ziemlich weit entfernt, Tommy. Das ist einer der Gründe, warum viele Eltern ihre Kinder gern zu uns schicken. Sie sehen eine gewisse Sicherheit darin, Bredgar Chambers liegt isoliert. Da kann man keine Dummheiten machen. Es gibt keine Ablenkungen. Matthew hätte ganz schön marschieren müssen, um sicher davonzukommen. Er hätte es sich nicht leisten können, in der Nähe der Schule ein Auto anzuhalten; da wäre die Gefahr zu groß gewesen, daß jemand von der Schule – einer der Lehrer vielleicht oder einer der anderen Angestellten – vorbeigekommen wäre, ihn gesehen und sofort aufgelesen hätte.«
»Dann wird er vermutlich gar nicht erst zur Straße gegangen sein.«
»Das denke ich auch. Meiner Ansicht nach ist er querfeldein gelaufen, durch den St. Leonard’s Forst hinauf nach Crawley und zur M 23. Da hätte er nichts mehr zu fürchten gehabt.«
»Das Wahrscheinlichste ist, daß er dort immer noch ist, meinst du nicht? Daß er sich verlaufen hat.«
»Zwei Nächte im Freien, jetzt, im März? Er kann sich den Tod geholt haben bei dieser Kälte. Oder er ist verhungert. Er kann sich ein Bein gebrochen haben oder gestürzt sein und sich das Genick gebrochen haben«, zählte Corntel mit Entsetzen auf.
»In drei Tagen verhungert man nicht«, versetzte Lynley. »Ist er ein großer Junge? Kräftig?«
Corntel schüttelte den Kopf. »Überhaupt nicht. Er ist sehr klein für sein Alter. Zart. Sehr zierlich. Ein schönes kleines Gesicht.« Er hielt inne, den Blick auf ein Bild gerichtet, das die anderen nicht sehen konnten. »Dunkles Haar. Dunkle Augen. Lange, schmale Hände. Makellose Haut. Wunderschöne Haut.«
Havers klopfte mit dem Bleistift auf ihren Block. Sie sah Lynley an. Als Corntel es bemerkte, hielt er inne. Tiefe Röte schoß ihm ins Gesicht.
Lynley schob seinen Sessel vom Schreibtisch weg.
»Hast du ein Foto von dem Jungen dabei?« fragte er. »Kannst du uns eine genaue Beschreibung geben?« Die letzte Frage, dachte er, war wahrscheinlich überflüssig.
»Ja, natürlich. Beides.« Die Erleichterung war nicht zu überhören.
»Dann laß uns beides da, und wir werden sehen, ob wir von hier aus etwas tun können. Vielleicht hat man ihn schon in Crawley aufgegabelt, und er traut sich nur nicht, seinen Namen anzugeben. Oder vielleicht irgendwo näher bei London. Man kann nie wissen.«
»Ich dachte – ich hoffte, daß du mir helfen würdest. Ich habe schon...« Corntel griff in die Brusttasche seines Jacketts und zog eine Fotografie und ein gefaltetes Blatt Papier heraus, das mit Maschine beschrieben war. Wenigstens besaß er Anstand genug, leichte Verlegenheit zu zeigen: die Tatsache, daß er beides zur Hand hatte, bewies, daß er fest mit Lynleys Hilfe gerechnet hatte.
Lynley nahm verdrossen Foto und Zettel. John Corntel war sich des alten Freundes sehr sicher gewesen.
Barbara las die Beschreibung, die Corntel ihnen dagelassen hatte. Sie studierte die Fotografie des Jungen, während Lynley den Aschenbecher ausleerte, den sie und Corntel während des Gesprächs gefüllt hatten. Er wischte ihn sorgfältig mit einem Papiertuch aus.
»Mein Gott, Sie sind ja schlimmer als eine alte Jungfer, Inspector«, bemerkte Barbara vorwurfsvoll. »Soll ich vielleicht von jetzt ab ein großes rotes R auf der Brust tragen.«
»Unsinn. Entweder ich leere den Aschenbecher aus oder ich freß den ganzen Müll aus reiner Verzweiflung. Und da scheint mir Ausleeren doch etwas angemessener zu sein. Aber auch nur um ein Haar.« Er blickte lächelnd auf.
Sie lachte trotz ihrer Gereiztheit. »Warum haben Sie das Rauchen überhaupt aufgegeben? Marschieren Sie doch einfach mit uns anderen früher ins Grab. Je mehr wir sind, desto lustiger ist es.«
Er antwortete nicht. Statt dessen fiel sein Blick zu der Ansichtskarte, die an eine Kaffeetasse gelehnt auf seinem Schreibtisch stand. Barbara wußte Bescheid. Helen Clyde rauchte nicht.
»Glauben Sie im Ernst, das ändert was, Inspector?«
Seine Antwort war eine Zurückweisung. »Wenn der Junge wirklich durchgebrannt ist, wird er wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder auftauchen. Sollte er allerdings nicht auftauchen, dann wird man, so gefühllos das klingt, vermutlich seine Leiche finden. Ich frage mich, ob die guten Leute darauf vorbereitet sind.«
Barbara gab den letzten Worten geschickt einen Sinn, der ihren Absichten entsprach. »Ist man denn je auf das Schlimmste vorbereitet, Inspector?«
Schicke meinen Wurzeln Regen. Schicke meinen Wurzeln Regen.
Diese vier Worte im Kopf wie einen sich endlos wiederholenden Refrain, saß Deborah St. James in ihrem Austin und starrte unverwandt auf das überdachte Tor des Kirchhofs von St. Giles, etwas außerhalb des Städtchens Stoke Poges. Ihre Aufmerksamkeit galt keinem Detail im besonderen. Vielmehr versuchte sie zurückzurechnen, wie oft in den vergangenen vier Wochen sie nicht nur diese Schlußworte, sondern Hopkins’ ganzes Sonett für sich aufgesagt hatte. Jeden neuen Tag hatte sie mit ihm begonnen und hatte daraus die Kraft geschöpft, die sie aus dem Bett, aus dem Hotelzimmer zu ihrem Wagen trieb und weiter von einem Aufnahmeort zum nächsten, wo sie wie ein Automat fotografiert hatte. Darüber hinaus jedoch hätte sie nicht sagen können, wie oft jeden Tag sie zu diesen vierzehn Zeilen flehentlicher Bitte Zuflucht genommen hatte, sobald irgendein unerwarteter Anblick, ein Wort, eine Musik oder sonst ein Geräusch, auf das sie nicht vorbereitet war, ihre Abwehr durchdrungen und ihre Ruhe erschüttert hatten.
Sie wußte, warum die Zeilen ihr jetzt in den Sinn kamen. Die Kirche von St. Giles war die letzte Station ihrer Fahrt, die mehr eine Flucht gewesen war. Am Ende dieses Nachmittags würde sie nach London zurückkehren, allerdings nicht auf der M 4, das wäre ihr zu schnell gegangen, sondern lieber auf der A 4 mit ihren vielen Ampeln, den ewigen Staus rund um Heathrow und der langen Kette rußverschmutzter und wintergrauer Vororte. Das würde die Fahrt in die Länge ziehen, und genau das war der springende Punkt. Sie konnte ihr Ende nicht ins Auge fassen. Sie wußte noch immer nicht, wie sie es fertigbringen sollte, Simon gegenüberzutreten.
Vor Monaten, als sie diesen Auftrag, Schauplätze von literarischer Bedeutung zu fotografieren, übernommen hatte, hatte sie die Fahrt so geplant, daß in Stoke Poges, wo Thomas Gray seine Elegy Written in a Country Churchyard geschrieben hatte, ihre Arbeit, nur einen Katzensprung von zu Hause, ihren Abschluß finden würde.
Deborah öffnete die Wagentür, nahm Kamera und Stativ und ging über den Parkplatz zum Tor. Der Friedhof dahinter war in zwei Hälften unterteilt; einen gebogenen Betonweg hinunter stand auf halbem Weg ein zweites überdachtes Tor, das in den zweiten Friedhof führte.
Die Luft war kalt für Spätmärz, ohne Verheißung des kommenden Frühlings. Ab und zu zwitscherte ein Vogel in den Bäumen, sonst war es, abgesehen vom gelegentlichen gedämpften Brummen eines Jets von Heathrow, still auf dem Friedhof. Verständlich, dachte sie, daß Thomas Gray hier sein Gedicht geschrieben und sich diesen Ort zur letzten Ruhe gewählt hatte.
Sie schloß das erste Tor hinter sich und ging zwischen zwei Reihen Buschrosen hindurch den Weg entlang. Die Bäumchen hatten schon neue Triebe, zarte junge Blättchen und feste kleine Knospen, doch diese neue Frische stand in scharfem Kontrast zur Umgebung. Dieser äußere Friedhof war schlecht instandgehalten. Gras und Unkraut wucherten wild, die alten verwitterten Grabsteine standen schief.
Das zweite Tor war feiner gearbeitet als das erste, und vielleicht in der Hoffnung, mutwillige Zerstörer davon abzuhalten, das feine Schnitzwerk des Tordachs, möglicherweise auch den Friedhof und die Kirche selbst, zu beschädigen, hatte man an einem der Torpfosten einen Scheinwerfer angebracht. Aber diese Vorsichtsmaßnahme konnte jetzt nichts mehr helfen; der Scheinwerfer war eingeschlagen, Glasscherben lagen hier und dort auf dem Boden.
Hinter dem zweiten Tor hielt Deborah nach dem Grab Thomas Grays Ausschau, das Gegenstand ihrer letzten Aufnahmen werden sollte. Beinahe sofort fiel ihr Blick auf eine Spur von Vogelfedern. Wie von der Hand eines Auguren zerrupft und ausgestreut lagen sie da, aschfarbener Flaum im gepflegten grünen Rasen. Sie sahen aus wie kleine Rauchwölkchen, die anstatt zum Himmel aufzusteigen und sich in der Luft aufzulösen, Substanz angenommen hatten. Doch die Zahl der Federn und die eindeutig gewaltsame Art, wie sie zerrupft worden waren, ließen auf einen erbitterten Kampf auf Leben und Tod schließen, und Deborah folgte ihrer Spur zu dem Ort ganz in der Nähe, wo der besiegte Kämpfer lag.
Der Kadaver des Vogels befand sich etwa einen halben Meter von der Eibenhecke entfernt, die inneren und äußeren Friedhof trennte. Deborah erschrak bei seinem Anblick. Obwohl sie geahnt hatte, was die entdecken würde, überkam sie angesichts der Brutalität, durch die das Geschöpf den Tod gefunden hatte, ein so tiefes Mitleiden – völlig absurd, wie sie sich sagte –, daß ihr die Tränen in die Augen schossen. Nichts war übrig von dem Vogel als ein zerbrechlicher, blutgetränkter Brustkorb, von beflecktem Flaum bedeckt, der keinen Schutz geboten hatte. Der Kopf fehlte. Beine und kleine Klauen waren abgerissen worden. Das kleine Geschöpf war vielleicht einmal eine Holztaube gewesen, jetzt war es nur noch eine beschädigte Hülle, in der einmal, allzu kurz, Leben gewesen war.
Wie flüchtig es war. Wie rasch es ausgelöscht werden konnte.
Deborah spürte, wie der Schmerz in ihr aufwallte, und wußte, daß ihr der Wille fehlte, ihn zu besiegen. In den vergangenen vier Wochen hatte sie ihn mit Arbeit bekämpft. Und ihr wandte sie sich auch jetzt wieder zu, ging fort von dem Vogel, in ihren kalten Händen ihr Arbeitsgerät.
Schauplätze der Literatur, hieß ihr Auftrag. In den Wochen seit Ende Februar hatte Deborah das Yorkshire der Brontes erforscht und sich in den Bann von Ponden Hall und High Withens ziehen lassen; sie hatte Tintern Abbey im Mondschein festgehalten; sie hatte das Cobb und insbesondere Granny’s Teeth fotografiert, von wo Louisa Musgrove in den Tod gestürzt war; sie hatte den Turnierplatz in Ashby de la Zouch abgeschritten, hatte das Kommen und Gehen in der Trinkhalle von Bath beobachtet, die Straßen von Dorchester durchstreift, um den langsamen Verfall Michael Henchards zu erspüren, und sie hatte sich vom Zauber der Hill Top Farm einfangen lassen.
In jedem Fall hatten der Schauplatz selbst und ihre Beschäftigung mit der Literatur, die er ausgelöst hatte, sie beflügelt und inspiriert. Aber als sie sich jetzt an diesem letzten Aufnahmeort umsah und die beiden Bauten entdeckte, die, da sie so nah bei der Kirche standen, die Grabmäler sein mußten, die sie fotografieren wollte, war sie enttäuscht. Wie sollte sie etwas so Prosaisches, Banales je in eine poetische Form bringen?
Deborah runzelte die Stirn. »Die reinste Katastrophe«, murmelte sie. Aus ihrem Kamerakoffer holte sie das Manuskript des Buches, das ihre Fotografien illustrieren sollten. Sie legte mehrere Seiten davon auf die Überdachung des Grabes, um nicht nur Elegy Written in a Country Churchyard zu lesen, sondern auch die Interpretation, die es begleitete. Nachdenklich, mit wachsendem Verständnis, ruhte ihr Blick schließlich auf der elften Stanze des Gedichts. Sie sann lange darüber nach.
Ruft einer Urne Pracht, des Künstlers Meisterstück,Ein seelenvolles Bild! den Geist im Flug zurück?Kann zu des Grabes Nacht der Ehre Stimme dringen?Läßt sich des Todes Ohr durch Schmeicheleien zwingen?
Als sie wieder aufblickte, sah sie den Friedhof so, wie Gray gewollt hatte, daß sie ihn sehen sollte, und sie wußte, daß ihre Aufnahmen das einfache Leben wiedergeben mußten, das der Dichter mit seinen Worten hatte feiern wollen. Sie packte die Papiere wieder ein und stellte ihr Stativ auf.
Nichts Schwelgerisches würde es werden, nichts Raffiniertes, schlichte fotografische Aufnahmen, die von Hell und Dunkel Gebrauch machten, um die Reinheit und die Schönheit einer ländlichen Abenddämmerung darzustellen. Sie bemühte sich, die Bescheidenheit des Ortes einzufangen, wo, um mit Gray zu sprechen, »von diesem armen Dorf der Väter rohe Schaar« schlief, und rundete ihre Impressionen mit einer Aufnahme der Eibe ab, unter der der Dichter angeblich seine Verse geschrieben hatte.
Als das getan war, ließ sie ihre Sachen liegen und ging ein paar Schritte, um nach Osten zu blicken, Richtung London. Es gab keinen Aufschub mehr. Es gab keinen Vorwand mehr, ihrem Zuhause fernzubleiben. Aber sie mußte sich darauf einstellen, ehe sie ihrem Mann gegenübertreten konnte. Darum ging sie in die Kirche.
Gleich als sie eintrat, fiel ihr Blick auf den Gegenstand, der in der Mitte des Kirchenschiffs stand, ein achteckiges Taufbecken aus Marmor, das unter der hohen Wölbung der Holzdecke klein, beinahe zierlich wirkte. Jede Seite des Beckens war mit feingemeißelten Reliefs verziert, und hinter ihm standen zwei hohe Zinnleuchter mit frischen Kerzen.
Deborah ging nach vorn und berührte vorsichtig das glatte Eichenholz, das das Becken bedeckte. Nur einen Moment lang gab sie der Vorstellung nach, sie halte ein Kind in ihren Armen und spüre den zarten Druck seines Köpfchens an ihrer Brust. Sie hörte sein erschrecktes Aufweinen, als das Wasser auf seine reine, ungeschützte Stirn tropfte. Sie spürte, wie sich das Händchen um ihren Finger schloß. Sie erlaubte sich zu vergessen, daß sie – zum viertenmal innerhalb von achtzehn Monaten – eine Fehlgeburt gehabt hatte. Sie erlaubte sich zu vergessen, daß sie je im Krankenhaus gewesen war, doch die Erinnerung an das letzte Gespräch mit dem Arzt hatte sie nie endgültig verdrängen können. Sie konnte nicht entfliehen.
»Ein Abbruch schließt die Möglichkeit zukünftiger gesunder Schwangerschaften nicht unbedingt aus, Deborah. Aber es kommt vor. Sie sagen, das war vor mehr als sechs Jahren. Vielleicht gab es Komplikationen. Verwachsungen eventuell oder etwas Ähnliches. Das können wir mit Sicherheit erst nach gründlichen Untersuchungen sagen. Wenn Sie und Ihr Mann also wirklich den Wunsch haben...«
»Nein!«
Das Gesicht des Arztes zeigte augenblicklich Verständnis. »Simon weiß nichts davon?«
»Ich war gerade erst achtzehn. Ich war in Amerika. Er soll nicht – er darf nicht . . . «
Selbst jetzt schreckte sie vor dem Gedanken daran zurück. In Panik tastete sie nach einem Kirchenstuhl, riß das Türchen auf, stolperte hinein und sank auf die Bank.
Hier wartet kein Wunder auf mich, dachte sie bitter, kein Wasser von Lourdes, in dem ich mich waschen kann, kein Handauflegen, keine Absolution. Sie verließ die Kirche.
Die Sonne stand tief. Deborah holte ihre Sachen und ging auf dem Betonweg zurück. Am inneren Tor drehte sie sich um und warf einen letzten Blick auf die Kirche, als könne diese ihr doch noch den inneren Frieden geben, den sie suchte. Die untergehende Sonne sandte Strahlen ersterbenden Lichts zum Himmel hinauf, die hinter den Bäumen um die Kirche und ihren gezinnten normannischen Glockenturm wie eine Aureole leuchteten.
Normalerweise hätte sie ohne Überlegung fotografiert, um den langsamen Wechsel des Farbenspiels am Himmel festzuhalten. In diesem Augenblick jedoch konnte sie nur zusehen, wie die Schönheit des Lichts fahl wurde und verblich, während sie daran dachte, daß sie die Heimkehr und die Rückkehr zu Simons argloser, bedingungsloser Liebe nicht länger vermeiden konnte.
Auf dem Weg, dicht vor ihren Füßen, zankten sich zwei Eichhörnchen mit zornigem Geplapper. Sie stritten sich um einen Happen, jedes entschlossen, in diesem Kampf Sieger zu bleiben. Sie flitzten um einen verschnörkelten Marmorstein am Rand des Friedhofs und sprangen auf die knapp brusthohe Flintsteinmauer, die den Kirchengrund vom Feld eines Bauern abgrenzte und von mehreren ausladenden Nadelbäumen überschattet war. Hin und her huschten sie auf der Mauer, sich abwechselnd attackierend. Pfötchen und buschige Schwänze flogen im erbitterten Kampf, und das heißumstrittene Häppchen fiel zu Boden.
Deborah nahm die Gelegenheit wahr. »Schluß jetzt«, sagte sie. »Nicht streiten. Hört auf ihr beiden!«
Sie näherte sich den beiden Tieren, und diese flohen, als sie sie kommen sahen, auf die andere Seite der Mauer, in die Bäume.
»Na, das ist doch besser als streiten, oder?« sagte sie und blickte zu den Zweigen hinauf, die über den Friedhof hingen. »Benehmt euch jetzt! Streiten gehört sich nicht. Und das ist hier wirklich nicht der Ort dafür.«
Eines der Eichhörnchen hatte sich in einer Gabelung zwischen Ast und Baumstamm niedergelassen. Das andere war verschwunden. Das Tier oben im Baum beobachtete sie von seinem sicheren Plätzchen aus mit wachem Blick. Dann begann es, offenbar beruhigt, sich zu putzen, wobei es sich die Pfötchen träge über die Augen zog, als beabsichtige es, ein Nickerchen zu machen.
»Ich an deiner Stelle wär mir meiner Sache nicht so sicher«, warnte Deborah. »Der andere kleine Frechdachs wartet wahrscheinlich nur auf so eine Gelegenheit, um dich wieder zu überfallen. Was meinst du, wo er sich versteckt hat, hm?«
Sie suchte mit den Augen erfolglos in den Zweigen und senkte schließlich den Blick.
»Er wird doch nicht so schlau sein und –« Die Stimme versagte ihr. Der Mund war ihr augenblicklich trocken. Alle Worte flohen sie. Alle Gedanken lösten sich auf.
Unter dem Baum lag die nackte Leiche eines Kindes.
3
Entsetzen lähmte sie und ließ sie wie angewurzelt verharren. Details gewannen eine ungeheure Intensität, von der Gewalt des Schocks in ihr Hirn eingehämmert.
Sie spürte, wie sich ihr Mund öffnete, sie fühlte den Luftschwall, der ihre Lunge mit unnatürlicher Kraft aufblähte. Nur ein Schrei des Entsetzens hätte die Luft rasch genug wieder herauspressen können, um zu verhindern, daß ihre Lunge barst.
Aber sie konnte nicht schreien, und selbst wenn sie es getan hätte, es war ja niemand in der Nähe, der sie hätte hören können. Sie brachte nur ein Flüstern zustande. »O Gott.« Und dann, sinnlos: »Simon.« Danach starrte sie, obwohl sie es nicht wollte, mit aufgerissenen Augen hinunter, die Hände zu Fäusten geballt und alle Muskeln gespannt, um jederzeit wegzulaufen, wenn sie mußte, sobald sie konnte.
Das Kind lag halb auf dem Bauch gleich hinter der Mauer im blütenlosen Gerank irgendeines Kriechgewächses. Nach Länge und Schnitt des Haars zu urteilen, mußte es ein Junge sein.
Selbst wenn Deborah so naiv oder so hysterisch gewesen wäre, sich einreden zu wollen, er schliefe nur, wäre eine Erklärung dafür, warum er splitternackt in der Spätnachmittagsluft schlief, die von Minute zu Minute kühler wurde, unmöglich gewesen. Und warum unter einem Baum inmitten einer Fichtengruppe, wo die Temperatur noch niedriger war als dort, wo wenigstens die letzten Sonnenstrahlen noch etwas wärmten? Und warum hätte er in dieser unnatürlichen Lage schlafen sollen, fast die gesamte Last seines Körpers auf der rechten Hüfte, die Beine weit gespreizt, den rechten Arm so ungeschickt verdreht, daß er wie abgeknickt schien, den Kopf nach links gedreht, so daß das Gesicht zu drei Vierteln in den Boden gedrückt war? Und doch war seine Haut gerötet – ja, rot beinahe –, und das bedeutete doch Wärme, Leben, pulsierendes Blut.
Die Eichhörnchen nahmen ihr Gezänk wieder auf, flitzten den Baum hinunter, in dem sie Schutz gesucht hatten, und setzten in drolligen Sprüngen über die reglose Gestalt unweit des Baumstamms. Die winzige Kralle des ersten Eichhörnchens verfing sich im Fleisch des kindlichen Oberschenkels, blieb hängen, und das Tier war gefangen. Wütendes Geschimpfe war zu vernehmen, während das Tier verzweifelt versuchte, sich loszureißen. Die Haut des Kindes brach auf. Das Eichhörnchen verschwand.
Deborah sah, daß kein Blut aus der Wunde sickerte, die die Kralle zurückgelassen hatte. Einen Moment lang fand sie es merkwürdig, dann fiel ihr ein, daß Tote nicht bluten.
Jetzt endlich begann sie zu schreien und wandte sich ab. Aber jedes Detail stand ihr so lebhaft vor Augen, daß ihr war, als starre sie noch immer auf das Kind. Ein Blatt im nußbraunen Haar; eine sichelförmige Narbe, die sich über die linke Kniescheibe zog; ein ovales Muttermal am Rücken; und auf der ganzen linken Seite des Körpers, soweit sie sichtbar war, merkwürdige Verfärbungen, als wäre das Kind irgendwann vor seinem Tod auf diese Körperseite gewaltsam niedergeworfen worden.
Selbst bei dem kurzen Blick, den Deborah aus einer Entfernung von zwei Metern auf ihn geworfen hatte, hatte sie die verräterischen Abschürfungen an Handgelenken und Fesseln sehen können: grellweiße Flecken toter Haut auf rotem, entzündeten Untergrund. Sie wußte, was das hieß. Sie wußte auch, was die gleichförmigen, runden Brandmale auf dem zarten Fleisch seines Innenarms bedeuteten.
»O Gott, o Gott!« schrie sie laut.
Ihre Worte gaben ihr plötzliche, unerwartete Kraft. Sie rannte zum Parkplatz.
Simon Allcourt-St. James hielt seinen alten MG neben dem Polizeikordon an, der an der Einfahrt zum Parkplatz von St. Giles gezogen worden war. Flüchtig fiel das Licht der Scheinwerfer auf das weiße Gesicht eines jungen, schlaksigen Polizeibeamten, der dort Wache hielt. Ganz überflüssig, wie es schien, denn wenn auch die Kirche nicht völlig isoliert stand, so waren die umliegenden Häuser doch in einigem Abstand, und es hatte sich keine neugierige Menge auf der Straße gesammelt.
Doch es war Sonntag. In einer Stunde fing die Abendandacht an. Da mußte jemand da sein, die frommen Kirchgänger wieder nach Hause zu schicken.
An dem schmalen Sträßchen, das auf den Parkplatz führte, sah Simon einen Halbkreis von starken Lichtern. Die Polizei hatte dort ihr Quartier aufgeschlagen. Grellblaue Blitze durchzuckten in regelmäßig pulsendem Rhythmus das weiße Licht der Scheinwerfer. Jemand hatte vergessen, das Blaulicht auf einem der Polizeifahrzeuge auszuschalten.