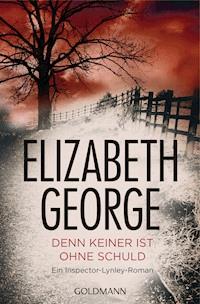
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen Spannungsromans." New York Times
Eigentlich wollten Simon St. James und seine Frau Deborah im winterlichen Lancashire nur ein wenig Erholung suchen. Doch stattdessen erwartet sie in dem kleinen Dorf Winslough Erschütterndes: Der Pfarrer des Ortes wurde vergiftet aufgefunden. Nur ein tragischer Unglücksfall? Lynleys Ermittlungen bringen Licht in die Vergangenheit der Dorfbewohner. Und was dabei schließlich zutage kommt, lässt alle verstummen ...
Der sechste Fall für Inspector Lynley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 982
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Eigentlich hatten sie im winterlich einsamen Lancashire nur ein wenig Erholung suchen wollen: Simon St. James, Inspector Lynleys bester Freund, und seine Frau Deborah. Doch statt der Lösung ihrer persönlichen Probleme – der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind scheint für immer unerfüllbar – erwartet sie in dem kleinen Dorf Winslough Erschütterndes. Der Pfarrer, von dem sich Deborah Trost erhofft hatte, wird vergiftet aufgefunden. Ein tragischer Unfall? Trotz aller entlastenden Aussagen konzentriert sich der Verdacht auf die kräuterkundige Juliet Spence. Mit einem Mal finden sich St. James und seine Frau in einem Labyrinth aus zerstörten Träumen und irregeleiteten Gefühlen wieder – in einem Labyrinth, das selbst den hinzugerufenen Lynley am Sinn von Recht und Gerechtigkeit zweifeln lässt ...
Inhaltsverzeichnis
Für Deborah
Ich tat nichts als aus Sorge nur für dich, Für dich, mein Teuerstes, dich, meine Tochter, Die unbekannt ist mit sich selbst, nicht wissend, Woher ich bin ...
William Shakespeare, DerSturm
NOVEMBER: REGEN
Cappuccino – das neue Mittel gegen Weltschmerz und Depression. Ein wenig Espresso, ein Schuß geschäumter heißer Milch, dazu eine im allgemeinen geschmacklose Prise Kakaopulver, und schon war angeblich alles wieder in Butter. So ein Blödsinn!
Deborah St. James seufzte. Sie nahm die Quittung, die eine vorüberkommende Kellnerin ihr diskret auf den Tisch gelegt hatte.
»Wahnsinn!« sagte sie und starrte bestürzt und verärgert auf den geforderten Betrag. Dabei hätte sie sich eine Straße weiter in ein Pub setzen und damit die hartnäckige innere Stimme befriedigen können, die ihr immer wieder gesagt hatte: Was soll dieses Schicki-Micki-Gehabe, Deb? Du kannst doch genausogut irgendwo ein simples Guinness trinken. Aber nein, sie hatte ins Upstairs gehen müssen, das aufgedonnerte, von Marmor und Glas blitzende Café des Savoy Hotels, wo jeder, der etwas anderes als Wasser trank, für dieses Privileg teuer bezahlen mußte.
Deborah war ins Savoy gekommen, um ihre Mappe zu präsentieren – einem jungen, aufstrebenden Produzenten namens Richie Rica, der im Auftrag eines neugegründeten Unternehmens der Unterhaltungsbranche namens L. A. Sound Machine arbeitete. Der junge Mann war einmal eben für sieben Tage nach London gekommen, um einen Fotografen zu suchen. Rica hatte den Auftrag bekommen, das neueste Album von Dead Meat, einer fünfköpfigen Band aus Leeds, vom Entwurf bis zur Fertigstellung zu betreuen. Sie sei, bemerkte er, als Deborah kam, »der neunte beschissene Knipser«, dessen Arbeiten er sich ansehen müsse. Er hatte offensichtlich keine Lust mehr.
Daran änderte leider auch ihr Gespräch nichts. Rittlings auf einem zierlichen vergoldeten Stuhl sitzend, ging Rica ihre Mappe mit dem Interesse und dem Tempo eines Kartengebers in einem Spielcasino durch. Eine nach der anderen segelten Deborahs Aufnahmen zu Boden. Sie sah zu, wie sie abstürzten: ihr Mann, ihr Vater, ihre Schwägerin, ihre Freunde, die neuen Verwandten, die sie durch ihre Heirat gewonnen hatte. Kein Sting oder Bowie oder George Michael war unter ihnen. Sie hatte den Termin sowieso nur der Empfehlung eines Kollegen zu verdanken, dessen Arbeit dem Amerikaner nicht zugesagt hatte. Nach Ricas Miene zu urteilen, würde auch sie nicht weiterkommen als alle anderen.
Aber das kümmerte sie weniger als das ständige Anwachsen des grauweißen Felds von Fotografien neben Ricas Stuhl. Unter ihnen war eine Aufnahme ihres Mannes, und seine Augen – seine hellen, graublauen Augen, die scharf gegen sein schwarzes Haar abstachen – schienen sie direkt anzusehen. Flucht ist nicht der Weg, schien er zu sagen.
Immer dann, wenn Simon im Grunde recht hatte, wollte sie ihm einfach nicht glauben. Das war die Hauptschwierigkeit in ihrer Ehe: ihre Weigerung, Gefühlsregungen vor Augen Vernunft walten zu lassen, ihre ständige Fehde mit seiner kühlen Beurteilung der gegebenen Fakten. Verdammt noch mal, Simon, rief sie dann, sag mir nicht, was ich für Gefühle habe, du kennst meine Gefühle nicht ... Und am heftigsten, am bitterlichsten pflegte sie zu weinen, wenn sie wußte, daß er recht hatte.
So wie jetzt, da er fast hundert Kilometer entfernt in Cambridge eine Tote untersuchte und eine Serie Röntgenbilder studierte, um mit der ihm eigenen unbestechlichen Sachlichkeit festzustellen zu versuchen, mit was für einer Waffe das Gesicht dieses fremden toten Mädchens entstellt worden war.
Schließlich kam Richie Rica mit Märtyrermiene wegen der immensen Vergeudung seiner kostbaren Zeit zu einem Urteil: »Okay, das ist ja ganz nett, aber wollen Sie die Wahrheit wissen? Mit den Bildern da ließe sich Scheiße nicht mal verkaufen, wenn sie vergoldet wäre.« Deborah nahm die Aussage betont cool. Erst als er, in der Absicht aufzustehen, seinen Stuhl zurückschob, fing ihr leise schwelender Unmut Feuer. Er schob seinen Stuhl nämlich mitten in das Meer von Fotografien, das er auf dem Boden geschaffen hatte, und eines der Stuhlbeine durchbohrte das faltige Gesicht ihres Vaters, wobei ein klaffender Riß entstand.
Doch auch das brachte ihr Blut eigentlich noch nicht in Wallung. Genaugenommen war es Ricas lässiger Kommentar: »O Mist, tut mir leid. Aber Sie können den Alten ja noch mal abziehen, oder?«
Sie kniete nieder, sammelte ihre Bilder ein, legte sie wieder in die Mappe, band die Mappe zu, sah dann auf und sagte: »Sie sehen eigentlich gar nicht aus wie ein Ignorant. Warum benehmen Sie sich dann wie einer?«
Womit natürlich – ganz abgesehen einmal vom künstlerischen Wert der Bilder – feststand, daß sie den Auftrag nicht bekommen würde.
Es hat eben nicht sollen sein, Deb, hätte ihr Vater gesagt. Das war natürlich richtig. Es gab vieles im Leben, was nicht sein sollte.
Sie nahm ihre Umhängetasche, ihre Mappe, ihren Schirm und ging durch das riesige Foyer hinaus. Ein paar Schritte an den wartenden Taxis vorbei, und sie war draußen auf dem Bürgersteig. Der morgendliche Regen hatte für einen Augenblick nachgelassen, aber es blies ein scharfer Wind, wie er in London gern herrschte; ein Wind, der aus dem Südosten angefegt kommt, über dem offenen Wasser Geschwindigkeit zulegt und dann durch die Straßen pfeift und Schirme und Kleider packt. Deborah sah blinzelnd in den Himmel. Graue Wolken türmten sich übereinander. Es konnte sich nur um Minuten handeln, ehe es erneut zu regnen anfangen würde.
Sie hatte vorgehabt, ein Stück spazierenzugehen. Sie war nicht weit vom Fluß, und ein Spaziergang das Embankment hinunter erschien ihr ungleich verlockender als die Rückkehr in ein Haus, das bei diesem Wetter düster war und in dem noch ihre letzte unerfreuliche Auseinandersetzung mit Simon nachhallte. Doch in Anbetracht des Windes, der ihr die Haare in die Augen schlug, und der regenschweren Luft überlegte sie es sich anders.
Kurz darauf stand sie gepufft und gestoßen mitten im Gedränge im Bus und fand schon nach wenigen Metern Fahrt, daß ein Marsch selbst im tobenden Sturm dieser Busfahrt eindeutig vorzuziehen sei: Sie war so eingepfercht, daß sie kaum atmen konnte; ein von Kopf bis Fuß in Burberry gekleideter Fremder malträtierte mit der Spitze seines Regenschirms ihre kleine Zehe, und die reizende, großmütterlich aussehende alte Dame neben ihr verströmte penetranten Knoblauchgeruch – das genügte, um Deborah davon zu überzeugen, daß dieser Tag nur noch schlimmer werden konnte.
An der Craven Street brach der Verkehr zusammen. Weitere acht Personen nutzten die Gelegenheit, um sich in den Bus zu drängen. Es begann zu regnen. Scheinbar als Reaktion auf die sich ständig verschlimmernde Situation stieß die reizende alte Dame einen tiefen Seufzer aus, und der Burberry-Mensch stützte sich mit seinem gesamten Gewicht auf seinen Schirm. Deborah versuchte, die Luft anzuhalten; ihr wurde flau.
Nichts – nicht Sturm und Regen, nicht einmal eine Begegnung mit allen vier Reitern der Apokalypse zugleich – konnte schlimmer sein als dies. Nicht einmal ein zweites. Gespräch mit Richie Rica. Während der Bus im Schneckentempo in Richtung Trafalgar Square kroch, kämpfte sich Deborah an fünf Skinheads, zwei Punks, einem halben Dutzend Hausfrauen und einer fröhlich schnatternden Gruppe amerikanischer Touristen vorbei. Als die Nelson-Säule in Sicht kam, hatte sie den Ausgang erreicht und rettete sich mit einem resoluten Sprung hinaus in Wind und Regen.
Sie wußte, daß es keinen Sinn hatte, den Schirm aufzuspannen. Der Wind würde ihn packen und wie einen Fetzen Papier die Straße hinunterwirbeln. Statt dessen suchte sie daher einen geschützten Winkel. Der Platz selbst war wie leergefegt, eine große nackte Betonfläche mit ein paar Springbrunnen und ein paar steinernen Löwen. Ohne die Scharen von Tauben, die sich hier niedergelassen hatten, und ohne die Obdachlosen und Freudlosen, die sonst immer bei den Brunnen oder auf den Löwen hockten und die Touristen ermunterten, die Vögel zu füttern, gehörte der Platz ausnahmsweise einmal tatsächlich dem Heldenmonument, das auf ihm stand. Drüben, auf der anderen Seite, war die National Gallery, wo einige Menschen in ihre Mäntel schlüpften, mit Regenschirmen kämpften und wie die Mäuse die breiten Stufen hinaufhuschten. Dort war man vor Wind und Wetter geschützt. Dort gab es zu essen und zu trinken, wenn Deborah das wollte. Kunst, wenn sie das brauchte. Und verlockende Ablenkung, wie sie Deborah in den letzten acht Monaten bewußt gesucht hatte.
Der Regen begann schon durch ihre Haare bis auf die Kopfhaut durchzudringen, als sie die Treppe zum Fußgängertunnel hinunterlief und wenig später auf dem Platz selbst wieder an die Oberfläche kam. Ihre schwarze Mappe fest an sich gedrückt, überquerte sie ihn schnell. Als sie den Museumseingang erreichte, schwamm sie in ihren Schuhen, ihre Strümpfe waren von oben bis unten bespritzt, ihr Haar fühlte sich auf ihrem Kopf an wie eine feuchte Wollmütze.
Und wohin nun? Sie war seit einer Ewigkeit nicht mehr in der National Gallery gewesen. Wie peinlich, dachte sie. Und ich will Künstlerin sein!
Tatsache jedoch war, daß sie sich in Museen unweigerlich überwältigt fühlte, nach spätestens einer Viertelstunde erschlagen vom ästhetischen Overkill. Andere konnten umhergehen, schauen und, die Nasen keine zehn Zentimeter von der Leinwand entfernt, ihre Kommentare zum Pinselstrich geben. Deborah brauchte nur zehn Gemälde weit zu gehen, und schon hatte sie das erste vergessen.
Sie gab ihre Sachen an der Garderobe ab, nahm sich einen Plan des Museums und begann ihre Wanderung, froh, der Kälte entronnen zu sein, dankbar bei dem Gedanken, daß das Museum wenigstens vorübergehend eine Atempause erlaubte. Ein Fotoauftrag, der sie abgelenkt hätte, mochte im Augenblick außer Reichweite sein, aber die Ausstellung hier ließ sie wenigstens noch ein paar Stunden alles andere verdrängen. Und wenn sie wirklich Glück hatte, würde die Arbeit Simon über Nacht in Cambridge festhalten. Dann mußte sie nicht die abgebrochene Diskussion weiterführen, gewann noch ein paar Stunden Schonzeit.
Auf der Suche nach etwas, das sie fesseln konnte, überflog sie rasch den Museumsplan. Frühes Italien, Italien des 15. Jahrhunderts, Niederlande 17. Jahrhundert, England 18. Jahrhundert. Nur ein Künstler wurde mit Namen genannt. »Leonardo«, hieß es da. »Entwurf. Saal 7.«
Sie fand den Raum mühelos, etwas abseits gelegen, nicht größer als Simons Arbeitszimmer in Chelsea. Im Gegensatz zu den Ausstellungsräumen, die sie passiert hatte, hing in Saal 7 nur ein einziges Werk, Leonardo da Vincis lebensgroße Darstellung der Jungfrau mit dem Kind zusammen mit der heiligen Anna und Johannes dem Täufer als Kind. Der Raum erinnerte an eine Kapelle, dämmrig erleuchtet von schwachen Lampen, die nur auf das Kunstwerk selbst gerichtet waren, mit einer Reihe Bänken ausgestattet, auf denen die Bewunderer sich niedersetzen konnten, um, wie es im Museumsplan hieß, eines der schönsten Werke Leonardos zu betrachten. Im Augenblick allerdings war sie alleine.
Deborah setzte sich. In ihrem Rücken begann sich eine Spannung aufzubauen, die bis zu ihrem Nacken hochstieg. Sie war gegen die feine Ironie, die in der Entscheidung für dieses Gemälde lag, keineswegs gefeit.
Sie entsprang dem Ausdruck der Heiligen Jungfrau, dieser absoluten Hingabe und selbstlosen Liebe. Sie entsprang dem Ausdruck in den Augen der heiligen Anna – tiefes Verständnis in einem Gesicht voller Zufriedenheit –, die auf die Jungfrau gerichtet waren. Wer hätte denn auch besser diese Mutterliebe verstehen können als die heilige Anna: die Liebe ihrer eigenen Tochter für das wundersame Kind, das sie geboren hatte! Und das Kind selbst strebte fort aus den Armen seiner Mutter, streckte die Ärmchen nach dem Täufer aus, verließ schon jetzt – schon jetzt die Mutter ...
Genau auf diesen Punkt, auf die Trennung, würde Simon sich berufen. Da sprach der Wissenschaftler aus ihm, ruhig, analytisch, geneigt, die Welt im Licht der praktischen Gegebenheiten zu sehen, wie sie von den Statistiken dokumentiert wurden. Aber sein Blick auf die Welt war ein anderer als ihrer – ja, seine ganze Welt war eine andere. Er konnte sagen, hör mir zu, Deborah, es gibt andere Bindungen als die des Bluts – weil es für ihn einfach war, gerade für ihn, diese Haltung einzunehmen. Für sie jedoch definierte sich das Leben durch andere Faktoren.
Mühelos konnte sie das Bild der Fotografie heraufbeschwören, das Rica mit seinem Stuhlbein durchbohrt und zerstört hatte: das schüttere Haar ihres Vaters, in dem ein leichter Frühlingswind spielte; der Schatten eines Asts, der wie eine Vogelschwinge geformt auf das Grab ihrer Mutter sank; die Narzissen, die ihr Vater gerade in die Vase steckte und die in der Sonne wie kleine Trompeten leuchteten; seine Hand, die die Blumen hielt, die Finger fest um die Stengel gelegt. Ihr Vater war achtundfünfzig Jahre alt. Er war ihr einziger Blutsverwandter.
Deborah hatte ihren Blick auf die Da-Vinci-Zeichnung gerichtet. Die beiden weiblichen Figuren hätten verstanden, was Simon nicht verstand. Es war die Macht, das Glück, die tiefe Ehrfurcht angesichts des Lebens, das aus dem eigenen entstanden und auf die Welt gekommen war.
Sie sollten Ihrem Körper mindestens ein Jahr Ruhe gönnen, hatte der Arzt zu ihr gesagt. Sie haben sechs Fehlgeburten gehabt. Drei davon allein in den letzten neun Monaten. Die physische Belastung, den gefährlichen Blutverlust, die hormonellen Schwankungen, all dies muß Ihr Körper erst einmal verarbeiten.
Sie haben mich nicht verstanden. Das kommt im Augenblick überhaupt nicht in Frage.
Und in vitro.
Sie wissen, daß nicht die Befruchtung das Problem ist, Deborah, sondern die Erhaltung der Schwangerschaft.
Ich werde neun Monate lang liegen, wenn es sein muß. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Ich tue alles.
Dann lassen Sie sich auf eine Adoptionsliste setzen, nehmen Sie die Pille und versuchen Sie es in einem Jahr noch einmal. Wenn Sie nämlich auf diese Art und Weise weitermachen, laufen Sie Gefahr, noch vor Ihrem dreißigsten Lebensjahr Ihre Gebärmutter zu verlieren.
Er hatte ihr ein Rezept ausgeschrieben.
Aber es muß doch eine Chance geben, sagte sie und bemühte sich, die Bemerkung so beiläufig wie möglich klingen zu lassen. Sie konnte es sich nicht erlauben, sich aufzuregen. Sie wollte nicht zeigen, wie angespannt und nervös sie das Thema machte.
Der Arzt zeigte Verständnis. Es gibt eine Chance, sagte er. Nächstes Jahr. Wenn Sie Ihrem Körper Zeit lassen, sich zu erholen. Dann sehen wir uns alle Möglichkeiten an. In vitro. Tabletten. Wir machen sämtliche Untersuchungen, die wir machen können. In einem Jahr.
Sie begann also gehorsam die Pille zu nehmen. Aber als Simon mit den Adoptionsformularen nach Hause gekommen war, hatte sie abgeblockt.
Es war völlig sinnlos, jetzt darüber nachzudenken. Sie zwang sich, das Kunstwerk zu betrachten. Die Gesichter waren heiter, entschied sie. Sie schienen ihr klar konturiert zu sein. Der Rest der Zeichnung war großenteils Impression, hingeworfen wie eine Reihe von Fragen, die für immer unbeantwortet bleiben würden. Würde die Jungfrau ihren Fuß erhoben halten, oder würde sie ihn senken? Würde die heilige Anna weiterhin zum Himmel hinaufweisen? Würde die runde Hand des Kindes das Kinn des Täufers umschließen? Und war der Hintergrund Golgatha, oder war das eine allzu schaurige Vision in diesem Moment ruhigen Friedens, etwas, das besser unausgesprochen und unsichtbar blieb?
»Kein Josef. Ja. Natürlich. Kein Josef.«
Deborah drehte sich herum, als sie die geflüsterten Worte hörte, und sah, daß ein Mann – noch im nassen Mantel, mit einem Schal und Hut – in das Kabinett getreten war. Er schien sie gar nicht zu bemerken, und hätte er nicht gesprochen, so hätte auch sie ihn wahrscheinlich nicht bemerkt.
»Kein Josef«, flüsterte er wieder in resigniertem Ton.
Rugbyspieler, dachte Deborah, denn er war groß, und der Körper unter dem schwarzen Mantel schien kräftig zu sein. Und auch die Hände, in denen er einen zusammengerollten Museumsplan hielt, waren groß und kantig, mit kräftigen Fingern, durchaus in der Lage, andere Spieler aus dem Weg zu stoßen, wenn er über das Spielfeld stürmte.
Jetzt allerdings kam er nur ein Stück nach vorn und trat in den gedämpften Schein eines der Lichter. Sein Schritt schien ehrfürchtig. Den Blick auf Leonardos Zeichnung gerichtet, hob er die Hand zum Hut und nahm ihn ab, wie ein Mann das vielleicht in der Kirche tun würde. Er legte ihn auf eine der Bänke. Dann setzte er sich.
Er trug Schuhe mit dicken Sohlen – geländegängiges Schuhwerk –, und er kippte die Füße nach außen auf die Kanten und ließ die Hände zwischen seinen Knien herabhängen. Dann fuhr er sich mit einer Hand durch das lichte Haar, das zu ergrauen begann. Es schien weniger eine Geste der Sorge um sein Aussehen zu sein als eine der Nachdenklichkeit. Sein Gesicht, leicht erhoben, damit er die Zeichnung studieren konnte, sah besorgt und gequält aus; halbmondförmige Tränensäcke unter den Augen, tiefe Falten in der Stirn.
Er hielt die Lippen zusammengepreßt. Die untere war voll, die obere schmal. Sie bildeten eine Naht aus Trauer in seinem Gesicht, die nur unzulänglich seinen inneren Aufruhr überdecken konnte. Auch ein Kämpfender, dachte Deborah, angerührt von seinem Leiden.
»Die Zeichnung ist wunderschön, nicht wahr?« Sie sprach gedämpft, beinahe flüsternd, wie man das an Orten der Meditation und des Gebets automatisch macht. »Ich sehe sie heute zum erstenmal.«
Er wandte sich ihr zu. Er war dunkelhäutig, älter, als er zuerst gewirkt hatte. Er schien überrascht darüber, aus heiterem Himmel von einer Fremden angesprochen zu werden.
»Ich auch«, sagte er.
»Schlimm, wenn ich mir überlege, daß ich seit achtzehn Jahren in London lebe. Ich frage mich, was mir sonst noch alles entgangen ist.«
»Josef«, sagte er.
»Wie bitte?«
Mit dem gerollten Museumsplan deutete er auf die Zeichnung. »Josef ist Ihnen entgangen. Er fehlt immer. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Daß es immer nur die Madonna mit dem Kind ist.«
»Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht.«
»Oder Jungfrau mit Kind. Oder Mutter mit Kind. Oder die Anbetung der Heiligen Drei Könige mit einer Kuh und einem Esel. Und ein paar Engeln im Hintergrund. Aber Josef sieht man höchst selten. Haben Sie sich nie gefragt, wie das kommt?«
»Vielleicht – na ja, er war natürlich nicht der wirkliche Vater, nicht wahr?«
Der Mann schloß einen Moment die Augen. »Lieber Gott«, sagte er.
Er wirkte so betroffen, daß Deborah eilig zu sprechen fortfuhr: »Ich meine, man lehrt uns doch zu glauben, er sei nicht der Vater gewesen. Aber wir wissen es nicht mit Gewißheit. Woher sollten wir auch? Wir waren ja nicht dabei. Und sie hat kein Tagebuch über ihr Leben geführt. Uns wird nur gesagt, daß der Heilige Geist zu ihr kam oder so ähnlich und ... es war eben ein Wunder, nicht wahr? Eben noch war sie eine Jungfrau, und schon in der nächsten Minute war sie schwanger, und nach neun Monaten – kam das Kind auf die Welt. Sie hielt es in ihren Armen und konnte wahrscheinlich gar nicht richtig glauben, daß es ein leibhaftiges Kind war, ihr eigenes Kind, dieses Kind, nach dem sie solche Sehnsucht gehabt hatte ... Ich meine, wenn man an Wunder glaubt ...«
Erst als sie sah, wie sich das Gesicht des Mannes veränderte, bemerkte sie, daß sie zu weinen angefangen hatte. Und dann hätte sie über die verrückte Situation am liebsten gelacht. Absurd, dieser seelische Schmerz. Sie warfen ihn wie einen Tennisball zwischen sich hin und her.
Er zog ein Taschentuch aus einer Tasche seines Mantels und drückte es ihr zerknittert in die Hand. »Bitte.« Sein Ton war ernst. »Es ist noch fast sauber. Ich habe es nur einmal benützt. Um mir den Regen vom Gesicht zu wischen.«
Deborah lachte zittrig. Sie drückte den Stoff kurz unter ihre Augen und gab es ihm zurück. »Gedanken haben eine Art, einfach ineinander überzugehen, nicht wahr? Man rechnet überhaupt nicht damit. Man bildet sich ein, man hätte sich gut abgeschirmt. Und plötzlich sagt man etwas, das an der Oberfläche absolut vernünftig und risikolos erscheint, und merkt, daß man vor dem, was man nicht fühlen möchte, überhaupt nicht abgeschirmt ist.«
Er lächelte. Der Rest seines Gesichts war müde und alt, Falten an den Augen, schlaffe Haut unter dem Kinn, aber sein Lächeln war wunderschön. »Genauso geht es mir. Ich bin nur hierhergekommen, weil ich einen Ort gesucht habe, wo ich umhergehen und denken könnte, ohne naß zu werden, und statt dessen stieß ich auf diese Zeichnung.«
»Und da dachten Sie an Josef, obwohl Sie das gar nicht wollten?«
»Nein. In gewisser Weise hatte ich sowieso an ihn gedacht.« Er steckte sein Taschentuch wieder ein, und als er zu sprechen fortfuhr, schlug er einen leichteren Ton an. »Ich wäre lieber im Park spazierengegangen, um ehrlich zu sein. Ich war auf dem Weg zum St. James’ Park, als es wieder zu regnen anfing. Ich denke nämlich am liebsten draußen im Freien nach. Im Herzen bin ich ein Landmensch, und wenn ich Probleme wälzen oder Entscheidungen fällen muß, dann tue ich das am liebsten in der freien Natur. So ein Marsch an der frischen Luft klärt den Kopf. Und das Herz auch. Es fällt einem leichter, das Richtige und das Falsche im Leben – das Ja und das Nein – zu sehen.«
»Es fällt einem vielleicht leichter, es zu sehen«, meinte sie, »aber es macht es einem nicht leichter, damit umzugehen. Jedenfalls mir nicht. Ich kann nicht ja sagen, nur weil bestimmte Leute es gern hätten, ganz gleich, wie richtig es sein mag, es zu tun.«
Er richtete seinen Blick wieder auf die Zeichnung, rollte den Plan in seiner Hand fester zusammen. »Auch ich kann das nicht immer«, sagte er. »Und da muß ich dann hinaus ins Freie. Ich wollte auf der Brücke im St. James’ Park die Spatzen füttern und zusehen, wie sie mir aus der Hand fressen. Die Probleme hätten sich dann ganz von selbst geklärt.« Er zuckte die Achseln und lächelte bekümmert. »Aber dann kam der Regen.«
»Und da sind Sie hierhergekommen. Und mußten sehen, daß Josef fehlt.«
Er griff nach seinem Hut und setzte ihn auf. Die Krempe warf einen dreieckigen Schatten über sein Gesicht. »Und Sie, nehme ich an, haben nur das Kind gesehen.«
»Ja.« Deborah zwang sich zu einem kurzen, mühsamen Lächeln. Sie sah sich um, als hätte auch sie Sachen hier, die sie vor dem Aufbruch einsammeln mußte.
»Was für ein Kind ist es? Eines, das Sie sich wünschen, oder eines, das gestorben ist, oder eines, das Sie nicht haben wollen?«
»Nicht haben – !«
Rasch hob er die Hand. »Eines, das Sie sich wünschen«, sagte er. »Tut mir leid. Das hätte ich eigentlich sehen müssen. Ich hätte die Sehnsucht erkennen müssen. Lieber Gott im Himmel, warum nur sind die Menschen solche Narren?«
»Er möchte, daß wir adoptieren. Ich möchte mein eigenes Kind – sein Kind –, eine richtige Familie, eine, die wir selbst gründen, nicht eine, die man per Fragebogen beantragt. Er hat die Papiere mit nach Hause gebracht. Sie liegen auf seinem Schreibtisch. Ich brauche nur noch meinen Teil auszufüllen und zu unterschreiben, aber das schaffe ich nicht. Es wäre nicht mein Kind, sage ich ihm immer wieder. Es wäre nicht von mir. Nicht von uns. Ich könnte es nicht wirklich lieben, wenn es nicht meines wäre.«
»Das ist sehr wahr«, sagte er. »Sie würden es ganz gewiß nicht auf die gleiche Weise lieben.«
Sie faßte seinen Arm. Die Wolle seines Mantels war feucht und kratzig unter ihren Fingern. »Sie verstehen mich nicht. Genau wie er. Er behauptet, es gäbe Bindungen, die über Blutsbande hinausgehen. Aber bei mir ist das nicht so. Und ich kann nicht verstehen, warum es bei ihm so ist.«
»Vielleicht weil er weiß, daß wir Menschen letztlich immer das, worum wir kämpfen müssen – wofür wir alles aufgeben würden –, weit stärker lieben als die Dinge, die uns zufallen.«
Sie ließ seinen Arm los. Ihre Hand fiel mit einem dumpfen Aufprall auf die Bank zwischen ihnen. Ohne es zu wissen, hatte der Mann mit Simons eigenen Worten gesprochen. Ebensogut hätte ihr Mann hier mit ihr in diesem Raum sein können.
Sie fragte sich, wie sie dazu gekommen war, einem Fremden ihr Herz auszuschütten. Ich brauche einfach so dringend einen Menschen, der meine Partei ergreift, dachte sie; ich suche einen Ritter, der meine Flagge trägt. Es kümmert mich noch nicht einmal, wer dieser Ritter ist, Hauptsache, er versteht mich, stimmt mir zu und läßt mich meinen Weg gehen.
»Ich kann nichts für meine Gefühle«, sagte sie dumpf.
»Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand etwas für seine Gefühle kann.« Der Mann lockerte seinen Schal, knöpfte seinen Mantel auf und griff unter den Mantel in seine Jakkentasche. »Ich würde sagen, Sie brauchen einen langen Marsch an der frischen Luft, um gründlich nachzudenken und einen klaren Kopf zu bekommen«, sagte er. »Weiten Himmel und endlose Blicke. In London können Sie das nicht finden. Wenn Sie Lust haben, Ihre Wanderung im Norden zu machen, dann kommen Sie nach Lancashire.« Er reichte ihr seine Karte.
Robin Sage, stand darauf. Pfarrei, Winslough.
»Pfar –«, Deborah blickte auf und sah, was Mantel und Schal bisher verborgen hatten, den steifen weißen Kragen, der seinen Hals umschloß. Sie hätte es gleich erkennen müssen, an der Farbe seiner Kleider, seinen Worten über Josef, an der Ehrfurcht, mit der er sich der Zeichnung genähert hatte.
Kein Wunder, daß es ihr leichtgefallen war, ihm ihr Herz auszuschütten. Sie hatte sich einem anglikanischen Geistlichen anvertraut.
DEZEMBER: SCHNEE
Brendan Power drehte sich um, als knarrend die Tür aufging und sein jüngerer Bruder Hogarth in die eisige Kälte der Sakristei der Johanneskirche in dem Dorf Winslough trat. Hinter ihm spielte der Organist zum heftigen Tremolo einer einzigen dünnen Stimme, um deren Begleitung bestimmt kein Mensch gebeten hatte, Ihr alle, die Ihr Rettung sucht, nachdem er davor Unerforschlich sind die Wege des Herrn zum besten gegeben hatte. Brendan war überzeugt, daß beide Stücke den teilnehmenden, aber unerwünschten Kommentar des Organisten zu den Vorgängen dieses Morgens darstellten.
»Nichts«, sagte Hogarth. »Keine Spur. Der Pfarrer ist nicht zu finden. Bei ihr drüben sind sie alle kurz vorm Durchdrehen, Bren. Ihre Mutter jammert, daß das Hochzeitsfrühstück verkommt, sie hat ganz giftig gesagt, daß sie sich an irgendeiner ›gemeinen Sau‹ rächen will, und ihr Vater ist gerade abgehauen, um sich ›diese widerliche kleine Ratte zu schnappen‹. Echt klasse Leute, diese Townley-Youngs.«
»Vielleicht geht der Kelch noch mal an dir vorüber, Bren«, sagte Tyrone, sein älterer Bruder und Trauzeuge, von Rechts wegen eigentlich der einzige, der außer dem Pfarrer in der Sakristei sein dürfte, in vorsichtig hoffnungsvollem Ton.
»Nie im Leben«, widersprach Hogarth. Er griff in die Tasche seines gemieteten Cuts, der trotz aller Bemühungen des Schneiders die Hängeschultern nicht verbergen konnte, und zog eine Packung Silk Cut heraus. Er steckte sich eine der Zigaretten an und schnippte das Streichholz auf den kalten Steinboden. »Die läßt ihn nicht mehr aus den Klauen, das kannst du mir glauben, Ty. Da mach dir mal keine Illusionen. Und laß dir’s ’ne Lehre sein. Behalt ihn in der Hose, bis er das richtige Zuhause findet.«
Brendan wandte sich ab. Sie mochten ihn beide. Und jeder von ihnen hatte seine eigene Art, ihm Trost zu bieten. Aber weder Hogarths Witze noch Tyrones Optimismus konnten an der Realität des Tages etwas ändern. Mochte kommen, was wollte, er würde heute Rebecca Townley-Young heiraten. Er versuchte nicht daran zu denken; versuchte das schon seit dem Tag, an dem sie mit dem Resultat des Schwangerschaftstests zu ihm ins Büro in Clitheroe gekommen war.
»Ich weiß nicht, wie das passieren konnte«, sagte sie. »Ich hab mein Leben lang die Periode nicht regelmäßig bekommen. Mein Arzt hat mir sogar erklärt, ich müßte erst Medikamente nehmen, damit sich das einpendelt, wenn ich mal Kinder haben möchte. Und jetzt ... Schau dir die Bescherung an, Brendan.«
Schau dir an, was du mir angetan hast, hieß das. Ausgerechnet du, Brendan Power, Juniorpartner in Daddys Anwaltskanzlei. Gott, wär das nicht ein Pech, dafür jetzt an die Luft gesetzt zu werden?
Nichts von alledem brauchte sie auszusprechen. Sie brauchte nur mit gesenktem Kopf verzweifelt zu sagen: »Brendan, ich habe keine Ahnung, was ich Daddy sagen soll. Was soll ich nur tun?«
Ein Mann in einer anderen Situation hätte gesagt: »Treib ab, Rebecca«, und hätte sich wieder seiner Arbeit zugewandt. Ein anderer Mann hätte vielleicht sogar in Brendans Situation ebendies gesagt. Aber Brendan wußte, daß in anderthalb Jahren St. John Andrew Townley-Young darüber entscheiden würde, welche der Anwälte der Sozietät seine Geschäfte als Seniorpartner übernehmen und sein Vermögen verwalten sollte, wenn er sich aus der Kanzlei zurückzog, und die Vorteile, die dem winkten, für den Townley-Young sich entschied, waren so verlockend, daß Brendan ihnen nicht einfach leichten Herzens den Rücken kehren konnte: Einführung in die feine Gesellschaft, weitere Mandanten vom Kaliber Townley-Youngs, steiler beruflicher Aufstieg.
Eben die Möglichkeiten, die Townley-Youngs Förderung verhießen, hatten Brendan überhaupt erst veranlaßt, sich mit der achtundzwanzigjährigen Tochter des Mannes einzulassen. Er war knapp ein Jahr in der Kanzlei. Er wollte unbedingt vorwärtskommen. Als daher der Seniorpartner, St. John Andrew Townley-Young, Brendan eingeladen hatte, Miss Townley-Young zum Pferde- und Ponymarkt in Cowper zu begleiten, schien Brendan das eine günstige Gelegenheit, die er unmöglich ausschlagen konnte.
Die Vorstellung, ihren Begleiter zu spielen, hatte ihn damals überhaupt nicht geschreckt. Es war zwar richtig, daß Rebecca selbst unter den besten Bedingungen – gut ausgeschlafen und nach anderthalb Stunden vor dem Spiegel – eine fatale Ähnlichkeit mit der alternden Königin Viktoria hatte, aber Brendan war überzeugt, ein oder zwei gemeinsame Ausflüge mit Anstand und vorgetäuschter Kameradschaftlichkeit überstehen zu können. Er verließ sich auf seine Fähigkeit zur Verstellung. Er wußte ja, daß jeder gute Anwalt sich auf anständige Heuchelei verstehen mußte. Er hatte allerdings nicht mit Rebeccas Fähigkeit gerechnet, von Anfang an ihre Beziehung ziemlich eindeutig zu bestimmen und zu gestalten. Als sie sich das zweite Mal trafen, schleppte sie ihn in ihr Bett und ritt ihn wie der Master, der einen Fuchs gesichtet hat. Und als sie das dritte Mal zusammen waren, stürzte sie sich nach kurzem Vorspiel auf ihn und stand schwanger wieder auf.
Er hätte so gern ihr allein die Schuld gegeben. Aber er konnte nicht leugnen, daß er, als sie keuchend und japsend auf ihm herumgehopst war und ihm ihre seltsamen mageren Brüste ins Gesicht schlugen, die Augen geschlossen und lächelnd gesagt hatte: »Mann, du bist eine tolle Frau, Becky!« Dabei hatte er die ganze Zeit an seine bevorstehende Karriere gedacht.
Und heute würde sie ihn heiraten. Nicht einmal das Ausbleiben des Pfarrers, Mr. Sage, würde den Lauf von Brendan Powers Zukunft aufhalten können.
»Wie weit ist es schon über der Zeit?« fragte Hogarth.
Sein Bruder sah auf die Uhr. »Eine gute halbe Stunde.«
»Und es ist noch niemand gegangen?«
Hogarth schüttelte den Kopf. »Aber es wird natürlich getuschelt, du seist derjenige, der nicht erschienen ist. Ich hab mein Bestes getan, um deinen Ruf zu retten, alter Freund, aber vielleicht solltest du dich doch mal auf der Kanzel zeigen und freundlich winken, um das Volk zu beruhigen. Ich frage mich allerdings, wie du deine Braut beruhigen willst. Wer ist diese Sau, der sie Rache geschworen hat? Machst du jetzt schon Seitensprünge? Na ja, übelnehmen würd ich’s dir nicht. Ihn bei Becky hochzukriegen, da braucht’s schon einiges. Aber dich hat ja die Herausforderung schon immer gereizt, hm?«
»Hör auf, Howie«, sagte Tyrone. »Und mach die Zigarette aus. Wir sind hier in einer Kirche, Herrgott noch mal.«
Brendan ging zum einzigen Fenster der Sakristei, einem gotischen Spitzbogenfenster, das tief in die Mauer eingelassen war. Seine Scheiben waren so staubig wie der Raum selbst, und er mußte erst einen Fleck blank reiben, um hinaussehen zu können. Draußen lag der Friedhof mit seinen dunklen Schiefersteinen, die aussahen wie verunglückte Daumenabdrücke im Schnee, und, in der Ferne, die Hänge von Cotes Fell, dessen Kegel sich vom grauen Himmel abhob.
»Es hat wieder angefangen zu schneien.« Geistesabwesend zählte er nach, wie viele Gräber mit weihnachtlicher Stechpalme geschmückt waren. Sieben, soweit er sehen konnte. Die grünen Sträuße mit den glänzenden roten Beeren mußten am Morgen von Hochzeitsgästen gebracht worden sein, denn sie waren nur leicht mit Schnee bestäubt. »Der Pfarrer mußte wahrscheinlich heute schon in aller Frühe weg. Ja, so muß es gewesen sein. Und dann ist er irgendwo hängengeblieben.«
Tyrone kam zu ihm ans Fenster. Hinter ihm trat Hogarth seine Zigarette in den Boden. Brendan fröstelte. Obwohl die Heizung der Kirche unüberhörbar arbeitete, war es in der Sakristei unerträglich kalt. Er legte seine Hand an die Wand. Sie war eisig und feucht.
»Wie halten sich die Eltern?« fragte er.
»Oh, Mutter ist ein bißchen nervös, aber soweit ich sehen kann, hält sie es immer noch für eine tolle Partie. Gleich ihr erster Sohn, der heiratet, schafft, Gott sei gepriesen, den Sprung in den Schoß des Landadels, wenn nur endlich der Pfarrer aufkreuzen würde. Aber Vater fixiert die Tür, als hätte er die Nase voll.«
»Er war seit Jahren nicht mehr so weit von Liverpool weg«, stellte Tyrone fest. »Er ist nur nervös.«
»Nein. Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.« Brendan wandte sich vom Fenster ab und musterte seine Brüder. Sie sahen aus wie er, und er wußte es. Hängende Schultern, Hakennasen, alles andere unbestimmt: Haare, weder braun noch blond, Augen, weder blau noch grün; das Kinn, weder stark noch schwach ausgebildet. Sie waren alle, einer wie der andere, Prototypen des potentiellen Massenmörders, mit Gesichtern, die sich in jeder Menge verloren. Entsprechend hatten die Townley-Youngs reagiert, als sie zum erstenmal die ganze Familie zu Gesicht bekommen hatten: als stünden ihnen plötzlich ihre schlimmsten Erwartungen und ihre schrecklichsten Träume in Fleisch und Blut gegenüber. Brendan fand es überhaupt nicht verwunderlich, daß sein Vater die Tür fixierte und die Minuten zählte, bis er endlich würde verschwinden können. Seinen Schwestern ging es wahrscheinlich ebenso. Er beneidete sie ein wenig. Ein, zwei Stunden, dann war es vorbei. Für ihn hingegen hieß es lebenslänglich.
Cecily Townley-Young hatte sich nur deshalb bereit erklärt, bei der Hochzeit ihrer Cousine als Brautjungfer zu fungieren, weil ihr Vater es ihr geboten hatte. Am liebsten hätte sie überhaupt nicht an der Hochzeit teilgenommen. Sie und Rebecca hatten, abgesehen davon, daß sie demselben schwachen Familienstamm entsprangen, nie etwas gemeinsam gehabt, und wenn es nach Cecily ging, konnte das auch in Zukunft so bleiben.
Sie mochte Rebecca nicht. Eben weil sie nichts mit ihr gemeinsam hatte. Für Rebecca war es das höchste der Gefühle, sich auf irgendwelchen Pferdemärkten herumzudrükken, über Widerriste und Schulterhöhe zu fachsimpeln und gummiweiche Pferdelippen anzuheben, um sich mit scharfem Blick diese gräßlichen gelben Gebisse anzusehen. Sie schleppte Äpfel und Karotten wie Kleingeld in ihren Taschen mit sich herum und untersuchte Hufe, Hoden und Augäpfel mit dem brennenden Interesse, das andere Frauen auf Klamotten konzentrierten. Außerdem hatte Cecily ihre Cousine Rebecca ganz einfach satt. Zweiundzwanzig Jahre gequälter Familienfeste auf dem Gut ihres Onkels – zum Zwecke eines Familiensinns, der nie existiert hatte – hatten jeglicher Zuneigung, die sie vielleicht für ihre ältere Cousine übriggehabt hatte, den Garaus gemacht. Die wenigen Kostproben, die Rebecca ihr von ihren unverständlichen und extremen Verhaltensweisen gegeben hatte, hatten sie gelehrt, sicheren Abstand zu wahren, wann immer sie sich länger als eine Viertelstunde unter demselben Dach aufhielten. Und schließlich kam hinzu, daß sie Rebecca unerträglich dumm fand. Noch nie hatte Rebecca sich selbst ein Ei gekocht, noch nie hatte sie einen Scheck ausgeschrieben, niemals selbst ihr Bett gemacht. Auf jedes auch noch so kleine Problem des täglichen Lebens gab es für sie nur eine Antwort: Daddy wird sich schon darum kümmern. Eine Art der Bequemlichkeit und Abhängigkeit von den Eltern, die Cecily verabscheute.
Und auch heute kümmerte sich natürlich Daddy um alles. Sie hatten ihren Teil getan; gehorsam hatten sie mit blauen Lippen von einem Fuß auf den anderen tretend in der Eiseskälte unter dem Nordportal der Kirche auf den Pfarrer gewartet, während drinnen, im mit Stechpalme und Efeu geschmückten Kirchenschiff, die Gäste unruhig wurden und sich wunderten, wieso die Kerzen immer noch nicht angezündet wurden und der Organist noch immer nicht den Hochzeitsmarsch anstimmte. Eine Viertelstunde lang hatten sie im bräutlich weiß fallenden Schnee gewartet, ehe Daddy schließlich über die Straße gefegt war und wutschnaubend beim Pfarrer angeklopft hatte. In weniger als zwei Minuten war er wieder da gewesen, sein sonst so rosiges Gesicht kreideweiß vor Wut.
»Er ist nicht einmal zu Hause«, hatte St. John Andrew Townley-Young in heller Empörung berichtet. »Diese dämliche Kuh ...« Cecily kam zu dem Schluß, daß er damit die Haushälterin des Pfarrers meinte ... »sagte, er sei heute morgen, als sie kam, schon weg gewesen. Wenn man das glauben kann. Dieser inkompetente, elende ...« Die Hände in den perlgrauen Handschuhen ballten sich zu Fäusten. Sein Zylinder bebte. »Geht in die Kirche. Los, rein mit euch. Es hat keinen Sinn, hier in der Kälte herumzustehen. Ich erledige das schon.«
»Aber Brendan ist doch hier, oder?« hatte Rebecca ängstlich gefragt. »Daddy, Brendan ist doch hier?«
»Ja, leider«, antwortete ihr Vater brummig. »Die ganze Familie ist da. Wie die Ratten, die das sinkende Schiff nicht verlassen.«
»St. John!« murmelte seine Frau mahnend.
»Los, geht rein!«
»Aber dann bekommen doch die Leute die Braut schon vorher zu sehen«, jammerte Rebecca.
»Himmelherrgott, Rebecca!« Townley-Young verschwand noch einmal für zwei Minuten in der Kirche, ehe er zurückkam und sagte: »Ihr könnt im Glockenturm warten.« Dann machte er sich wieder auf die Suche nach dem Pfarrer.
Und nun warteten sie also immer noch unten im Glockenturm, den Blicken der Hochzeitsgäste durch eine hölzerne Gittertür entzogen, die mit einem staubigen, widerlich riechenden roten Samtvorhang verkleidet war. Der Stoff war so dünn, daß sie dahinter den Glanz der Leuchter im Kirchenschiff sehen konnten. Sie konnten auch das Getuschel und unruhige Füßescharren der Menge hören. Gesangbücher wurden geöffnet und wieder zugeklappt. Der Organist spielte. Unter ihren Füßen, in der Krypta, ächzte und stöhnte die Zentralheizung.
Cecily warf einen taxierenden Blick auf ihre Cousine. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, daß Rebecca wirklich einen Mann finden würde, der dumm genug war, sie zu heiraten. Es stimmte zwar, daß sie einmal ein beträchtliches Vermögen erben würde und ihr schon jetzt diese Monströsität von einem Herrenhaus, Cotes Hall, gehörte, wohin sie sich, sobald der Ring an ihrer Hand steckte und der Trauschein unterschrieben war, in der Ekstase jungen Eheglücks zurückziehen würde, doch Cecily konnte sich nicht vorstellen, daß das Vermögen – wie groß auch immer – oder das bröckelnde viktorianische Herrenhaus – ganz gleich, wie prächtig man es wieder herrichten lassen konnte – einen Mann dazu verleitet haben konnte, sich zu einem Leben mit Rebecca zu verurteilen. Doch jetzt ... sie erinnerte sich der morgendlichen Szene in der Toilette. Sie hatte gehört, wie Rebecca sich übergeben und dann schrill gefragt hatte: »Geht das vielleicht jetzt jeden Morgen so?« »Rebecca!« hatte ihre Mutter besänftigend gesagt. »Bitte! Wir haben Gäste im Haus.« Worauf Rebecca geschrien hatte: »Das ist mir doch egal. Mir ist überhaupt alles egal. Rühr mich bloß nicht an. Laß mich hier raus.« Eine Tür fiel krachend zu. Jemand rannte durch den oberen Korridor.
Schwanger? fragte sich Cecily, während sie sich mit Sorgfalt die Wimpern tuschte und dann etwas Rouge auflegte. Sie fand die Vorstellung, daß Rebecca tatsächlich einen Mann gefunden haben sollte, der freiwillig mit ihr geschlafen hatte, fast unglaublich. Wenn das zutraf, dann war alles möglich. Sie musterte ihre Cousine forschend.
Rebecca sah nicht gerade aus wie eine Frau, die ihre Erfüllung gefunden hatte. Wenn es stimmte, daß Frauen in der Schwangerschaft aufblühten, so war Rebecca offensichtlich erst in einem Vorstadium des Knospens – mit einer Neigung zu Hängebacken und Augen, die die Größe und Form von Murmeln hatten. Immerhin, sie hatte eine sehr schöne Haut und einen recht hübschen Mund. Aber irgendwie ergaben die einzelnen Details nicht ein harmonisches Ganzes.
Es war im Grunde nicht ihre Schuld, sagte sich Cecily. Eigentlich hätte man wenigstens ein Fünkchen Mitleid mit einer Frau haben müssen, deren Äußeres so vom Schicksal benachteiligt war. Aber jedesmal, wenn Cecily sich bemühte, aus den Tiefen ihres Herzens ein, zwei freundliche Gedanken hervorzukramen, zerquetschte Rebecca sie wie lästige Insekten.
Wie auch jetzt.
Ihren Brautstrauß wütend in den Händen drehend, lief Rebecca in dem kleinen Raum unter den Kirchenglocken hin und her. Der Boden war schmutzig, aber sie raffte weder ihren Rock noch ihre Schleppe. Das tat ihre Mutter für sie. Satin und Samt in den Händen, folgte sie ihrer Tochter wie ein treues Hündchen. Cecily stand abseits zwischen zwei Blecheimern, einer Rolle Seil, einer Schaufel, einem Besen und einem Haufen Lumpen. Ein alter Staubsauger lehnte an einem Stapel Kartons, und vorsichtig hängte sie ihren eigenen Strauß an dem Metallhaken auf, der eigentlich für das Kabel des Staubsaugers gedacht war. Sie hob den Rock ihres Samtkleids, damit er den Boden nicht berührte. Die Luft in dem kleinen Raum war muffig, und man konnte kaum eine Bewegung machen, ohne irgend etwas zu berühren, was nicht vor Schmutz starrte. Aber wenigstens war es warm.
»Ich hab ja gewußt, daß so etwas passieren würde.« Rebecca erwürgte die zarten Blumen in ihren Händen. »Die ganze Trauung fällt ins Wasser, und die draußen lachen sich kaputt über mich. Ich kann ihr Gelächter richtig hören.«
Mrs. Townley-Young vollführte im Gleichschritt mit ihrer Tochter eine Vierteldrehung und raffte dabei noch etwas mehr Satin in ihren Armen zusammen. »Kein Mensch lacht«, versicherte sie. »Mach dir keine Gedanken, Herzchen. Das ist nur irgendein dummes Mißverständnis. Dein Vater bringt das bestimmt sofort in Ordnung.«
»Wieso soll es ein Mißverständnis sein? Wir waren doch erst gestern nachmittag bei Mr. Sage. Und als letztes sagte er noch: ›Wir sehen uns dann morgen vormittag.‹ Und das soll er einfach vergessen haben und verschwunden sein?«
»Vielleicht hatte er einen Notfall. Es kann doch sein, daß jemand im Sterben liegt. Vielleicht wollte jemand ...«
»Aber Brendan ist noch mal umgekehrt.« Rebecca hielt in ihren Wanderungen inne. Mit zusammengekniffenen Augen starrte sie nachdenklich auf die Westwand des Glockenturms, als könnte sie durch sie hindurch das Pfarrhaus über der Straße sehen. »Ich war schon beim Auto, da sagte er, er hätte noch etwas vergessen, was er Mr. Sage fragen wollte. Er ist noch einmal umgekehrt. Er ist noch einmal ins Haus gegangen. Ich habe bestimmt eine Minute gewartet. Nein, länger, zwei oder drei. Und ...« Sie wirbelte herum und begann wieder zu marschieren. »Er hat überhaupt nicht mit Mr. Sage gesprochen. Es ist dieses Weib. Diese Hexe! Die steckt dahinter, Mutter. Das weißt du doch so gut wie ich. Aber warte nur, der werd ich’s zeigen.«
Cecily fand diese Wendung der Dinge einigermaßen interessant. Das versprach unter Umständen noch ganz unterhaltsam zu werden. Wenn sie diesen Tag schon im Namen der Familie ertragen mußte, dann, sagte sie sich, konnte sie wenigstens versuchen, sich die Qual ein wenig zu versüßen. Sie fragte also: »Wem denn?«
Mrs. Townley-Young sagte in freundlichem, aber strengem Ton: »Cecily!«
Doch die kurze Frage hatte genügt. »Polly Yarkin.« Rebecca stieß den Namen zähneknirschend hervor. »Dieser widerlichen kleinen Schlampe im Pfarrhaus.«
»Die Haushälterin, meinst du?« fragte Cecily. Diese überraschende Wendung mußte doch näher erforscht werden. Schon jetzt eine andere Frau? Alles in allem konnte sie es dem armen Brendan nicht verübeln, fand allerdings, er sei etwas stark abgesunken im Niveau. Sie setzte das Spielchen fort. »Du meine Güte, Becky, was hat die denn mit dem allen hier zu tun?«
»Cecily, mein Kind.« Mrs. Townley-Youngs Stimme klang nicht mehr ganz so freundlich.
»Jedem Mann hält sie ihre Riesenlollos unter die Nase und wartet auf die Reaktion«, sagte Rebecca. »Er findet die Ziege toll. Ich weiß es. Das kann er mir nicht verheimlichen.«
»Brendan liebt dich, Herzchen«, sagte Mrs. Townley-Young. »Er heiratet dich doch.«
»Er hat letzte Woche im Crofters Inn mit ihr einen getrunken. Nur schnell ein Glas vor der Rückfahrt nach Clitheroe, hat er zu mir gesagt. Er hätte gar nicht gewußt, daß sie dort sei. Er hätte schließlich nicht so tun können, als würde er sie nicht kennen, sagte er. Wir lebten schließlich in einem Dorf. Da hätte er doch nicht fremd tun können.«
»Liebes, du regst dich wegen nichts und wieder nichts auf.«
»Du glaubst, er ist in die Haushälterin vom Pfarrer verknallt?« fragte Cecily und riß die Augen auf, um sich den Anschein der Naivität zu geben. »Aber Becky, warum heiratet er dich dann?«
»Cecily!« zischte ihre Tante.
»Er heiratet mich ja gar nicht«, rief Rebecca. »Er heiratet überhaupt nicht. Wir haben ja gar keinen Pfarrer.«
In der Kirche auf der anderen Seite des roten Samtvorhangs wurde es totenstill. Der Organist hatte einen Moment zu spielen aufgehört, und Rebeccas Worte schienen durch das ganze Schiff zu hallen. Eilig griff der Organist wieder in die Tasten. Diesmal wählte er Krön, Herr, mit Liebe diesen frohen Tag.
»Du meine Güte«, hauchte Mrs. Townley-Young.
Schritte knallten auf dem Steinboden, der rote Vorhang wurde auf die Seite geschoben. Rebeccas Vater trat herein. »Nichts.« Er klopfte sich den Schnee vom Mantel und Hut. »Nirgends zu finden. Nicht im Dorf. Nicht am Fluß. Nicht auf dem Anger. Einfach weg. Aber das wird er mir mit seinem Posten bezahlen.«
Seine Frau steckte flehend die Arme nach ihm aus, berührte ihn aber nicht. »St. John, um Himmels willen, was sollen wir tun? Die vielen Leute. Das Essen zu Hause. Und Rebeccas Zust ...«
»Ich kenne die Details. Du brauchst sie mir nicht aufzuzählen.« Townley-Young zog den Vorhang zur Seite und spähte in die Kirche. »Wir werden für die nächsten zehn Jahre die Zielscheibe des allgemeinen Spotts sein.« Er drehte sich nach den Frauen herum, richtete seinen Blick insbesondere auf seine Tochter. »Du hast dir diese Suppe eingebrockt, Rebecca, und ich sollte sie dich, verdammt noch mal, auch allein auslöffeln lassen.«
»Daddy!« Es klang jammervoll.
»Also wirklich, St. John ...«
Cecily fand, dies wäre der Moment, Hilfsbereitschaft zu zeigen. Zweifellos würde gleich ihr Vater aus der Kirche zu ihnen herüberkommen – emotionale Krisen waren ihm stets ein Quell besonderen Ergötzens –, und wenn das der Fall war, konnte es für sie nur von Vorteil sein zu zeigen, daß sie bestens fähig war, bei Familienkrisen erfolgreich in die Bresche zu springen. Er hatte sich schließlich bezüglich ihrer Bitte, das Frühjahr in Kreta zu verbringen, immer noch nicht verbindlich geäußert.
Sie sagte: »Vielleicht sollten wir jemanden anrufen, Onkel St. John. Es muß doch einen anderen Pfarrer in der Nähe geben.«
»Ich habe bereits mit dem Constable gesprochen«, sagte Townley-Young.
»Aber der kann sie doch nicht trauen, St. John«, protestierte seine Frau. »Wir brauchen einen Geistlichen. Wir brauchen eine ordentliche Hochzeitsfeier. Das Essen wartet. Die Gäste werden allmählich hungrig. Die ...«
»Ich möchte Sage sehen«, unterbrach er. »Ich möchte ihn hier sehen. Und zwar auf der Stelle. Und wenn ich diesen Low-Church-Banausen eigenhändig zum Altar schleifen muß!«
»Aber wenn er dringend weggerufen worden ist ...« Mrs. Townley-Young gab sich offenkundig alle Mühe, die Stimme der Vernunft zu vertreten.
»Er ist nicht weggerufen worden. Diese Yankin kam mir im Dorf hinterhergelaufen. Sein Bett sei nicht benutzt, sagte sie. Sein Wagen steht aber in der Garage. Er muß also irgendwo in der Nähe sein. Und mir ist völlig klar, was der Bursche getrieben hat.«
»Der Pfarrer?« fragte Cecily und schaffte es, Entsetzen zu zeigen, während die Entwicklung des Dramas ihr in Wirklichkeit höchstes Vergnügen bereitete. Eine Hochzeit mit Rückenwind, von einem hurenden Geistlichen vorgenommen, zwischen einem widerstrebenden Bräutigam, der die Haushälterin des Pfarrers liebt, und einer wutschäumenden Braut, die auf bittere Rache sinnt. Da lohnte es sich doch fast, Brautjungfer zu sein. »Nein, Onkel St. John. Doch nicht der Pfarrer. Du meine Güte, so ein Skandal.«
Ihr Onkel warf ihr einen scharfen Blick zu. Er deutete mit spitzem Finger auf sie und wollte gerade zu sprechen beginnen, als der Vorhang von neuem auf die Seite gezogen wurde. Wie auf Kommando drehten sie sich alle herum. An der Tür stand der Dorfpolizist. Seine dicke Jacke war voller Schnee, die Gläser seiner Brille beschlagen. Er hatte keine Mütze auf, und sein rotes Haar war mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt.
»Und?« fragte Townley-Young. »Haben Sie ihn gefunden, Shepherd?«
»Ja«, antwortete der Constable. »Aber der traut niemanden mehr.«
JANUAR: FROST
1
»Was war das für ein Schild? Hast du es gesehen, Simon? Es war so eine Art Plakat am Straßenrand.«
Deborah St. James bremste den Wagen ab und sah sich um. Sie hatte die Kurve schon hinter sich, und das dichte Gestrüpp kahler Äste von Eichen und Kastanien verbarg sowohl die Straße selbst als auch die von Flechten überzogene Kalksteinmauer die Straße entlang. »War da ein Hotelschild? Hast du eine Einfahrt gesehen?«
Simon St. James riß sich von den Gedanken los, die ihn auf der langen Fahrt vom Flughafen in Manchester gefangen gehalten hatten: Da war einerseits das winterliche Hochmoor Lancashires mit seinen gedämpften rostroten Farben und dem zartgrünen Weideland; andererseits hatte er darüber gerätselt, mit welchem Instrument man einen dicken Elektrodraht durchtrennen konnte, um damit die Hände und Füße einer weiblichen Leiche so zu fesseln, wie sie in der letzten Woche in Surrey gefunden worden war.
»Eine Einfahrt?« wiederholte er. »Kann schon sein, daß da eine war. Aber ich habe nichts gesehen. Das Schild war ein Hinweis auf die Dorfwahrsagerin.«
»Ach, hör auf!«
»Wirklich! Ist das vielleicht ein Service, den das Hotel bietet und von dem du mir nichts gesagt hast?«
»Nicht, daß ich wüßte.« Die Straße begann zu steigen, und in der Ferne, vielleicht noch anderthalb Kilometer entfernt, schimmerten die Lichter eines Dorfes. »Wir sind wahrscheinlich einfach noch nicht weit genug gefahren.«
»Wie heißt das Hotel?«
»Crofters Inn.«
»Nein, das stand eindeutig nicht auf dem Schild. Vergiß nicht, daß wir hier in Lancashire sind. Es wundert mich, daß das Hotel nicht Zum Hexenkessel heißt.«
»Dann wären wir nicht hergekommen, Schatz. Mit fortschreitendem Alter werde ich nämlich abergläubisch.«
»Ach, so das ist das.« Er lächelte. Mit fortschreitendem Alter. Sie war gerade fünfundzwanzig und verfügte über die ganze Kraft und den Elan der jungen Jahre.
Aber sie sah müde aus – er wußte, daß sie in letzter Zeit schlecht geschlafen hatte –, und ihr Gesicht war blaß. Ein paar Tage auf dem Land, lange Spaziergänge und viel Ruhe, das war es, was sie jetzt brauchte. Sie hatte in den letzten Monaten zuviel gearbeitet, mehr als er, und war morgens viel zu früh zu Fototerminen aufgebrochen, die mit ihren eigentlichen Interessen nur am Rande zu tun hatten. Ich möchte meinen Horizont erweitern, pflegte sie zu sagen. Landschaften und Porträts reichen nicht, Simon. Ich muß vielseitiger werden. Ich würde meine neuen Arbeiten gern im kommenden Sommer ausstellen. Aber ich bekomme die Bilder nicht zusammen, wenn ich mich nicht auf die Socken mache und Neues ausprobiere, ein paar Kontakte knüpfe und so ... Er erhob keine Einwände und versuchte nicht, sie zurückzuhalten. Er wartete einfach darauf, daß die Krise vorbeigehen würde. Sie hatten in den ersten zwei Jahren ihrer Ehe mehrere kritische Phasen gemeistert. Diese Tatsache versuchte er sich vor Augen zu halten, wenn er die Hoffnung zu verlieren drohte, daß sie dies momentan nicht meistern würden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























