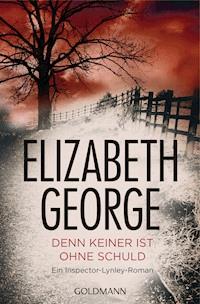10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Als die Polizistin Teo Bontempi nach einer schweren Verletzung nicht mehr aus dem Koma erwacht, weist alles auf einen Mordanschlag hin. Weil Teo zuletzt vor allem in der nigerianischen Gemeinde Nord-Londons ermittelte, beginnt Detective Superintendent Thomas Lynley auch genau dort mit der Suche nach dem Täter. Zusammen mit DS Barbara Havers taucht er in eine Welt ein, die nichts mit dem privilegierten britisch-bürgerlichen Leben, wie es Lynley bisher kannte, gemein zu haben scheint. Eine Welt, in der Schweigen und Unverständnis mehr als sonst ihre Arbeit behindern. Zumal auch Teo selbst nicht nur ein Geheimnis zu verbergen hatte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1011
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Teo Bontempi ist mit Leib und Seele Polizistin, entsprechend fällt es ihr schwer, Arbeit und Privatleben zu trennen. Besonders, seitdem sie als Angehörige einer Spezialeinheit in der nigerianischen Gemeinde Nord-Londons ermittelt. Dann wird Teo nach einer verhängnisvollen Nacht bewusstlos und mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert – und wacht nicht mehr auf. Die anschließende Obduktion erhärtet den Verdacht auf einen Mordanschlag.
Weil der Fall aus mehr als einem Grund brisant ist, übernimmt Scotland Yard. Gemeinsam mit Barbara Havers und Winston Nkata ermittelt Detective Superintendent Thomas Lynley von Anfang an in diverse Richtungen. Doch sowohl in Teos privatem als auch in ihrem beruflichen Umfeld stoßen sie schnell auf gekonnt verhülltes Schweigen, auf Abwehr und Unverständnis. Denn Teo war eine Frau mit vielen Gesichtern – und das Rätsel um ihren Tod führt Lynley und sein Team in eine bisher verborgene, abgründige Welt …
Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elizabeth George
Was im Verborgenen ruht
Ein Inspector-Lynley-Roman
Ins Deutsche übertragen vonCharlotte Breuer
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Something to hide«bei Viking, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.
Das Zitat von Alice Miller entstammt aus: Alice Miller, Am Anfang war Erziehung. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.
Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
Diese Übersetzung wurde im Rahmen des NEUSTART KULTUR-Stipendiumprogramms der VG-Wort gefördert durch die BKM.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung März 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © David Lichtneker/Arcangel; FinePic®, München
Th · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27379-8V002
www.goldmann-verlag.de
Für jene, die leiden,die durchhalten,die kämpfen.
Denn die menschliche Seele ist praktisch unausrottbar, und ihre Chance, vom Tod aufzuerstehen, bleibt, solange der Körper lebt.
Alice Miller, Am Anfang war Erziehung
TEIL 1
21. Juli
_________________
WESTMINSTERCENTRAL LONDON
An einem der heißesten Tage eines ungewöhnlich heißen Sommers traf Deborah St. James, vom Parliament Square her kommend, im Bildungsministerium ein. Man hatte sie zu einem Treffen mit der Staatssekretärin des Ministeriums und dem Vorsitzenden des Nationalen Gesundheitsdienstes gebeten. »Wir würden gern mit Ihnen über ein Projekt sprechen«, hatte es geheißen. »Haben Sie gerade Kapazitäten frei?«
Hatte sie. Seit der Veröffentlichung von London Voices vor vier Monaten, einem Bildband, an dem sie mehrere Jahre lang gearbeitet hatte, war sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Eine Einladung zu einem Gespräch über ein mögliches neues Projekt kam ihr also gerade recht, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, welche Art Fotografie dem Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdienst vorschwebte.
Sie hielt dem Wachmann ihren Ausweis hin, doch der interessierte sich nur für den Inhalt ihrer geräumigen Tasche. Ihr Handy sei kein Problem, sagte er, sie müsse jedoch beweisen, dass es sich bei ihrer digitalen Kamera tatsächlich um eine Kamera handele. Deborah kam der Aufforderung nach, indem sie ein Foto von dem Mann machte. Sie zeigte es ihm. Er warf einen Blick darauf und machte die Tür frei. Als sie gerade das Gebäude betreten wollte, sagte er: »Aber löschen Sie das. Ich sehe ja fürchterlich aus auf dem Bild.«
Am Empfangstresen fragte sie nach Dominique Shaw. Ihr Name sei Deborah St. James, fügte sie hinzu, sie habe einen Termin mit der Staatssekretärin. Nach einem diskret gemurmelten Anruf reichte die Rezeptionistin ihr einen Besucherausweis an einem Umhängeband. Konferenzraum vier, zweiter Stock, sagte die Frau. Linker Hand befinde sich der Aufzug, rechter Hand die Treppe. Deborah nahm die Treppe.
Als sie die Tür zu Konferenzraum vier öffnete, glaubte sie zunächst, man habe ihr die falsche Nummer genannt. Um einen polierten Konferenztisch saßen insgesamt fünf Personen, nicht nur die beiden, die sie um das Gespräch gebeten hatten. Drei Standventilatoren bemühten sich tapfer, die Temperatur im Raum zu senken, produzierten jedoch nur eine Art Wüstenwind.
Eine Frau, die am Kopfende des Tischs saß, erhob sich und trat mit ausgestreckter Hand auf Deborah zu. Ihr formeller Kleidungsstil wies sie unübersehbar als Staatsbedienstete aus, dazu trug sie eine überdimensionierte randlose Brille und goldene Ohrringe, groß wie Golfbälle. Sie sei Dominique Shaw, Staatssekretärin des Bildungsministeriums, erklärte sie. Die anderen stellte sie so hastig vor, dass Deborah kaum mehr als deren berufliche Stellung mitbekam: Leiter der staatlichen Gesundheitsbehörde, ein Vertreter von Barnardo’s, die Gründerin einer Organisation namens Orchid House und eine Frau namens Narissa Soundso. Die Gruppe war sehr gemischt: eine Schwarze, ein Mann, der aussah wie ein Koreaner, Dominique Shaw selbst war eine Weiße, und die ethnische Zugehörigkeit der Frau namens Narissa konnte Deborah nicht einordnen.
»Nehmen Sie Platz.« Dominique Shaw deutete auf einen leeren Stuhl neben dem Vertreter von Barnardo’s.
Deborah setzte sich. Zu ihrer Überraschung lag vor jedem Anwesenden ein Exemplar von London Voices auf dem Tisch. Ihr erster Gedanke war, dass das Buch Probleme verursacht hatte, dass ihr Werk in irgendeiner Weise als politisch, sozial oder kulturell anstößig aufgenommen worden war, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, warum sich deswegen das Bildungsministerium hätte einschalten sollen. Das Buch enthielt Porträts von Londonern, die sie über einen Zeitraum von drei Jahren aufgenommen hatte. Und jedes Foto wurde begleitet von ein paar Worten der abgebildeten Person, die Deborah beim Fotografieren aufgezeichnet hatte. Zu den Porträtierten gehörten auch mindestens ein Dutzend Obdachlose, deren Zahl stetig anwuchs, Menschen jeden Alters und Geschlechts, Angehörige aller Ethnien und Nationalitäten, die an der Straße The Strand in Hauseingängen schliefen, unter der Park Lane in U-Bahnhöfen neben – manchmal auch in – Mülltonnen und hinter Hotels wie dem Savoy oder dem Dorchester. Diese Fotos zeigten London nicht als die glamouröse Weltstadt, als die sie sich gern darstellte.
Man bot ihr Kaffee oder Tee an, sie lehnte beides dankend ab. Sie wartete darauf, dass jemand das Thema des Treffens zur Sprache brachte – und vor allem erklärte, warum in aller Welt man sie hergebeten hatte. Und nachdem man ihr ein Glas mit lauwarmem Wasser hingestellt und Dominique Shaw ihr unnötigerweise ein Exemplar von London Voices ausgehändigt hatte, begann die Staatssekretärin, sie aufzuklären.
»Mr Oh«, sagte sie mit einer Kopfbewegung in Richtung des Vertreters von Barnardo’s, »hat mich auf Ihr Buch aufmerksam gemacht. Sehr beeindruckend. Ich frage mich allerdings …« Sie schien zu überlegen, was genau sie sich fragte, während draußen vor dem Gebäude ein lautes Kreischen ertönte, das anscheinend von einem Lastwagen mit ausgeleiertem Getriebe verursacht wurde. Shaw schaute zum offenen Fenster, runzelte die Stirn und fuhr fort: »Wie haben Sie das geschafft?«
Deborah war sich nicht sicher, was Dominique Shaw meinte. Einen Moment lang betrachtete sie den Einband ihres Buchs. Der Verlag hatte als Titelbild ein harmloses Foto ausgewählt. Es zeigte einen alten Mann, der im St. James’s Park die Vögel fütterte. Mit einer Schirmmütze auf dem Kopf stand er auf der Brücke, die über den Teich führte, den Arm ausgestreckt, einen Vogel auf der Handfläche. Es war sein zerfurchtes Gesicht gewesen, das sie angezogen hatte, die tiefen Falten, die sich von den Augen bis zu den aufgesprungenen Lippen zogen. Sie selbst hätte dieses Foto nicht als Titelbild für das Buch gewählt, doch sie konnte die Entscheidung des Verlags nachvollziehen. Schließlich sollte es den potenziellen Käufer dazu animieren, das Buch in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Ein Foto von einem Obdachlosen, der hinter einer Mülltonne campierte, würde diesen Zweck nicht so gut erfüllen.
»Meinen Sie, wie ich die Leute dazu gebracht habe, sich fotografieren zu lassen?«, fragte Deborah. »Ich habe sie einfach gefragt. Ich habe ihnen erklärt, dass ich ein Porträtfoto von ihnen machen wollte … und, na ja, die meisten Leute lassen sich gern fotografieren, wenn man ihnen einen guten Grund nennt. Also, natürlich nicht alle. Es gab auch Leute, die Nein gesagt haben, die das sogar kategorisch abgelehnt haben. Es gab auch die eine oder andere aggressive Reaktion, aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Den Leuten, die sich spontan fotografieren ließen, habe ich, sofern sie eine Adresse hatten, später eine Kopie des Fotos geschickt, das ich für das Buch ausgewählt hatte.«
»Und was die Leute Ihnen erzählt haben?«, fragte Mr Oh. »Das, was Sie im Buch abgedruckt haben?«
»Ja, wie haben Sie sie dazu gebracht, so offen mit Ihnen zu reden?«, wollte Narissa wissen.
»Ach so.« Deborah schlug das Buch auf und blätterte darin. »Wenn man eine Person fotografiert, muss man sie von der Tatsache ablenken, dass sie fotografiert wird«, sagte sie dann. »Die Leute verkrampfen sich vor der Kamera. So sind die Menschen nun mal. Sie glauben, sie müssen posieren, und dann sind sie plötzlich nicht mehr sie selbst. Als Fotografin versuche ich, sie in einem Moment zu erwischen, wo sie … Na ja, man könnte sagen, wo sie sich zeigen. Das Thema kennen alle Fotografen. Bei Schnappschüssen ist das natürlich kein Problem, weil den Leuten nicht bewusst ist, dass sie fotografiert werden. Aber solche Porträts, die in einem Buch veröffentlicht werden sollen, sind ja keine Schnappschüsse, sondern fotografische Inszenierungen. Das bekommt man am besten hin, indem man mit den Leuten redet, während man sie fotografiert.«
»Also, Sie sagen ihnen, sie sollen sich entspannen, Sie bitten sie zu lächeln … oder wie hat man sich das vorzustellen?«, fragte Dominique Shaw.
Die Staatssekretärin hatte ihre Erklärung offenbar nicht verstanden. »Ich bitte sie um gar nichts«, sagte Deborah. »Ich lasse sie einfach erzählen und reagiere auf das, was sie sagen, und dann erzählen sie weiter. Für dieses Projekt zum Beispiel«, sie zeigte auf das Buch, »habe ich sie nach ihren Erfahrungen in London gefragt, ob sie gern in London leben und wie die Stadt sich für sie anfühlt, was ihnen der Ort bedeutete, an dem ich sie fotografierte. Natürlich hatte jeder eine andere Geschichte zu erzählen. Und beim Zuhören ergaben sich die Situationen, die ich brauchte.«
Die Gründerin von Orchid House sagte: »Wie darf ich das verstehen? Glauben Sie, Sie besitzen ein besonderes Talent dafür, die Leute zum Reden zu bringen?«
Deborah schüttelte lächelnd den Kopf. »Ganz und gar nicht. Ich gerate total ins Schwimmen, sobald ein Gespräch sich nicht um Fotografie, Hunde oder Katzen dreht. Übers Gärtnern könnte ich noch mitreden, aber nur, wenn es ums Jäten ginge und wenn man nicht von mir verlangt, jedes Unkraut zu benennen. Für dieses Buch hatte ich mir im Voraus eine Reihe von Fragen zurechtgelegt, die ich den Leuten beim Fotografieren gestellt habe. Anhand ihrer Antworten hat sich dann das Gespräch entwickelt. Wenn Leute über Dinge reden, die sie berühren, verändert sich ihr Gesichtsausdruck.«
»Und dann machen Sie das Foto?«
»Nein, nein. Ich warte auf die Veränderung des Gesichtsausdrucks, aber ich fotografiere die ganze Zeit. Für ein Buch wie das hier mache ich … so Pi mal Daumen … an die dreitausend Aufnahmen.«
Eine Weile herrschte Schweigen am Tisch. Blicke wurden ausgetauscht. Deborah war sich ziemlich sicher, dass man sie nicht herbestellt hatte, um über London Voices zu reden, aber sie konnte sich immer noch nicht vorstellen, was man von ihr wollte. Schließlich ergriff die Staatssekretärin das Wort.
»Ihr Buch ist wirklich beeindruckend«, sagte sie. »Meinen Glückwunsch. Wir würden gern über ein anderes Projekt mit Ihnen sprechen.«
»Etwas, das mit Bildung zu tun hat?«, fragte Deborah.
»Ja, aber nicht so, wie Sie vielleicht vermuten.«
MAYVILLE ESTATEDALSTONNORTH-EAST LONDON
Tanimola Bankole hoffte inständig, dass die seit vier Wochen anhaltende quälende Sommerhitze seinen Vater ermüden würde, der sich seit geschlagenen siebenunddreißig Minuten über die Verantwortungslosigkeit seines Sohnes ausließ. Es war kein neues Thema für Abeo Bankole. Tanis Vater konnte seinen Vortrag locker auf über eine geschlagene Dreiviertelstunde ausdehnen, und zwar sowohl auf Englisch als auch auf Yoruba, seiner Muttersprache, das hatte Tani schon mehr als einmal erlebt. Er betrachtete es als seine väterliche Pflicht, seinen Sohn zu einem nach seiner Definition mustergültigen Mann zu erziehen, und der konnte Tani nur werden, wenn er alle ebenfalls von Abeo festgelegten Pflichten eines solchen erfüllte. Und Abeo betrachtete es als Tanis Sohnespflicht, seinem Vater zuzuhören, sich alles, was er sagte, zu merken und seinem Vater in allen Dingen zu gehorchen. Die erste dieser drei Forderungen konnte Tani meistens erfüllen, aber die zweite und dritte bereiteten ihm ziemliche Schwierigkeiten.
An diesem Tag hatte Tani keinem einzigen Argument seines Vaters etwas entgegenzusetzen. Ja, er konnte sich glücklich schätzen, dass er als Sohn von Abeo Bankole, Besitzer des Supermarkts »Into Africa Groceries Etc.« sowie einer Metzgerei und eines Fischstandes auf dem Markt, einer regelmäßigen Arbeit nachgehen konnte. Ja, er konnte froh sein, dass sein Vater ihm ein Achtel seines Lohns als Taschengeld zugestand und nicht von ihm verlangte, das ganze Geld zu Hause abzugeben. Ja, er bekam täglich drei gehaltvolle, von seiner Mutter zubereitete Mahlzeiten. Seine Wäsche wurde gewaschen, gebügelt und gefaltet in sein Zimmer gebracht. Und so weiter, bla, bla, bla. Ungeachtet der Hitze, die vom Asphalt aufstieg und aus den wenigen in ihrem Viertel vorhandenen Bäumen waberte, die jetzt schon ihre Blätter abwarfen, und ohne sich darum zu scheren, dass das Eis in seinem Fischstand auf dem Ridley Road Market rasend schnell dahinschmolz und Seehecht und Schnapper und Makrelen verdarben, dass die glänzenden Innereien von Kühen und Schafen in der Metzgerei vor sich hin stanken, dass Obst und Gemüse im Supermarkt zu Schleuderpreisen verkauft werden mussten, marschierte Abeo wutschnaubend in Richtung Mayville Estate, weil er an nichts anderes denken konnte, als dass Tani nicht pünktlich zur Arbeit erschienen war.
Tani war an allem schuld. Alles, was sein Vater sagte, stimmte. Er konnte einfach nicht bei der Sache bleiben. Er dachte nicht immer zuerst an seine Familie. Er vergaß immer wieder, wer er war. Und deswegen brachte er jetzt auch nichts zu seiner Verteidigung vor. Stattdessen dachte er nur an Sophie Franklin.
Und da gab es einiges, woran er gern dachte: ihre wunderbare Haut, ihr weiches, kurzes Haar, ihre seidigen Beine, ihre göttlichen Fesseln, ihre herrlichen Brüste, ihre Lippen, ihre Zunge und überhaupt … Natürlich war er total pflichtvergessen. Was sollte er sonst sein, wenn er mit Sophie zusammen war?
Das hätte sein Vater sogar verstanden. Er war jetzt zweiundsechzig, aber er war schließlich auch mal jung gewesen. Aber Tani konnte ihm unmöglich von Sophie erzählen. Dabei war die Tatsache, dass sie keine Nigerianerin war, nur einer der Gründe, warum Abeo Bankole einen Herzinfarkt kriegen würde, wenn Tani ihm von seiner Beziehung erzählte. Der zweite Grund war der Sex mit Sophie, etwas, das Abeo nie im Leben gelassen hinnehmen würde.
Tani war mal wieder zu spät zur Arbeit im Into Africa Groceries Etc. erschienen. Und zwar so spät, dass Zaid bereits angefangen hatte, die Regale aufzufüllen. Das tägliche Auffüllen der Regale – sowie das Aufräumen und Putzen – war Tanis Aufgabe, die er zu erledigen hatte, sobald er vom College kam. Zaid sollte lediglich den Kunden sagen, wo sie fanden, was sie suchten, und ansonsten die Kasse bedienen. Er war sauer, dass die ganze Arbeit an ihm hängen geblieben war, und so hatte er Abeo in der Metzgerei angerufen, um seinem Ärger Luft zu machen.
Als Tani schließlich im Supermarkt eingetroffen war, wollte er sich pflichtschuldigst daranmachen, die Regale aufzufüllen; das hatte Zaid jedoch bereits alles erledigt und ihn mit wütenden Blicken bedacht, bis Abeo hereingestürmt war und Tani befohlen hatte, mit ihm zu kommen.
Tani hatte natürlich gewusst, was ihm blühte. Gleichzeitig witterte er eine gute Gelegenheit, seinen Vater endlich über seine Zukunftspläne ins Bild zu setzen. Er hasste die Arbeit im Supermarkt und in der Metzgerei und am Fischstand, und auf gar keinen Fall hatte er vor, so wie sein Vater sich das vorstellte, die Leitung von Into Africa Groceries Etc. zu übernehmen, sobald er seine Catering-Ausbildung am Sixth-Form-College beendet hatte. Das war nicht sein Ding. Das war das Allerletzte. Er hatte vor, an die Uni zu gehen und Wirtschaftswissenschaften zu studieren, und für nichts auf der Welt würde er sein Diplom vergeuden, indem er in irgendeinem Laden arbeitete. Tani hatte genug Vettern, sollte Abeo doch einen von denen als Geschäftsführer einstellen. Das würde natürlich bedeuten, dass jemand aus dem in Peckham ansässigen Teil der Familie in das Geschäft einsteigen würde, das Abeo für sich und seine Kinder im Nordosten Londons aufgebaut hatte, und das würde Abeo nicht gefallen. Aber Tani würde ihm keine andere Wahl lassen. Er würde sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten.
Der Weg nach Mayville Estate war der reinste Hindernislauf. Jetzt am späten Nachmittag war alles auf dem Heimweg, und es wimmelte nur so von Fußgängern, Autos, Bussen und Fahrrädern. Die Bankoles gehörten zu den wenigen Nigerianern in diesem sehr gemischten Viertel, in dem zunehmend mehr karibisch- als afrikanischstämmige Menschen lebten. Die Familie wohnte in Bronte House, einem für Mayville Estate typischen fünfstöckigen, schlichten Backsteingebäude. Direkt gegenüber befand sich ein asphaltierter Bolzplatz, wo riesige Londoner Platanen Schutz gegen die sengende Sonne boten. Es gab Basketballkörbe und Fußballtore, und ein hoher Zaun sorgte dafür, dass keine Bälle auf die Straße flogen.
Über Betonstufen gelangte man in die Erdgeschosswohnungen von Bronte House, während die Wohnungen in den oberen Stockwerken über Außengalerien erreichbar waren, zu denen ein Aufzug und ein Treppenhaus führten. Fast alle Türen standen offen, um für ein bisschen Durchzug zu sorgen, was jedoch bei der stehenden Luft ziemlich zwecklos war. Aus den offenen Fenstern drang eine Mischung aus Fernsehgeräuschen, Dance Music und Rap, und es duftete nach allen möglichen Speisen, die gerade zubereitet wurden.
In der Wohnung der Bankoles war es so heiß wie in einer Sauna. Tani fühlte sich eingehüllt von der feuchten Luft, und er blinzelte fortwährend, weil ihm der Schweiß in die Augen lief. Mehrere Ventilatoren liefen auf Hochtouren, konnten jedoch gegen die Bruthitze nichts ausrichten, sondern rührten nur die heiße Suppe um. Man bekam zwar noch Luft, aber das Atmen war unangenehm.
Tani nahm den Geruch sofort wahr. Er schaute seinen Vater an, der grimmig dreinblickte.
Von Monifa Bankole wurden hellseherische Fähigkeiten verlangt. So sollte sie nicht nur voraussehen, um welche Uhrzeit ihr Mann nach Hause kam, sondern auch, welches Essen er vorgesetzt haben wollte. Abeo hielt es nicht für nötig, sie über solche Dinge in Kenntnis zu setzen. Schließlich waren sie seit zwanzig Jahren verheiratet, wieso sollte er ihr also alles dreimal sagen wie ein frisch angetrauter Ehemann? Im Lauf ihres ersten Ehejahres hatte er ihr klargemacht, was er von ihr erwartete, und dazu gehörte, dass er spätestens zehn Minuten, nachdem er von der Arbeit kam, sein Essen auf dem Tisch haben wollte. Abeo und Tani kamen zur rechten Zeit, aber es gab nicht das gewünschte Gericht. Tanis Schwester Simisola war gerade dabei, den Tisch für alle zu decken, das Abendessen war also fertig.
Simi nickte zum Gruß und grinste, als Tani sagte: »Na, Squeak, hast du dich so aufgetakelt, weil dein Freund zum Essen kommt?« Um ihr Grinsen zu verbergen, hielt sie sich hastig eine Hand vor den Mund, sodass ihre putzige Zahnlücke nicht zu sehen war, aber ihr Kichern konnte sie damit nicht unterdrücken. Sie war acht Jahre alt, zehn Jahre jünger als Tani. Und ihm machte nichts mehr Spaß, als seine kleine Schwester aufzuziehen.
»Ich hab keinen Freund!«, rief Simi.
»Ach nein? Warum denn nicht?«, fragte er. »In Nigeria wärst du längst verheiratet.«
»Nein, wär ich nicht!«, entgegnete sie.
»Wärst du doch. So läuft das da, stimmt’s, Pa?«
Abeo beachtete Tani nicht und befahl Simi: »Sag deiner Mutter, dass wir hier sind.« Als wäre das nötig gewesen.
Das Mädchen wirbelte herum, tanzte an einem der fast nutzlosen Ventilatoren vorbei und rief: »Mummy! Sie sind da!« Dann sagte sie, genau wie ihre Mutter es immer machte, zu ihrem Vater und ihrem Bruder: »Setzt euch, setzt euch. Willst du ein Bier, Papa? Tani, du?«
»Für ihn Wasser«, sagte Abeo.
Simi wirbelte wieder herum. Da ging Tani auf, dass seine Schwester die ganze Zeit so herumwirbelte, um einen neuen Rock vorzuführen. Schien ein neues Teil von Oxfam zu sein – allerdings hatte sie ihn mit Pailletten und Glitzerzeug bestickt, ebenso wie ihr Haarband, mit dem sie versuchte, ihre kurzen schwarzen Locken zu bändigen. Auf dem Haarband prangte außer den Pailletten auch noch eine Feder. Sie sauste in die Küche und stieß beinahe mit ihrer Mutter zusammen, die gerade die Gbegiri-Suppe auftragen wollte, die Tani schon beim Hereinkommen gerochen hatte. Der Topf dampfte, und auf Monifas Stirn und Wangen glänzten Schweißperlen.
Wie er bei der Affenhitze Bohneneintopf essen sollte, war Tani ein Rätsel, aber er wusste genau, was passieren würde, wenn er eine entsprechende Bemerkung machte. Dann würde Abeo ihm einen Vortrag darüber halten, wie es früher war, als er selbst noch ein Junge gewesen war. Er war jetzt zweiundsechzig und lebte seit vierzig Jahren in England, aber wenn er von seiner Kindheit in Nigeria erzählte, hätte man meinen können, er wäre erst vor vierzehn Tagen in Heathrow gelandet. Wie es »zu Hause« gewesen war, gehörte zu seinen Lieblingsthemen – die Schulen, die Lebensumstände, das Wetter, die Sitten und Bräuche … und es hörte sich immer so an, als dozierte er über eine afrikanische Fantasieheimat, die er aus Black Panther kannte, seinem Lieblingsfilm, den er schon mindestens fünfmal gesehen hatte.
Als Monifa den dampfenden Topf auf den Tisch stellte, sagte Abeo mit zusammengezogenen Brauen: »Das ist kein Efo riro.«
»Bei der Hitze …«, sagte Monifa. »Wir hatten weder Hühnchen noch Fleisch oder Fisch im Haus. Wenn ich auf dem Markt welches für ein Efo riro besorgt hätte, wäre es nicht mehr frisch gewesen, bis ich nach Hause gekommen wär. Da dachte ich, mit einem Bohneneintopf bin ich auf der sicheren Seite.«
Abeo schaute sie an. »Hast du keinen Reis gekocht, Monifa?«
»Hier, Papa!« Simi hielt ihm eine geeiste Bierdose und ein geeistes Glas hin. »Es fühlt sich sooo schön kühl an, fühl mal, Papa! Kann ich einen Schluck davon haben? Einen klitzekleinen?«
»Nein, kannst du nicht!«, sagte ihre Mutter. »Setz dich. Jetzt wird gegessen. Das mit dem Reis tut mir leid, Abeo.«
»Aber ich muss noch Tanis Wasser holen, Mummy«, sagte Simi.
»Tu, was deine Mutter dir sagt, Simisola!«, herrschte ihr Vater sie an.
Simi tat, wie ihr geheißen, und warf Tani beim Hinsetzen einen entschuldigenden Blick zu, doch der zuckte nur die Achseln.
Sie verbarg ihre Hände unter dem Tisch und schaute Tani an, der ihr zuzwinkerte. Dann schaute sie ihre Mutter an, die ihren Blick nicht von Abeo abwandte. Nachdem Abeo seine Frau lange mit strenger Miene betrachtet hatte, nickte er kurz, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie jetzt das Essen verteilen durfte.
»Dein Sohn ist mal wieder zu spät zur Arbeit erschienen«, sagte Abeo zu Monifa. »Er hatte nur eine halbe Stunde von seiner kostbaren Zeit für den Laden übrig. Zaid musste kurz vor Feierabend fast alles allein machen, und das hat ihn ziemlich geärgert.« Dann sagte er zu Tani: »Wo warst du, dass du deine Pflichten einfach so vernachlässigt hast?«
»Abeo …?«, murmelte Monifa. »Vielleicht kannst du später mit Tani …?«
»Worüber ich spreche, geht dich nichts an«, sagte Abeo. »Hast du Eba gemacht? Ja? Simisola, hol es aus der Küche!«
Monifa füllte einen Suppenteller mit einer großen Portion Gbegiri-Suppe und reichte ihn Abeo. Dann füllte sie einen Teller für Tani.
Simi kam aus der Küche mit einem großen Teller Eba, eine Beilage aus geriebener Maniokwurzel. Unter den Arm hatte sie sich eine Flasche Brown Sauce geklemmt – um die Klöße ein bisschen aufzupeppen und dem Essen eine englische Note zu verleihen. Sie stellte beides vor Abeo auf den Tisch und setzte sich. Ihr wurde wie immer zuletzt serviert.
Sie aßen schweigend. Nur Geräusche von draußen und das Schmatzen und Kauen der Familienmitglieder waren zu hören. Nachdem er seinen Teller zur Hälfte geleert hatte, legte Abeo seinen Löffel ab, schob seinen Stuhl zurück und absolvierte sein allabendliches Ritual, wie Tani es im Stillen bezeichnete: Er schnäuzte sich energisch in eine Papierserviette, zerknüllte sie und warf sie auf den Boden. Dann befahl er Simi, ihm eine neue Serviette zu bringen. Als Monifa aufsprang, sagte Abeo: »Setz dich! Du bist nicht Simi.« Simi lief los und kehrte zurück mit einem uralten Geschirrtuch, das so verwaschen war, dass man nicht mehr erkennen konnte, welche königliche Hochzeit darauf abgebildet war. »Ich konnte keine Papierserviette finden, aber das hier tut’s doch auch, oder, Papa?«
Er nahm das Geschirrtuch entgegen und wischte sich damit das Gesicht ab. Dann legte er das Tuch auf den Tisch und schaute in die Runde. »Ich habe Neuigkeiten«, sagte er.
Alle erstarrten.
»Was für Neuigkeiten?«, fragte Monifa.
»Es ist alles geregelt«, lautete seine Antwort.
Tani bemerkte, dass seine Mutter einen kurzen Blick in seine Richtung warf. Ihr Gesichtsausdruck reichte aus, um ihn in Panik zu versetzen.
»Es hat viele Monate gedauert«, sagte Abeo. »Die Kosten waren höher, als ich erwartet hatte. Bei zehn Kühen haben wir angefangen. Zehn! Ich habe gefragt, wird sie Kinder gebären, wenn ich zehn Kühe für sie bezahlen muss? Er sagt, sie ist eine von zwölf Geschwistern, und drei davon haben schon geliefert. Sie kommt also aus einer Familie mit gutem Zuchtmaterial. Sehr gebärfreudig. Das spielt keine Rolle, habe ich gesagt. Dass ihre Mutter und ihre Geschwister so viele Nachkommen produziert haben, heißt noch lange nicht, dass sie das auch tun wird. Ich habe also eine Garantie verlangt. Zehn Kühe und keine Garantie?, hab ich zu ihm gesagt. Er darauf: Pah, welcher Mann verlangt eine Garantie? Ich: ein Mann, der weiß, worauf es ankommt. So ging das hin und her, und am Ende haben wir uns auf sechs Kühe geeinigt. Ich habe gesagt, das ist immer noch zu viel, worauf er geantwortet hat: Dann kann sie hierbleiben, denn ich habe noch andere Optionen. Optionen, hat er gesagt. Mir war klar, dass er blufft. Aber der Zeitpunkt ist günstig, ihr Alter perfekt, und sie wird nicht lange auf dem Markt bleiben, wenn er sie anbietet. Daher habe ich eingeschlagen, der Handel ist also perfekt.«
Monifa hatte den Blick gesenkt und während Abeos Vortrag kein einziges Mal aufgeschaut. Simi hatte aufgehört zu kauen, ihr Gesicht drückte Verwirrung aus. Tani hatte den Worten seines Vaters irgendwann nicht mehr folgen können. Zehn Kühe? Sechs? Etwas ganz Schlimmes schien sich da zusammenzubrauen. Eine Spannung lag in der Luft, die ihm Angst machte.
Jetzt wandte Abeo sich ihm zu. »Sechs Kühe habe ich bezahlt für eine sechzehnjährige Jungfrau«, sagte er. »Und das habe ich für dich getan. Ich werde bald mit dir nach Nigeria fahren, damit du sie kennenlernen kannst.«
»Wieso soll ich ein Mädchen in Nigeria kennenlernen?«, fragte Tani.
»Weil du sie heiraten wirst, sobald sie siebzehn ist.« Damit rückte Abeo seinen Stuhl wieder zurecht und begann, den Rest seiner Suppe zu essen. Er nahm sich etwas von dem Eba und schaufelte damit ein kleines Stück Rindfleisch von seinem Teller. Das schien ihn an etwas zu erinnern, das er zu erwähnen vergessen hatte. »Du kannst dich glücklich schätzen«, sagte er zu Tani. »Wegen des hohen Preises geht so ein junges Mädchen normalerweise an einen Mann von mindestens vierzig Jahren, nicht an einen Jungen wie dich. Aber du musst zur Ruhe kommen und ein Mann werden. Also werden wir nach Nigeria fliegen. Wenn wir dort sind, wird sie für dich kochen, und du kannst sie kennenlernen. Für all das habe ich gesorgt, damit du nicht am Ende eine nichtsnutzige Frau bekommst. Sie heißt übrigens Omorinsola.«
Tani verschränkte die Hände auf dem Tisch. Die Temperatur im Zimmer schien um mehrere Grad angestiegen zu sein, seit sie aus der Ripley Road hergekommen waren. Er sagte: »Das mach ich nicht, Pa.«
Monifa atmete hörbar ein, und Simis Augen weiteten sich. Abeo blickte von seinem Teller auf. »Was hast du gerade zu mir gesagt, Tanimola?«
»Ich habe gesagt, ich mach das nicht. Ich werde mich nicht mit dieser Jungfrau treffen, die du für mich ausgesucht hast, und ich werde auch kein siebzehnjähriges Mädchen heiraten.« Tani hörte seine Mutter seinen Namen flüstern und wandte sich ihr zu. »Wir leben nicht im Mittelalter, Mum.«
»In Nigeria«, sagte Abeo, »werden diese Dinge so geregelt, dass …«
»Wir leben aber nicht in Nigeria. Wir leben in London, und in London heiraten die Leute, wen sie wollen und wann sie wollen. Das habe ich zumindest vor. Niemand sucht mir eine Frau aus. Außerdem will ich sowieso nicht heiraten. Jedenfalls jetzt noch nicht. Und auf gar keinen Fall eine afrikanische Jungfrau mit Fruchtbarkeitsgarantie. Das ist ja Wahnsinn.«
Einen Augenblick lang herrschte dröhnende Stille. Dann sagte Abeo: »Du tust genau das, was ich dir sage, Tani. Du wirst Omorinsola kennenlernen. Du bist ihr versprochen, und sie ist dir versprochen, Ende der Diskussion.«
»Du«, sagte Tani, »bestimmst nicht über mich.«
Monifa schnappte nach Luft. Tani hörte es und sagte: »Nein, Mum, ich gehe weder nach Nigeria noch sonst wohin, nur weil er das so bestimmt.«
»Ich bestimme in dieser Familie«, sagte Abeo, »und als Mitglied dieser Familie tust du, was ich dir sage.«
»Nein«, sagte Tani. »Da irrst du dich. Du kannst mich nicht zum Heiraten zwingen.«
»Du wirst tun, was ich von dir verlange, Tani. Ich werde dafür sorgen.«
»Ach ja? Das glaubst du? Willst du mir etwa eine Pistole an den Kopf halten? Das gibt bestimmt hübsche Hochzeitsfotos.«
»Hüte deine Zunge!«
»Wieso? Was tust du denn, wenn nicht? Willst du mich verprügeln, wie …«
Monifa fiel ihm ins Wort. »Hör auf, Tani. Hab etwas Respekt vor deinem Vater.« Dann wandte sie sich an ihre Tochter. »Simi, geh auf dein …«
»Sie bleibt«, donnerte Abeo. Dann sagte er zu Tani: »Sprich deinen Satz zu Ende.«
»Ich habe nichts mehr zu sagen.« Damit stand er auf, sein Stuhl quietschte auf dem Linoleum. Sein Vater erhob sich ebenfalls.
Abeos Fäuste ballten sich. Tani zuckte mit keiner Wimper. Ihre Blicke bohrten sich über den Tisch hinweg ineinander. Schließlich sagte Abeo: »Geh mir aus den Augen.«
Das ließ Tani sich nicht zweimal sagen.
THE NARROW WAYHACKNEYNORTH-EAST LONDON
Detective Chief Superintendent Mark Phinney war nicht überrascht, als er sah, dass sein Bruder auf ihn wartete. Paulie hatte das alles organisiert, und er wollte natürlich wissen, wie Mark gefiel, was er bei Massage Dreams geboten bekommen hatte. Massage Dreams lag erstens in der Nähe von Paulies beiden Pfandleihhäusern und zweitens nur einen Steinwurf von der Wohnung ihrer Eltern und Paulies eigener Wohnung entfernt. Zumindest, dachte Mark, lauerte sein Bruder ihm nicht in dem winzigen Eingangsbereich des verdammten Ladens auf, sondern war das kurze Stück von der Mare Street bis zum Narrow Way gegangen und saß jetzt auf einer der schmalen Bänke, die in der Mitte der Fußgängerzone standen. Mark hatte ihn sofort entdeckt, als er um die Ecke gebogen war. Paulies Lippen umspielte das wissende Grinsen, mit dem er seinen jüngeren Bruder schon immer empfangen hatte, wenn er glaubte, dass der – ein pickelgesichtiger Teenager – von einem Date mit einem Mädchen kam, während Mark in Wirklichkeit nur mit ein paar Kumpels aus der Schule abgehangen hatte, alles Außenseiter wie er, drei davon Mädchen. Und Paulie hatte jedes Mal denselben Spruch vom Stapel gelassen: »Na, hast du eine flachgelegt?«, worauf Mark jedes Mal geantwortet hatte: »Wenn Ja, würdest du’s als Letzter erfahren.«
Aber heute hatte Marks Grinsen nichts mit Mädchen zu tun, sondern mit Frauen, die man in einem der Hinterzimmer des Day Spa flachlegen konnte, denn dieses Spa bot einiges an Extras, wenn man das nötige Kleingeld parat hatte. Wortwörtlich, denn Kreditkarten wurden dort nicht akzeptiert.
»Und?«, fragte Paulie, und als Mark nicht sofort antwortete: »Hat verdammt lange gedauert, Boyko. Was ist passiert? Hast du sie mehrmals rangenommen?«
»Sie hat mich zwanzig Minuten warten lassen«, sagte Mark. »Los, gehen wir. Mum hat gleich das Essen fertig.«
»Das ist alles?«, fragte Paulie. »›Sie hat mich zwanzig Minuten warten lassen‹? Ich musste mich mächtig ins Zeug legen, um dir den Termin heute zu besorgen, Junge. Der Laden brummt nämlich inzwischen ordentlich. Also, war’s gut? War sie ihr Geld wert? War sie jung? Schön? Oder war sie ausgemergelt? Zahnlos? Wie hat sie’s dir besorgt? Mit der Hand, dem Mund, der Zunge? Mit ’nem anderen Körperteil? Zwischen den Titten kommt auch gut, oder? Nein? Hmm. Unterm Arm? Oder hast du sie richtig genagelt?«
Mark hörte gar nicht mehr hin. Er ging in Richtung St. Augustine Tower, dessen Zinnen sich über dem Narrow Way erhoben. Vor dem Turm spielten ein paar Jugendliche eine fantasievolle Version von Kick-the-Can, ein Spiel, das Mark nicht mehr gesehen hatte, seit Handys, Textnachrichten und Spielkonsolen in Mode gekommen waren.
Paulie und Mark betraten den Friedhof der St.-John-of-Hackney-Gemeinde und gingen rechts an dem alten Turm vorbei über einen gepflasterten Weg in Richtung Sutton Place, wo Paulie mit seiner Familie in einem unansehnlichen Gebäude wohnte, das an die Architektur der späten Sechzigerjahre erinnerte, eckig und kantig, mit Panoramafenstern mit Blick auf nichts, was irgendwen interessieren könnte.
Paulie sagte: »Also, ich schätze, es war immerhin besser als Internetpornos. Natürlich auch teurer, klar, aber dafür fasst die Frau einen auch an. Das bringt’s. Das Zwischenmenschliche. Wenn Eileen nicht immer schon wüsste, was ich will, bevor ich es selber weiß, wär ich glatt mit dir gegangen. Aber meine Eileen ist ’ne Sexmaschine«, sagte er verträumt. »Sie läuft meistens unten ohne rum, und wenn die Kinder nicht da sind, hebt sie bei jeder Gelegenheit den Rock. Sie hat’s mir sogar schon mal in meinem Laden besorgt. Hab ich dir das erzählt? Direkt hinterm Tresen. Das war vor drei Tagen, und wir hatten sogar geöffnet. Ein Wunder, dass ich nicht wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde, bei dem Geschrei, das sie veranstaltet hat, als sie so richtig in Fahrt war.«
Mark sagte nichts. Er hatte schon öfter von Eileens sexuellen Possen gehört. Bis zum Erbrechen. Sie gingen schweigend nebeneinander her, bis Paulie fragte: »Kommt Pete auch zum Essen? Oder nur du?«
Mark wandte sich seinem Bruder zu, der stur geradeaus blickte, als gäbe es in der Ferne etwas Interessantes zu sehen. »Warum fragst du das? Du weißt doch, dass das im Moment nicht geht.«
»Und was ist mit dieser Greer? Oder wie hieß die noch? Petes Freundin? Die, mit der sie sich neuerdings dauernd trifft? Greer könnte doch mal ’ne Stunde oder so aushelfen. Sie wüsste, was zu tun ist, falls was passiert.«
»Pete lässt Lilybet nicht gern allein«, sagte Mark.
»Ich weiß, dass sie das nicht gern tut. Das wissen wir alle, Boyko.«
Mark sagte nichts. Es ging ihm beschissen, aber das lag nicht an Pete, die in Anbetracht der Umstände ihr Bestes gab. Er fühlte sich elend, weil er keine Ahnung hatte, wie die Zukunft für sie drei aussehen sollte, für Pietra, Lilybet und ihn.
Sie durchquerten den unteren Teil des Friedhofs. So kurz vor der Abendessenszeit war hier nicht viel los. Ein paar Leute saßen auf den Bänken, aber die starrten alle auf ihre Handys. Es gab auch ein paar Passanten, die ihre Hunde ausführten, und eine Frau in einem knallroten Kleid ging sogar mit ihrer Katze an der Leine spazieren, wobei allerdings nicht zu übersehen war, dass die Katze, die einen Schleichgang eingelegt hatte, bei dem ihr Bauch fast den Boden berührte, alles andere als begeistert war von der Aktion.
Am anderen Ende des Friedhofs duftete es nach Gebratenem. Der Geruch kam aus einem kleinen Imbiss direkt an der Friedhofsmauer, hinter der ein sehr multikulturelles Viertel begann. Entsprechend sah die Speisekarte des Imbisses aus, auf der sowohl verschiedene Burger als auch Crêpes, Samosas, Kebabs, Hähnchen-Shawarma und diverse vegetarische Gerichte angeboten wurden. Der Laden schien zu brummen. Die auf dem Rasen verteilten Picknicktische waren voll besetzt mit Leuten, die genüsslich aus Pappbehältern aßen. Andere standen an der Kasse an, um etwas zu bestellen, und in der Schlange daneben warteten Leute auf ihr Essen zum Mitnehmen. Die Gesichter drückten die typische Schicksalsergebenheit der Londoner aus, die es gewohnt waren, ständig für irgendetwas Schlange zu stehen: für den Bus, die U-Bahn, den Zug, ein Taxi, an irgendeinem Schalter.
»Nicht zu fassen, dass der Laden immer noch da ist«, bemerkte Paulie im Vorbeigehen. »Das müssen die Enkel der ursprünglichen Besitzer sein.«
»Wahrscheinlich«, sagte Mark. Sie ließen die Imbissbude hinter sich und verließen den Friedhof durch den Hinterausgang, durch den sie auf den Sutton Place gelangten. Paulie hob eine weggeworfene Zigarettenschachtel auf und steckte sie ein. Sie gingen nicht zu Paulie nach Hause, sondern zu dem Haus, in dem sie aufgewachsen waren, ein Stück die Straße hinunter, die von rußgeschwärzten Backsteinhäusern gesäumt wurde. Die zweistöckigen Reihenhäuser sahen alle gleich aus. In den etwas zurückgesetzten, gewölbten Eingängen befanden sich schwarz lackierte Haustüren mit Oberlicht, die Vorgärten waren von schmiedeeisernen Gittern eingefasst, pro Stockwerk gab es zwei Fenster. Nichts unterschied die Häuser voneinander, bis auf die Gardinen und die Türklopfer aus Messing, von denen kaum noch Originalexemplare vorhanden waren, weil die Leute sie über die Jahre nach ihrem Geschmack durch andere ersetzt hatten. An der Tür von Mark und Paulies Elternhaus diente ein Halloweenkürbis aus Messing als Türklopfer, und an den Fensterscheiben klebten bunte Tiere, die Paulies Kinder mit Fensterfarbe gemalt hatten. Der Fensterschmuck verlieh dem Haus einen gewissen Charme, solange man nicht versuchte zu ergründen, welche Tiere die Kinder hatten darstellen wollen.
Paulie öffnete die Haustür, die tagsüber fast nie abgeschlossen wurde, und rief: »Hallo! Die Eroberer sind da!«, dann bückte er sich, um seine Kinder zu umarmen, die auf ihn zugestürmt kamen. »Dad ist da!«, riefen die Kinder aufgeregt. »Mummy! Gran! Granddad, Dad ist da! Und er hat Onkel Boyko mitgebracht!«
Mark schaute sich nach seinem Patenkind um. Esme war seine Lieblingsnichte, aber zugleich versetzte ihm jede Begegnung mit ihr einen Stich, denn sie war nur zwei Wochen jünger als Lilybet.
Ein heilloses Durcheinander brach aus, als die Kinder ihren Dad bedrängten, ihnen zu zeigen, was er diesmal mitgebracht hatte. Paulie brachte ihnen regelmäßig Sachen aus dem Pfandleihhaus mit, die nicht ausgelöst worden waren, sich aber auch nicht wirklich verkaufen ließen. Diesmal handelte es sich um einen stumpfen, angelaufenen Zigarrenabschneider, den Paulie seinem ältesten Sohn überreichte. Dann mussten die Kinder raten, um was für einen Gegenstand es sich handelte. Jedes musste seinen Tipp auf einen Zettel schreiben und diesen Paulie geben, so lautete die Spielregel. Wer richtig riet, durfte den Gegenstand behalten.
Paulies und Marks Vater saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher, auf dem Kopf einen riesigen Kopfhörer, um den anderen Familienmitgliedern die Kopfschmerzen zu ersparen, die das laute Gedröhne aus der Glotze ihnen andernfalls bereitet hätte. Der Alte hob die Hand zum Gruß, die Söhne winkten zurück und gingen in die Küche. Dort rührte Eileen gerade in einem großen Topf, der auf dem Herd stand, während Floss Phinney, die Mutter der Brüder, einen Salat zubereitete.
Eileen ließ ihren Eintopf Eintopf sein und fiel ihrem Mann um den Hals. Paulie knetete ihre Pobacken, während sie sich küssten, als wären sie nicht stunden-, sondern jahrelang getrennt gewesen. Mark wandte sich ab und bemerkte, wie Floss ihn beobachtete. Sie lächelte ihn liebevoll an. Eileen und Paulie lösten sich voneinander, und Paulie drehte sich zum Herd um und hob den Topfdeckel an. Er schnupperte. »Mich laust der Affe! Du hast doch nicht etwa Eileen das Kochen überlassen, Mum? Das riecht wie was, das sie zusammenbrauen würde.«
Eileen schlug seine Hand weg. »Fang jetzt nicht damit an!«
Floss fragte Mark: »Pietra ist nicht mitgekommen, Boyko?«
»Sie kommt vielleicht später nach«, sagte Mark. Paulie öffnete den Kühlschrank und betrachtete, wie er es schon als Jugendlicher gemacht hatte, dessen Inhalt, als versuchte er, aus den Essensresten der letzten Tage die Zukunft zu lesen. Mark sagte leise zu seiner Mutter: »Sie hat ein Vorstellungsgespräch.«
»Wirklich?«, sagte Floss. »Das ist doch großartig, oder? Hoffen wir, dass es diesmal besser läuft.« Sie schaute an ihm vorbei zu Paulie hinüber, der immer noch sinnierend vor dem offenen Kühlschrank stand, und sagte: »Paulie, sei doch so lieb und mach uns einen Drink. Eileen, pass auf, dass er nicht wieder so mit dem Eis geizt, ich kann lauwarme Drinks nicht leiden.«
Irgendwo im Haus tobten die Kinder lautstark herum, und Paulie schalt sie auf dem Weg ins Wohnzimmer, wo der Getränkewagen stand. Er würde seiner Mutter ihren Lieblingscocktail machen, einen Gin Tonic mit wenig Tonic. Die Kinder wurden ein bisschen leiser – was wie üblich nicht lange anhalten würde –, und jetzt, wo es einen Moment lang etwas friedlicher im Haus war, schlüpfte Esme in die Küche. Sie näherte sich Mark und schob ihre Hand in seine. »Ich hab meine Matheprüfung bestanden, Onkel Mark.« Außer Marks Frau war sie die Einzige in der Familie, die ihn nicht Boyko nannte.
»Hey, super, Em«, sagte er.
»Lilybet würd bestimmt auch bestehen, wenn sie könnte«, sagte Esme. »Wahrscheinlich würde sie sogar eine bessere Note kriegen als ich.«
Marks Augen brannten ein bisschen. »Ja. Na ja«, sagte er. »Vielleicht irgendwann.«
Floss bat das Mädchen, den Tisch zu decken. Esme machte ihre Großmutter darauf aufmerksam, dass ihre Mutter das schon getan hatte. »Ach, wirklich?«, wunderte sich Gran. Dann lächelte sie ihre Enkelin liebevoll an und sagte: »Könntest du mich einen Moment mit deinem Onkel allein lassen?«
Esme schaute erst Mark, dann ihre Großmutter, dann wieder Mark an. »Ach, deswegen wolltest du, dass ich den Tisch decke, Gran«, sagte sie. »Das hättest du doch gleich sagen können.«
»Da hast du recht, mein Schatz. Manchmal vergesse ich, dass du schon ein großes Mädchen bist. Wird nicht wieder vorkommen.«
Esme nickte ernst. Nachdem sie die Küche verlassen hatte, sagte Floss zu Mark: »Wie viele sind es diesmal?«
»Bewerber?« Er zuckte die Achseln. »Ich hab sie nicht gefragt. Sie tut, was sie kann, Mum.«
»Sie braucht ab und zu auch mal Zeit für sich.«
»Sie nimmt sich jede Woche zwei, drei Stunden.«
»Na, das kann man ja wohl kaum als Zeit für sich bezeichnen. Sie übertreibt es wirklich. Wenn sie so weitermacht, ist sie mit fünfzig tot, und was soll dann aus Lilybet werden? Und aus dir?«
»Du hast ja recht.«
»Du musst ihr ins Gewissen reden, Boyko.«
Als hätte er das nicht schon hundertmal versucht. Als hätte er das nicht schon so oft versucht, dass seine Worte langsam ihren Sinn verloren. »Pete will einfach alles richtig machen bei Lilybet.«
»Das weiß ich doch. Und du auch. Aber ihr müsst auch an euch selbst denken.« Sie rührte in Eileens Eintopf, dann wandte sie sich wieder Mark zu, den Kochlöffel in der Hand. Sie musterte ihn auf eine Weise, wie nur eine Mutter es kann: Sie verglich im Stillen den Jungen, der er gewesen war, mit dem Mann, zu dem er geworden war. Offenbar gefiel ihr nicht, was sie sah. »Wann wart ihr das letzte Mal zusammen im Bett?«
So etwas hatte sie ihn noch nie gefragt. »Meine Güte, Mum …«, sagte Mark etwas pikiert.
»Raus mit der Sprache, Boyko«, sagte sie.
Sein Blick wanderte zum offenen Küchenfenster, wo in Tontöpfen die Kräuter wuchsen, die seine Mutter immer gern zur Hand hatte. Er war drauf und dran, sie zu fragen, wann sie sie zuletzt gegossen hatte. Das Basilikum ließ die Flügel hängen. »Letzte Woche«, sagte er und machte sich darauf gefasst, dass sie ihn der Lüge bezichtigte, denn es war tatsächlich gelogen. Er wusste nicht einmal mehr, wann sie das letzte Mal miteinander geschlafen hatten. Er wusste nur, dass es nicht Wochen, sondern Jahre her war. Aber das war nicht Petes Schuld. Selbst wenn sie da war, war sie nicht da, also welchen Zweck hätte es? Sie war mit allen Sinnen auf Lilybets kleines Zimmer geeicht, auf die Geräusche, die aus dem Babyfon kamen: das Zischen des Sauerstoffgeräts, das Schnaufen, das das Heben und Senken von Lilybets Brustkorb anzeigte. Man kann nicht mit einer Frau Sex haben, die gar nicht da ist, hätte Mark gern zu seiner Mutter gesagt. Es geht um mehr als Erregung, mehr als zwei Körper, die sich in wachsender Ekstase aneinander reiben. Wenn es nur das wäre, könnte es jeder mit jedem machen. Dann könnte eine anonyme »Masseurin« es einem besorgen. Verdammt, selbst eine Gummipuppe würde ausreichen. Aber darum ging es nicht. Zumindest war es nicht das, was er wollte. Das hatte ihm das Intermezzo im Massage Dreams heute einmal mehr bewusst gemacht. Orgasmus? Klar. Verbindung? Nein.
Floss schaute ihn mit traurigen Augen an. Aber sie sagte nur: »Ach mein Junge.«
»Passt schon«, antwortete er.
KINGSLAND HIGH STREETDALSTONNORTH-EAST LONDON
Um nicht aufzufallen, hatte Adaku Obiaka sich im Stil der Community gekleidet. Wo sie stand, fügte sie sich ins Straßenbild. Sie war anonym, eine, die man sofort vergaß oder gar nicht erst wahrnahm. Sie hatte im Eingang des Rio Cinema Posten bezogen, wo der Duft nach Popcorn und Kaffee – was für eine seltsame Mischung, dachte sie – sich gegen Gerüche von der anderen Straßenseite durchzusetzen versuchte. Dort blies das Taste of Tennessee widerliche Geruchswolken aus Frittierfett, Brathähnchen, Rippchen und Burgern in die Luft.
Sie stand jetzt schon seit fast drei Stunden dort und beobachtete das allgemeine Treiben in der Straße und die Abwesenheit desselben in zwei heruntergekommen wirkenden Wohnungen über dem ehemaligen Kingsland Toys, Games and Books, dessen violettes Firmenschild mit Buchstaben in zwölf verschiedenen Neonfarben immer noch an der Fassade prangte. Der Spielzeugladen existierte schon lange nicht mehr, und obwohl ein Schild mit der Aufschrift »Demnächst Neueröffnung« im Schaufenster hing, standen die Räume seitdem leer.
Das leere Ladenlokal lag genau zwischen dem Taste of Tennessee und dem Vape Superstore, und wie die meisten Geschäfte in der Straße verfügte es über zwei Eingänge. Durch die eine Tür gelangte man in den Laden, durch die andere, die stets abgeschlossen war, zu den darüber gelegenen Wohnungen. Wenn man denn einen Schlüssel besaß. Sechs klapprige Fenster befanden sich über dem Laden, zwei auf jeder Etage. In den obersten Fenstern brannte helles Licht hinter schmuddeligen Gardinen. In der mittleren waren die Jalousien heruntergelassen, und dahinter schien es dunkel zu sein. In den Fenstern im ersten Stock spiegelte sich die Kinoreklame, die für einen der zahllosen düsteren Sci-Fi-Filme warb, in dem das Universum von einer jugendlichen Heldin gerettet werden musste, die natürlich weiß und blond war.
Während der drei Stunden, die Adaku jetzt schon dort stand, hatte niemand das Gebäude durch die verschlossene Tür betreten oder verlassen. Aber man hatte ihr versichert, dass jemand aufkreuzen würde, und deswegen harrte sie unbeirrt auf ihrem Posten aus, obwohl ihr der Magen knurrte. Es hatte sie schon viel zu viel Zeit und Energie gekostet, die Praxis namens Women’s Health of Hackney zu finden. Sie hätte natürlich an einem anderen Tag noch einmal herkommen können, aber das Licht im obersten Stockwerk sagte ihr, dass jemand dort war. Sie musste nur warten, bis derjenige herauskam, und wenn es bis zum nächsten Morgen dauerte.
Als Adaku anfangs im Eingang des Kinos gestanden hatte, waren nur das Geschnatter von Passanten, Babygreinen und das Jauchzen von Kindern zu hören gewesen, die auf ihren Rollern vorbeiflitzten. Seitdem war die Geräuschkulisse immer lauter geworden. Verkehrslärm erfüllte die Straße, und in irgendeiner Wohnung übte jemand Geige. Vor einem Snappy Snaps, nur wenige Meter von einem Wettbüro entfernt, quälte ein Straßenmusikant sein Akkordeon, zweifellos in der Hoffnung, dass ein Wettkunde heute seinen Glückstag hatte und ihm ein paar Pfund in den Hut werfen würde.
Adaku wünschte, sie hätte sich ein Sandwich eingesteckt. Selbst mit einem Apfel oder einer Flasche Wasser wäre sie jetzt zufrieden. Aber an Proviant hatte sie nicht gedacht. Sie hätte auch keine Zeit dafür gehabt. Auf eine Textnachricht hin – »Sie ist da« – war sie in West Brompton aus der U-Bahn gesprungen und zum Rio Cinema gelaufen, und solange niemand aus der Tür des Gebäudes gegenüber kam, würde nur eine weitere Textnachricht sie dazu bewegen, ihren Posten zu verlassen.
Sie stand bereits drei Stunden und zehn Minuten da, als ihre Geduld endlich belohnt wurde. Das Licht im obersten Stockwerk ging aus, und eine Minute später wurde die Tür geöffnet, die zu den Wohnungen über Kingsland Toys, Games & Books führte. Eine Frau kam heraus. Im Gegensatz zu Adaku war sie nach englischer Mode gekleidet. Sie trug eine enge Hose, einen dünnen rotgestreiften Pullover mit U-Boot-Ausschnitt, auf dem Kopf eine Baseballmütze, die sie sich keck in die Stirn gezogen hatte, und über der Schulter eine große Einkaufstasche.
Wahrscheinlich hatte die Frau sich am Morgen, bevor sie ihren Arbeitstag angefangen hatte, in einer dieser Wohnungen umgezogen. Für die Arbeit kleidete sie sich sicherlich professioneller. Um ihre Kundinnen zu beruhigen, zog sie vermutlich Sachen an, die signalisieren sollten: Alles wird gut. War es nicht so, dachte Adaku mit einem verächtlichen Kopfschütteln, dass verzweifelte Menschen bereit waren, alles zu glauben, was man ihnen auftischte?
Die Frau ging mit schnellen Schritten in Richtung Bahnhof. Was vermuten ließ, dass sie nicht in der Nähe wohnte. In dem Fall musste Adaku handeln, bevor ihr Opfer in den Zug stieg. Rasch überquerte sie die Straße und lief hinter der Frau her. Schon bald hatte sie sie eingeholt. Sie hakte sich bei ihr unter und sagte: »Ich muss mit Ihnen reden.«
Die Frau sah sie verblüfft an. Dann fragte sie: »Wer sind Sie? Was wollen Sie?«, und versuchte sich loszureißen. Ihr Akzent verriet, dass sie in England geboren war.
»Wie gesagt, ich muss mit Ihnen reden. Es dauert nicht lange«, antwortete Adaku. »Man hat mir den Namen der Praxis genannt. Er lautet Women’s Health of Hackney, richtig?«
»Ich lasse mich von niemandem einfach so auf der Straße aufhalten. Was wollen Sie von mir?«
Adaku schaute sich um, dann sagte sie leise: »Mir wurde nur der Ort genannt. Deshalb ist mir gar nichts anderes übrig geblieben, als mich Ihnen auf diese Weise zu nähern. Ich habe keine Telefonnummer, konnte Sie also nicht anrufen. Es ging nicht anders. Werden Sie mit mir reden?«
»Worüber? Wenn Sie glauben, dass Sie einfach so auf der Straße eine medizinische Beratung bekommen, dann irren Sie sich.«
»Ich will nur fünf Minuten von Ihrer Zeit. Ein Stück die Straße hinunter ist ein Costa Coffee. Da können wir hingehen.«
»Sagen Sie mal, hören Sie schlecht? Ich hab Ihnen doch gerade gesagt …«
»Ich habe Geld.«
»Wofür? Ist das ein Bestechungsversuch? Was wollen Sie überhaupt?«
»Ich habe Geld«, wiederholte Adaku. »Hier in meiner Tasche. Ich gebe es Ihnen.«
Die Frau lachte. »Sie sind verrückt. Ich kenne Sie nicht mal, und auf der Straße rede ich auf keinen Fall über medizinische Probleme.«
»Ich habe fünfzig Pfund. Später kann ich Ihnen noch mehr geben. So viel Sie wollen.«
»Ach ja, so viel ich will?« Die Frau musterte Adaku eine ganze Weile, dann schaute sie sich nach allen Seiten um, wie um sich zu vergewissern, dass das kein Trick war. Schließlich sagte sie: »Also gut. Zeigen Sie mir die fünfzig.«
Adaku langte in ihre Umhängetasche, die eher einem Einkaufsbeutel glich als einer Handtasche, in der man Dinge sicher aufbewahren konnte. Sie zog einen zerknitterten Umschlag hervor, den der ringförmige Abdruck einer Kaffeetasse zierte. Den öffnete sie und nahm das Geld heraus, das die Frau ihr blitzschnell aus der Hand riss. Es waren nur wenige Geldscheine, aber die Frau zählte sie sehr genau.
Dann sagte sie: »Also gut, fünf Minuten. Falls Sie mehr als diese fünf Minuten von meiner Zeit wollen, kostet das noch mal zweihundertfünfzig.«
Adaku fragte sich, wie sie zweihundertfünfzig Pfund auftreiben und gleichzeitig ihre Pläne geheim halten sollte. Außerdem fragte sie sich, was ihr das alles bringen sollte, wo sie sich doch eigentlich nur Zutritt zum Allerheiligsten der Räumlichkeiten über Kingsland Toys, Games & Books verschaffen wollte. Sie fragte: »Und was bekomme ich für die dreihundert Pfund?«
Die Frau runzelte die Stirn. »Was Sie bekommen?«, fragte sie. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
»Sind die dreihundert eine Anzahlung?«
»Worauf? Das ist eine gynäkologische Praxis. Wir behandeln Frauen, die gesundheitliche Probleme haben. Dafür werden wir bezahlt. Sobald Sie das Geld haben, können Sie zu uns in die Sprechstunde kommen. Und bringen Sie Ihre Patientenakte mit.«
»Wozu brauchen Sie die?«
»Sie wollen doch eine Behandlung, oder? Haben Sie mich nicht deswegen angesprochen? Oder hatte das einen anderen Grund?«
»Das Problem ist, dass ich nicht so viel im Voraus bezahlen kann.«
»Tja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. So arbeiten wir nun einmal.«
»Aber können Sie mir garantieren …«
»Hören Sie. Ihre fünf Minuten sind um. Und hier auf dem Gehweg rede ich nicht weiter mit Ihnen. Sie haben mir fünfzig Pfund gegeben. Den Rest können Sie bezahlen, wenn Sie das Geld haben.«
Adaku spürte, wie ihr der Schweiß über den Rücken lief. Doch sie nickte. Dann sagte sie: »Ich kenne Ihren Namen nicht.«
»Den brauchen Sie auch nicht zu kennen. Sie werden mir ja keinen Scheck ausstellen.«
»Wie soll ich Sie denn ansprechen?«
Die Frau zögerte, musterte sie misstrauisch. Dann entschied sie sich. Sie nahm eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche und reichte sie Adaku.
»Easter«, sagte sie. »Easter Lange.«
25. Juli
_________________
THE MOTHERS SQUARELOWER CLAPTONNORTH-EAST LONDON
Mark Phinney wurde von der Stimme seiner Frau geweckt. Sie murmelte im Schlaf Liebling, mein Liebling, und ihre Worte hatten einen Traum entfacht: ihr endlich wieder williger Körper unter ihm und er so erregt, dass es schmerzte. Aber als er aus dem Traum erwachte, wurde ihm klar, dass der Schmerz nur von seiner Morgenlatte kam und dass Petes Worte aus dem Babyfon krächzten und Lilybet galten, die sie im Nebenzimmer beruhigte. Während Mark sich unter dem dünnen Laken auf die Seite drehte – die dünne Decke hatten sie im Lauf der Nacht wegen der Hitze weggestrampelt –, begann Pete leise zu singen. Pete hatte ein Talent dafür, aus allem ein Lied zu machen. Sie sang nie zweimal dieselbe Melodie, und Reime schüttelte sie einfach so aus dem Ärmel.
An den Hintergrundgeräuschen erkannte Mark, was Pete beim Singen tat: Sie wechselte Lilybets Sauerstoffflasche, wie immer vor dem Wickeln. Er wartete, bis das Wickellied ertönte, dann schlug er das Laken zurück und sprang aus dem Bett, während Pete fröhlich sang: »Oje, das stinkt ja fürchterlich, was mir da in die Nase sticht! O weh, o weh …«
Mark musste lächeln. Wie sehr er seine Frau doch bewunderte. Ihre Liebe zu Lilybet hatte in all den zehn Jahren, seit ihre Tochter auf der Welt war, nicht nachgelassen. Sie kümmerte sich liebevoll um das Mädchen und bemühte sich unermüdlich darum, ihr ein besseres Leben zu ermöglichen als das, wozu die Katastrophe bei ihrer Geburt sie verdammt hatte. Seine eigene Zuneigung zu dem Kind hielt sich in Grenzen, und das machte ihn todtraurig.
Sein Handy bimmelte auf dem Nachttisch. Eine Nachricht von Paulie: Heute Abend Bier, Boyk? Er konnte sich schon denken, was Paulie mit Bier meinte. Er antwortete: Werde hier gebraucht. Trotzdem danke. Paulie antwortete mit einem Emoji, das den Daumen hochreckte.
Mark betrachtete das Display zu lange. Wenn er das Handy zurück auf den Nachttisch gelegt hätte, wäre nichts passiert, das sollte ihm später klarwerden. Dann wäre nicht ein Gedanke auf den anderen gefolgt, und dann wäre er nicht in Versuchung geraten. Aber er war nicht schnell genug. Beides war sofort da: der Gedanke und die Versuchung. Er scrollte durch seine Kontakte bis zu den drei Nummern, die ohne Namen gespeichert waren. An eine Nummer schickte er eine Nachricht: Denk an dich.
Er wartete auf eine Antwort. Fragte sich, ob es noch zu früh am Tag war. Aber eine Minute später bimmelte sein Handy. Auf dem Display erschien ein Link. Er klickte ihn an, und im nächsten Augenblick ertönte ihr Song. Zugleich wusste er, dass es völlig bescheuert war, etwas zu haben, das sie »unseren Song« nannten. Andererseits war der Refrain des Stücks mehr als passend: »And I never want to fall in love … with you«, gesungen von einer so tiefen, sanften Stimme, dass es eher wie eine Meditation klang.
Mark verstand, warum sie ihm den Link schickte. Sie sehnte sich genauso nach ihm, wie er sich nach ihr sehnte, und ihrer beider Qual drückte die absolute Unmöglichkeit ihrer Situation aus. Mit geschlossenen Augen hielt er sich das Handy ans Ohr und lauschte der Musik.
Während er noch überlegte, wie er antworten sollte, fragte Pietra, die ins Schlafzimmer gekommen war: »Ist es was Dienstliches?«
Er fuhr herum und sah, dass sie schon eine ganze Weile auf sein musste, denn sie war bereits komplett angezogen: Jeans, Turnschuhe, keine Strümpfe, weißes T-Shirt. Ihre Uniform, wie er es im Stillen nannte, und sie änderte sich nur, wenn das Wetter kühler wurde. Dann tauschte sie das weiße T-Shirt gegen eine weiße Bluse, die sie gewöhnlich mit hochgekrempelten Ärmeln trug. Wenn er ihr sagte, sie solle sich doch mal was Neues zum Anziehen kaufen, antwortete sie jedes Mal: »Schatz, ich brauche nichts anderes.« Was im Prinzip stimmte, da sie fast nie die Wohnung verließ, und wenn sie es doch tat, dann meistens mit Lilybet in ihrem schweren Rollstuhl und dem Notfall-Sauerstoffbeutel an einem Halter hinter ihr. Wenn er vorschlug, mal auswärts essen oder ins Kino zu gehen, nur sie beide – schließlich konnte Greer doch mal ein paar Stunden nach Lilybet sehen, oder? –, antwortete sie jedes Mal: »Ich bitte sie so ungern, Schatz. Sie macht schon so viel.«
Als Pete, die immer noch in der Tür stand, noch einmal fragte: »Mark? Ist es was Dienstliches?«, merkte er, dass er ihr beim ersten Mal nicht geantwortet hatte.
Er sagte: »Besprechung in Westminster«, was sogar stimmte. Dann fügte er hinzu: »Jemand meinte, mich daran erinnern zu müssen.«
Sie lächelte ihn liebevoll an. »Die kennen dich wohl schlecht, was?«
Als sie sich zum Gehen wandte, sah er, dass sie sich das T-Shirt mit Lilybets Kacke bekleckert hatte. Er sagte ihren Namen und deutete mit dem Kinn auf den Fleck. Sie schaute an sich hinunter und rief aus: »Gott, wie eklig!« Dann lachte sie und lief ins Bad, um den Fleck auszuwaschen.
Er hörte Lilybet über das Babyfon. Offenbar hantierte sie mit dem Handy, das über ihrem Pflegebett hing. Im nächsten Augenblick begann der Fernseher zu dröhnen. Lilybet schrie auf. »Ich sehe nach ihr!«, rief er, zog sich schnell die Hose an und ging ins Kinderzimmer.
Im Zimmer roch es unangenehm, und er öffnete das Fenster, das auf den Mothers Square hinausging, einen ovalen Platz, der, auch wenn er längst nicht so prachtvoll war, an den Royal Crescent in Bath erinnerte. Eins von den unter den Pergolas auf dem Platz geparkten Autos wurde angelassen, und im selben Augenblick kam Mrs Neville aus dem Haus gerannt und wedelte mit der Butterbrottüte ihres Mannes. Sie lief zum Auto, reichte ihrem Mann das Pausenbrot durchs Fenster und hastete, das Nachthemd am Hals zusammenhaltend, zurück ins Haus.
Mark wandte sich vom Fenster ab. Zwischen dem Pflegebett, dem klobigen Rollstuhl, den Sauerstoffbehältern, der Kommode und dem alten Sessel seines Vaters konnte man sich in dem Zimmer kaum bewegen. Außerdem waren da noch der Stapel Windelkartons, der Mülleimer für gebrauchte Windeln und all das andere Zeug, das man so brauchte, wenn man ein Baby hatte. Nur dass Lilybet kein Baby war, sondern ein Kind, das immer nur größer wurde und die einzige Konstante im Leben ihrer Eltern darstellte. Sie konnte sehen und hören, aber nicht sprechen. Sie konnte ihre Beine bewegen, aber nicht gehen. Mark hatte keine Ahnung, ob sie ihn verstand, wenn er mit ihr sprach.
Sie brabbelte etwas, als er sich dem Bett näherte. Er beugte sich über sie, wischte ihr mit einem feuchten Lappen über das Gesicht und fragte: »Hoch?« Sie gurgelte. Er klappte die Rückenlehne hoch und sagte: »Na, was hast du denn heute vor, Kleines? Eine Geburtstagsparty? Einen Zoobesuch? Einen Besuch im Wachsfigurenkabinett? Geht mein Mädchen heute in die Bibliothek? Oder will es sich vielleicht lieber ein Kleid für die nächste Party kaufen? Mädchen in deinem Alter gehen doch auf Geburtstagspartys. Wurdest du schon mal zu einer eingeladen? Wen möchtest du zu deiner Party einladen? Esme? Esme kommt bestimmt gern.«
Als Antwort kam ein Gurren. Er schob ihr das dünne Haar hinter die Ohren und gab sich einen Moment lang dem Gedanken Was wäre wenn hin. Das war wesentlich angenehmer, als sich die schreckliche Frage zu stellen: Wie soll das bloß weitergehen?
»Das alles tut mir so leid«, sagte Pete. Sie stand in der Zimmertür und drückte ein Handtuch auf die Stelle an ihrem T-Shirt, wo sie die Kacke ausgewaschen hatte.
Er wandte sich von seiner Tochter ab. Am Gesichtsausdruck seiner Frau erkannte er, dass sie alles gehört hatte. »Es ist niemandes Schuld«, sagte er.
»Aber sie ist kein ›Es‹«, sagte Pete. »Jedenfalls nicht für mich.«
Er richtete sich auf. »Du weißt, dass ich damit nicht Lilybet gemeint habe.«