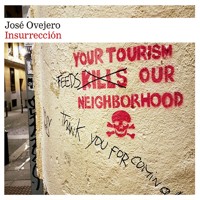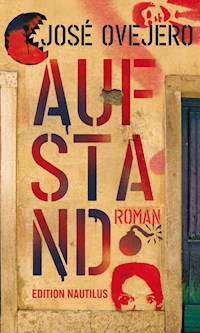
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ana ist siebzehn und rebelliert gegen die zerstörerische Welt um sie herum. Enttäuscht von einer Mutter, die glaubt, mit Taschen aus recycletem Material die Welt retten zu können, und einem Vater, der in seinem immer prekäreren Job beim Radio resigniert, bricht sie die Schule und den Kontakt ab. Sie zieht in ein besetztes Haus in Lavapiés, einem Viertel von Madrid, wo soziale Zentren und linksalternative Projekte Anas Vorstellung einer gesellschaftlichen Utopie ein wenig näher rücken. Ihren Vater Aitor, bei dem Ana mit ihrem Bruder seit der Scheidung von Isabel gelebt hat, wirft das völlig aus der Bahn – ihm den Rücken zu kehren, hatte er sie doch gerade wegen ihres kritischen Widerstandsgeistes immer bewundert. Da er zunächst nicht weiß, wo Ana sich aufhält, engagiert er gemeinsam mit Isabel einen Detektiv, der Aitor aber schließlich mit seinem Wissen erpresst. Denn Ana ist Teil einer anarchistischen Gruppe, die gegen Gentrifizierung und den Wegfall von Wohnraum kämpft. Als Ana und der Anführer Alfon sich weiter radikalisieren und Gewalt ins Spiel kommt, springt ein Großteil der Gruppe ab … Mit geschäftem Blick für komplexe Verhältnisse, poetisch und temporeich, zeichnet Ovejero die Spannungen der Gesellschaft im Innern einer Familie nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSÉ OVEJERO, geboren 1958 in Madrid, ist Autor zahlreicher Romane, Kurzgeschichten, Essays, Theaterstücke und Gedichte. 2013 wurde er mit dem Premio Alfaguara de Novela ausgezeichnet. Auf Deutsch erschien bereits 1997 und erneut 2015 sein Roman Erzähl mir noch einmal von Havanna (Anoranza del héroe).
PATRICIA HANSEL, geboren 1965 in Stade, studierte Theaterwissenschaften und Germanistik an der FU Berlin und lebt seit 2008 in Barcelona. Sie arbeitet in einem Buchverlag und übersetzt kürzere fiktionale und Sachtexte. Aufstand ist ihre erste Romanübersetzung.
Die Originalausgabe des vorliegenden Buches erschien unter dem Titel Insurrección bei Galaxia Gutenberg, Barcelona 2019
© José Ovejero
Editorische Notiz:
Zitat auf Seite 259: Don DeLillo, Unterwelt. Aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1998 (Originalausgabe New York: Scribner, 2007).
Quelle der in Kapitel 24 genannten Daten: Nick Srnicek/Alex Williams, Die Zukunft erfinden. Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit.
Aus dem Englischen von Thomas Atzert. Berlin: Tiamat 2016 (Originalausgabe London: Verso 2015).
Bildnachweise:
Seite 226: © Anthony Phelps / REUTERS.JPG
Seite 227: © 2009 TeleGeograph
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2020
Deutsche Erstausgabe September 2022
Umschlaggestaltung:
Olga Machverkova
Porträt des Autors Seite 2:
© Isabel Wagemann
ISBN EPUB 978-3-96054-297-1
INHALT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
Vorbemerkung der Übersetzerin zum Hintergrund der Haus- und Wohnungsbesetzungen in Spanien:
Der spanische Begriff ocupa bedeutet »illegaler Besetzer« bzw. »illegale Besetzerin«. Allerdings hat sich in Spanien die Unterscheidung zwischen ocupa mit c (orthografisch korrekte Schreibweise) und okupa mit k durchgesetzt.
Als okupas verstehen sich diejenigen, die Häuser und Wohnungen nicht nur in Notlagen, sondern auch aus einem politischen Engagement gegen Spekulation, Wohnungsnotstand und dem Wunsch nach einem anderen Zusammenleben heraus besetzen. Dazu gehört auch die Nutzung von leerstehenden Gebäuden als soziale oder kulturelle Zentren (Centro Social Okupado). Als ocupas werden hingegen diejenigen bezeichnet, die ohne spezifisch politische Forderungen leerstehenden Wohnraum besetzen, weil sie sonst keine Wohnung finden oder die Miete nicht bezahlen können. Diese Form der Besetzungen hat gerade nach der Immobilienkrise 2008 stark zugenommen. Oft sind es Familien, Immigranten oder Studierende, die Wohnungen, auch in leerstehenden Neubauten, oder Reihenhäuser in den Randgebieten der Städte besetzen.
Auch José Ovejero verwendet diese Unterscheidung. In der vorliegenden Übersetzung ergibt sich der Unterschied entweder aus dem Zusammenhang oder er wird ausdrücklich thematisiert, dann werden die spanischen Ausdrücke verwendet.
Schreibweisen mit k statt mit c haben sich in der ganzen alternativen Szene seit den 80er Jahren verbreitet, für politische Begriffe oder auch in den Namen vieler Punkgruppen. Die baskische Punkgruppe Eskorbuto, die in Kapitel 28 erwähnt wird, trägt dieses k auch in ihrem Namen; die korrekte spanische Schreibweise wäre escorbuto, dt. Skorbut.
1
Aitor konnte sich an kein Ereignis in seinem Leben erinnern, das ihm so nahegegangen wäre wie das Verschwinden seiner Tochter. Obwohl Ana nach mehrmaliger Ankündigung, vielmehr Drohung, das Haus freiwillig verlassen hatte, fühlte Aitor die gleiche Verzweiflung wie jemand, der bei einem Unfall oder einer Katastrophe einen geliebten Menschen verloren hat. Dass er selbst sich niemals eigene Kinder gewünscht hatte, tröstete ihn nicht.
Er hatte vermutet, dass er welche haben würde, nicht so sehr aus freien Stücken, eher, weil es ihm als die logische Konsequenz seines Wunsches erschien, mit einer Frau zu leben. Als Jugendlicher hatte er wohl von einem wilden Leben ohne Bindungen geträumt, einem Nomadenleben, in dem er sich spontan immer wieder für neue Orte und Menschen entscheiden könnte, auch für die Dauer seiner Beziehungen, aber sehr bald wurde ihm klar, dass er eine Frau brauchte, gelassen und liebevoll, die ihm helfen würde, eine Unruhe zu besänftigen, die ihn, obwohl sie fast nie nach außen drang, mit der Vorahnung eines unmittelbar bevorstehenden Unglücks in Schach hielt, eine Bedrohung, für die er gewappnet sein musste. Diese Frau würde ohne Zweifel Kinder haben wollen – er vermutete, dass gelassene, liebevolle Frauen eine Familie anstreben –, und er würde es hinnehmen, wie er es hinnehmen würde, ein Haus zu kaufen, eine Hypothek aufzunehmen, eine sichere Anstellung zu haben und an den Wochenenden ihre Eltern zu besuchen, und selbstverständlich an Weihnachten. Diese Aussicht erschien ihm etwas lästig, aber nicht sehr besorgniserregend, so wie die Notwendigkeit einkaufen zu gehen oder das Auto zu waschen, Aufgaben, die keinen Spaß machen, aber die auch nicht so unangenehm sind, dass sie einem den Tag verderben, eine Routine, eine beruhigend vorhersehbare Abfolge von Tätigkeiten, die ihm die Struktur geben würde, um seine Ängste in den Griff zu bekommen. Aber wenn ihn jemand gefragt hätte, ob er, unabhängig davon, was andere wollen, sich Kinder wünschte, hätte er lächelnd geantwortet, dass er gern einen Hund hätte. Einen Hund, dachte er, ein Hund hätte genügt, um diese Rastlosigkeit zu vertreiben, die dieses Summen in seinem Innern verursachte.
Wahrscheinlich hatte seine Distanz zu Kindern etwas mit der Zeit zu tun, als er selbst Kind war, sein Vater Anton verbrachte als Ingenieur in der Erdölförderung die meiste Zeit außer Haus und außer Landes, so dass sein Verhältnis zu ihm eher dem zu einem entfernten Verwandten glich, und das zu seiner Mutter Maika war auch nicht gerade von überströmender Herzlichkeit geprägt. Nicht, dass sie ihn schlecht behandelt oder vernachlässigt hätte, aber sie beschränkte sich darauf, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, wie jemand, der eine unumgängliche Arbeit verrichten muss, die weder befriedigend noch unangenehm ist, so halt, wie ein Auto zu waschen oder einkaufen zu gehen. Sie hätte lieber ein Mädchen bekommen. Sie war sogar absolut davon überzeugt, dass ein Mädchen in ihr heranwuchs, nichtsdestotrotz hatte sie vierundzwanzig Stunden vor der Geburt noch nicht entschieden, wie es denn heißen sollte, eine Entscheidung, die sie allein treffen musste, da ihr Mann schon seit drei Monaten hundert Kilometer vor der Küste Norwegens arbeitete und sie nie die Gelegenheit gefunden hatten, es zu besprechen.
Aitor hatte Glück, dass er nicht als Mädchen zur Welt kam.
Wenn seine Mutter sich noch nicht für einen Namen entschieden hatte, dann deshalb, weil sie alles verabscheute, was spanisch oder baskisch klang. Maikas Vater war ein Alkoholiker gewesen, der seine Frau mit der gleichen Wut misshandelte, wie er die Unabhängigkeit des Baskenlandes verteidigte, und der alle Spanier ohne Ausnahme als weibisch und gottlos betrachtete, und Maika erinnerte sich schon nicht mehr, ob ihr Vater so viele Monate im Gefängnis verbracht hatte, weil er ihre Mutter wieder einmal verprügelt hatte oder wegen seiner politischen Aktivitäten in dem anarchistischen Zirkel, dem er angehörte. Maika hieß in Wirklichkeit Maria del Carmen, aber ihr Vater verbot ihr, sich so zu nennen, und zwang ihr diese Verkürzung auf, die ihm zufolge im baskischen Vaterland eher verwurzelt ist. Die Tochter, obwohl sie die Reden des Vaters von der Überlegenheit der Bizkainos, die weit über den Guipuzcoanos und selbstverständlich über den Alavesos standen, verachtete, konnte ihre Abneigung gegenüber den Spaniern nicht überwinden, und als sie sich in Madrid niederließ, brachte sie es nicht fertig, sich wieder Maria del Carmen zu nennen oder wenigstens Mari Carmen oder kurz und knapp Carmen; obwohl sie sich neuen Bekannten zunächst so vorstellte, nannte sie sich aus Gewohnheit oder aus einem schwer erklärbaren Stolz heraus bald wieder Maika. Deshalb wollte sie auch für ihr Kind keinen der üblichen Namen aus einer der beiden Traditionen, die ihr unbequem waren wie ein Paar zu enge Schuhe, und sie hatte mit der Möglichkeit gespielt, ihrer Tochter einen indianischen Namen zu geben, wie Pocahontas oder Malinche, aber eine Radiosendung weckte eine andere Vorliebe. Aitor kam am 6. August 1970 zur Welt, durch eine eingeleitete Geburt, da die Schwangerschaft bereits auf die 42. Woche zuging, und in ihrem Bett im Krankenhaus hörte Maika im Radio ihrer Zimmernachbarin, dass man des Abwurfs der Bombe auf Hiroshima vor 25 Jahren gedachte, und vielleicht durch die Schmerzen und die Verlassenheit verwirrt (niemand aus der Familie war in diesem Moment bei ihr) oder später durch die Betäubung, die für den Kaiserschnitt notwendig war, entschied sie, dass ihre Tochter Hiroshima heißen sollte. Der Name erschien ihr wohlklingend, exotisch und originell zugleich, genau passend für einen so außergewöhnlichen Menschen, wie ihre Tochter einer werden würde. Als man ihr zeigte, dass es sich um einen Jungen handelte, bestand sie zunächst darauf, eine Tochter geboren zu haben, aber sie musste schließlich, wenn sie auch nicht den Beteuerungen des Chirurgen und der Krankenschwestern glaubte, doch die Offensichtlichkeit eines Penis akzeptieren, der ihr im Vergleich zu einem so kleinen Kind etwas überdimensioniert erschien, und als Stunden später eine Frau im weißen Kittel sie fragte, wie das Neugeborene heißen sollte, wusste sie nichts zu antworten. Wie heißt denn der Vater?, wollte die Ärztin oder Schwester ihr helfen. Aitor, antwortete Maika, und gab den Namen ihres eigenen Vaters an, vielleicht verhaspelte sie sich, weil er ähnlich klang wie der Name ihres Mannes, doch obwohl sie das Missverständnis später hätte ausräumen oder einen anderen Namen hätte wählen können, beließ sie es aus Gleichgültigkeit oder Erschöpfung dabei, so dass der Junge schließlich einen baskischen Vornamen und einen kastilischen Nachnamen bekam, Aitor Sánchez.
Eines der wenigen Male, bei denen Maika mit ihrem Sohn über ihre Schwangerschaft und Geburt sprach, er war noch klein, erzählte sie ihm lachend, dass er in Wirklichkeit Hiroshima hätte heißen sollen, zu Ehren der Stadt, die von der Atombombe dem Erdboden gleichgemacht worden war. Ihm war plötzlich zum Heulen zumute, und er hätte nicht sagen können, ob wegen der ungewohnten Heiterkeit seiner Mutter oder weil es ihm wehtat, dass sie ihn nicht lieben konnte, genau ihn, anstatt eines Mädchens oder irgendeines anderen Jungen. Er überwand sich sie zu fragen, warum sie so überzeugt davon gewesen war, ein Mädchen zu bekommen, und nach kurzem Nachdenken erklärte sie, dass es eine sehr einfache Schwangerschaft gewesen sei, fast ohne Anfälle von Übelkeit, und er habe sie nie getreten, selten habe er sich überhaupt bewegt, so dass sie seine Anwesenheit oft gar nicht bemerkt habe, fast, als hätte der Fötus niemals die Wände der Gebärmutter auch nur gestreift. Jungs treten dich, bevor sie aus deinem Körper herauskommen, erläuterte sie, obwohl sie das gar nicht wissen konnte. Aitor malte sich aus, wie ein Astronaut in seiner Mutter zu schweben, sich um sich selbst drehend, langsam, mit dem Raumschiff nur durch ein Kabel verbunden, das verhinderte, dass er für immer in der ihn umgebenden Schwärze verloren ging.
Aitor hatte keine Geschwister: Sein Vater entschied sich, in Brasilien zu bleiben, wo er mehrere Monate in der Erdölförderung für Petrobras an den Ufern des Amazonas gearbeitet hatte (er schickte ein paar Fotos vom Dschungel und von einem toten Tapir, dem ein Bein fehlte), und reichte die Scheidung in Abwesenheit ein. Maika akzeptierte widerstandslos. Das letzte Mal sah Aitor seinen Vater auf einem Foto in El País. Der Artikel schilderte ein Gerichtsverfahren, das 2003 in Chevron eröffnet wurde und in dem es um die Ölpest im Nationalpark Yasuní in Ecuador ging. Sein Vater lächelte inmitten der Beschuldigten; mit den wenigen Haaren, die auf einer durch das Blitzlicht glänzenden Glatze klebten, einem Jackett mit zu kurzen Ärmeln und der dicken Brille wie der eines Professors für irgendeine tote Sprache, sah er älter aus, als er hätte sein können. Trotz des Lächelns wirkte er verloren, unschlüssig, unbehaglich, und die gelockerte Krawatte und der aufgeknöpfte Kragen des Hemdes vermittelten den Eindruck, als hätte man ihn gerade von einem Fest geholt, auf dem er zu viel getrunken hatte, um ihn dann vor den Richter zu führen. Aitor hatte das Foto nicht seiner Frau gezeigt und auch Maika nicht gefragt, ob sie es gesehen hatte.
Seine Mutter heiratete nicht wieder und sie hatte seines Wissens auch keine länger andauernden Beziehungen zu anderen Männern. Sie brachte sich am selben Tag um, an dem Aitor 29 Jahre alt wurde, wenige Minuten nachdem sie ihn angerufen hatte, um ihm zu gratulieren und ihm zu sagen, dass sie vergessen hätte, ihm ein Geschenk zu kaufen.
Vielleicht hatte Aitor sich nie Kinder gewünscht, weil er kein attraktives Vorbild für den Umgang mit ihnen kannte, aber seine Erfahrungen waren auch nicht so konfliktbeladen, dass er sich entschieden dagegen ausgesprochen hätte. Sie waren in seinem Programm nicht vorgesehen, auch wenn sie schließlich auftauchten, wie Falten oder, falls er dieses Merkmal seines Vaters geerbt haben sollte, Haarausfall. Deshalb überraschte ihn seine enge Verbindung zu Ana und dass das Mädchen, kaum geboren, zum Mittelpunkt seines Lebens wurde. Eine Bindung, stärker als die zu seiner Frau Isabel, und zweifellos stärker als die zu Luis, seinem anderen Kind, das sie vier Jahre vor Ana bekommen hatten, und die eher von einer Art freundlicher Gleichgültigkeit geprägt war, so wie die zwischen Maika und ihm. So dass ihn Anas Weggang, trotz aller Probleme, Diskussionen, Beschimpfungen, Kämpfe und all der Schwierigkeiten, in die sich Ana gebracht hatte, lange bevor man sie als Teenager hätte bezeichnen können, buchstäblich nach Luft ringen ließ. Angstattacken überfielen ihn in völlig unerwarteten Momenten, während er aß, wenn er nachts aufwachte, auch während seiner Arbeit, sogar mitten in seiner Sendung. Er musste dann sofort aufhören mit dem, was er gerade tat, und sich ausschließlich auf das Atmen konzentrieren, wobei er fürchtete, das Bewusstsein zu verlieren, und er hatte Glück, dass ihn die Attacke während der Werbepause erwischte.
Weil es diesmal nicht wie die anderen Male war. Dieses Mal war Ana nicht mitten in einem Wutanfall davongelaufen, um einige Tage später wieder aufzutauchen, mit einem neuen Tattoo oder einem neuen Piercing, wie Markierungen im Revolver eines Kopfgeldjägers oder Skalps am Gürtel einer Rothaut, Zeugnisse eines weiteren Abenteuers und ein weiterer Schritt hin zur Verhärtung ihres Herzens und zu einem wilden, gesetzlosen Leben. Jetzt blieb ihm als Trost nicht einmal mehr, sie noch kaltschnäuziger, noch distanzierter, noch verächtlicher wiederkommen zu sehen als kurz bevor sie gegangen war. Ana würde nicht zurückkommen, es sei denn, eine echte Katastrophe passierte, und er war sich nicht sicher, ob er diese befürchten oder erhoffen sollte.
»Hast du deine Schwester gesehen?«
»Schon wieder? Du hast mich schon gestern früh gefragt, und vorgestern. Und davor.«
»Aber du hättest sie inzwischen treffen können. Was frühstückst du da?«
»Cornflakes.«
»Das ist Dreck, mein Sohn. Die enthalten viel zu viel Zucker.«
»Ich esse sie, weil ich sie mag. Nicht, weil sie gesund sind. Nichts, was wir essen, ist gesund.«
»Iss Obst zum Frühstück.«
»Obst enthält Pestizide.«
»Du hast deine Schwester wirklich nicht gesehen?«
»Ich schwör’s.«
»Luis, es ist wichtig.«
»Ich weiß, Papa. Du wiederholst dich, täglich.«
»Deinetwegen stecke ich jetzt in diesem Mist.«
»Scheiße.«
»Ja, genau. Scheiße. Musst du nicht längst zu deinem Kurs?«
»Und du? Musst du nicht zur Arbeit?«
»Ich schätze, sie hat dich auch nicht angerufen?«
»Sie hat mich nicht angerufen. Und ihre Nummer gibt es nicht mehr.«
»Deine Mutter?«
»Was ist mit Mama?«
»Nichts. Vielleicht hat sie mit ihr gesprochen.«
»Frag sie halt.«
»Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich nerve, aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Es sind schon mehr als zehn Tage.«
»Es wird ihr schon gutgehen. Ana weiß sich durchzuschlagen.«
»Sie ist minderjährig. Vielleicht ist dir das noch nicht aufgefallen, aber deine Schwester ist minderjährig. Ich könnte sie dazu zwingen, wieder nach Hause zu kommen.«
»Theoretisch schon. Aber du weißt auch, das wird nicht lange halten.«
»Also, deine Mutter?«
»Ich spreche genauso selten mit ihr wie du. Ich weiß nicht einmal, ob sie in Madrid ist.«
»Ich muss gehen.«
»Okay.«
»Falls sie anruft …«
»Ja doch.«
»Deine Schwester spinnt. Es ist nicht normal, was sie tut.«
»Sie würde sagen, dass es auch nicht normal ist, wie du lebst.«
»Ich habe einen Job, ich ernähre meine Kinder.«
»Du bist ein Handlanger des Kapitals. Das würde sie jetzt antworten. Dass du für einen Radiosender arbeitest, der dem Kapital dient.«
»Ich bin Journalist. Für irgendjemanden muss ich arbeiten, und ich kann mir nicht aussuchen für wen. Oder glaubt ihr, ich bräuchte bloß zu sagen, wo ich am liebsten arbeiten will, und das ist alles? Sehr erfreut, Señor Sánchez, Sie können jederzeit anfangen, welches Büro hätten Sie denn gern?«
»Sie sagt, dass man immer die Wahl hat. Dass wir nur Angst davor haben.«
»Das heißt, du hast doch mit deiner Schwester gesprochen.«
»Ach was, hau ab, geh arbeiten.«
»Es ist … ach, ich stelle mir vor, wie sie auf Politiker schießt oder einen Anschlag vorbereitet. Und sag mir nicht, dass ich übertreibe. Mein Gott, sie ist siebzehn und schon des Terrorismus beschuldigt worden.«
»Sie ist wegen nichts beschuldigt worden. Sie haben sie festgenommen und wieder freigelassen. Es gab keine Beweise.«
»Was nicht heißt, dass sie nicht schuldig ist. Eine Bombe in einem Papierkorb. Man muss doch ein Vollidiot sein für sowas.«
»Es war nur ein Feuerwerkskörper. Ein bisschen Krach und Rauch. Sie haben niemanden verletzt.«
»Aber sie hätten jemanden verletzen können. Und direkt vor der Polizeistation.«
»Man konnte nicht nachweisen, dass sie es gewesen ist. Sie war nur in der Nähe. Das ist alles.«
»Warum verteidigst du sie die ganze Zeit?«
»Ich versuche nur, dich zu beruhigen. Aber ich sehe schon, das bringt nichts.«
»Ich muss gehen.«
»Aber ja doch.«
»Ich komme später nach Hause, wir haben heute eine Sitzung nach der Sendung. Aber du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Komm schon, iss was anderes zum Frühstück.«
»Warum haust du nicht endlich ab, Papa?«
»Gut. Gib mir einen Kuss.«
»Wie bitte?«
»Schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Ich nehme die U-Bahn, nur, falls du das Auto möchtest. Sag Bescheid, falls du spät nach Hause kommst.«
»Papa, im Ernst, was ist los mit dir? Seit Jahren sage ich nicht Bescheid, wenn ich später komme. Seit Jahren geben wir uns keine Küsschen mehr.«
»Gut. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ein Sohn seinem Vater einen Kuss gibt. Wir sehen uns. Oder auch nicht. Wirklich, deine Schwester macht mich noch ganz verrückt. Den ganzen Tag mit diesem Gesindel. Ich möchte mir nicht vorstellen, mit wem sie alles schläft.«
»Tschüs, Papa.«
»Tschüs, Luis. Weißt du, wie hoch mein Blutdruck ist? Ich habe ihn gestern gemessen. Mit 47 Jahren habe ich den Blutdruck eines alten Mannes.«
»Auf Wiedersehen, Papa.«
»Und deine Mutter verkauft irgendwo Handtaschen. Als wäre es ihr egal. Es ist ihr egal, wahrscheinlich. Ja, ja, bis später. Was für eine Scheiße, das alles.«
Ich könnte ein gutes Leben haben, sagst du dir, kaum dass du die Tür geschlossen hast. Ich könnte ein ruhiges Leben haben. Mich nach der Arbeit, zu Hause angekommen, in den Sessel setzen. Und dort eine Weile sitzen bleiben, ohne etwas zu tun, nur so, nur weil bereits alles getan ist. Ein Buch lesen und ein Bier dabei trinken. Den Kopf heben und lächeln, wenn meine Tochter heimkommt, warten, immer noch mit einem halben Lächeln auf den Lippen, dass sie sich nähert und mir einen Kuss auf die Wange gibt. Wie geht es dir, Papa? Mit ihr plaudern, sie fragen, wie es in der Schule war. Ihren Geschichten zuhören über den ach so langweiligen Lehrer oder über den Mitschüler, den sie mag, der sie aber nicht beachtet (oder was auch immer Jugendliche heutzutage so erzählen, weil ich zwar zwei Kinder habe, aber keine Ahnung davon, was sie in ihrem Alter interessiert). Ein bisschen weiterlesen. Vergessen, was ich gerade lese, weil ich an dies oder das denke, an Dinge, die nicht wichtig sind und die mir nicht wirklich Sorgen machen. Mich von einem handlungsarmen Film forttragen lassen, der Folge unbedeutender Szenen. Bis mir plötzlich einfällt, dass es spät geworden ist. Mich aus dem Sessel erheben, die Kühlschranktür öffnen und unschlüssig überlegen, ob ich mir eine Tortilla oder ein Sandwich machen soll. Mich umdrehen und meine Tochter im Schlafanzug sehen. Gehst du schon zu Bett? Ich bin müde und habe morgen einen Sozialkundetest. Ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben. Ich geh schlafen, Papa. Ruh dich aus, Kleines. Im Stehen zu Abend essen, an die Arbeitsplatte gelehnt, immer noch ohne an irgendetwas Bestimmtes zu denken. Mir die Zähne putzen, während ich eine alberne Melodie summe. Mit einem zufriedenen Lächeln zu Bett gehen. Das Licht ausschalten. Einschlafen. Keine Träume haben. Das ist wichtig: keine Träume zu haben. Denn das Glück, was auch immer sie sagen, besteht genau darin: keine Träume zu haben.
Du zuckst zusammen, als die Fahrstuhltür sich öffnet und dich aus deinen Grübeleien reißt, und zögerst einen Moment, wie jemand, der aufwacht und nicht weiß, ob er sich in seinem Schlafzimmer oder in einem unbekannten Raum befindet. Du wolltest raus auf die Straße, aber du hast die falsche Taste gedrückt und bist in der Tiefgarage gelandet, mit ihrem weißen Neonlicht, den dunklen Ecken und dem Geruch nach Benzin, verbranntem Gummi und Abgasen, leer, obwohl sich zu dieser Tageszeit die Hälfte der Bewohner des Gebäudes auf den Weg zur Arbeit machen müsste. Du willst zwar schon auf den Fahrstuhlknopf für das Erdgeschoss drücken, um zu Fuß oder per U-Bahn zum Sender zu gelangen, wie du es dir vorgenommen hattest, aber schließlich endet es wie immer damit, dass du trotz aller guten Vorsätze (der Umwelt zuliebe, der Gesundheit zuliebe, dem Geldbeutel zuliebe, usw.) das Auto nimmst. Unbewusst hast du mit der anderen Hand schon die Schlüssel aus der Hosentasche gezogen, wie auch immer, der Junge nimmt ohnehin lieber das Motorrad, davon gehst du jedenfalls aus, aber du lächelst bei der Vorstellung, wie er vor dem leeren Parkplatz steht, den Kopf schüttelt und denkt, der Alte ist doch nicht mehr ganz dicht.
Es ist kein Nebel, wie auch, mitten im Juni, aber die Luftverschmutzung oder deine vielleicht feuchten Augen verwandeln die Straßen in verschwommene oder so alte Fotografien, dass die Konturen sich auflösen; du hast das vage Gefühl, dass du ein Erinnerungsbild betrittst, einen Raum, der langsam verblasst. In einer dieser Straßen, vielleicht in einem dieser Gebäude, zwischen denen dein BMW langsam vorrückt, ein Relikt aus guten alten Zeiten, ein Wrack, das du immer noch instand hältst, weil es schon so alt ist, dass du nicht einmal mehr 2000 oder 3000 Euro dafür bekommen würdest, nicht nur wegen all der Beulen und Kratzer, auch wegen des Motors, der sich anhört, als bestünde er aus lauter losen Einzelteilen, in einer dieser Wohnungen könnte Ana sein, und deshalb musterst du ab und zu Balkone und Fenster, als könntest du sie so finden, und du ziehst sogar den Kopf zwischen die Schultern, damit dein Blick an den oberen Stockwerken entlangstreichen kann. Du stellst sie dir schlafend vor, allein, bitte, lass sie allein schlafen, das Haar total verschnitten, und ein feiner Speichelfaden läuft aus ihrem Mundwinkel. Sie hat die Fäuste geschlossen, immer schon hat sie mit geballten Fäusten geschlafen, eine Angewohnheit, die dich immer gerührt hat, weil es dir schien, als ob sie das kleine Mädchen bewahren würde. In Ana war immer noch etwas von dem Baby, das sie gewesen war, eine Erinnerung aus der Zeit, als du an ihrer Seite gesessen hast, während sie schlief, bis zu welchem Alter hast du das gemacht, bis sie zwölf, dreizehn war?, und nicht, dass es dir nicht gefallen hätte, auch die weiteren Jahre an ihrer Seite zu wachen, im Morgengrauen, während nicht nur Ana schlief, sondern auch deine Frau und dein Sohn, weil du diese Angewohnheit von früher – die des Jugendlichen, der du, auch wenn du es kaum glauben kannst, einmal warst – immer beibehalten hast, die Nacht zum Tage machen, durch das stille Haus zu streifen, auf die leeren Straßen hinauszuschauen und lange Zeit so zu verharren, auf die trügerische Dunkelheit der Stadt zu blicken, die Fenster der Nachbarn zu betrachten und sich ihr Leben vorzustellen, immer verträumt, sagte deine Mutter, wenn sie dich so antraf, vor dem Fenster oder auf dem Sofa ohne etwas zu tun, denn für sie war es Nichtstun, und sie nannte dich romantisch und fragte dich, ob du an ein Mädchen denkst, die einzig plausible Erklärung für diese Untätigkeit, die dieser in Phasen der Euphorie hyperaktiven Frau einfiel, die dann die Nägel kaute oder Tics entwickelte, wie wieder und wieder ihren Rock glatt zu streifen, oder mit dem Zeigefinger leicht auf die Armbanduhr zu klopfen – vielleicht ein Hinweis auf einen nahen Termin, bei dem über die Zukunft entschieden würde, irgendeine Zukunft –, aber du hast einfach nur zum Fenster hinausgeschaut oder dich deinen Fantasien hingegeben, vielleicht weil du gespürt hast, dass sich das Leben woanders abspielte, nicht hier, wo du warst, in dieser spießigen, langweiligen Umgebung, nein, das war nicht das Leben, sondern was im Haus der Nachbarn passierte, ihre Dramen und Leidenschaften, von denen du gehofft hattest, dass du sie einmal leben würdest, ohne damals zu ahnen, dass Dramen und Leidenschaften oftmals für den, der sie erlebt, nicht so aufregend sind, sondern eher eine Last und Quelle von Ängsten und Sorgen, die einige dazu brachte, aus ihren Fenstern zu schauen und sich ein ruhiges Leben auszumalen, vielleicht eines wie deines, aber du konntest das nicht einmal erahnen und bist erst sehr spät zu Bett gegangen, wenn dich der Schlaf schon so gut wie übermannte, weil du nicht wahrhaben wolltest, dass der Tag zu Ende gegangen war, ohne dass irgendetwas daran der Erinnerung lohnte, kein Ereignis hatte dir plötzlich die Tür zu einem anderen Leben aufgetan, vielmehr warst du davon überzeugt, dass du eines Tages ein Anderer sein würdest, und deswegen bist du nicht schlafen gegangen, um dich deinen Träumen hinzugeben und um dich nicht damit abzufinden, dass du weiterhin Nacht für Nacht am selben Ort derselbe sein würdest, und diese Gewohnheit blieb, auch als du geheiratet hattest und es deine Frau wie eine Treulosigkeit kränkte, dass du, selbst wenn ihr zur gleichen Zeit schlafen gegangen seid, selbst wenn ihr miteinander geschlafen hattet, später wieder aufgestanden und manchmal stundenlang im Wohnzimmer im Dunkeln auf die Straße geschaut hast, die eine andere war und doch dieselbe wie die, auf die du als junger Mann geblickt hattest, so war es irgendwie natürlich, dass du dich nachts um Ana gekümmert hast, um Luis nicht, weil beim ersten Kind deine Frau sich noch zuständig fühlte, die Windeln zu wechseln, das Fläschchen zu geben, die Temperatur zu messen, mit dem Baby auf dem Arm durchs Haus zu laufen bis es schlief, aber bei Ana überließ sie dir diese Rolle, wenn du sowieso nicht schläfst, sagte sie, also hast du ihr nachts das Fläschchen gegeben und die Windeln gewechselt und sie zu Bett gebracht, und später ihre nächtlichen Ängste vertrieben, indem du dich an ihre Seite gelegt hast, bis sie wieder eingeschlafen war, und es hat dir auch nichts ausgemacht, ihr vorzulesen oder ihr Geschichten zu erzählen, wenn sie im Morgengrauen aufwachte – was ihre Schlaflosigkeit anging, kam sie nach dir – und du immer noch bei ihr warst, und du hast ihr die Zeit vertrieben, ihr habt euch gegenseitig die Zeit vertrieben mit dem, was du ihr vorgelesen oder was du dir in dem Moment für sie ausgedacht hattest, und immer noch musst du darüber lächeln wie sie nachhakte, aber ist das wahr oder hast du das erfunden?, sobald sie ein Zögern bemerkte, und du hast geantwortet, alles, was ich dir erzähle ist wahr, es war schon ein Ritual zwischen euch, auch wenn du den Verdacht hegst, dass sie dir nicht geglaubt hat, so musste sie sich dennoch vergewissern, dass deine Antwort aufrichtig war, stimmig, beruhigend, wie alle Rituale, und du könntest nicht exakt sagen, bis zu welchem Alter du Ana nachts in ihrer Schlaflosigkeit begleitet hast oder auch während sie schlief – wenn du an ihrer Seite warst, hattest du irgendwie das Gefühl, dass sie deine Anwesenheit spürte und sie ihr die Ruhe gab, die dir fehlte –, aber es war, als sie ungefähr elf war, oder zwölf, in der gleichen Zeit, in der du aufgehört hast, sie zu baden oder auch nur ihr beim Baden Gesellschaft zu leisten, in der gleichen Zeit, in der du ihr nicht mehr beim Anziehen geholfen hast – und du hast ihr viel länger dabei geholfen, als es notwendig gewesen wäre –, und als du versucht hast, sie nicht mehr so verzückt anzuschauen und so zu tun, als würdest du die Veränderung ihres Körpers nicht bemerken, obwohl dir die Entwicklung ihrer Brüste und Hüften unangenehm war, nicht weil sie dich erregten, bestimmt nicht, sondern weil du sie nicht akzeptieren wolltest und dich dadurch schuldig fühltest, du wolltest nicht, dass deine Tochter sich veränderte, dass sie dich verließ, obwohl sie immer noch Kind war, und vielleicht auch, weil du ihre Verwirrung bemerkt hast, wenn du sie nicht oder kaum bekleidet angetroffen hast oder ihr zufällig im Bad begegnet bist, oder wenn du dich aus einem alten Reflex heraus einen Moment neben sie gelegt hast, oder wenn sie sich auf deine Knie gesetzt hat und sich damit vergnügte, dich mit Küsschen zu überschütten, vielleicht kämpfte auch sie dagegen an sich einzugestehen, dass eure Beziehung sich veränderte, bestrebt, weiterhin für dich das kleine Mädchen zu sein, dir den Gefallen zu tun, diesen Körper zu ignorieren, bis es nicht mehr zu leugnen war und die Küsschen aufhörten und die Geschichten und das Beim-Anziehen-Helfen, und schon hast du immer an ihre Tür geklopft und auf die Erlaubnis gewartet, sie zu öffnen, oder nicht einmal das, nur halb zu öffnen, kommst du zum Abendessen?, alles in Ordnung?, und später hast du dich sogar wie ein Eindringling gefühlt, wenn du auch nur den Kopf in ihr Zimmer gesteckt hast und sie, das hast du dir nicht eingebildet, seufzte jedes Mal ärgerlich, wenn du sie unterbrochen hast – sie unterbrechen, was machte sie schon, das so wichtig war? – oder sie belästigt hast, also hast du damit aufgehört, sie beim Schlafen zu beobachten, obwohl das nicht ganz stimmt, denn bisweilen, im Morgengrauen, hast du die Türklinke heruntergedrückt, ganz langsam, voller Angst, dass sie dich hören könnte, oder deine Frau, denn wie hättest du ihr erklären sollen, dass du zu dieser Stunde die Tür zum Schlafzimmer deiner Tochter öffnest, vor allem wenn du bedenkst, dass deine Frau schon lange dein inniges Verhältnis zu Ana mit Argwohn beobachtete, sie ist schon groß genug, um sich allein anzuziehen, sagte sie, wenn sie dich dabei erwischte, wie du ihr einen Pullover anzogst, und du hast den Blick nicht gehoben, wenn du deine Tochter mit Sonnenschutz eingecremt hast, um dich nicht diesem Misstrauen auszusetzen und um dich nicht schuldig zu fühlen, nicht, weil du es gewesen wärst, denn du hast in dem Mädchen weiterhin nur ein Mädchen gesehen, aber genauso, wie du dich schuldig fühlst, wenn ein Polizist deine Papiere überprüft, obwohl sie alle in Ordnung sind, oder wenn du einer Frau gegenüberstehst, die dir gefällt, und du dich anstrengst, um ihr nicht auf den Busen zu schauen, aber gleichzeitig ist dir bewusst, dass du dich anstrengst, und du vermutest, dass sie den gleichen Verdacht hat, also hast du ein paar Sekunden in die Dunkelheit gelauscht, und erst wenn du weder das Bett knarren gehört hast noch Schritte, noch der Lichtschein der Nachttischlampe aus eurem Schlafzimmer zu sehen war, hast du vorsichtig einen Blick auf Ana geworfen, und deshalb weißt du, dass sie als Jugendliche immer noch mit geballten Fäusten schlief, wie sie es jetzt tun wird, in diesem Zimmer in dieser Wohnung, von dem du nicht weißt, wo es sich befindet, aber wie auch immer, du stellst sie dir darin vor, verschwommen, als wenn der von dir erdachte Nebel der Straße in ihr Zimmer eingedrungen wäre, die Gegenstände einhüllen und sich auf dem Boden ausbreiten würde, als wäre der Raum selbst Teil dessen, was Ana gerade träumt, eine zerfaserte Welt, die im Begriff ist zu verschwinden, und du möchtest dir Ana in allen Einzelheiten vorstellen, aber es ist wie mit Erinnerungen, sie bleiben im Nebel eingehüllt, je stärker du versuchst, sie dir vor Augen zu führen, umso klarer wird dir, bei welchen Gesichtszügen das unmöglich ist, dann aktivierst du die Freisprechfunktion des Handys und rufst Ana an und hörst, während du nach links abbiegst: Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist derzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal, und dann zögerst du, fährst noch hundert oder zweihundert Meter weiter, aber schließlich entscheidest du dich und versuchst es mit der Nummer von Isabel.
»Hallo, Aitor.«
»Hallo. Wo bist du?«
Nach der Frage herrscht Schweigen, das noch andauert, als du den Plaza de Cibeles umkreist, um die Gran Vía hochzufahren, auch noch, als du dem Motorrad ausweichst, das plötzlich vor dem BMW aufgetaucht ist, und du scharf bremsen musst, und immer noch hast du nichts hinzugefügt, als der Motorradfahrer mit der behandschuhten Faust auf die Motorhaube schlägt und ohne sich umzudrehen nach oben zeigt, und du nach oben schaust, in den Himmel, bis dir klar wird, dass es nicht der Zeigefinger ist, den er reckt.
»Ich meine, ob du in Madrid bist.«
»Ja, aber ich fahre morgen schon wieder.«
»Du machst nie Pause.«
Wieder Schweigen. Es ist egal, was du sagst und in welchem Ton du es sagst, sogar wenn du dich bemühst, jovial zu klingen, unbesorgt, so sehr, dass sie durch das Handy hindurch das Lächeln spüren könnte, mit dem du versuchst, deine Worte zu schmücken, immer klingen sie nach Vorwürfen und Schuldzuweisungen. In dem Hohlraum, den ihr Schweigen bildet, wiederholst du in Gedanken diese so banale Frage wie ein Echo, Wo bist du?, und selbst für dich klingt sie wie ein Vorwurf, der andere Fragen impliziert, die du nicht gestellt, nicht einmal gedacht hast, nicht einfach nur Wo bist du?, sondern auch Mit wem? oder Warum rufst du nicht an, wenigstens um über Ana zu sprechen, aber unsere Tochter scheint dir egal zu sein, alles ist dir egal … Du hörst Isabel seufzen, und da du sowieso schon überzeugt bist, dass sie deine Frage nicht beantworten wird, weil das bedeuten würde, weitere Erklärungen geben zu müssen, und sie zu absolut nichts mehr verpflichtet ist, sie hat es dir mehrfach gesagt, dass sie bereits alles getan hat, was sie konnte, dass sie ein Recht hat zu leben, ohne dich, dieses verdrießliche Gespenst, überall in ihrem neuen Leben mit hinzuschleifen, nein, sie wird mit nicht mehr antworten als mit diesem müden Seufzer, also bist du derjenige, der sich erklären muss.
»Ich würde dich gern sehen.«
»Weswegen denn?«
»Wegen Ana.«
»Ich habe nicht viel Zeit. Wie schon gesagt, ich fahre bald wieder.«
»Wegen Ana«, wiederholst du, und wenn du diesmal das neue Schweigen unterbrechen würdest, dann würden Vorwürfe fallen, und vielleicht spürt sie das, denn jetzt, nach einem weiteren Seufzer, der dir ihre Müdigkeit und ihren Überdruss vermittelt, antwortet sie.
»Nächste Woche habe ich ein wenig Luft, Mittwochnachmittag. So gegen sieben.«
»Im El Despertar?«
»Okay. Geht’s dir gut?«
Sie fragt dich, wie es dir geht und dir schnürt sich die Kehle zu, es ist nicht das erste Mal in den letzten Tagen, dass dich aus heiterem Himmel und ohne Grund diese Traurigkeit überfällt, das heißt, natürlich hat diese Traurigkeit einen Grund, aber doch keinen, dass dir in einer so banalen Situation, im Auto, mitten im Verkehr von Madrid, bei einer so banalen Frage, Geht es dir gut, unmittelbar die Augen feucht werden und du kaum noch sprechen kannst, so dass du, während du deine Karte in den Kartenleser an der Einfahrt der Tiefgarage schiebst, nur antwortest:
»Bis nächste Woche also.«
Ein ums andere Mal steckst du die Karte in den Schlitz, aber die Schranke geht nicht hoch und obwohl du weißt, dass sie nicht hochgehen wird, versuchst du es wieder und schlägst ein paar Mal auf den Kasten, bevor du den Rufknopf drückst, um mit dem Sicherheitspersonal zu sprechen.
»Ich bin’s, Sánchez, die Schranke öffnet sich schon wieder nicht.«
»Ich komm schon runter.«
Ohne daran zu denken, den Motor auszustellen, wartest du, schon mit den Gedanken woanders, du entfernst dich von Ana und dem Bett, in dem sie wahrscheinlich um diese Zeit noch schläft, weil die Frühaufsteherin mit dem Erwachsenwerden begann, an den Wochenenden bis zum Mittag oder noch länger in den Federn liegen zu bleiben, und jetzt sind sicherlich alle Tage für sie Wochenende, da sie sich Arbeit und Studium, durch Institutionen und Normen reguliert, verweigert, aber schon denkst du daran, dass du dich in einer Stunde mit Pascual herumschlagen musst, der dir die x-te Umgestaltung des Programms vorschlagen oder eine Änderung der Arbeitszeiten ankündigen wird, zum Schlechteren, weil alle Änderungen immer zum Schlechteren erfolgen, und du fürchtest, dass sie dich irgendwann um deinen Firmenausweis bitten und um den für das Parkhaus, und genau deshalb wirst du so nervös, wenn die Schranke nicht hochgeht, weil es bedeuten könnte, dass sie dich schon aus dem System geschmissen haben, und so lächelst du gezwungen, ohne gänzlich deine Erleichterung verbergen zu können, als der Mann vom Sicherheitsdienst langsam vom Fahrstuhl aus auf dich zukommt, kurz die Schwingachse prüft, am elektronischen Schaltkasten herumhantiert und schließlich doch die Schranke mit der Hand nach oben drückt, hat sich schon erledigt, Sie können durchfahren, geben Sie mir mal Ihre Karte, hmm, ja, mal sehen was zum Teufel da schon wieder los ist, Entschuldigung, ich gebe sie Ihnen später zurück, oder ich mache Ihnen eine neue, und der Mann grüßt dich mit einer Art Verbeugung, oder er hat sich nur gebückt, um dein Gesicht besser durchs Seitenfenster zu sehen, aber er wiederholt die Bewegung zweimal und macht keine Anstalten zu gehen, da fällt dir auf, dass sein Hosenschlitz offen steht und gleichzeitig fragst du dich, ob er ein Trinkgeld erwartet, obwohl das unwahrscheinlich ist, du nickst ihm knapp zu und schaltest in den ersten Gang, um zu deinem Parkplatz zu kommen, genau neben der Wand, der kleinste und ungünstigste, zwischen der Mauer und einem Pfeiler, der das Einparken schwierig macht, und während du aus dem Auto steigst, fragst du dich wieder einmal, warum sie ausgerechnet dir den miserabelsten Parkplatz des Hauses gegeben haben, und du betrittst einen anderen Aufzug, der im Siebten ankommt, ohne dass jemand zwischendurch dazusteigt, und bevor du Richtung Studio gehst, schaust du aus dem Panoramafenster auf diese Landschaft aus Dächern und Hochhäusern, aus der jetzt wieder die Baukräne ragen, die während der Krise verschwunden waren, wie Vögel, die kurz vor dem Aussterben waren und jetzt langsam aber sicher zurückkehren, um das Gebiet zu besiedeln, eine Assoziation, die dich jedes Mal überkommt, wenn du einen Blick aus dem Panoramafenster wirfst, aber obwohl du gerne noch eine Weile hier stehen bleiben würdest, du würdest sogar gerne wieder rauchen, nur um auf die Terrasse zu gehen, wie es einige Kollegen tun, und du musst dich wirklich losreißen, komm schon, du hast viel zu tun, sagst du halblaut vor dich hin, fast geflüstert, zwischen zusammengebissenen Zähnen, du wiederholst es auf dem Weg zum Studio, trittst ein, grüßt, und auf dem Weg zu deinem Platz beschwörst du dich, dass du jetzt unter allen Umständen eine Panikattacke vermeiden musst, und genau in diesem Moment, als du dich setzen willst und dich an den Armlehnen des Drehstuhls festhältst, denkst du wieder an Ana, im Bett, schlafend, schutzlos, allein. Hoffentlich ist sie allein. Und du fühlst dich wie ein Idiot vor diesem Mikrofon und unfähig, über ein Thema zu sprechen, von dem du dich jetzt nicht einmal erinnerst es vorbereitet zu haben, und du überfliegst eilig die Blätter, während deine Tochter …
Deine Tochter, was.
2
Spät am Vormittag und die Augen noch vom Schlaf verquollen. Sie gähnt ausgiebig, streckt die Arme so weit wie möglich von sich, als ob sie zwei Objekte gleichzeitig berühren will, die weit von ihr entfernt sind. Ihre linke Hand stößt gegen ein Bündel. Das Bündel bewegt sich und schnalzt mit der Zunge.
»Wie spät ist es?«
Ana antwortet nicht. Sie setzt sich im Bett auf, ohne sich nach links zu drehen. Sie haben auf den Matratzen nah beieinander geschlafen, sich unterhalten, wie immer im Dunkeln, bis Alfon, er ist immer der Erste, verstummte und fast unhörbar zu schnarchen begann, als würde er die Luft durch eine feine Membran in seine Lunge ziehen.
Sie wirft die Bettdecke zurück. Sie kann sich nicht daran erinnern, ihren Slip ausgezogen zu haben. Eigentlich ist es das einzige Kleidungsstück, das sie beim Schlafen anbehält.
Sie hat ihre Tage bekommen. Ein kleiner dunkler Fleck, den man kaum auf dem nicht besonders sauberen Laken ausmachen kann. Wein, Kaffee, Blut, andere Flüssigkeiten. Alfon wälzt sich herum und verströmt einen Geruch wie ein Tier im Käfig, aber nicht ganz so scharf. Dusch dich, hat sie ihm am Tag zuvor gesagt, dusch dich endlich mal. Die Hygiene ist eine Erfindung der Bourgeoisie, eine Form, sich von den Arbeitern abzugrenzen, die nach Schweiß rochen, hat er geantwortet; nicht nach Schweiß zu riechen, würde bedeuten, die körperliche Arbeit zu verleugnen.
Sie hat ihn weder darauf aufmerksam gemacht, dass er von körperlicher Arbeit meilenweit entfernt ist, noch seine Theorie in Frage gestellt. Das tut sie nie, weil es ein stundenlanges Gezerre bedeuten würde. Er lässt seine Beute nicht los, er argumentiert, bis der andere aufgibt und ihm zustimmt. Alfon sagt immer, er sei ein Mann ohne Ansprüche, er sei zufrieden mit dem, was er hat: eine Ecke zum Schlafen, Tisch und Stuhl, seine Schreibmaschine Marke Olivetti Studio 64 im Koffer, dessen Deckel er nie zu schließen vergisst. Nur auf eins kann er nicht verzichten: Er muss immer Recht behalten, zu jeder Tageszeit, kaum dass er morgens die Augen aufschlägt.
Sie schaut sich nach ihrer Unterwäsche um, gibt aber gleich auf und geht ins Bad. Die Tür quietscht und Ana wartet kurz auf einen Laut des Protests, der aber ausbleibt.
Zum Glück haben sie ihnen nicht das Wasser abgestellt. Sie rechnet jeden Tag damit, dass sie ihnen den Hahn zudrehen. Warmes Wasser wäre noch besser gewesen, aber das Gas haben sie ihnen schon letzten Monat abgeschaltet, ein Problem, das bis zum Winter warten kann, und wer weiß, ob sie dann überhaupt noch hier sein werden. Bevor sie in die Dusche steigt, bückt sie sich unter das Waschbecken. Sie steckt den Fingernagel in die Fuge zwischen zwei Kacheln, da, wo das Waschbecken an die Wand stößt, entfernt eine von ihnen und tastet in dem Loch herum. Wahrscheinlich ist es ein total idiotisches Versteck, aber sie hat kein besseres gefunden. Sie zählt die Scheine, ohne sie herauszunehmen: vier Hunderter. Gut. Oder nein, nicht gut, aber es ist alles, was sie hat. Ihr wird nichts anderes übrig bleiben, als an den Wochenenden wieder auf dem Markt des Viertels zu arbeiten, der sich samstags und sonntags in eine Tapas-Zone verwandelt; ab und zu hat sie das schon gemacht, bevor sie in dieses Haus gezogen ist, dass sie bezeichnenderweise El Agujero – Das Loch – genannt haben. Sie setzt die lose Kachel wieder an ihren Platz.
Kaltes Wasser fließt über ihren Scheitel. Ein einzelner Strahl, weil irgendein Schwachkopf oder jemand, der total zu war, den Duschkopf geklaut hat. Sie lässt das Wasser eine Weile laufen, es fließt über ihren Kopf und bedeckt sofort das ganze Gesicht, läuft fast in ihre Nase. Es ist wie versinken.
Versinken. Im Stausee, vor ein paar Monaten. Nein, Wochen nur, aber es fühlt sich an wie Monate, weil in jeder Stunde so viel passierte, dass die Zeit anschwoll, sich ausdehnte, und in jeder Minute, die verging, entfernten sich die Ereignisse auf unverhältnismäßige Weise voneinander. Nerea, ein Mädchen, das zwei Wochen zuvor aus dem El Agujero ausgezogen war (Ana ging schon seit langem im Haus ein und aus, aber sie konnte erst bleiben, als der Platz von Nerea frei wurde), ging nachts oft zur Garage ihrer Eltern, nahm das Auto, machte damit einen Ausflug und stellte es morgens wieder an seinen Platz zurück, bevor ihr Vater aufstand, um zur Arbeit zu fahren.
Sie näherten sich dem Haus wie Diebe, Nerea und ihre Freundinnen, fast auf Zehenspitzen. Als sie das Auto aus der Garage holten, mussten sie das Lachen unterdrücken. Sie kamen in der Morgendämmerung am Stausee an; ein flacher, schwarzer Fleck zwischen dem sanft gewellten Grau der Ufer. Es war windstill, sie erinnert sich genau daran, dass kein Windhauch zu spüren war, es war seltsam, als würde man sich in einem Hologramm oder in einem virtuellen Raum befinden. Kaum am Ufer angekommen, zog sie sich aus und nahm zwei Steine; sie hatte das noch nie zuvor gemacht, es war eine spontane Eingebung, zwei Steine aufzusammeln und mit ihnen in den See zu gehen, ganz langsam, fast ohne Wellen auf der Oberfläche zu verursachen. Dann schwamm sie nur mit den Füßen bis in die Mitte des Sees. Sie atmete tief ein, bewegte sich nicht und ließ sich langsam nach unten sinken. Es war wie Sterben, so wie sie sich Sterben vorstellte. Die Kälte des Wassers auf ihrem Gesicht und an ihrem Schädel; in eine Dimension ohne Erinnerungen, ohne Wünsche eintreten. Sich loslassen bis zum Grund. Ausharren, die Augen der Schwärze öffnen. Und dann die Steine loslassen und langsam nach oben schwimmen, den Kopf aus dem Wasser strecken, einen tiefen Atemzug ebenfalls kalter Luft nehmen, lachen, glücklich lauthals loslachen und fühlen, wie das Lachen von der Oberfläche zurückprallt, Lachen wie Kieselsteine, und mit den Armen klatschend Wellen produzieren, kleine Seebeben. Wie gut das tut, sagte sie, als sie aus dem Wasser kam, machen wir ein Lagerfeuer?
Sie stellt das Wasser ab und merkt erst dann, dass sie kein Handtuch mitgenommen hat. Da hängt eins, aber sie weiß nicht, von wem es ist. Sie schüttelt sich das Wasser aus dem Haar und kehrt auf die Matratze zurück.
»Weißt du, was mir gestern passiert ist?«, fragt sie.
Er hat sich aufgesetzt und kratzt sich den Bart, nachdenklich, vielleicht auch noch halb schlafend. Er dreht sich zu ihr, ohne ihren nackten, pitschnassen Körper oder den feuchten Fleck, der sich auf dem Kopfkissen ausbreitet, irgendwie zu kommentieren.
»Gestern?«
»Ich war Geld abheben.«
»Du hast immer noch Geld? Kapitalistenschwein. Wie viel?«
Obwohl er Spaß macht, ist da eine gewisse Gier in seinem Ausdruck, eine überspielte Neugierde. Möglicherweise ist Ana aber zu hart mit ihm, zu misstrauisch.
»Nichts mehr. Gestern habe ich das Konto leergeräumt. Kleingeld. Aber nun ja, ich war also am Geldautomaten. Vor mir war ein Mann dran. Und ich wartete. Übrigens, der Junkie, der im Vorraum der Bank schläft, war nicht da. Aber sein Hund. Er saß da, als würde er auf etwas warten, ich will damit sagen, so mit gespitzten Ohren. Ich wartete also auch und beobachtete all diese Dinge, und der Mann, ein älterer Typ, ein Opa oder so, schaffte es nicht, Geld abzuheben. Es funktioniert nicht, sagt er zu mir, bereits im Weggehen, und da bemerke ich erst, dass er nicht die EC-Karte, sondern seinen Personalausweis in der Hand hält. Sie haben Ihren Ausweis benutzt, sage ich zu ihm und lächle, um die Sache herunterzuspielen, aber er wird rot und murmelt, wie schusselig, was bin ich aber auch zerstreut, und er ist so nervös, oder verlegen, ich weiß nicht, aber statt dann halt die richtige Karte zu benutzen, geht er ohne Geld weg. Vielleicht hätte ich nichts sagen sollen. Wenn ich ihm hätte helfen wollen, hätte ich ihn nicht darauf hinweisen sollen, dass er mit seinem verdammten Perso versucht, Geld abzuheben.«
»Ist das ein Gleichnis? Etwas, worüber ich jetzt meditieren sollte?«
»Du müsstest dich vor allem endlich mal duschen oder dir wenigstens die Zähne putzen, echt. Auch wenn das minibourgeois wäre.«
»Schon gut, machst du den Kaffee, während ich mir die Zähne putze?«
»Nein. Den Kaffee machst du dir selbst.«
»Die weibliche Emanzipation ist ein historischer Fehler.« Alfon legt sich wieder hin. »Ein Fehler mit tragischen Konsequenzen. Ich hätte gern einen Harem gehabt.«
»Aber du bekommst keinen hoch. Ich will sagen …«
»Du sagst es ganz richtig. Ich bekomme keinen hoch. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass ich nicht impotent bin, sondern asexuell, ich weiß nicht, ob du den Unterschied verstehst. Es ist nicht so, dass ich wollte und nicht könnte, sondern ich will nicht. Gib zu, das hat mehr Würde.«
»Du sag mir lieber, wofür du dann einen Harem willst.«
»Nicht wegen dem Sex. Da ist die Zärtlichkeit, die Zuneigung, die Fürsorge.«
»Sie sollen sich um dich kümmern, und nicht du um sie.«
»Du verstehst mich immer sofort. Apropos, du bist die erste Rothaarige, mit der ich schlafe. Obwohl, so richtig rothaarig bist du nicht. Eher kupferfarben oder so ähnlich.«
»Halt die Klappe und putz dir die Zähne, bitte. Wirklich. Das ist echt eklig.«
»Na schön. Ich geh ja schon. Machst du uns einen Kaffee?«
Alfon steht auf, verlässt langsam den Raum, dabei hält er die Schlafanzughose mit dem ausgeleierten Gummizug um die Taille fest. Ana steht auch auf, nimmt eine Unterhose aus der Schublade, einen Tampon, den sie sich einführt, sich mit raschen Blicken versichernd, dass Alfon noch nicht wieder aus dem Bad zurückkommt. Nicht dass sie irgendwas von ihm befürchten muss; im Gegenteil, sie können sich ein Zimmer teilen und die Matratzen zusammenschieben, und manchmal liegen sie nah beieinander, obwohl sie nichts anhat, gerade eben deshalb, weil es nichts zu befürchten gibt. Und trotzdem wäre es ihr unangenehm, wenn er sie dabei sähe, wie sie sich einen Tampon einführt.
In der Kaffeemaschine gibt es noch Kaffee vom Vortag. Ana füllt zwei Tassen, eine mit kaputtem Rand; die andere sagt Guten Tag, wenn man sie hochhebt. Es ist die Tasse von Alfon. Der grinst, als er sieht, dass Ana tatsächlich Kaffee auf den Tisch stellt.
»Gibt es Zucker?«
Ana schüttelt den Kopf.
»Milch?«
Ana antwortet nicht einmal.
»Ich bin sicher, die beiden, die letzte Nacht hier geschlafen haben, haben sie ausgetrunken. Zwei sehr sympathische Junkies. Sehr gut erzogen. Aber sie haben die Milch aufgebraucht.«
»Seit einer Ewigkeit haben wir keine Milch mehr, Alfon.«
»Ach, nee? Dann sollte man welche kaufen.«
»Sollte man.«
»Ich, ich bringe mein Wissen ein. Ich trage zu deiner Menschenbildung bei. Das sollte ausreichen. Apropos, ich habe vergessen, was du studiert hast. Hast du es mir erzählt?«
»Wie, was ich studiert habe?«
»An der Universität.«
»Mensch, ich bin siebzehn.«
»Stimmt ja, ich habe dein Alter vergessen, weil du immer so ernst bist. Du könntest meine ältere Schwester sein.«
»Jede Frau könnte deine ältere Schwester sein.«
Er lächelt und wiederholt laut, jede Frau könnte meine ältere Schwester sein, und fängt an zu lachen, verstummt aber sofort wieder. Er schüttelt den Kopf. Solange er unnötigerweise den Kaffee umrührt, weicht das alberne Grinsen nicht von seinen Lippen.
Ana zieht ihre Matratze auf eine Seite des Raumes und packt die von Alfon darüber. Danach bedeckt sie beide mit einer Tagesdecke und ein paar Kissen, die sie von zu Hause mitgebracht hat. Sie stopft die Bettdecken in den einzigen Schrank, der im Zimmer steht. Ana hätte gern einen alten Schrank gehabt, so einen dunklen, großen, wie sie in den Häusern auf dem Dorf zu finden sind, und nicht so einen Scheiß von IKEA, von dem sich das Furnier aus Melanin löst. Melanin, nicht zu verwechseln mit Melatonin, hat Alfon zu ihr gesagt, und in dem Moment hatte sie keine Lust nachzufragen. Seine Erklärungen gehen ihr auf die Nerven, aber manchmal provoziert sie sie auch, denn sie muss sich eingestehen, dass sie viel von ihm lernt.
»Ich lese ein bisschen«, sagt sie, und nimmt einen Essay von einem kleinen Tisch, mit dem sie nicht vorankommt; zu viele Begriffe, die ihr nichts sagen, Verweise auf Theorien, die sie nicht kennt, obwohl sie mit den Schlussfolgerungen dann doch einverstanden ist, als hätte der Autor die Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels geschrieben, damit auch Menschen wie sie sie verstehen. Ana hat beschlossen, sich die Dinge, die ihr wirklich wichtig sind, selbst beizubringen, statt an die Universität zu gehen. Alfon könnte ihr helfen. Und es gibt auch die Kurse im Centro Social, dort bringen sie dir bei, was du wissen musst, um zu leben, um dich zu verteidigen, um deinen Platz einzunehmen.
Er hat sich auf den Stuhl gesetzt, den sie vor einigen Tagen vom Sperrmüll gerettet haben. Von dem, was man auf einem nächtlichen Spaziergang durch das Viertel findet, könnte man ein ganzes Haus einrichten. Sie ekelt sich allerdings vor den gebrauchten Matratzen. Auf dem letzten Plenum haben sie beschlossen, etwas aus der Gemeinschaftskasse zurückzulegen, um ein paar in besserem Zustand zu kaufen. Sie klappt das Buch zu und beobachtet, wie Alfon das Farbband aus der Schreibmaschine herausnimmt, es vorsichtig von der Spule abrollt und es dann, mit der gleichen Behutsamkeit, Zentimeter für Zentimeter in eine Dose mit Schuhcreme drückt.
»Erinnerst du dich noch an die Original-Farbbänder? Viele waren auf der oberen Hälfte schwarz und auf der unteren rot, man konnte mit zwei Farben schreiben«, sagt Alfon.
»Wo hast du das gelernt?«
»Mein Vater benutzte sie, in genau dieser Maschine.«
»Ich meine die Idee, das Band mit Schuhcreme einzufärben.«
»Aber ich kann natürlich nicht eine Hälfte rot färben.«
Alfon trägt eine Brille für Altersweitsichtigkeit und schaut über deren Rand, als er sich Ana zuwendet. Sie findet, dass er aussieht wie ein Uhrmacher, aber dann schiebt sich das Bild einer älteren, stickenden Frau vor ihre Augen. Er hat etwas von einer in die Jahre gekommenen, fülligen Dame. Alfon setzt sein Werk fort, bis er das Farbband vollständig neu eingefärbt und zurückgespult hat.
»Auf Kuba. Ich habe dort während der Sonderperiode als Freiwilliger gearbeitet«, antwortet er schließlich.
»Kuba ist eine Scheißdiktatur.«
»Manchmal kannst du dir deine Freunde nicht aussuchen, deine Feinde aber schon.«
»Versteh ich nicht.«
»Du wirst es schon verstehen, wenn du groß bist.«
»Fick dich.«
Alfon schließt den Deckel der Schreibmaschine, er nimmt die Brille ab und verstaut sie in einem Lederetui.
»Ich habe an Demonstrationen gegen den Irakkrieg teilgenommen.«
»Das hast du mir schon erzählt.«
»Und wer demonstrierte an meiner Seite? Ein paar schreiende Arschlöcher, die womöglich heute Dschihadisten sind und Bomben in die U-Bahn legen oder mit einem gestohlenen Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern rasen, in der Hoffnung, den Islamischen Staat zu errichten. Sie demonstrierten nicht gegen den Krieg, sie demonstrierten gegen die USA. Sie waren aus Hass gegen die USA da und sie nutzten uns aus, die wir gegen den Krieg demonstrierten. Was machst du also? Demonstrierst du gegen den Krieg oder bleibst du zu Hause, weil neben dir ein paar fanatische Idioten mitlaufen werden, die gerne mit einer Kalaschnikow in die Luft ballern würden?«
»Ich versteh schon.«
»Es ist eine Frage der Taktik.«
Alfon erklärt weiter, was Ana längst verstanden hat, die Sätze immer weiter auseinanderziehend, bis er selbst zu vergessen scheint, was er eigentlich erzählt. Er holt eine Dose Öl mit Applikator hervor und hält sie in der Luft, aber nach einigen Sekunden stellt er sie unbenutzt auf dem Tisch ab.
Ana widmet sich wieder ihrem Buch, und diesmal kann sie sich besser konzentrieren, bis Alfon sich neben sie auf die Matratze setzt.
»Fasst du es mir zusammen?«
»Kann ich nicht.«
Alfon steht auf und wühlt in einer Schublade.
»Komm, lies das«, und er lässt das kleine Taschenbuch neben Ana fallen. »An unsere Freunde, Unsichtbares Komitee«, liest sie laut vor. Sie legt das Buch, das sie gerade liest, zur Seite und greift nach dem anderen. Es gefällt ihr sofort, es spricht ihre Sprache, es ist für sie geschrieben, als würde sie in einer Kneipe zusammen mit den Autoren sitzen, die ihr in die Augen schauen und sagen: Ein Aufstand kann jederzeit losbrechen, aus welchem Anlass auch immer, in welchem Land auch immer; und irgendwohin führen. Die Machthaber bewegen sich zwischen Abgründen.
Ana spürt die Aufbruchsstimmung vor der Veränderung, vor diesem kommenden großen Ereignis, das nur sehr wenige voraussehen. Und sie wird Teil dieser Veränderung sein. Die Welt, wie wir sie kennen, liegt in ihren letzten Zügen. Die Widersprüche des Kapitalismus holen die Menschen auf die Straße. Es wird eine globale Bewegung von Leuten wie ihr geben, die nicht mehr mitmachen, die sich entschlossen haben, die Karte, die ihre Papas ihnen mitgegeben haben, wie sie zu Haus und Arbeit kommen und zur Ehe und zu Kindern und Enkelkindern und bis ins Grab, zu durchkreuzen. Die Menschen sind kurz, aber wirklich kurz davor, auf die Barrikaden zu gehen. Sie brauchen nur ein Zeichen, nicht mehr als das. Und dann werden sie, wie Alfon sagt, die Bibliothek von Alexandria niederbrennen, die Anhäufung von unnützem Wissen. Alles wird brennen und sie hat das Streichholz in der Hand. Lohnt es sich nicht allein dafür zu leben?
3
Als er die Sendung beendet hat, findet er auf seiner Computertastatur eine Notiz vor. Pascual bittet ihn erneut, zu ihm zu kommen. Jedes Mal, wenn er ihn einbestellt, malt Aitor sich die Szene aus, in der er ihm den Vertrag kündigt. Dutzende sind bereits gefallen. Es stehen nur noch die letzten Soldaten einer verlorenen Schlacht. Und jeden Tag was Neues. Jetzt wollen sie den Fahrdienst auslagern, eine so große Belegschaft ist nicht rentabel. Es geht aber nicht darum, rentabel zu sein, sondern so billig wie möglich. Und es ist immer möglich, noch billiger zu sein, es ist ein endloser Kreislauf, und er weiß, dass er Teil dieses Kreislaufs werden wird, in gewisser Weise ist er es schon. Er läuft durch die Flure und grüßt durch Glasscheiben hindurch Techniker und Moderatoren. Seit zwanzig Jahren arbeitet er beim Sender und hat zwei Generationen vorbeiziehen sehen, sie sind ausgestorben wie die Baukräne, aber in diesem Fall kehrt nicht zurück, wer einmal gegangen ist. Andere kommen, schwächere, furchtsamere Säugetiere, bereit, sich mittels Camouflage in einem feindlichen Lebensraum zu behaupten. Sie haben keine Reißzähne mehr, keine Krallen, und wer welche hat, versteckt sie gut. Die großen Raubtiere der Savanne sind nur auf den höchsten Ebenen zu finden.
Aitor bleibt vor der Tür zum Büro des Programmdirektors stehen, er will gerade anklopfen, da hört er Stimmen. Carolina ist im Büro, eine der Redaktionsleiterinnen, die wenige Jahre nach ihm angefangen hat, aber viel schneller aufgestiegen ist. Aitor hört die langen Momente des Schweigens, er ahnt den Beginn eines Schluchzens. Er fühlt sich, als würde er, mit dem Ohr an der Wand klebend, seine Nachbarn beim Sex belauschen. Mit einer Mischung aus Scham und Verlangen.