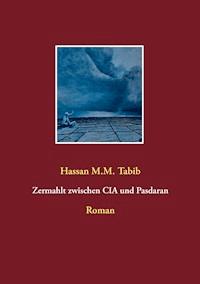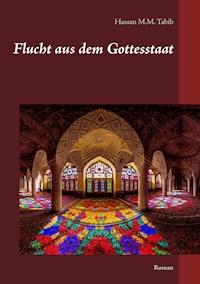Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Cyrus gehört der adligen iranischen Familie Salaar an. Sein Vater war ein exzellenter und bekannter Chirurg zur Zeit des Schah-Regimes, wurde aber in den Wirren der Revolution ermordet, das gesamte Vermögen vom Staat konfisziert. Die Familie floh und lebt seither in alle Welt verstreut im Exil. Cyrus Salaar ist inzwischen deutscher Staatsbürger und arbeitet bei einem Versicherungskonzern in Hamburg. Dieser beauftragt ihn, die Richtigkeit des Totenscheins eines iranischen Versicherungsnehmers in Teheran zu überprüfen; es wird ein Versicherungsbetrug vermutet. Der Protagonist hat auch ein privates Interesse, diese nicht ungefährliche Dienstreise ins Land der Mullahs anzutreten. Er will die Gelegenheit nutzen, wieder in den Besitz des Familienwappens der Salaars zu gelangen – es hatte bei der Flucht zurückgelassen werden müssen. In seinem ehemaligen Elternhaus, einer alten Villa, residiert jetzt allerdings die Geheimpolizei... Ein authentischer, spannender Roman aus dem Reich der Mullahs!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Perdis
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Prolog
1. Ein ungewöhnlicher Auftrag
2. Das Familienwappen
3. Der Flug nach Teheran
4. Begegnung am Grab des Vaters
5. Zino
Intermezzo
6. Der Totenschein
7. Der Einbruch
8. Auf der Suche nach den verlorenen Träumen
9. Zeuge eines Mordes
10. Die Opfer der Mullahs
11. Das Verhör
12. Auf der Suche nach einem Ausweg
Intermezzo
13. Die verlorene Identität
14. Das Geschäft mit islamischen Grundsätzen
15. Die Bewertung des Systems
16. Die zerrissene Seele eines Mörders
17. Die Oberschicht
18. Das Haus des Vergessens
19. Heimlicher Aufbruch
20. Schmerzlicher Abschied
Epilog
Vorbemerkung des Autors
Der erste Leser dieses Manuskriptes meinte, ich solle mit der Veröffentlichung dieses Buches noch einige Jahre warten, bis sich die politische Lage der Islamischen Republik Iran positiv stabilisiert hätte und die Regierung kritikfähiger wäre. Das war Anfang 2001.
Ich hatte in jenem Jahr sowieso allerhand mit der Publikation meines ersten Buches in Deutschland „Von orientalischen Träumen zur Tragödie im Westen“ zu tun.
Außerdem ich hatte vor, mich über die Erzählung von Herrn Cyrus Salaar eingehend zu informieren und den Sachverhalt gründlich zu recherchieren. Ich reiste am 2. Juni 2002 nach Teheran.
Die Ergebnisse meiner Gespräche, besonders mit den Herren Zino Darbandi, Reza Danesch und Iraj Shirazi, waren aufschlussreich, aber auch schockierend. Weiterhin habe ich illegal zahlreiche Dokumente, u.a. Memoiren von Ayatollah Montasery – dem in den Jahren 1982 bis 1992 zweitwichtigsten Mann der Islamischen Republik Iran –, im Zusammenhang mit der politischen und religiösen Lage dieses sogenannten Gottesstaates mitgenommen.
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich mich dazu entschlossen, egal wie die iranische Regierung auf mein neues Buch reagieren würde, wie geplant diesen spannenden Roman zu veröffentlichen.
In den Memoiren von Ayatollah Montasery fand ich hilfreiche Erklärungen für viele neue, erst einmal unverständliche islamische Grundsätze und merkwürdige Vorschriften.
Die Lebenserinnerungen dieses islamischen Führers wurden im Februar 2001 durch den Verlag Islamische Revolution publik gemacht. Glaubhaft und überzeugend dokumentiert Ayatollah Montasery den schrecklichen Umgang der iranischen Behörden mit dem Volk und berichtet von Mullahs, die glauben, über das Leben anderer Menschen verfügen zu können.
Er manifestiert schonungslos die Ungerechtigkeiten und die Grausamkeiten seiner Kollegen, distanziert sich von unzähligen haarsträubenden neuen Gesetzen und den unglaublichen Verfahren zur Hinrichtung politischer Gegner und hilflosen Frauen. Das Buch wurde von seinen Kontrahenten aus den Regalen der Buchhandlungen entfernt und ist seitdem legal nicht erhältlich. In der Folge wurde Ayatollah Montasery aus der politischen Szene herausgedrängt.
Nun ist mein Buch in erster Linie ein Roman und nur am Rande ein politisches Statement. Jedoch habe ich, um die Tatbestände glaubhaft darzustellen, einige Zitate von Ayatollah Montasery verwendet.
Denn man kann die erbärmlichen Zustände im Iran gar nicht genug anklagen. Man muss der westlichen Welt eindringlich zeigen, was die Mullahs im Land von Darius, Ibne-Sina, Hafez, Saadi, Molawi, Omar Khaiyam u.v.a. angerichtet haben!
Die Perser genossen seit Tausenden von Jahren die Anerkennung der ganzen Welt, besonders für ihre Zivilisation, ihre Traditionen und ihre Lebensart. Und nun müssen sie überall beweisen, dass sie mit dem terroristischen und steinzeitlichen Tun vieler Männer mit schwarzem oder weißem Turban nichts zu tun haben.
Ich erinnere mich an die sechziger Jahre: Als ich zum ersten Mal in Deutschland einreiste, schaute der Beamte an der Zollkontrolle meinen persischen Reisepass an, lächelte mir freundlich zu und wünschte mir einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland.
Und heute, so meine bittere Erkenntnis, spürt man an fast allen europäischen Grenzen Misstrauen und Abneigung, wenn ein iranischer Pass vorgelegt wird. Man hat das Gefühl, dass der zuständige Beamte schwer enttäuscht ist, wenn er dem Reisenden die Einreiseerlaubnis erteilen muss, weil dessen Name nicht im Computer gespeichert ist.
Diesen unwürdigen Zustand verdanken die Iraner einem Haufen machtgieriger Mullahs, die mit ihren Dummheiten und ihrem Fanatismus dieses wunderbare Land um fast ein Jahrhundert zurückgeworfen haben.
Und die, noch schlimmer, über mehrere Jahrzehnte im Namen des Islam die grässlichsten Verbrechen veranlasst haben.
Springe, 31.12.2001
Prolog
Das Seminar war langweilig. Schon nach zwei Stunden erwog ich, den Saal zu verlassen, meine Hotelrechnung zu bezahlen und nach Hause zu fahren.
Was der junge Professor erzählte, war praxisferne Theorie. Ich beobachtete die anderen Teilnehmer, es schien, als wären sie mit dem Vortrag genauso unzufrieden wie ich. Auf den Gesichtern zeigten sich Frust und Abneigung. Einige lasen sogar demonstrativ Zeitung und ein alter Herr schlief lautlos ein.
Ich ärgerte mich, dass ich offenbar das Opfer eines vielversprechenden Werbeprospekts geworden war. Nach der Mittagspause entschied ich, meine kostbare Zeit besser zu nutzen, in die Cafeteria zu gehen und dort den mitgebrachten Korrekturabzug meines neuen Buches durchzuarbeiten. Ich hegte die Hoffnung, dass der zweite Teil des Seminars am nächsten Tag besser würde, und ich wollte für dreitausend Mark Teilnahmegebühr doch zumindest versuchen, etwas Brauchbares mit nach Hause zu nehmen.
Die Cafeteria war ziemlich voll, aber ich konnte gleich einen freien, bequemen Ledersessel finden und bestellte beim Ober einen Espresso. Während meiner Korrekturtätigkeiten beobachtete ich die Hotelgäste mit flüchtigem Interesse.
Es war eine gemischte Gesellschaft, Asiaten, Amerikaner, Flugpersonal verschiedener Airlines und einige Seminar-teilnehmer.
Mir gegenüber, in einer Entfernung von etwa fünf Metern, saß ein Mann, dessen Gesicht mir bekannt vorkam.
Jedes Mal, wenn ich ein neues Blatt zum Lesen hochnahm, schaute ich ihn mit leerem Blick an und überlegte, woher ich ihn kannte.
Er hatte schwarze, glatte Haare, ausdruckvolle, glänzende Augen, einen leicht ergrauten Schnurrbart und ein kleines Muttermal auf der linken Wange. Er war sehr elegant angezogen und wirkte wie ein seriöser Geschäftsmann. Dieses Muttermal hatte ich schon einmal gesehen. Aber wann? Es müsste vor mehreren Jahren gewesen sein. Aber wo?
Ach, natürlich, das war er, Cyrus Salaar; zwölf Jahre hatte ich in der Grundschule und im Gymnasium neben ihm gesessen. Allerdings waren wir nicht sonderlich befreundet gewesen. Er stammte aus einer reichen, adeligen Großfamilie und ich hatte daher Hemmungen, mich in seiner Oberen-Zehntausend-Gesellschaft blicken zu lassen.
Obwohl er mir gegenüber immer freundlich und hilfsbereit war, wagte ich nur einmal, in ihre riesige, wunderschöne Villa einzutreten.
Es war in der Schule bekannt, dass seine Familie im Rahmen der Weißen Revolution des Schahs, im Jahr 1963, einen beachtlichen Teil ihres Vermögens verloren hatte.
Die Großgrundbesitzer durften nicht mehr als ein Dorf ihr Eigen nennen. Das übrige Land wurde systematisch den Bauern zur freien Verfügung gestellt. Die Grundbesitzer, die ihren Besitz abtreten mussten, wurden in unterschiedlicher Weise entschädigt.
Soweit ich das damals mitbekam, wurde sein Großvater wegen politischer Auseinandersetzungen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Dr. Ali Amini erheblich benachteiligt. Er hatte nach der Landreform über achtzig Prozent seines Vermögens verloren. Denn die Entschädigung bestand ausschließlich aus Aktien staatlicher Hüttenwerke, die bereits voll ausgebeutet waren.
Dennoch, Familie Salaar war reich genug, um im Vergleich zu meiner Familie ein traumhaftes Leben zu führen.
Cyrus war der zweite Sohn von Dr. Salaar, dem bekanntesten Chirurgen Teherans bis Ende der siebziger Jahre.
Ich verlor ihn unmittelbar nach dem Abitur aus den Augen. Man erzählte mir, dass er seine Ausbildung in den USA fortsetzen wollte.
Und jetzt, nach mehr als siebenundzwanzig Jahren, saß er mir genau gegenüber und las ein dickes Buch.
Plötzlich war er sich bewusst, dass von irgendwoher ein Blick zu ihm drang und auf ihm ruhte. Er sah mich eine Weile verwundert an und hatte offenbar keine Ahnung, woher er mich kannte. Doch mit einer freundlichen Geste ermutigte er mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich fragte ihn auf Persisch:
»Kennst du mich noch?«
Er lächelte, schüttelte den Kopf und sagte:
»Nein, das heißt, ich bin nicht sicher. Kennen wir uns aus Schulzeiten?«
»Ja, Ferdowsi Grundschule und Alborz Gymnasium.«
Er sprang auf, kam zu mir und umarmte mich.
»Das ist nicht zu fassen! Jetzt erkenne ich dich. Wenn ich mich nicht irre, warst du der beste Mann in unserem Basketball Team. Habe ich recht?«
»Ich wusste nicht, dass ich der Beste war, aber ich spiele immer noch leidenschaftlich gern Basketball.«
»Was machst du hier? Bist du Hotelgast oder wartest du auf jemand?«
»Eigentlich bin ich hier, um an einem Seminar teilzunehmen. Es geht um die Weltwirtschaft im Jahre 2010. Aber der erste Teil war nicht nur langweilig, sondern fern von jeder Realität. Ich hoffe, morgen mit dem zweiten Teil etwas anfangen zu können.«
»Ein Seminar über die Weltwirtschaft? Arbeitest du in einer Bank oder Versicherung?«
»Nein, ich bin freier Journalist. Ich schreibe Artikel über Politik und Wirtschaft für verschiedene Tageszeitungen, und wenn mir etwas Zeit bleibt, schreibe ich Romane. Zwei Bücher habe ich bereits veröffentlicht und mein optimistischer Verlag meint, eines davon sei bestseller-verdächtig.«
Er strahlte mich mit seinen hellen Augen an und sagte:
»Herzlichen Glückwunsch, ich bin stolz auf dich. Du solltest mir die Titel deiner beiden Bücher verraten. Ich würde sie gerne lesen.«
»Es wäre mir eine große Freude, sie dir mit einer Widmung zu schenken. Aber was machst du hier? Nimmst du auch an einem Seminar teil?«
»Oh nein, ich warte auf jemand. Ich bin seit gestern hier und erwarte einen Kurier aus Teheran, genauer gesagt, einen Flugkapitän.
Er soll mir einen Koffer aus Teheran bringen, ein Gepäckstück, das ich selbst nicht mitbringen konnte.«
»Du warst in Teheran? Wie hast du gewagt, dort einzureisen? Ich habe gehört, sie gehen mit Leuten wie dir und deiner Familie nicht gerade freundlich um. Oder hat sich die Situation dort geändert?«
Er schwieg eine Weile. Offenbar wusste er nicht, wie er es begründen sollte. Aber dann blickte er mich ernst an und sagte:
»Ehrlich gesagt, ich kann es selbst kaum begreifen. Vielleicht war es eine emotionale Entscheidung, vielleicht war es eine Dummheit.
Wenn ich heute auf meine Reise nach Teheran zurückblicke, stelle ich erstaunt fest, dass im Gegensatz zu dem, was die Leute von mir immer behaupten - dass ich jedem Konflikt aus dem Weg gehe, dass ich ein ängstlicher, vorsichtiger Mensch, ja zu konservativ sei -, stattdessen in mir jede Menge Potenzial zu unberechenbaren Revolten und Eskapaden steckt.
Um meine Entscheidung etwas poetisch zu begründen, möchte ich einen Spruch von Leonhard Bernstein zitieren: „Um sich auf die Suche nach der Wahrheit begeben zu können, muss man trunken von der Fantasie sein.“
Ich bin vor drei Wochen nach Teheran gereist, ohne dass meine Familie davon wusste; noch schlimmer, ich wusste genau, dass die Islamische Republik Iran keine gute Meinung über meine Familie hat, besonders in Bezug auf meinen Vater und meinen Onkel. Ich habe oft die schockierenden Berichte im Fernsehen über den Umgang der Mullahs mit ihren Gegnern gesehen. Und ich bin dennoch gereist!
Ich glaube, ich habe es nur wegen meiner Mutter getan. Ich wollte ihr einmal in meinem Leben beweisen, dass ich sie liebe.«
Er schwieg wieder. Mit seiner kurzen Erklärung voller Andeutungen hatte er mich richtig neugierig gemacht.
Aber in der Cafeteria war es laut und ungemütlich.
Cyrus folgte meinem Vorschlag und wir gingen gemeinsam in eine Bar und bestellten zwei große Gläser Bier. Um wieder auf sein Thema zurückzukommen, fragte ich:
»Wohnt deine Mutter noch in Teheran?«
»Nein, weder sie noch andere nähere Verwandte«, erwiderte er kurz.
Viele Fragen brannten mir auf den Lippen, doch ich war nicht imstande, sie zu formulieren.
Ich hoffte, dass er seine rätselhafte Reise etwas deutlicher erläutern würde. Dabei konnte ich meinen neugierigen, fragenden Blick nicht von ihm wenden und er merkte es.
Endlich fuhr er fort, zu sprechen, und berichtete von seiner Reise. Er erzählte eine erschütternde Geschichte, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich hörte voller Aufmerksamkeit zu, ohne eine einzige Zwischenfrage zu stellen. Denn er erzählte von seinem neuntägigen Aufenthalt in Teheran so spannend und so bildhaft, dass ich auf einmal meine Umgebung vergaß und mich nach und nach in seinem Abenteuer verlor.
1. Ein ungewöhnlicher Auftrag
Die Idee, nach Teheran zu reisen, entstand am fünfzehnten Mai 1998, genauer gesagt, am vierzigsten Geburtstag meiner Frau. An diesem Tag sollte ein unvergessliches Fest stattfinden. Seit Wochen arbeiteten unsere Töchter konzentriert an der Vorbereitung; sie hatten den Hobbyraum geschmackvoll dekoriert, bei einem bekannten Partyservice reichlich Essen und Getränke bestellt und mehr als fünfzig Gäste eingeladen. Als Überraschung sollte um Mitternacht eine Bauchtänzerin kommen. Und ich hatte meinen Kindern versprochen, diesmal, im Gegensatz zu sonst, pünktlich zu Hause zu sein.
Kurz vor sechzehn Uhr war ich gerade dabei, meinen Schreibtisch aufzuräumen, als das Telefon leise klingelte.
Ich sagte mir, nein, nicht heute, auch wenn mein Chef, der Generaldirektor, persönlich am Apparat wäre.
Ich schaute auf den Monitor des Telefons, er blendete den Namen des Anrufers ein: Frau Hoffmann. Meine Feindin Nummer eins, die mächtigste Frau in unserer Firma. Schon bevor sie zur Abteilungsdirektorin ernannt wurde, war sie eine selbstbewusste und autoritäre Person.
Sie ist ziemlich klein, hat ein schmales Gesicht und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Während meiner zwanzig Jahre bei der Firma habe ich nie gesehen, dass sie jemals lacht oder freundlich mit jemandem umgeht. Sie ist bei jedem Gespräch sachlich, dennoch immer kritisch und spricht meist in hartem, distanziertem Tonfall. Ihre Antwort zu jedem Thema ist kurz, präzise und wohlüberlegt. Sie ist fast fünfzig und unverheiratet.
Der Gedanke, dass mir an solch einem Tag ihretwegen die Laune verdorben werden könnte, ließ mich ihren Anruf ignorieren – ich würde einfach nach Hause fahren.
Aber meine pflichtbewusste Sekretärin, Frau Klein, sprang ein und übernahm das Gespräch. Offenbar dachte sie, dass ich wie meistens ganz in meine Arbeit versunken wäre und sie das Gespräch übernehmen müsste. In wenigen Sekunden läutete es wieder und Frau Klein sagte mir, dass Frau Hoffmann darauf bestehe, mit mir zu sprechen.
Ich bat sie, das Gespräch durchzustellen, und sagte in abweisendem Ton: »Ja?« Frau Hoffmann fragte ungewöhnlich höflich, ob ich sie kurz besuchen könne. Es gehe um eine sehr wichtige Entscheidung und meine Beratung wäre hierzu dringend erwünscht.
Das war nun ganz neu. Sie hatte in den letzten Jahren nie Wert auf meine Meinung gelegt und war schon gar nicht an meiner Beratung interessiert.
Ich versuchte herauszufinden, worum es überhaupt ging, aber sie war nicht willens, mir telefonisch irgendeinen Hinweis zu geben.
Ich nehme an, du weißt nicht, dass ich seit meinem Studium in Deutschland lebe und seit mehr als zehn Jahren als Leiter der Revisionsabteilung in unserer Hamburger Firma arbeite.
Die Revisionstätigkeiten in allen Unternehmen bestehen nicht aus normalen und geregelten Aufgaben. Sie erfordern täglich mehr als zehn Stunden intensiver Arbeit, zudem das Lesen von Akten, Berichten und Fachkonzepten zu Hause oder während der Dienstreisen.
Eigentlich war dieser Job nicht meine Welt. Und er erschien mir noch unerfreulicher, als mein Vorgänger bei seinem Abschied zu mir sagte:
»Ein Revisor muss die Notwendigkeit seines Daseins ständig unter Beweis stellen. Je mehr Missstände er in seinem Betrieb aufdeckt, desto besser steht er da.
Folglich muss er permanent alle kontrollieren und möglichst viele Verstöße aufdecken.
Das heißt, wenn alle Mitarbeiter und Kunden eines Unternehmens sich ständig korrekt und ordnungsgemäß benehmen würden, wäre der Einsatz eines Revisors völlig überflüssig.«
Diese Theorie konnte ich glücklicherweise später nicht bestätigen, denn die EDV-Systeme und Betriebs-arbeitsabläufe werden von Tag zu Tag komplizierter, die Verpflichtung von Geschäftsführung bzw. Vorstand gegenüber Kunden, Gesetzgebern und Aufsichtsräten immer risikobehafteter. Folglich wurde der Einsatz von qualifizierten Revisoren existenziell wichtig für ein Unternehmen, insbesondere in Banken und Versicherungen.
Was die erforderliche Qualifikation betrifft, gibt es bei mir kaum Defizite. Die vier Jahre Studium von Informatik, Mathematik und Betriebswirtschaft in den Staaten waren eine gute Grundlage, um 1975 eine Stelle als EDV-Berater bei einem renommierten deutschen Softwarehause zu bekommen. Im Jahr 1978 wechselte ich zu einer großen Versicherungsgruppe nach Hamburg – als Leiter der Datenverarbeitung.
Zehn Jahre nach meiner Einstellung kam ein neuer Generaldirektor. Er reorganisierte fast alle Bereiche und setzte mich dann als Leiter der Revision ein.
Gleich zu Beginn führte ich dort eine völlig neue Methode ein. Meine Mitarbeiter sollten nicht wie bisher ohne Vorwarnung eine Abteilung oder ein Projektteam überfallen, um deren Arbeitsergebnisse zu überprüfen. Vielmehr sollten sie zuerst in mehreren gut vorbereiteten Workshops die Mitarbeiter für die gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften sensibilisieren; nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als nachträgliche Beanstandung.
Es gab natürlich hier und da noch immer Widerstände gegen die Arbeit der Revision. Eine dieser Rebellierenden war gerade Frau Hoffmann.
Sie mochte nicht, dass jemand sie oder ihre Mitarbeiter überprüfte. Ihr plötzlicher Wunsch, dass ich sie in ihrem Büro besuchen und, wie sie sagte, beraten solle, war fast eine Sensation und für mich persönlich ein Erfolg, ja ein Zeichen gewisser Anerkennung. Ich erwiderte:
»Ich komme gern, aber nur für einen kurzen Moment, denn ich bin eigentlich schon unterwegs nach Hause.«
Frau Hoffmann arbeitet in der vierten Etage in einem kleinen Büro. Im Gegensatz zu vielen Führungskräften unserer Firma legt sie keinen Wert auf ein repräsentatives Office. In ihrem Zimmer gibt es nur einen grauen Schreibtisch, ein altes PC-Modell, einen runden Besprechungstisch mit vier abgenutzten Stühlen sowie mehrere verschlossene Aktenschränke. Überall dort, wo die weiße Wand noch ungenutzt ist, klebt sie die Urlaubspläne ihrer Mitarbeiter an und einige Umsatzstatistiken.
Als ich in ihr Büro trat, wartete sie mit zwei mir unbekannten Herren auf mich. Sie stellte die beiden vor und kam gleich zur Sache.
»Wir haben ein kleines Problem; ich denke, Sie können uns dabei helfen.« Sie redete leise, wirkte aber aufgeregt und vermied während ihrer Ausführung jeglichen Blickkontakt. Sie fügte hinzu: »Herr Direktor Baginsky ist der verantwortliche Aktuar bei der Münchener Versicherungen AG und Herr Direktor Obermeier kommt von der International Lebensversicherungen AG. Wir möchten mit Ihnen über einen dubiosen Fall sprechen.« Sie atmete tief ein und sagte weiter: »Wir haben das Gefühl, dass man versucht, uns zu betrügen, genauer gesagt: Wir vermuten, dass ein „toter Versicherter“ dahintersteckt.
Beweise haben wir nicht, aber wir denken, dass wir mit unserer Annahme recht haben.«
Ich konnte dem nicht folgen, was sie sagte. Wie konnte ausgerechnet ein Toter Frau Hoffmann über den Tisch ziehen?
Die beiden Herren waren still und gelegentlich beobachteten sie mich, um meine Reaktion zu erforschen. Herr Baginsky war ein weißhaariger, streng blickender Mann, schätzungsweise sechzig Jahre alt, groß und etwas korpulent. Herr Obermeier war ebenfalls groß, aber schlank, mit ovalem Gesicht und leuchtend blauen Augen.
Er kam mir für seine Position als Direktor sehr jung vor, höchstens Mitte vierzig.
Frau Hoffmann legte ein Blatt mit persischer Schrift auf den Tisch und erklärte weiter:
»Die Frau eines Versicherten hat uns dieses Dokument als Beweis für den Tod ihres Mannes geschickt und gemäß den abgeschlossenen Verträgen möchte sie als Begünstigte die Versicherungssumme in Anspruch nehmen. Sie wissen ja, bei Auszahlung von hohen Schadensbeträgen, besonders an Ausländer, sind wir ausgesprochen vorsichtig. In solchen Fällen ist es üblich, dass alle anderen Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz schriftlich befragt werden, ob der Kunde noch weitere Lebensversicherungsverträge abgeschlossen hat.
Ich war sehr erstaunt, dass der Bursche nicht nur bei uns zwei Verträge in Höhe über je 250.000 DM abgeschlossen hat, sondern auch bei der Münchener Versicherungen AG in Höhe von 440.000 DM und bei der International Lebensversicherungen AG in Höhe von 610.000 DM.
Angesichts der Tatsache, dass der Versicherte ein einfacher iranischer Student in Braunschweig ist bzw. war, scheint uns hinter diesem Geschäft eine kriminelle Absicht zu stecken. Aber, wie ich bereits erwähnte, Beweise haben wir nicht, im Gegenteil, es liegt ein amtlicher Totenschein vor, beglaubigt von einem Notar.« Sie atmete tief durch, schaute mich Hilfe suchend an und sagte, was sie von mir wollte: »Sie fragen sich sicherlich, was Sie damit zu tun haben?
Ehrlich gesagt, wir sind auf Ihre iranischen Sprach- und Ortskenntnisse angewiesen. Denn Sie sind der einzige Perser in der Assekuranz, den ich kenne.« Sie überreichte mir das persische Dokument und sagte weiter: »Ich möchte Sie bitten, diesen Totenschein genau anzuschauen und mir dann zu sagen, was Sie davon halten.«
Mit Interesse nahm ich die Urkunde an mich und begann langsam zu lesen. Die Bescheinigung war vom Standesamt Teheran, Abteilung Friedhofsverwaltung, ausgestellt worden. Es wurde bestätigt, dass am dritten April 1998 ein Herr Mohammad Sahradju im Alter von neunundzwanzig Jahren bei einem Autounfall in Teheran umgekommen und am gleichen Tag auf dem Friedhof Beheschte Zahra1 beerdigt worden war.
Neben der Anschrift des Verstorbenen, Datum und Uhrzeit gab es eine Registernummer und den genauen Standort des Grabes: Allee 37, Block 3, Reihe 5. Unten auf dem Dokument war die Bescheinigung des Standesamtes handschriftlich von einem iranischen Notar ins Deutsche übersetzt und beglaubigt worden.
Nun wusste ich in der Tat nicht, wie ein Totenschein aussehen soll. Dennoch wirkte die persische Urkunde auf mich etwas dubios. Ich konnte daher das Misstrauen durchaus nachvollziehen.
»Was meinen Sie, Herr Revisor?«, unterbrach Frau Hoffmann meine Gedanken. Ich hatte den Eindruck, dass sie mich mit dem Begriff Revisor irgendwie in die Sache hineinziehen wollte. Ich legte das Dokument auf den Tisch und sagte:
»Ich würde auch sagen: Es sieht etwas komisch aus. Ich weiß nicht, wie heutzutage Dokumente im Iran ausgestellt werden, aber als ich dort lebte, wurde jede Bescheinigung mit mehreren Briefmarken und mindestens drei unterschiedlichen Stempeln versehen, gleichgültig, ob es eine Geburtsurkunde war oder eine Aufenthaltsbescheinigung. Für einen Totenschein ist dieses Papier zu dünn. Außerdem wurde die Bescheinigung am zehnten April ausgestellt.«
»Das ist ganz normal, die Beurkundung dauert normalerweise ein bis zwei Wochen.«
»Das schon, aber der zehnte April 1998 war ein Freitag und freitags arbeiten die Behörden im Iran nicht. – Haben Sie von den Hinterbliebenen keinen polizeilichen Unfallbericht erhalten?«
Alle drei tauschten einen beunruhigten Blick aus und Herr Baginsky sagte:
»Nein, es gibt keinen Unfallbericht. Laut Aussage der Ehefrau werden im Iran aus hygienischen oder religiösen Gründen die Toten noch am Tag ihres Todes vor Sonnenuntergang beerdigt. Offenbar wurde der Mann einige Stunden nach seinem Tod zu einem Friedhof gebracht und dort beigesetzt. Es gibt daher keinen polizeilichen Unfallbericht.«
»Und was wollen Sie jetzt tun? Auszahlen?«, fragte ich Frau Hoffmann herausfordernd.
»Nein, noch nicht. Laut Gesetz stehen uns einige Monate Zeit zu, um den Sachverhalt zu prüfen.«
»Was wollen Sie prüfen? Besser gesagt, wo wollen Sie prüfen?«
Sie schwieg. Sie vermied wieder jeden Blickkontakt mit mir. Irgendwie kam sie mir nervös vor.
Sie wirkte etwas verkrampft und zu meiner Überraschung sogar ziemlich schüchtern. Die beiden Herren blieben ebenfalls stumm.
Ich dachte eigentlich, das alles wäre nicht mein Problem. Sie wollten meine Einschätzung bezüglich der Echtheit des Totenscheins erfahren und dazu hatte ich auch unmissverständlich meine Meinung gesagt. Jetzt los, die Kinder warteten. Einmal in deinem Leben solltest du pünktlich zu Hause sein. Ich wollte aufstehen und das Büro verlassen, als plötzlich Frau Hoffmann ihre Karten auf den Tisch legte:
»Wir haben überlegt – es wäre eine große Hilfe, wenn Sie als gebürtiger Iraner, als Versicherungsfachmann, vor allem als erfahrener Revisor, die erforderliche Prüfung übernehmen würden, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Iran.
Sämtliche Kosten, egal, wie hoch sie sein werden, werden von allen drei Gesellschaften übernommen. Und selbstverständlich werden wir Ihnen jede Art von Aufwendung erstatten.«
Ich richtete meinen Blick scharf auf ihr blasses Gesicht und erwiderte zornig:
»Oh nein, Frau Kollegin, das kann ich nicht akzeptieren. Ich bin weder Detektiv noch habe ich Lust, diese merkwürdige Aufgabe im Iran zu übernehmen. Außerdem, als Revisor bin ich völlig unabhängig. Sie können mir keine Aufgabe erteilen. Wenn überhaupt muss solch ein Auftrag direkt vom Herrn Generaldirektor kommen.«
Frau Hoffmann war bislang ungewöhnlich friedlich gewesen. Vielleicht nahm sie etwas Rücksicht auf ihre Besucher. Aber es dauerte nicht lange, bis sie zu ihrem normalen Verhalten zurückkehrte und feindselig sagte:
»Die Idee, dass Sie in diesem Fall die Prüfung und Bewertung übernehmen sollen, stammt nicht von mir, sondern kommt von Herrn Generaldirektor Dr. Bender persönlich. Er bat mich, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und Sie ausführlich zu informieren.
Wir haben letzten Freitag mit ihm eine Sitzung gehabt. Wir sind alle der gleichen Auffassung, dass die Sache ordentlich geprüft werden muss, bevor insgesamt 1,5 Millionen DM an eine sogenannte Hinterbliebene bezahlt werden.
Sie können davon ausgehen, dass ich kein Interesse an Ihrer Mitarbeit hatte. Das war die Forderung von Herrn Dr. Bender. Er meinte, in diesem Fall hätten wir keine große Wahl. Sie sind der Einzige, der für die Klärung aller offenen Fragen – und zwar ganz diskret – Antworten finden könnte.«
Ich war ziemlich verärgert. Der Chef hätte mir vorher etwas sagen können. Warum ein Revisionsauftrag über die Leiterin der Abteilung Lebensversicherungen? Warum indirekt und ausgerechnet über Frau Hoffmann?
Herr Baginsky mischte sich in die Diskussion ein und unterbrach meine Gedanken:
»Ich habe das Gefühl, dass Sie verärgert sind über die Art und Weise, wie Ihnen unsere Wünsche übermittelt wurden. Ich kann Sie sehr wohl verstehen. Ich bin vor Jahren Leiter der Revision in einer unserer Tochtergesellschaften gewesen und ich bin Ihrer Meinung, dass ein Auftrag normalerweise von oben kommen sollte. Aber leider waren Sie letzten Freitag auf Dienstreise und das Sekretariat von Herrn Dr. Bender konnte Sie nicht erreichen.
Der Herr Generaldirektor ist fest davon überzeugt, dass Sie der beste Mann für die Untersuchung dieses Falles sind. Insbesondere, da Sie die persische Sprache beherrschen und, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch ein guter Revisor sind.«
Ich versuchte, mich zu beruhigen.
»Ich bin wohl gebürtiger Iraner, aber das letzte Mal, dass ich Teheran gesehen habe, war vor siebenundzwanzig Jahren. Nach dem Regimewechsel sind fast alle Mitglieder meiner Familie nach Europa oder Amerika ausgewandert. Ich kenne kaum noch jemanden dort. Außerdem brauche ich für eine Reise in den Iran ein Visum. Ich kenne niemanden dort, der für mich die erforderliche Bürgschaft übernimmt.«
Zum ersten Mal beteiligte sich Herr Obermeier an der Diskussion:
»Das dürfte unser geringstes Problem sein. Wir haben gute geschäftliche Beziehungen mit der iranischen Versicherung „Aban“ in Teheran. Es dauert höchstens eine Woche, bis wir eine Einladung und damit ein Einreisevisum bekommen. Diese Aufgabe übernehme ich. Sie müssen mir lediglich Ihren Reisepass und ein Passbild zur Verfügung stellen. Je schneller, desto besser.«
Ich war eine Weile still und etwas nachdenklich. Es schien alles wohl geplant zu sein. Ich brauchte Zeit, um zu überlegen. Ich stand auf und sagte:
»Frau Hoffmann, meine Herren, ich habe verstanden, was Sie von mir wollen. Ich möchte gründlich über den Sachverhalt nachdenken. Außerdem hat heute meine Frau Geburtstag und ich möchte rechtzeitig zu Hause sein. Ich werde meine Entscheidung in Kürze Frau Hoffmann mitteilen.«
Alle standen auf. Ich schüttelte die Hände von Frau Hoffmann, von Herrn Baginsky und Herrn Obermeier und verließ das Büro.
1 Der größte Friedhof Teherans.
2. Das Familienwappen
Eigentlich war ich in keiner Weise abgeneigt, diesen Auftrag zu übernehmen, auch wenn eine Reise in den Iran gefährlich zu sein schien. Um den Grund dafür zu benennen, muss ich etwa drei Monate zurückgehen.
Seit meiner Familie wegen Khomeinis Regime den Iran verlassen musste und in verschiedenen westlichen Ländern eine neue Heimat suchte, findet alle zwei Jahre in der dritten Woche im Monat März ein Familientreffen statt.
Es war die Idee meiner Mutter, dass sich die Mitglieder der Familie alle zwei Jahre treffen, um das iranische Neujahrsfest miteinander zu feiern. Mehrere Male fand dies bei meiner Mutter in San Diego statt. Aber zweimal war auch mein jüngerer Bruder in Stockholm der Gastgeber, einmal meine Tante in Barcelona, dreimal mein älterer Bruder in Amsterdam. Und vor zwei Jahren hatte ich das Vergnügen, die Organisation dieser Veranstaltung in Hamburg zu übernehmen.
Am Anfang bestand unsere Familie aus dreißig Erwachsenen und Kindern. In den letzten zwanzig Jahren hat sich diese Zahl fast verdoppelt – denn die Kinder sind inzwischen groß geworden, haben geheiratet und selbst mehrere Kinder.
Beim ersten oder zweiten Familientreffen gab es immer Streit zwischen meinen Geschwistern, Tanten oder Onkeln. Die meisten waren unglücklich, in fremden Ländern zu leben, sich an unbekannte Traditionen und Kulturen anzupassen, ganz zu schweigen von den Sprachschwierigkeiten, besonders mit Schwedisch, Holländisch oder der spanischen Sprache. Es gab unterschiedliche Meinungen bezüglich der Auswanderung und eine immer unbeantwortete Frage: Wie soll es weitergehen?
Aber was man damals von der Heimat hörte, war deprimierend. Es gab Krieg zwischen Iran und Irak, eingeschränkte Freiheit, besonders für die Frauen.
Es war wohl bekannt, dass die Frauen in der Islamischen Republik Iran nicht ohne Tschador2 in der Öffentlichkeit auftreten durften, und dabei durfte das Tuch nicht einmal eine Haarsträhne sichtbar werden lassen. Andernfalls hatte die erwischte Frau mit einer hohen Geldstrafe oder mit Peitschenhieben zu rechnen. Dieses Gesetz war für viele Frauen in meiner Familie völlig inakzeptabel!
Im Laufe der Zeit verschwanden die Träume von einer Rückkehr in die Heimat und allmählich fand man sich mit der neuen Situation ab. Einige waren sogar dankbar, dass sie den Iran rechtzeitig verlassen hatten und ihr Leben nach der eigenen Vorstellung führen konnten. Die Kinder wurden in der neuen Heimat eingeschult und die Männer und Frauen versuchten, aus der Situation das Beste zu machen. Jeder wusste, dass sein Schicksal kein Einzelfall war. Allein in Kalifornien leben seit 1985 über eine Million Iraner. Die meisten sind inzwischen eingebürgert und besitzen keine iranische Staatsangehörigkeit mehr.
Obwohl meine Mutter jedes Familienmitglied motivierte, sich im jeweiligen Gastland einbürgern zu lassen, weigerte sie selbst sich, ihre iranische Nationalität aufzugeben. Im Gegenteil, sie sagte bei jeder Gelegenheit, dass sie nach ihrem Tod neben meinem Vater im Iran beerdigt werden wollte. Sie hatte noch einen weiteren Wunsch, den sie bei jeder Neujahrs-Veranstaltung wiederholte.
Sie wünschte sich, dass unser Familienwappen in Darband3 ihr neues Zuhause in San Diego schmücken sollte. Ein fast unerfüllbares Verlangen!
Ich weiß nicht, ob du dich noch an unser Familienwappen erinnern kannst. Es wurde 1885 nach dem Entwurf meines Urgroßvaters geschmiedet und neben dem Tor unseres Hauses befestigt.
Das Wappen stellte das Bild einer glücklichen Familie dar. Auf einer achteckigen Fläche aus Kupfer, ca. 70 x 90 cm, standen mehrere Männer, Frauen und Kinder Hand in Hand vor einem riesigen Haus.
Das Gebäude im Hintergrund dieser fröhlichen Personen war in der Tat unser ehemaliges Eigenheim. Obwohl dieses Gebäude in der letzten Zeit mehrfach gründlich renoviert wurde, war es wegen seiner U-förmigen Konstruktion und seiner sonderbaren, runden Fenster leicht zu identifizieren. Am Rande des Wappens war der berühmte "Drei-Spruch von Zarathustra" eingraviert:
„Gute Gedanken“, „Gute Taten“ und „Gute Reden“.
Wir vermuteten, dass sich das Wappen noch an unserem Haus befand, aber wir wussten auch, dass das Haus uns ja nicht mehr gehörte.
Dieses Gebäude wie auch weitere Hunderte leere Häuser und Tausende unbebaute Grundstücke waren von der neuen Regierung enteignet und den Pasdaran4 oder den Stadtverwaltungen zur Verfügung gestellt worden. Die ehemaligen Eigentümer dieser Häuser wurden „Taghuti5“ genannt.
Etwa drei Monate vor dem Meeting in Frau Hoffmanns Büro war ich während des persischen Neujahrsfestes in San Diego gewesen.
Meine Schwester Susan fragte bei einem Spaziergang am Strand: »Siehst du eine Möglichkeit, unser Familienwappen durch deine Teheraner Freunde hierher zu holen?«
Ich blickte sie verwundert an und erwiderte:
»Bist du verrückt geworden? Wie stellst du dir das vor? Das Haus ist voller bewaffneter Männer! Es ist unmöglich, das Wappen von der Wand zu lösen, ohne dass jemand es merkt.«
»Es war nur eine Frage«, meinte sie achselzuckend. Ich fasste nach:
»Warum kommst du auf solch eine merkwürdige Idee?«
»Weil die alte Lady im September siebzig wird. Es gibt kein Geschenk auf der Welt, dass sie so überraschen und freuen könnte wie dieses Wappen. Du weißt, wie sehr sie an diesem Familiensymbol hängt. Hast du nicht gemerkt, dass sie bei jeder Gelegenheit davon spricht? Wir sollten uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir dieses Ding hierherholen.«
Sie hatte recht, meine Mutter war sehr stolz auf unser Wappen. Ich erinnere mich lebhaft: Während der Zeit, die ich dort lebte, durften es weder die Putzfrau noch der Gärtner anfassen. Mutter selbst hat diesen Schmuck jeden Monat mit etwas Seifenwasser und Zitronensaft gründlich gereinigt und danach mit einer speziellen Paste poliert. Sie meinte, das sei nicht nur die Visitenkarte unseres Hauses, es sei der Geist der Familie Salaar. Sie ärgerte sich maßlos, dass sie bei ihrer Ausreise dieses für sie so wichtige Stück nicht mitnehmen konnte.
Du weißt ja, Ende 1978 und Anfang 1979 herrschten im Iran Angst und Schrecken. Niemand konnte mitnehmen, was er wollte. Man war überglücklich, wenn man überhaupt das Land verlassen durfte.
Mit Hilfe einiger Freunde organisierte mein Vater die Flugreisen für meine Mutter, meine Geschwister, alle Kinder sowie für mehrere Onkel und Tanten nach Kairo. Von dort sollten sie versuchen, in ein westliches Land weiterzureisen. Er wollte in einigen Wochen seine Praxis schließen und sich dann ebenfalls ins Ausland absetzen.
Aus Respekt vor der Meinung meines Vaters, aber auch aus Angst vor der unüberschaubaren politischen Lage, packten alle Mitglieder meiner Familie ihre Koffer und verließen den Iran mit dem nächsten verfügbaren Flug. Nur meine Mutter widersetzte sich hartnäckig und blieb bei meinem Vater. Nach mehr als dreißig Jahren Ehe war es für sie undenkbar, ohne ihren Mann das Land zu verlassen, schon gar nicht in solch gefährlichen Zeiten. Der Hauptgrund für diesen eiligen Exodus meiner Familie waren die Tätigkeiten meines Vaters und meiner Onkel.
Ich glaube, du hast meinen Vater einmal gesehen. Er war einer der bekanntesten Chirurgen in Teheran. Er hat sein Studium zwischen 1937 und 1942 in Amerika absolviert. Sechs Jahre ärztlicher Tätigkeit in einem modernen Krankenhaus in San Diego hatten aus ihm einen erfahrenen Arzt gemacht. Während dieser Zeit hatte er auch leidenschaftlich an amerikanischen Börsen spekuliert. Durch seine Finanzgeschäfte konnte er sich seinen Traum erfüllen: Mit fast sechshunderttausend Dollar beteiligte er sich an der Gründung eines kleinen Pharmaunternehmens in San Diego.
Eigentlich wollte er damals nicht mehr in den Iran zurückkehren, aber bei einer kurzen Heimreise passierte, was er nicht für möglich gehalten hätte. Er lernte meine Mutter kennen; sechs Monate später heirateten sie und er blieb für immer in Teheran. Als Partner des Pharmaunternehmens in Amerika konnte er aber für sich und später für fast alle Mitglieder der Familie eine Aufenthaltserlaubnis (Greencard) in den USA beschaffen.
Das Geschäft in San Diego lief bestens und brachte ihm erheblich mehr Geld, als er in einem staatlichen Krankenhaus hätte verdienen können. Er konnte daher seine eigene Privatklinik einrichten, das alte Haus völlig renovieren, das teure Studium seiner Söhne und Töchter finanzieren und sich am Bau einer Moschee in Darband und an der Gründung eines Kinderheims südlich von Teheran großzügig beteiligen.
Er war in der Tat eine erfolgreiche Persönlichkeit. Seine Klinik war immer ausgebucht. Die meisten seiner Patienten kamen aus Nachbarländern, wie Dubai, Kuwait oder der Türkei.
Auch Mitglieder der Familie des Schahs nahmen sein ärztliches Können in Anspruch. Er gehörte zum Ärzte-Team, das 1960 die Geburt von Prinzessin Leila, der Tochter des Schahs, überwachte. Ein Jahr vor der Revolution hatte er Gholam Reza Pahlavi, den Bruder des Schahs, operiert und dieser blieb dann einige Monate bei ihm in Behandlung, erzählte meine Mutter mir später.
Ich nehme an, du weißt, dass mein Onkel ein General der Luftwaffe war, ein loyaler und zuverlässiger Soldat. Er leitete die Elite-Einheit am Persischen Golf. Ich erinnere mich, dass er nie bereit war, mit uns über Schwächen und Fehler des Schahs zu diskutieren. Es sagte immer:
»In meinem Herz haben drei große Lieben tiefe Wurzeln: Gott, Schah und Heimatland.«
Also, die beiden Brüder hatten dem Schah gedient und waren nach Logik der Revolutionäre Taghuti. Es bestand daher die große Gefahr, dass beide Brüder, wie Tausende anderer Taghuti, jahrelang im Gefängnis sitzen müssten oder sogar hingerichtet würden.
Die Unsicherheit über die Folgen der Revolution machte der ganzen Familie Angst. Wer in den letzten Jahren mit dem Schah-Regime in Berührung gekommen war, musste um sein Leben bangen.
Die Schießereien zwischen der Nationalgarde und den Anhängern von Ayatollah Khomeini nahmen täglich zu, besonders als Bakhtiyar seine Träume von der Bildung einer neuen Regierung aufgeben musste und fluchtartig nach Paris verschwand.
Khomeini meinte, dass er ein Verräter wäre. Jeder, der mit dem Schah verhandelte, sei ein Verräter.
Jeden Tag gab es zahlreiche Tote und Verletzte in Teheran. Mein alter Herr musste seinen Plan, auszureisen, von Tag zu Tag verschieben. Er arbeitete täglich über sechzehn Stunden in seiner Klinik. Ihm war gleichgültig, wer für die Revolution und wer dagegen war. Er versuchte, als pflichtbewusster Arzt, das Leben vieler Verwundeter zu retten.
Sein Wunsch, dass meine Mutter das Land verließ, nach San Diego flog und dort auf ihn wartete, wurde von ihr kompromisslos abgelehnt.
Mein Vater weigerte sich jedoch – in einer Zeit, in der täglich über fünfzig Verletzte in seine Klinik gebracht wurden –, sich seiner Verantwortung als Arzt zu entziehen. Es kam hinzu, dass sich viele Ärzte ins Ausland absetzten und die ärztliche Versorgung immer schlechter wurde.
Die Warnung vieler unserer Freunde, es sei höchste Zeit für beide, aus dem Iran zu verschwinden, wurde von meinem Vater stets ignoriert.
Und, wie gesagt, die alte Dame war auch nicht bereit, ohne ihn ins Ausland zu reisen. Dann passierte, wovor wir alle Angst gehabt hatten.
Eines Tages hatte meine Mutter das plötzliche Bedürfnis, ihren Mann in der Klinik zu besuchen. Sie erzählte uns einige Jahre später:
»Ich hatte keine Erklärung für meinen plötzlichen Besuch in seinem Krankenhaus. Ich hatte das dringende Gefühl, dass er mich brauchte. Irgendetwas beunruhigte mich.
Als das Taxi vor der Einfahrt stoppte, sah ich viele Männer und Frauen im Garten der Klinik, wo sie leidenschaftlich miteinander diskutierten. Ich wusste nicht, was los war. Ich näherte mich dem Eingangstor. Es roch überall entsetzlich nach Schießpulver. Ohne die bösen Blicke bewaffneter Männer zur Kenntnis zu nehmen, trat ich langsam in die Empfangshalle.
Meine Beine begannen zu zittern, mein Herz hämmerte heftig, als ich zerborstene Türen, zerschlagene Bilder, verspritztes Blut auf dem Boden, an den Wänden und sogar an der Decke sah. Man hatte alles demoliert, was erreichbar war; die Rezeptionstheken, die Schränke, Tische, Telefonanlagen, Lampen usw. Ich kam in den ersten Operationssaal, dort war ebenfalls randaliert worden. Hunderte Löcher in Wänden, Schränken, in der Decke und den Sanitärgeräten deuteten auf einen brutalen Überfall hin.
Ich stand da mit trockenem Mund und weichen Knien und ich hatte wahnsinnige Angst, weiterzugehen. Mich überfiel die Gewissheit, dass eurem Vater etwas passiert war. Nach einer geraumen Weile ging ich weiter zum zweiten Operationssaal. Plötzlich nahm das Gefühl des Entsetzens mir den Atem, mein Herz drohte zu bersten; der hell beleuchtete Operationssaal sah aus wie ein schreckliches Schlachtfeld. Neben erschossenen Patienten lag das ganze Operationsteam tot auf dem Boden.
Und ich sah ihn, meinen lieben Mann, bewegungslos zwischen den anderen Leichen. Sein Blutdruckmessgerät hing noch über seiner Schulter, sein weißer Kittel war rot von Blut.«
Meine Mutter weiß immer noch nicht, was dann passierte. Sie fand sich einige Tage später mit gebrochenem Herzen und unerträglichen Kopfschmerzen in einem staatlichen Krankenhaus im Süden von Teheran wieder.
Unser langjähriger Gärtner, Djawad Khan, wurde vom Hausmeister der Klinik über dieses Massaker informiert. Er packte einen Koffer für meine Mutter, holte sie aus dem Krankenhaus ab und brachte sie zu seiner Familie in Rasht, einer Stadt am Kaspischen Meer.
Die völlig erschütterte und angeschlagene Frau blieb fast einen Monat in diesem ziemlich isolierten Haus, bis wir für sie eine Reise nach Pakistan organisiert hatten. Von dort wurde sie nach San Diego gebracht. Als Inhaberin einer gültigen Greencard konnte sie ohne Einreisevisum in die USA fliegen. Finanziell ging es ihr auch gut, denn die Rendite aus der Beteiligung an den Pharmaunternehmen war erfreulich. Aber der Schock hatte sich tief in ihre Seele eingegraben. Ihr Gesicht war von Trauer und Enttäuschung gezeichnet. Sie sprach kaum. Sie ging den ganzen Tag an den Strand von San Diego Beach und betrachtete das Meer und die Seevögel.
Im Laufe der Zeit, insbesondere nach der Geburt einiger Enkelkinder, fing sie allmählich an „normal“ zu leben und wurde wieder unsere mächtige, aber auch liebevolle Mutter.
Einige Jahre später erfuhren wir, wie es zu diesem Blutbad gekommen war. Es gab zwei Versionen: Eine stammte vom Hausmeister der Klinik. Er erzählte einem meiner Schulkameraden, Zino Darbandi, dass schon um elf Uhr morgens ein Militärjeep zwei schwer verletzte Soldaten von der Elite-Einheit in die Klinik gebracht hatte. Unmittelbar danach begann mein Vater, gemeinsam mit seinem Team, einen der Soldaten zu operieren. Offenbar aber war der Jeep von Revolutionären verfolgt worden. Kurz nach Beginn der Operation strömten Hunderte von aufgeputschten, bewaffneten Männern in die Klinik, randalierten und zerstörten alles, was ihnen in den Weg kam. Ihre Aufforderung, dass mein Vater mit der Operation aufhören sollte, wurde von ihm entschieden abgelehnt. Er beschimpfte die hemmungslosen Aufständischen und bezeichnete sie als Barbaren; das hatte für ihn und sein Team ein fatales Ende.
Die zweite Version wurde von einem Anwohner gegenüber der Klinik vertreten. Er war der Auffassung, mein Vater und sein Bruder hätten seit Tagen auf der Liste von Hojattolah Khalkhali gestanden, dem berühmten Henker der Revolution. Beide Brüder sollten Anhänger von Zarathustra gewesen sein.
Am gleichen Tag wurden dann weitere dreißig Ärzte, Offiziere und Beamte auf gleiche Art und Weise getötet.
Zurück zu meiner Reise nach Teheran. Außer der vagen Hoffnung, vielleicht das Familienwappen wiederzubekommen, gab es einen weiteren Grund dafür, in meine Heimat zurückzukehren. Ich hatte schon immer am Grab meines Vaters niederknien und ihm sagen wollen, wie sehr ich ihn vermisste. Im Namen der gesamten Familie wollte ich mich bei ihm dafür bedanken, was er für uns alle getan hatte. Ich wollte ihm herzlich versichern, dass wir ihn nie vergessen und er uns immer als lieber und bester Vater in Erinnerung bleibt.
Das Thema „Iranreise“ habe ich aber bei der Geburtstagsfeier meiner Frau aus guten Gründen nicht angesprochen.
Ich wartete auf eine günstige Gelegenheit, um diese Frage mit ihr zu beraten. Ich wusste, dass sie von diesem Vorhaben schockiert sein würde. Sie traute dem neuen Regime im Iran überhaupt nicht, besonders die negativen Berichte in Fernsehen und Presse ließen den Wunsch bei ihr gar nicht erst aufkommen, einmal meine ehemalige Heimat zu besuchen.
Ein weiterer Grund, weshalb ich dieses Geheimnis meiner Familie noch nicht verraten wollte, war, dass es keinesfalls sicher war, ob Herr Obermeier mir ein Visum beschaffen könnte.
Am nächsten Tag besuchte ich Frau Hoffmann, überreichte ihr meinen Reisepass und ein Passbild. Dazu sagte ich: »Ichwerde diesen Auftrag nur unter folgenden Voraussetzungen übernehmen:
Erstens: Diese Reise muss absolut diskret behandelt werden. Nicht einmal meine Mitarbeiter dürfen davon erfahren. Wir erzählen allen, dass ich eine unserer Tochtergesellschaften in England besuche.
Zweitens: Ein Mitarbeiter der beteiligten Versicherungsunternehmen sollte mich bei dieser Reise begleiten. Schließlich würden die beiden Gesellschaften über achthunderttausend DM sparen, wenn sich herausstellt, dass der Totenschein eine Fälschung ist.
Außerdem könnte mein Partner die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn ich in Teheran Schwierigkeiten, z. B. Probleme mit der Behörde, bekäme.
Drittens: Die Reise sollte spätestens in zwei Wochen stattfinden, da ich ab Juli mit meiner Familie Urlaub machen wollte. Abgesehen davon, dass man es im Spätsommer in Teheran nicht aushalten kann.«
Frau Hoffmann war mit allen Bedingungen einverstanden. Sie sagte, sie hätten inzwischen auch über mögliche Probleme mit der Behörde im Iran nachgedacht. Herr Obermeier unterhalte enge Beziehungen mit der iranischen Handelskammer, einem iranischen Versicherungsunternehmen sowie mit der deutschen Botschaft in Teheran. Er würde für ausreichende Unterstützung sorgen.
Eigentlich hatte ich keinen Grund, vor den neuen iranischen Machthabern Angst zu haben. Ich hatte Iran im Jahr 1971 auf legale Weise verlassen. Ich war weder im Iran noch im Ausland politisch tätig gewesen.
Dennoch machte ich mir manchmal etwas Sorgen, denn schließlich war ich der Sohn eines sogenannten Taghuti.
Was mir Tag und Nacht zu schaffen machte, war mein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau. Ich war sicher, sie würde völlig durchdrehen, wenn sie wüsste, was ich vorhatte. Wahrscheinlich würde sie alles daransetzen, meine Entscheidung zu ändern.
Sie ist eine wunderbare Frau, die mir zwanzig Jahre lieb und treu geblieben ist und mir drei reizende Töchter geschenkt hat. Wir haben uns während meines Studiums in den USA kennengelernt und haben 1978 in ihrer Heimat, in Lyon, geheiratet. Sie stammt aus Frankreich, ist jedoch als Tochter eines Diplomaten in Amerika groß geworden. In allen Ehejahren haben wir nie irgendein Thema vor dem anderen geheim gehalten. Wir waren wie eine Seele in zwei Körpern. Und jetzt behandelte ich sie wie eine Fremde!
Ich fühlte mich dabei überhaupt nicht wohl. Schuldbewusst und nervös lief ich zu Hause herum, konnte mich aber auch nicht entschließen, darüber zu reden. Das merkte sie natürlich und machte ab und zu eine entsprechende Bemerkung. Es gab eine spürbare Spannung zwischen uns. Zweimal wollte ich ihr alles erzählen, aber dann dachte ich, es wäre besser, zu warten, bis es absolut sicher sei, dass ich überhaupt reisen würde.
Was mich die ganze Zeit bei Laune hielt, war meine private Mission, das Familienwappen aus Iran herauszuschmuggeln. Ich stellte mir lebhaft vor: Zum siebzigsten Geburtstag meiner Mutter würden wir das Wappen an der Stelle montieren, wo sie es immer haben wollte.
Dann würden wir sie mit verbundenen Augen dorthin führen ... und sie diesen glücklichen Moment genießen lassen. Sie sollte das Symbol ihres Lebens berühren und ihren zurückgewonnenen Stolz wieder leidenschaftlich polieren können!
Dennoch stellte sich die Frage, die ich immer mit einer gewissen Angst zu vermeiden suchte: Wie sollte ich das Wappen von einem Haus voller bewaffneter Männer entwenden und nach Deutschland transportieren?
Am Dienstag, dem zweiten Juni, war es so weit. Frau Hoffmann sprach mir schon um sieben Uhr eine Nachricht auf meine Mailbox. Ich sollte um vierzehn Uhr in ihr Büro kommen. Ich hatte gemischte Gefühle; einerseits hoffte ich, dass es mit dem Visum nicht geklappt hätte und ich mich von dieser doch großen Sorge befreien könnte. Andererseits würde es mich sehr freuen, wenn ich durch diese einmalige Chance meine Mutter glücklich machen könnte.
Als ich in das Büro von Frau Hoffmann trat, bemerkte ich, dass neben Herrn Obermeier ein mir unbekannter Herr saß. Er war Mitte dreißig, schlank, hatte dunkelblondes Haar und frech blickende blaue Augen.
Jeder betrachtete mich ganz freundlich. Nach dem üblichen Händeschütteln stellte Herr Obermeier mir den neuen Herrn vor:
»Das ist Herr Bruns, Michael Bruns, Mitarbeiter unserer Organisationsabteilung. Er wird Sie bei dieser Reise begleiten, so wie Sie es gewünscht haben.«