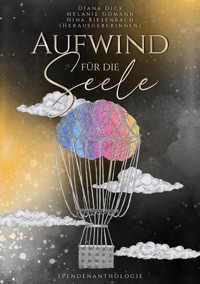
Aufwind für die Seele E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie hast du dich gefühlt, als du das letzte Mal Angst hattest? Wann hast du dich zuletzt sicher gefühlt? Wann wurde Lächeln zu einer Herausforderung? Fragen, die nicht jeder Mensch spontan beantworten kann. Ist die Psyche nicht mehr gesund, verstecken sich viele hinter Masken. Aus Furcht vor Unverständnis spielen sie ihrem Umfeld vor, alles sei in Ordnung. Denn trotz intensiver Aufklärungsarbeit gelten psychische Erkrankungen und mentale Probleme noch immer als gesellschaftliche Makel, die gerne totgeschwiegen werden. Damit muss endlich Schluss sein! Mit dieser Anthologie möchten die Autorinnen und Autoren dazu beitragen, Vorurteile gegenüber psychisch belasteten Menschen abzubauen. Ihre Kurzgeschichten sollen Betroffenen Mut machen und gleichzeitig den Außenstehenden zeigen, dass eine verletzte Seele ein ganz besonderes Pflaster braucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Stigma tut weh – nieder mit dem Stigma!, Nora Hille
Und dann bin ich glücklich, Diana Dick
Sturmwolkenblau, Melanie Gömann
Alles Routine, Nina Biesenbach
Wer, wenn nicht wir?, Lex Smithereens
Das Reich hinter den Wolken, Ilka Mella
Trigger mich, Simone Heisz
Ein weiterer Versuch, Scarlett Henning
Martin Ehrmann jun., Finn Crawley
Zwischen den Ohren, Martina Rens
Wächter, Nadia Raia
Rot, Lucia Barreto Cabrera
Mamas Wolke, Petra Baar
Amber, Daniela Kilb
Eine Kanne voller Trost, Emilia Laforge
Ungesichert, Anne Polifka
Die filigrane Fee, Enna Bée
Kalter Krieger, Inken B. Weiss
Druck, Blaenk Jones
Die unvollkommene Drei, Nadine Opitz
Eben wegen Regen leben, Adam Staubbart
Elefantentrampeln, Salia Jean
Ausgebrannt, Yana Svelush
Zähler im Kopf, Karla Schulz
Die surreale Symmetrie und das Kaleidoskop der Wahrnehmung, Ronja Anna-Luzia Schmuck
Seitdem, Lena Franke
Die Kriegerin, Stefanie Hempen
Maskenball, Gerd Schäfer
Von Dunkelheit und Licht, Ulrike Asmussen
Ben, Juma Jaro
Flut, Sonja Zimmer
Taktgefühl, Anea Fähe
Danksagung
Über die Herausgeber
Vorwort
Die Idee für diese Anthologie kam mir beim Lesen eines Instagram-Posts. Es ging um das Thema Selbstwertgefühl und ich erinnere mich noch, dass der Verfasser schrieb, er wünschte, er hätte mehr davon, und er fühle sich oft einsam und nichts wert.
Damit steht er nicht allein. Viele Menschen haben negative Gedanken und Gefühle. Viele Menschen kämpfen mit Problemen, die sie nicht aussprechen wollen, aus Angst, verurteilt oder belächelt zu werden. Aus genau diesem Grund – um mehr Aufmerksamkeit und Verständnis für psychologische Themen zu schaffen – wollte ich diese Anthologie veröffentlichen.
Da so etwas mit mehreren leichter ist als allein, habe ich Melanie und Nina mit ins Boot geholt. Sie waren sofort begeistert von der Idee. Genau wie ich sehen sie die Notwendigkeit, psychischen Erkrankungen und mentalen Belastungen zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Wir möchten, dass es genauso normal wird, über mentale Schwierigkeiten zu sprechen wie über ein gebrochenes Bein.
Das große Problem bei allem, das sich im Kopf abspielt, ist die Schwierigkeit, dies nachzuvollziehen – insbesondere von Menschen, denen es gut geht. Die mit sich im Reinen sind und die sich nicht einmal annähernd vorstellen können, wie beispielsweise eine Depression jemanden daran hindern kann, aus dem Bett aufzustehen.
Dabei wird das Wichtigste so gerne vergessen: Es ist nicht wichtig, zu verstehen, wieso jemand fühlt, wie er fühlt, sondern nur, dass er es tut.
Menschen wollen immer verstehen. Sehnen sich nach dem Wieso. Doch besonders bei mentalen Problemen ist es häufig schwierig, diese nachzuvollziehen. Ein gebrochenes Bein können sich die meisten Menschen problemlos vorstellen. Ein Gipsverband ist, anders als zum Beispiel eine Depression, schließlich sichtbar. Viele haben sich vielleicht schon selbst einmal etwas gebrochen und kennen den Schmerz. Aber eine gebrochene Seele, einen chaotischen Kopf – das versteht nicht jeder.
Unter dem Hashtag #DiMeNiPSYCH riefen wir auf Instagram dazu auf, Geschichten zum Thema »psych-« zu verfassen. Die Rückmeldung war überwältigend: So viele Autorinnen und Autoren haben Texte zu ganz unterschiedlichen psychologischen Themen eingereicht, dass wir für dieses Buch eine Auswahl treffen mussten.
Natürlich können wir hier nicht alle Probleme, nicht alle Krankheitsbilder aufgreifen, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, sichtbarer, begreifbarer zu machen, was unsichtbar, aber allgegenwärtig ist.
Wir hoffen, mit dieser Anthologie etwas mehr Licht in die Dunkelheit zu bringen, die mentale Probleme umgibt. Die gesellschaftliche Akzeptanz zu steigern und es Betroffenen leichter zu machen. Das Thema »psych-« zu einem Thema zu machen, über das man offen reden kann.
Der Erlös aus dem Verkauf dieser Anthologie kommt übrigens der Organisation Irrsinnig Menschlich e. V. (www.irrsinnig-menschlich.de) zugute. Diese bringt das Thema psychische Gesundheit präventiv an die Schulen und macht, wie sie es selbst ausdrücken, seelische Krisen besprechbar. Also genau das, was wir auch wollen.
Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: viel Spaß mit den kreativen und vielfältigen Kurzgeschichten!
Diana Dick
Stigma tut weh – nieder mit dem Stigma!
von Nora Hille (@norahille_autorin)
Ein Appell für mehr Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung – anstelle von Ausgrenzung und Stigmatisierung
Das Verurteilen und Ablehnen psychisch Kranker in unserer Gesellschaft ist weit verbreitet – und fällt oft als schmerzhafte Selbst-Stigmatisierung auf die Betroffenen zurück. Eigentlich doch seltsam, wenn gut ein Viertel der deutschen Erwachsenen psychisch krank ist, oder?
Konkret sind in Deutschland jährlich 27,8 % der erwachsenen Bevölkerung akut von einer psychischen Erkrankung betroffen: Das entspricht 17,8 Millionen erwachsener Menschen!1 Es ist also davon auszugehen, dass jeder bzw. jede Lesende dieses Textes mindestens einen Menschen mit psychischer Erkrankung kennt. Menschen wie deine beste Freundin, ein Sportkamerad, dein Nachbar, der Verkäufer an der Supermarktkasse, die vielbeschäftigte Managerin, ein Familienmitglied oder eine Arbeitskollegin. Menschen wie du und ich.
Nicht immer wissen wir von ihnen, denn viele möchten sich nicht offen mit ihrer psychischen Erkrankung zeigen. Sie haben Schamgefühle aufgrund der Diagnose und Angst vor Ablehnung – gerade Letzteres leider häufig nicht zu Unrecht.
Warum unterliegen psychische Erkrankungen, obwohl so weit verbreitet, so häufig einer Tabuisierung? Warum werden psychisch Kranke von der Gesellschaft stigmatisiert2, also abgewertet, angegriffen, benachteiligt und sozial ausgegrenzt?
Die Gründe für Stigmatisierung psychisch kranker Mitmenschen sind vielschichtig und liegen zumeist in Vorurteilen, Ängsten und Unsicherheit. Diese haben mehrere Ursachen:
kein (wissentlicher) persönlicher Kontakt zu psychisch Kranken
fehlendes oder falsches Wissen über Krankheitsbilder
klischeehafte, überzeichnete oder einseitige Darstellung psychisch Kranker in den Medien, (Horror-)Filmen und Büchern
Verbrechen durch psychisch kranke Täter
Noch vor Kurzem war mir der Begriff Stigmatisierung nicht geläufig – geschweige denn, dass ich auf die Idee gekommen wäre, ihn auf mich und meine persönliche Situation anzuwenden. Der Begriff »Stigma«, der Brand- oder Wundmal bedeutet, war zwar nicht Teil meines aktiven Wortschatzes, doch habe ich das damit bezeichnete verletzende Verhalten anderer mir gegenüber bereits mehrfach erlitten: die schmerzhafte Stigmatisierung, also Ablehnung und Entwertung meiner Person, aufgrund meiner psychischen Erkrankung.
Von nahezu unerträglicher Schmerz-Intensität und lange Zeit auch mein Selbstbild prägend waren für mich die drei folgenden Aussagen:
eine frühere Schulfreundin: »Bei deinem Tablettenkonsum würde ich mich erschießen.«
ein Psychiater: »Jemand wie Sie darf niemals Kinder bekommen.«
meine Mutter: »Die ist die Irre in unserer Familie.«
Drei Sätze, mit denen ich in den zurückliegenden fünfundzwanzig Jahren konfrontiert wurde. Sätze, die übergriffig sind und so sehr schmerzen, dass sie tiefe Wunden schlagen – Stigmata eben. Sätze, nein: Verurteilungen, die ich zu hören bekam, weil ich eine bipolare Erkrankung habe. Weil ich in meinem Leben seit dem Alter von Anfang Zwanzig immer wieder depressive und hypomanische Phasen durchlebt habe; auch Mischzustände kenne ich.
Zwei der oben zitierten Stigmatisierungen wurden mir mitten ins Gesicht geschleudert:
Einmal erst vor Kurzem, als eine frühere Schulfreundin meinte, mir mitteilen zu müssen, mein Leben sei wegen der bipolaren Erkrankung und der Medikamente, die ich deswegen regelmäßig einnehme, nicht lebenswert.
Ein anderes Mal vor über zwanzig Jahren. Ich war als junge, verzweifelte Frau, beinahe noch ein Mädchen, mit einer ersten manischen Episode in einer psychiatrischen Klinik vorstellig geworden. Der Psychiater dort hatte auf meine verzweifelte Aussage »Aber irgendwann werde ich Kinder bekommen« nichts Besseres zu erwidern als eben diese schwere Stigmatisierung, jemand wie ich dürfe niemals Mutter werden.
Was gab ihm das Recht, mich derart zu verurteilen? Mich in die Schublade »ungeeignet als Mutter« zu stecken? Nichts gab ihm das Recht – im Gegenteil! Dieser Arzt hat missbräuchlich an mir als Patientin gehandelt. Seine Aussage wurde von mir unbewusst als negativer Glaubenssatz übernommen. Damit bekam diese Aussage des Psychiaters große Macht über mich und meinen Lebensverlauf. Dieser Satz hat ein Jahrzehnt später beinahe die Beziehung zu meinem Mann zerstört. Und er hätte beinahe verhindert, dass wir Eltern und damit eine glückliche Familie wurden.
Meine Mutter hingegen sagt es mir nicht ins Gesicht, sondern bezeichnet mich in meiner Abwesenheit – vor meinem Bruder und dessen Ehefrau – regelmäßig als »die Irre unserer Familie«.
Warum macht sie das? Aus einem einfachen Grund: Wenn ich doch »unzurechnungsfähig« bin, ist jede Kritik, die von mir kommt, irrelevant. Wenn sie mich zu einer »Irren« abwertet, zählen meine Worte nichts. Das macht es für sie sehr komfortabel, denn jede mögliche Kritik meinerseits wird für sie dadurch bedeutungslos, erlaubt es ihr gleichsam, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
Wer aber bin ich wirklich?
Eine Frau, die niemals Mutter hätte werden dürfen?
Die »Irre der Familie«, die sich wegen ihres Tablettenkonsums am besten suizidieren sollte?
Nein. All das bin ich sicher nicht!
Stehen diese drei verletzenden und stigmatisierenden Äußerungen in irgendeinem Zusammenhang mit meiner Persönlichkeit?
Nein, das tun sie nicht!
Diese drei Sätze haben NICHTS mit mir zu tun. Aber das musste ich erst lernen, und der Weg dahin war lang und schmerzlich. Diese drei Sätze haben nichts mit mir zu tun, sondern sie verweisen zurück auf ihre Sprecher. Auf deren Engstirnigkeit, Berührungsängste oder gar Boshaftigkeit.
Über zwei Jahrzehnte habe ich meine Erkrankung vor der Außenwelt verborgen. Aus Angst vor Ablehnung und damit unbewusst vor Stigmatisierung – und aufgrund meiner eigenen Scham. Dass diese Scham offiziell als Selbst-Stigma bezeichnet wird, dass sie genau ein Echo auf die Verurteilung psychisch Kranker durch die Gesellschaft und die eigenen unbewussten Vorbehalte darstellt, war mir bis vor Kurzem nicht bewusst. Ich wollte schlicht nicht negativ auffallen.
Wollte weder mir noch meinen Kindern gegenüber Ablehnung riskieren.
Was die bipolare Erkrankung angeht, bin ich zur Expertin in eigener Sache geworden: Mit Anfang Zwanzig erkrankt, hatte ich diesen Umstand zunächst für ein Jahrzehnt verdrängt und still an meinen Depressionen gelitten, die mir eine unbeschwerte Lebenszeit in jungen Jahren nahmen. Dann aber, direkt nach der Geburt unseres ersten Kindes, bekam ich einen heftigen manisch-verzweifelten Krankheitsschub, ein Klinikaufenthalt wurde nötig, die Diagnose »bipolar« gestellt. Innerhalb weniger Tage war mir klar, dass ich Managerin meiner Krankheit werden und zu 100 % mit den Ärzten und Therapeuten kooperieren musste, wollte ich meine kleine Familie nicht verlieren.
Über die Jahre war es häufig schwer, mit den intensiven Krankheitsschüben zurechtzukommen, mit Depressionen oder (hypo-)manischer Verzweiflung.
Doch nach und nach lernte ich immer mehr über die bipolare Erkrankung und wie ich ihr mit Medikamenten und erprobten Alltagsstrategien begegnen kann, sodass ich zu einem angstfreien Dasein zurückfinden und ein Mehr an mentaler Stärke gewinnen konnte. Und genau dies ermöglichte meinem Mann und mir die Entscheidung für unser zweites Kind.
Dass man trotzdem mit seinem Leben und seiner psychischen Erkrankung gut zurechtkommen kann, zählt für Personen, die ihre Mitmenschen wegen ihrer psychischen Erkrankungen derart verurteilen, nicht. Denn oft wollen sie eigenen Ängsten ausweichen oder auf andere herabsehen und sie herabwürdigen – vermutlich, um sich so selbst besser oder überlegen zu fühlen, ihr in Wahrheit »mickriges Ego« zu füttern.
Vielfach geschieht das Stigmatisieren psychisch Kranker jedoch versehentlich und unbewusst: Wenn nämlich einfach nicht darüber nachgedacht wird, was die eigenen Worte bei Betroffenen auslösen können. Und genau deswegen ist es so wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren.
In dieser Anthologie sind Texte vieler Autorinnen und Autoren versammelt, die mutig und offen zeigen, wie sich psychische Erkrankungen anfühlen, welche persönlichen Auswirkungen sie haben können. Möge dieses engagierte Buch viele Lesende finden! Denn ein gesellschaftlicher Wandel im Umgang mit psychisch kranken Menschen kann nur gelingen, wenn Wissen zunimmt und Verständnis wächst. Literatur, die emotional berührt und gleichzeitig informiert, kann dafür eine wunderbare Vermittlerin sein.
Weg von Ausgrenzung und Stigmatisierung, hin zu mehr Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung: Mentale Gesundheit geht uns alle an, individuell wie gesellschaftlich. Einen offenen Umgang miteinander zu erreichen, auf Augenhöhe, ist eine enorme Herausforderung. Nehmen wir sie gemeinsam an.
1 Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (dgppn) stellt regelmäßig Basisdaten zu psychischen Erkrankungen in Deutschland bereit. Hier aus folgender Quelle: Dossier »Psychische Erkrankungen in Deutschland: Schwerpunkt Versorgung. Eine Publikation der DGPPN (dgppn)«, 2018, S. 10. Online verfügbar unter: https://www.dgppn.de/_Resources/Persis-tent/f80fb3f112b4eda48f6c5f3c68d23632a03ba599/DGPPN_Dossier%20web.pdf (Stand: 16. Januar 2023).
2 »Das Wort Stigma kommt aus dem Griechischen und bedeutet ›Wundmal‹. Stigmatisierung heißt also wörtlich, ›jemandem Wundmale zuzufügen‹ oder ihn zu ›brandmarken‹. Im übertragenen Sinne spricht man von Stigmatisierung, wenn man ein bestimmtes Merkmal (z. B. depressiv sein) mit einer negativen Eigenschaft oder einem Vorurteil (z. B. ist faul) verknüpft.« Zitiert wird Glaßmeyer, Anke (Psychotherapeutin) mit ihrem Online-Artikel »End the stigma – Was du als Therapeutin für die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten tun kannst«, veröffentlicht am 5. Februar 2019. Quelle: https://psylife.de/magazin/psychotherapie/entstigmatisierung-psychischer-krankheiten(Stand: 16. Januar 2023).
Und dann bin ich glücklich
von Diana Dick (@di_di_author)
Chris lehnte sich entspannt zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
Der Bürostuhl neigte sich mit einem leisen Quietschen nach hinten. Verärgert verzog er das Gesicht. Gestern schon hatte er Maria gesagt, sie solle sich um dieses unerträgliche Geräusch kümmern. Stattdessen saß sie heute früh mit frisch manikürten Nägeln hinter ihrem kleinen, unordentlichen Tisch und begrüßte ihn, als hätte sie sich nichts zuschulden kommen lassen. Einmal mit Profis arbeiten.
Es klopfte. Chris setzte sich auf, rollte an seinen Mahagonitisch und legte beide Hände an die Tastatur. Der Bildschirm war dunkel.
»Herein«, sagte er mit tiefer Stimme. Seine Stimme flößte Respekt ein. Er wusste das, sein Vater wusste das. Auch seine vier Brüder wussten das. Obwohl mindestens Anton diesen Umstand hasste. Anton war nämlich, anders als er selbst, ein viel fähigerer Geschäftsmann. Wenn er nicht so wenig Respekt ausstrahlen würde wie ein Regenwurm, hätte Vater ihn in die achtzehnte Etage gesetzt. An diesen schönen, glänzenden Tisch. Umgeben von perfekt geputzten Fenstern.
So saß Chris hier. Unfähig, aber charismatisch und selbstsicher. Er hatte absolut keine Ahnung, was er hier tat. Genau genommen wusste er nicht einmal, womit Vaters internationales Unternehmen die vielen Millionen verdiente. Aber es war ihm auch egal. Er war das Gesicht. Das schöne Lächeln. Der Grund, warum Frauen kreischend an Pressekonferenzen teilnahmen, wenn er sie gab. Und Vater war zufrieden. Nicht stolz. Nein, das war er nie. Aber zufrieden.
Chris hatte das perfekte Leben. Verdiente einen Haufen Asche mit seinem Perlweiß-Lächeln. Jenes, das sein Vater finanziert hatte. Genau wie die stolze, gerade Nase, die bis vor einigen Jahren weder stolz noch gerade gewesen war.
Das Resultat von zu vielen Schlägereien auf dem Schulhof. Es war nicht so, dass er sich prügeln wollte. Nur wenn ihn jemand provozierte, ging er darauf ein.
Mutter nannte ihn immer ihren kleinen Jähzorn. Er wusste nicht, ob das liebevoll oder abwertend gemeint war. Sein Glas war halb voll und er entschied, es als liebevoll aufzufassen.
Die dicke Eichenholztür mit der eingelassenen Milchglasscheibe schwang auf und Tino trat ein. Tino – Antons bester Freund seit Kindertagen. Und hier im Unternehmen ›Mädchen für alles‹. Chris war sich nicht ganz sicher, was das bedeutete, wollte es aber, um ehrlich zu sein, auch nicht wissen.
Sein Leben hier war nur gespielt. Er wollte keine Geschäfte führen.
Er wollte tanzen. Schon immer.
In jeder freien Minute bewegte er sich über irgendwelche Tanzflächen. Salsa-Bars, Techno-Schuppen, Schlager-Zelte – alles war ihm recht. Solange er nur tanzen durfte. Umgeben von anderen, die es genauso liebten wie er.
Seine Gedanken drifteten für eine Sekunde zu letzter Nacht. Zu Gina. Der blonden, vollbusigen Schönheit, die er stehengelassen hatte, weil ihn Frauen so wenig interessierten wie der Fussel, der unter dem A der Tastatur klemmte. Eine Enttäuschung mehr, wie Vater zu sagen pflegte. Gleichzeitig trichterte er ihm ein, es bloß für sich zu behalten. Auch wenn er es als Ratschlag verkaufte, wusste Chris, was es war: eine Drohung. Drohungen waren schon immer Vaters Lieblingserziehungsmethode gewesen. Ob das ein eigenes Kapitel in ›So erziehst du deine Kinder richtig‹ war?
»Chris«, sagte Tino und schloss dabei die Tür.
Seine Worte rissen Chris aus seinen Gedanken. »Tino«, erwiderte er gelassen, beinahe amüsiert. Weil er wusste, wie sehr Tino dieser Ton ärgerte. Immerhin kannte er den Hünen schon seit dem Kindergarten. Seit seinem, nicht dem von Tino. Anton und er waren fast zehn gewesen, als er seinen Kumpel zum ersten Mal mit nach Hause brachte. Genauso alt waren sie gewesen, als sie Antons jüngsten Bruder, mit seinen zarten vier Jahren, zum ersten Mal verprügelt hatten. Es sollte nicht das letzte Mal sein.
Viele Jahre hatte Chris nicht verstanden, wieso. Als Kind begriff er nicht, dass sie seine damals niedliche, jetzt umwerfende Ausstrahlung verachteten. Alle sahen ihn. Knuddelten ihn. Küssten ihn. Jeder liebte das süße Kind, während Anton nicht selten verächtliche Blicke und gerümpfte Nasen vorgesetzt bekam.
Er war wirklich vieles – schön gehörte nicht dazu.
Unter seinem Arm trug Tino ein Paket, das er vor Chris auf den Tisch stellte.
Ohne erklärende Worte wohlgemerkt.
Unbeeindruckt sah Chris ihn an.
»Oh, ein Geschenk?«, stieß er schließlich übertrieben begeistert aus und zog es an sich heran, wobei er die heute noch unbenutzte Tastatur zur Seite schob.
»Für mich? Aber ich hab doch noch gar nicht Geburtstag.«
Gleichgültig zuckte Tino mit den Schultern. »Ich soll es dir von Artur, Anton, Adam und Arno geben.«
Chris musterte das braune, schlichte Päckchen, das etwa die Größe eines Schuhkartons hatte. »Wieso?«
Tino drehte sich bereits wieder zur Tür. »Keine Ahnung. Jemandem wie mir sagt man so was nicht.«
Ja, is’ klar. Wer’s glaubt, dachte Chris und unterdrückte ein abfälliges Schnauben. Wenn hier einer über alles Bescheid wusste, dann war es Tino Jäger.
»Dann richte meinen Brüdern doch meinen herzlichen Dank aus«, sagte Chris noch.
Ohne darauf einzugehen, verließ das Mädchen für alles das Büro. Wäre dies ein Königreich, wäre er wohl so etwas wie ein Berater gemischt mit dem ersten Ritter oder so. Jemand, der alle Schlachten anzettelte und sie auch ausfocht.
Nur leider nicht meine, schoss es Chris unglücklich durch den Kopf. Würde ihm etwas an der Firma und dem Job liegen, wäre das hier die Hölle.
Gut, dass es ihm scheißegal war. Wer brauchte schon Brüder, die einen mochten?
Ein Paket von seinen Brüdern. Er bezweifelte, dass sie ihm bloß etwas Gutes tun wollten. Nie im Leben. Selbst Arno, der mit seinen 28 Jahren am nächsten an ihm dran war, konnte nichts mit ihm anfangen. Ab und an ertappte er sich dabei, dass er sich fragte, ob er wirklich das Kind seiner Eltern war. Er war so anders. Und nicht nur ein bisschen. Zwischen ihm und dem Rest seiner Familie lagen ganze Welten. Selbst seine Onkel und Tanten wunderten sich manchmal über ihn. Gleichzeitig hatten sie damals von dem kleinen Chrissy nicht genug bekommen können. Weil er ja so putzig war.
Putzig. Wer sagte so was? Was war das überhaupt für ein Wort?
Die Augen wieder auf dem Paket, überlegte er, was er damit machen sollte. Er sah sich schon damit zum Fenster gehen, das Päckchen wie eine Bombe vor sich ausgetreckt, und es rausschmeißen. Wie er seine Brüder kannte, könnte es durchaus eine Bombe sein. Oder ein Boxhandschuh, der ihm eine verpasste, sobald er die Deckel zur Seite klappte. Oder ein abgetrennter Pferdekopf. Immerhin waren seine Brüder große ›Der Pate‹-Fans.
Er erwartete alles – außer etwas Nettem.
Mit einer Hand strich er sich über das Gesicht und durch die Haare. Dann drehte er das Päckchen einmal und schob es ein Stück weg von sich. Ein stechender Schmerz durchzuckte seinen rechten Mittelfinger. Fluchend hob er ihn vor das Gesicht. Ein feiner Blutstropfen quoll aus einem winzigen Einschnitt hervor. Seine Augen scannten das Paket. An einer Ecke stand etwas Pappe ab, an der etwas Rotes glitzerte. Die kleine Wunde pochte. Am Papier geschnitten.
Das tat so verflucht weh. Diese Art von Verletzung gehörte seiner Meinung nach in die Kategorie ›Scheiße, tut das weh. Ich sterbe.‹ Grummelnd schob er den Finger zwischen die Lippen und saugte daran. Sein Speichel sorgte für eine sofortige Linderung der Schmerzen, während der metallische Geschmack von Blut sich auf seiner Zunge ausbreitete.
Mit dem Finger im Mund lehnte er sich wieder in seinem Bürostuhl zurück. Dabei entwich ihm ein tiefer Atemzug, der sich erst an seinem Finger vorbei nach draußen kämpfen musste. Bevor er sich mit dem aller Voraussicht nach unschönen Inhalt des Pakets auseinandersetzte, wollte er sich noch einen Moment Ruhe gönnen. Ruhe und die Erinnerung an Erik. Erik, dessen ungeöffnete Nachricht auf seinem Handy-Sperrbildschirm ihn daran erinnerte, dass die gestrige Nacht real gewesen war. Dass dieser Mann real war. Er und seine Fähigkeit, sich zu verbiegen wie Gummi.
Chris bis sich auf die Unterlippe und schloss die Augen. Es war nicht der Sex, der seine Gedanken beherrschte, sondern dieses raumeinnehmende Lachen, das Erik ausstieß, wenn er einen Witz erzählte, der eigentlich überhaupt nicht witzig war. Es riss einen förmlich mit. Chris hatte gelacht wie ein Weltmeister.
Nicht, weil die Witze lustig waren, sondern weil Eriks ganze Art ihn überschwemmt hatte – wie eine gigantische Welle. Sie hatte ihn unter Wasser gezogen und ließ ihn nicht wieder hinauf.
Es störte ihn nicht. Im Gegenteil: Mit Erik lachend unter Wasser – einen schöneren Ort konnte er sich momentan kaum vorstellen.
Seufzend öffnete er die Augen wieder. Er sah sich in seinem großen Büro um.
Betrachtete jedes teure Möbelstück. Strich mit der unverletzten Hand über seine Prada-Anzughose, die saß wie angegossen. Durchaus möglich, dass es Menschen gab, bei denen so ein Anblick Herzklopfen und Begeisterung ausgelöst hätte. Wie viele gab es, die von einer Position wie seiner träumten? Die davon träumten, überhaupt so eine Gelegenheit zu bekommen. Er solle nicht undankbar sein, pflegte sein Vater zu sagen.
Aber wofür sollte er bitte Dankbarkeit zeigen? Nur weil es Menschen gibt, die sich so ein Leben wünschen, musste er ja keiner von ihnen sein.
Er seufzte erneut.
Glück war doch für jeden etwas anderes. Und seines befand sich ganz sicher nicht in den Taschen eines Tausend-Tacken-Anzugs.
Glücklich sein. Das war ein schönes Ziel. Tanzen, lecker essen gehen, reisen, mit Erik nackt im Meer schwimmen, auf Bergspitzen stehen und laut schreien – ein Lächeln umspielte seine Lippen, während er sich das vorstellte. Es fiel jedoch sofort von ihm ab, als er den Raum um sich herum wieder deutlich wahrnahm.
Mit einer Hand zog er das Paket bis an die Kante des Tisches. Er atmete tief durch. Sollte er sich eine weitere Schikane seiner Brüder ansehen? Natürlich würde er. Das war sein Alltag. Fotografiert werden, nutzlos rumsitzen und den Bosheiten seiner Brüder ausweichen.
Er musste durchhalten. Vater stolz machen. In die Kamera lächeln. Ein perfektes Gesicht für das Unternehmen sein.
Wenn ich das durchhalte, darf ich irgendwann mein eigenes Leben führen.
Er presste die Lippen fest zusammen und klappte den linken Deckel des Kartons auf.
Und dann, dachte er, bin ich glücklich.
Sturmwolkenblau
von Melanie Gömann (@wortgeschmeide)
Ich hatte mich von der ersten Sekunde an in sie verliebt. In die blauen Augen der jungen Frau, die seit Wochen in das gleiche Café ging wie ich. Dass sie eine ebenmäßige Haut und eine makellose Figur hatte, fiel mir anfangs überhaupt nicht auf. Ich starrte sie einfach nur fasziniert an. Wenn sie meinen Blick erwiderte, schaute ich betreten zu Boden. Ich benahm mich nicht wie ein Dachdeckergeselle von achtundzwanzig Jahren, sondern wie ein dummer Schuljunge.
Diese wunderschöne Frau lächelte mich jeden Tag an, und ich schaffte es nicht, entsprechend zu reagieren.
Heute war es besonders peinlich gewesen. Ich war spät dran, und die Zeit reichte nur für einen Kaffee to go. Ich hatte nicht bemerkt, dass sie in der Schlange hinter mir stand. Sie tippte mir auf die Schulter, und ich drehte mich erschrocken um. Ich sah direkt in diese kristallblauen Augen und rannte davon.
»Unser Kennenlernen ist mir heute noch unangenehm, meine Schöne. Wärst du mir damals nicht hinterhergelaufen, wären wir jetzt nicht verheiratet.« Ich küsste Laura auf die Stirn, und sie lächelte mich an. Ich konnte das pure Glück fühlen, als ich behutsam über ihren Bauch streichelte. In wenigen Wochen würde unser kleines Mädchen auf die Welt kommen und unser Leben perfekt machen.
Meine Frau und ich hatten schon alles geplant. Sechs Monate nach der Geburt würde ich meine Arbeitsstelle aufgeben und als Hausmann einspringen. Wir waren ein Ehepaar, das in modernen Zeiten lebte. Laura verdiente als Abteilungsleiterin in einem Industrieunternehmen erheblich mehr als ich. Und außerdem konnte ich besser kochen, was sie jedoch niemals zugeben würde.
Unsere kleine Welt war ein Paradies. Wir hatten gerade ein Haus gekauft. Und wir liebten einander. Der Weg für eine sonnige Zukunft war mehr als geebnet.
»Marcel, es wird heute später. Der neue Großauftrag kostet uns eine Menge Zeit. Erledigst du ein paar Aufgaben für mich?«
Ich sah Laura schweigend an. Sie hatte sich in letzter Zeit verändert. Unser Rollentausch hielt ihr dermaßen den Rücken frei, dass sie die Karriereleiter hinauffliegen konnte. Sie arbeitete sechzig Stunden die Woche, aß kaum und trank Unmengen an Kaffee. Wenn sie nach Hause kam, schlief unsere Tochter bereits, und auch ich war oft zu müde, ihr noch vor dem Fernseher Gesellschaft zu leisten. Aus der ursprünglich geplanten Elternzeit waren inzwischen vier Jahre geworden. Ich war nicht unzufrieden mit dieser Rolle. Doch wir waren immer weniger eine Einheit. Mein Alltag war der eines typischen Hausmanns.
Die gemeinsame Zeit mit unserer Tochter entschädigte mich für alle Strapazen.
Aber mir fehlte die Zuneigung meiner Frau. Zärtlichkeiten blieben oft mangels Zeit auf der Strecke. Die Stunden, die ihr warmer Körper nachts neben mir lag, konnte ich an einer Hand abzählen.
Ich hatte den Eindruck, als zählte für Laura nur noch ihr Beruf. Die Familie blieb schmückendes Beiwerk. Ich schloss für einen Moment die Augen und versuchte, die Silhouette dieser hageren Karrierefrau mit der damaligen Schönheit zu vergleichen, in die ich mich verliebt hatte.
»Marcel, hast du mir überhaupt zugehört? Meine Zeit ist kostbar!«
Angesichts des barschen Tonfalls zuckte ich zusammen. Ich schaute betreten zu Boden und nickte nur kurz. So gereizt wie heute hatte ich Laura noch nie erlebt. Als ich aufblickte, schlug sie bereits wortlos die Haustür hinter sich zu.
Am besten sollte ich sofort mit ihrer Liste beginnen, damit ich sie nicht noch mehr verärgerte. Ihre verbalen Wutanfälle häuften sich, und ich muss zugeben, dass ich mir Sorgen machte.
Nach getaner Arbeit zappte ich lustlos durch die Fernsehkanäle. Es war nicht so, dass ich Langeweile verspürte. Ich war körperlich an meine Grenzen gekommen. In den ersten Jahren hatten wir alles gerecht verteilt. Ich war für den Haushalt und das Kind zuständig. Meine Frau war zum Abendessen zu Hause, und mir blieb genug Zeit, meine Freizeit zu gestalten.
In den letzten Monaten hatte Laura mir häufiger ihre eigenen Aufgaben und Besorgungen zugeteilt. Ich fügte mich, um ihr beizustehen. Laura sagte mir jeden Tag zum Abschied, dass bald alles besser werden würde. Doch inzwischen kam sie selten vor Mitternacht nach Hause, und mir blieb nicht genug Zeit, um mich körperlich fit zu halten.
Meine Freunde und ehemaligen Kollegen zogen mich schon auf, wenn wir uns gelegentlich mal auf ein Bier trafen. Ich lachte dann immer über ihre anmaßenden Witze, damit sie nicht merkten, wie sehr mich ihre Worte verletzten. Nachdem mich einer von ihnen grienend gefragt hatte, ob meine Frau mit ihrem Chef schläft, während ich die Hausarbeit mache, traf ich mich gar nicht mehr mit ihnen.
Ich hatte mich gerade für einen alten Liebesfilm entschieden, als ich die Haustür hörte. Ich sprang von der Couch und erkannte Laura im Halbdunkel.
»Schatz, ich freue mich, dass du da bist. Es ist nicht einmal halb neun. Alles in Ordnung im Büro?« Ich merkte selbst, wie meine Stimme zitterte. Ich schaltete das Flurlicht an und erschrak.
Ich konnte meiner Frau die schlechte Laune geradezu ansehen. Ihre Mundwinkel verliehen ihrem Gesicht ein genervtes Antlitz, und ihre Stirn war von Zornesfalten durchzogen. Aber den schrecklichsten Anblick boten mir ihre Augen.
Sie waren in letzter Zeit etwas matt gewesen, glichen aber immer noch eisklarem Gebirgswasser. Doch was ich jetzt sah, erinnerte mich nur an ein Heer von Himmelskriegern, die sich ihrem Feind entgegenstellen. Sturmwolkenblau, eine andere Farbe fiel mir nicht ein.
Laura hatte mir nicht geantwortet. Sie ging nur zum Kühlschrank und entnahm ihm eine Flasche Wein. Sie war so aufgeregt, dass sie den Korkenzieher nicht in den Griff bekam. Ich eilte zu ihr und hielt sie sanft am Arm fest. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passierte. Sie entzog sich der Berührung, holte aus und schlug mir mit der Faust ins Gesicht.
Blut tropfte aus meiner Nase, und ich taumelte überrascht zurück in den Flur.
Sie folgte mir. Und während ich noch hoffte, dass sie sich entschuldigte, stolperte ich über die Kinderkarre und fiel zu Boden. Sie starrte mich regungslos an. Ich werde niemals ihren Gesichtsausdruck vergessen. Innerhalb von Sekunden wich anfängliche Reue aus ihrem Gesicht, und dieses verformte sich zu einer diabolischen Fratze der Wut. Sie griff nach dem Plastikbügel, der einsam an der Garderobe hing, und schlug erbarmungslos auf mich ein.
Anfangs schrie ich sie noch laut an. Der Schmerz schien mir Mut zu geben. Doch mein Aufbäumen interessierte sie in ihrer aggressiven Verfassung nicht. Die ersten Blutspritzer schienen meine Frau noch mehr anzuspornen. Als ich nur noch schwach wimmerte, ließ sie endlich von mir ab. Doch war es kein Mitgefühl, das sie stoppte. Der Bügel war in zwei Teile zerbrochen und lag neben mir auf dem Boden. Sie drehte sich wortlos um und ging die Treppe hinauf. Zurück blieben zwei blutbefleckte Symbole der neuen Hierarchie in unseren vier Wänden: die wahllos gewählte Waffe und das erniedrigte Opfer.
Ich weiß nicht, wie lange ich bewegungslos da lag. Ich versuchte zu begreifen, was soeben passiert war. Was hatte Laura in ein prügelndes Monster verwandelt? Und warum hatte ich mich nicht gewehrt? Ein Gefühl zerdrückte in diesem Moment mein Herz, und das Bewusstsein traf mich wie eine Pfeilspitze.
Ich hatte Angst vor meiner eigenen Frau.
Ich konnte mich kaum bewegen und verbrachte die Nacht auf dem Sofa. Ich schlief so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich fürchtete, dass sie zurückkam oder mich meine eigene Scham einfach auffraß. Ich schlich am frühen Morgen ins Badezimmer, und zum ersten Mal, seit ich Laura kannte, schloss ich die Tür ab. Ich zog mich aus und stellte die Dusche an. Der geringe Blickwinkel, den mir der Badezimmerspiegel bot, brachte mich bereits zum Weinen. Mein Oberkörper war mit beginnenden Hämatomen übersäht. Meine Nase blutete nicht mehr, aber ich konnte deutlich die aufgeplatzte Oberlippe sehen. Ich ließ das viel zu heiß eingestellte Wasser über meinen Körper laufen, so als würde ich mir die Schande abwaschen wollen.
Ich wog zwanzig Kilogramm mehr als meine Frau, und doch war ich zu schwach gewesen, mich zu wehren. Obwohl Schwäche das falsche Wort war. Als normaler Mann trägt man eine anerzogene Sperre in sich: Man schlägt keine Frauen!
Doch angesichts der Bestie, in die sich Laura verwandelt hatte, kam mir dieser Leitsatz nun wie blanker Hohn vor. Ich stieg aus der Dusche und zog mir den Bademantel über. Ich zuckte zusammen, als die Türklinke heruntergedrückt wurde.
»Marcel, bitte! Es tut mir leid! Ich weiß nicht, was da gestern mit mir passiert ist. Der Tag in der Firma war ein Albtraum, weil der Kunde unsere Präsentation abgelehnt hat. Ich war so wütend. Die monatelange Arbeit und die Überstunden – alles umsonst! Und als du mich dann am Arm berührt hast, habe ich einfach nicht mehr gewusst, wer ich bin und wer vor mir steht. Bitte verzeih mir!
Das kommt nie wieder vor. Ich muss jetzt los, aber heute Abend reden wir, okay?«
Ich wartete noch endlose Minuten, nachdem ich die Haustür gehört hatte. Ich war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich wollte Verständnis aufbringen für diese Frau, die ich über alles liebte, aber in mir war nur Nebel.
Der Tag mit meiner Tochter Mia brachte mir ein kleines Lächeln zurück. Sie fragte mich, ob ich hingefallen sei und pustete mir sanft ins Gesicht. Ich brachte die Kleine nicht zum Kindergarten. Es war bereits Freitag, und ich hoffte, dass übers Wochenende die offensichtlichen Verletzungen unsichtbar würden. Als Mia schlief, gab ich die Worte »häusliche Gewalt durch Frauen« im Internet ein. Ich erschrak angesichts der prozentual festgestellten Fälle und vermuteten Dunkelziffer. Eins wusste ich nun: Ich war nicht allein! Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich mir die Nummer einer Selbsthilfegruppe aufschrieb. Immerhin hatte Laura versprochen, dass das nie wieder vorkommt.
In den kommenden Wochen war meine Frau wie ausgewechselt. Sie kam überpünktlich nach Hause, lachte viel und kochte für uns. Sie war zärtlich und zuvorkommend, als ich nach einigen Tagen ihre Berührungen wieder zuließ. Doch war ich wirklich bereit, ihr zu verzeihen? Ich schlief jede Nacht im Gästezimmer und schloss die Tür ab. In mir schwelte die Angst, dass es wieder passieren könnte. Ich versuchte, an unsere Liebe zu glauben. Bis zu jenem Tag im April, der unser Leben endgültig aus der Bahn warf. Wir hatten ein Wochenende ganz für uns allein geplant. Mia schlief bei meiner Mutter, und ich hatte Lauras Lieblingsessen gekocht. Wie immer in den letzten Wochen kam sie zeitig nach Hause, aber ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte.
Sie griff in den Schrank mit dem Alkohol und trank den Wodka direkt aus der Flasche. Ihre Augen hatten sich wieder zu diesem düsteren Blau des Sturmes verfärbt. Die Zeichen eines nahenden Wutanfalls waren deutlich sichtbar. Eine Flucht wäre in diesem Augenblick der richtige Ausweg gewesen, doch ich stand wie versteinert hinter der Kochinsel und sah sie angstvoll an. Sie kam bedrohlich näher, und dann sah ich nur noch, wie sie in Richtung des Messerblocks griff.
Ich erwachte in einem Krankenhausbett. Neben mir saßen ein Polizeibeamter und eine Frau mittleren Alters. Ich fühlte einen stechenden Schmerz oberhalb meiner rechten Hüfte. Mein Mund war wie ausgetrocknet. Ich bat um ein Glas Wasser, während die Frau zu reden begann:
»Herr Möhring, mein Name ist Bettina Sacher. Ich bin Mitarbeiterin des städtischen Männerbüros, und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ihre Nachbarin rief vorgestern die Polizei, und diese fand Sie anschließend blutüberströmt in Ihrem Haus. Sie wurden unverzüglich notoperiert. Und während die Polizei zunächst von einem Einbruch ausging, stellte sich heute Morgen heraus, dass Ihre Frau die Täterin war. Sie erschien mit ihrem Anwalt in einem Polizeirevier und gestand die körperlichen Attacken. Sie müssen sich nicht schämen. Und es ist in Ordnung, wenn Sie sich unwohl fühlen. Häusliche Gewalt gegenüber Männern ist heute kein Tabuthema mehr. Unser Verein wird Ihnen zurück ins Leben helfen.«
Ich versuchte etwas zu erwidern, doch die Dame wusste bereits, wonach mir der Sinn stand.
»Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Tochter. Sie ist noch bei ihrer Großmutter. Und beiden geht es gut. Ich habe auch bereits mit dem Verteidiger Ihrer Frau gesprochen. Sie wird auf das Sorgerecht verzichten und sich Ihnen nie wieder nähern.«
Die Sozialarbeiterin hatte genau die richtigen Worte ausgesprochen, die mich beruhigten. Ich war müde, aber ich hörte ihr weiter zu, weil ich unbedingt wissen wollte, was passiert war.
»Doch das soll Sie jetzt nicht weiter kümmern, Herr Möhring. Sie haben ein sehr schlimmes Trauma erlitten. Ihre Frau hat in blinder Wut mehrfach auf Sie eingestochen, und Sie haben nur knapp überlebt. Ihre körperlichen Wunden werden verheilen. Doch die Seele wird Zeit brauchen, um vollständig zu heilen.
Wenn Sie keine Hilfe annehmen, kann dies zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Sie kennen so etwas nur von Soldaten. Aber auch die körperlichen Angriffe eines Ehepartners können so etwas auslösen.«
Ich schloss die Augen und hörte nicht mehr richtig zu.
Ich wollte nur noch schlafen – tief und in Sicherheit.
Alles Routine
von Nina Biesenbach (@kleinkarismus)
»Ich geh duschen!«, rief Nele und schnappte sich auf dem Weg ins Badezimmer einen Satz frischer Kleidung.
»Alles klar.« Marc, ihr Freund, saß im Wohnzimmer und zockte auf der Konsole wieder irgendeins dieser Videospiele, die Nele nicht interessierten. Männerkram. Dann sah er noch einmal hoch. »Du denkst dran, dass wir um halb sieben loswollen zu Anne und Peter?«
»Ja, klar!« Neles Mund lächelte, während sich ihre Hände um die Klamotten auf ihrem Arm krampften.
Sie freute sich auf den Spieleabend mit ihren Freunden. Jan und Marie würden auch dort sein, und Alex und Mona. Es würde bestimmt lustig werden.
Bis eben hatte sie den freien Samstagnachmittag genossen und bei einer Tasse Tee mit dem neuen Buch auf der Couch gelegen. Eigentlich hatte sie schon vor einer halben Stunde unter die Dusche gehen wollen, aber es war so spannend gewesen, dass sie noch ein paar Kapitel mehr gelesen hatte. Doch jetzt wurde es Zeit. Sie sollten nicht schon wieder ihretwegen zu spät kommen.
Im Badezimmer angekommen blickte Nele auf die Uhr: vier Minuten nach fünf.
Sie erschrak: noch nicht einmal mehr eineinhalb Stunden! Zum Duschen, Föhnen, Kämmen und Schminken! Duschen dauerte sechsundfünfzig Minuten.
Acht Minuten fürs Föhnen, drei zum Kämmen: Dann blieben zum Frisieren und Schminken noch neunzehn Minuten. Sie schluckte. Normalerweise benötigte sie dafür zweiundzwanzig Minuten.
Wenn sie sich ein bisschen beeilte, klappte es hoffentlich trotzdem.
Die Hose hängte sie auf den rechten Handtuchhalter, das T-Shirt kam darüber, darauf die Socken. Obenauf der BH und der fein säuberlich zusammengelegte Slip. So wie immer.
Beim Blick auf den Badheizkörper runzelte Nele die Stirn: Marcs Duschtuch hing mal wieder auf links. Warum fiel es ihm denn so schwer, die Dinger richtig herum hinzuhängen? Er wusste doch, wie wichtig ihr das war! Sicher, das Muster sah auf beiden Seiten genau gleich aus; aber so sah man doch den Umschlag mit den Nähten. Letztere kratzten richtiggehend in Neles Innerem, wenn sie mal versuchte, auf links Gedrehtes zu ignorieren.
Seufzend drehte sie das Tuch um und achtete darauf, dass die Ecken exakt aufeinanderlagen. Ein Blick auf die Uhr: So ein Mist, durch die Aktion hatte sie eine Minute verloren!
Sie zog die Duschtür auf, hob den linken Fuß und setzte ihn wieder ab. Wo war sie bloß mit ihren Gedanken? Erst musste der rechte Fuß hinein! Kopfschüttelnd berichtigte sie ihre Routine und ärgerte sich über sich selbst: Noch mehr solcher Kleinigkeiten und sie konnte ihren Zeitplan vergessen! Dann wäre sie schuld daran, dass sie zu spät zum Spieleabend kämen. Mal wieder.
Nele drehte das Wasser auf und trat unter den Strahl, um wie üblich für eine Minute das beruhigende Gefühl der Tropfen zu genießen, die warm auf ihren Körper prasselten. Doch heute fühlte sie sie kaum. Alles, was sie wahrnahm, war die Unruhe, die langsam, aber sicher von ihr Besitz ergriff. Sie musste sich doch beeilen, sie hatte heute keine Zeit für diesen Luxus!
Mit der rechten Hand griff sie nach der Shampooflasche und stutzte: Das war das Duschgel! Hatte Marc etwa wieder ihres benutzt und es nicht an seinen Platz zurückgestellt? Das Duschgel musste links stehen, das Shampoo rechts, nicht andersherum! Nele fühlte, wie Wut in ihr hochbrodelte, schon wieder hatte sie durch Marcs Unbedachtheit Zeit verloren. Dabei gab sie sich solche Mühe, alles rechtzeitig zu schaffen!
Sie biss die Zähne zusammen und stellte das Duschgel an seinen Platz, richtete es mit dem unteren Rand des Etiketts genau an der Fliesenkante aus. Dann erst griff sie nach dem Shampoo und gab einen Klecks auf ihre Hand, bevor auch diese Flasche zurück an ihren Platz wanderte – exakt parallel zur vorderen Fuge.
Die Haare an den Schläfen wollten zuerst gewaschen werden, danach war die Kopfmitte dran, anschließend der Hinterkopf, zum Schluss die Längen. Jeweils fünf Mal bewegte Nele ihre Fingerspitzen kreisförmig durch die Haare, nicht mehr, nicht weniger. War es versehentlich einmal zu viel, musste sie von vorn anfangen. Das durfte heute nicht passieren, die Zeit für eine Wiederholung hatte sie nicht!
Auch die Körperwäsche folgte einer akkuraten Routine: Immer auf der linken Seite beginnend wusch Nele erst die Arme, dann die Beine, dann die Füße, dann die Achselhöhlen. – Marc hatte gelacht, als er das zum ersten Mal mitbekommen hatte: Sei es nicht viel sinnvoller, die Achseln im Anschluss an die Arme zu waschen statt nach den Füßen? Der logische Teil in Neles Gehirn stimmte dem sogar zu. Dennoch verhinderte dieser andere, pedantische Teil, dass sie ihre Routine änderte.
Sie hatte es versucht, mehrmals. Doch die einzige Erkenntnis bestand jedes Mal darin, dass sie anfing zu zittern und sich erst wieder beruhigte, wenn sie ihre gewohnte Abfolge ausgeführt hatte.





























