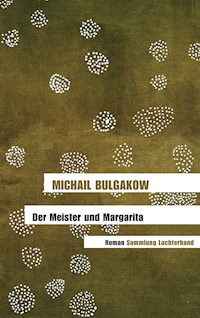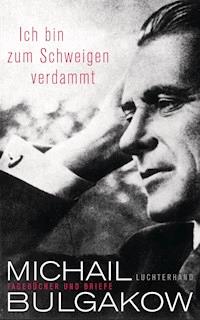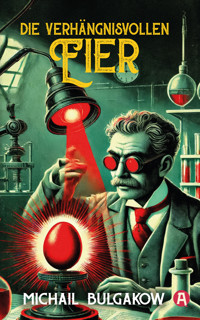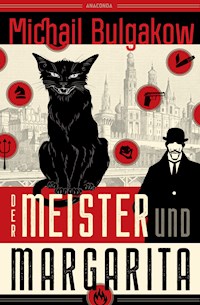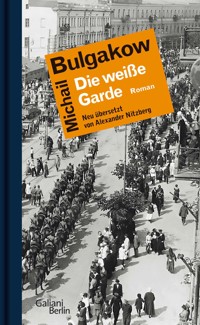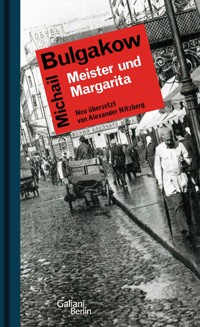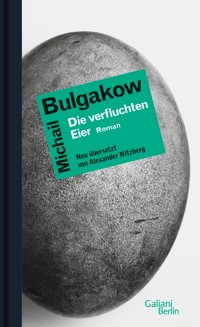8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine wunderbare Satire und scharfe Polemik gegen die Kulturpolitik des Russland der 30er Jahre.
Mit beißender Ironie und bitterem Sarkasmus beschreibt „Aufzeichnungen eines Toten“ (1936/37) Bulgakows Einstieg in die groteske Literatur- und Theaterwelt im Moskau der zwanziger Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bulgakow
Aufzeichnungen
eines Toten
THEATERROMAN
Aus dem Russischen von
Thomas Reschke
Sammlung Luchterhand
Die Übersetzung stützt sich auf folgende Originalausgabe:
M. Bulgakov, Sobranie socinenij v pjati tomach,
Bd. 4, Vlg. »Chudožestvennaja literatura«, Moskau 1990.
1. Auflage
Sammlung Luchterhand April 2005
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1993 by
Volk und Welt
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-09711-0
www.luchterhand-literaturverlag.de
Vorwort
Ich möchte dem Leser von vornherein sagen, daß ich mit der Abfassung dieser Aufzeichnungen nichts zu tun habe und daß sie unter äußerst merkwürdigen und betrüblichen Umständen in meinen Besitz gelangt sind.
Just an dem Tag, an dem Sergej Leontjewitsch Maksudow im vergangenen Frühjahr in Kiew Selbstmord beging, erhielt ich einen Brief und eine dicke Kreuzbandsendung, die der Selbstmörder noch vor seiner Tat abgeschickt hatte.
Die Kreuzbandsendung enthielt diese Aufzeichnungen, und der Inhalt des Briefes war höchst erstaunlich:
Sergej Leontjewitsch erklärte, er scheide aus dem Leben und schenke mir seine Aufzeichnungen, damit ich, sein einziger Freund, sie durchsähe und unter meinem Namen herausgäbe.
Ein merkwürdiger Wunsch, aber sein letzter Wille!
Ein Jahr lang zog ich Erkundigungen ein, um Verwandte oder Angehörige Sergej Leontjewitschs ausfindig zu machen. Vergeblich! Er hatte in seinem letzten Brief nicht gelogen – er besaß keinen Menschen auf dieser Welt.
Ich nehme das Geschenk an.
Jetzt das zweite: Ich teile dem Leser mit, daß der Selbstmörder zu Lebzeiten sowohl zur Dramatik als auch zum Theater nie irgendwelche Beziehungen hatte. Er war immer nur ein kleiner Angestellter der Zeitung »Dampfschiffahrt« gewesen und hatte sich bloß ein einziges Mal als Schriftsteller hervorgetan und auch da ohne Erfolg – sein Roman wurde nicht gedruckt.
Maksudows Aufzeichnungen sind also die Frucht seiner Phantasie, einer leider kranken Phantasie. Er litt an einer Krankheit, die einen höchst unangenehmen Namen trägt – Melancholie. Als guter Kenner des Moskauer Theaterlebens verbürge ich mich dafür, daß es solche Theater und solche Menschen, wie sie im Werk des Verblichenen dargestellt sind, nirgendwo gibt und auch nie gegeben hat.
Und endlich das dritte und letzte: Meine Arbeit an den Aufzeichnungen bestand darin, sie mit Überschriften zu versehen und das Motto zu streichen, das ich anmaßend, überflüssig und unangenehm fand.
Das Motto lautete: »Und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken.«
Außerdem setzte ich fehlende Interpunktionszeichen ein.
Sergej Leontjewitschs Stil rührte ich nicht an, obwohl er recht schlampig ist. Aber was sollte man schon von einem Menschen verlangen, der zwei Tage nach dem Schlußpunkt seiner Aufzeichnungen kopfüber von der Kettenbrücke sprang.
Also …
Erster Teil
1 Die Abenteuer beginnen
Ein Gewitterguß hatte Moskau am 29. April saubergespült, die Luft war erquickend, man fühlte sich beschwingt und bekam Appetit auf das Leben.
In meinem neuen grauen Anzug und einem recht anständigen Mantel ging ich durch eine Straße im Zentrum der Hauptstadt zu einem Haus, in dem ich noch nie gewesen war. Der Anlaß war ein Brief in meiner Tasche, den ich überraschend erhalten hatte. Hier ist er:
»Hochverehrter Sergej Leontjewitsch!
Ich möchte Sie schrecklich gern kennenlernen und ebensogern über eine geheimnisvolle Sache mit Ihnen sprechen, die Sie vielleicht ganz außerordentlich interessieren wird.
Wenn Sie Zeit haben, würde ich mich glücklich schätzen, Sie am Mittwoch um vier Uhr im Haus der Studiobühne des Unabhängigen Theaters begrüßen zu können.
Mit Gruß X. Iltschin.«
Der Brief war mit Bleistift auf ein Blatt Papier geschrieben, dessen linke obere Ecke die gedruckte Aufschrift trug:
»Xaveri Borissowitsch Iltschin
Regisseur der Studiobühne
des Unabhängigen Theaters«
Ich las den Namen Iltschin zum erstenmal und hatte nicht gewußt, daß es eine Studiobühne gab. Vom Unabhängigen Theater hatte ich schon gehört und wußte, ohne je dort gewesen zu sein, daß es ein hervorragendes Theater war.
Der Brief interessierte mich außerordentlich, zumal ich damals überhaupt keine Briefe bekam. Es sei erwähnt, daß ich ein kleiner Angestellter der Zeitung »Dampfschiffahrt« bin. Ich wohne in einem ziemlich miesen, aber separaten Zimmer im achten Stock, Bezirk Rotes Tor, nahe der Chomutowski-Gasse.
Ich ging also, atmete die erfrischte Luft und dachte daran, daß das Gewitter noch einmal zuschlagen würde, außerdem grübelte ich, woher Xaveri Iltschin von meiner Existenz wissen, wie er mich gefunden haben und was er von mir wollen mochte. Aber wie ich mir auch den Kopf zerbrach, das letztere blieb mir ein Rätsel, und endlich kam ich auf den Gedanken, daß er vielleicht mit mir das Zimmer tauschen wollte.
Natürlich hätte ich Iltschin schreiben sollen, er möge zu mir kommen, da er ja etwas von mir wollte, aber ich muß erwähnen, daß ich mich meines Zimmers, der Einrichtung und der Nachbarn schämte. Ich bin überhaupt ein Sonderling und ein bißchen menschenscheu. Man stelle sich vor, Iltschin kommt herein und sieht das Sofa mit dem geplatzten Bezug und der herausragenden Sprungfeder, der Lampenschirm überm Tisch ist aus einer Zeitung gemacht, eine Katze läuft rum, und aus der Küche tönt das Gezeter von Annuschka.
Ich durchschritt das Gittertor und erblickte eine Bude, in der ein grauhaariger Mann Abzeichen und Brillengestelle feilbot. Ich sprang über einen versiegenden trüben Regenbach und stand vor dem gelben Gebäude. Mir kam der Gedanke, dieses Haus müsse vor langer, langer Zeit gebaut worden sein, als Iltschin und ich noch gar nicht lebten.
Eine schwarze Tafel mit Goldbuchstaben verkündete, daß hier die Studiobühne sei. Ich trat ein, und sofort versperrte mir ein kleiner Mann mit Bärtchen den Weg; er trug eine Jacke mit grünen Kragenspiegeln.
»Zu wem wollen Sie, Bürger?« fragte er argwöhnisch und spreizte die Finger, als wolle er ein Huhn fangen.
»Ich muß den Regisseur Iltschin sprechen«, sagte ich, bemüht, meiner Stimme einen hochmütigen Ton zu geben.
Vor meinen Augen veränderte sich der Mann ganz außerordentlich. Er legte die Hände an die Hosennaht und lächelte ein falsches Lächeln.
»Xaveri Borissowitsch? Sofort bitte. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Galoschen haben Sie nicht?«
Der Mann nahm meinen Mantel so sorgsam entgegen, als sei er ein kostbares Meßgewand.
Ich stieg eine Eisentreppe hinauf und erblickte ein Basrelief, behelmte Krieger im Profil und drohende Schwerter darunter, sowie altertümliche Kachelöfen mit Warmluftklappen, goldblank geputzt.
Das Gebäude schwieg, kein Mensch ließ sich blicken, nur der Mann mit den grünen Kragenspiegeln trottete hinter mir her, und wenn ich mich umdrehte, sah ich an ihm stumme Zeichen von Aufmerksamkeit, Ergebenheit, Achtung, Liebe und Freude darüber, daß ich gekommen war und daß er, obwohl er hinter mir ging, mich führte und dorthin geleitete, wo einsam der geheimnisvolle Xaveri Borissowitsch Iltschin wartete.
Plötzlich wurde es dunkel, die Öfen verloren ihren fetten weißen Glanz, Finsternis brach herein – draußen ging das zweite Gewitter nieder. Ich klopfte an die Tür, trat ein und erblickte endlich im Dämmerlicht Xaveri Borissowitsch.
»Maksudow«, sagte ich würdevoll.
In diesem Moment spaltete weit außerhalb von Moskau ein Blitz den Himmel und hüllte Iltschin für einen Moment in phosphoreszierendes Licht.
»Ja, Sie sind’s, liebenswürdiger Sergej Leontjewitsch!« sagte Iltschin und lächelte listig.
Er faßte mich um die Taille und zog mich zu einem Sofa, das meinem aufs Haar glich, sogar die Sprungfeder ragte an derselben Stelle heraus wie bei mir, genau in der Mitte.
Bis auf den heutigen Tag kenne ich nicht die Bestimmung dieses Zimmers, in dem die verhängnisvolle Begegnung stattfand. Wozu das Sofa? Was waren das für zerfledderte Noten, die in der Ecke auf dem Fußboden lagen? Warum stand auf dem Fensterbrett eine Waage mit zwei Schalen? Warum hatte mich Iltschin in diesem Zimmer erwartet und nicht zum Beispiel in dem Saal nebenan, in dessen hinterer Ecke sich im Gewitterdämmer undeutlich ein Konzertflügel abzeichnete?
Unterm Gebrummel des Gewitters sagte Xaveri Borissowitsch unheilschwer:
»Ich habe Ihren Roman gelesen.«
Ich zuckte zusammen.
Die Sache war die …
2 Ein Anfall von Neurasthenie
Die Sache war die, daß ich meine bescheidene Tätigkeit als Lektor bei der »Dampfschiffahrt« haßte und nachts, manchmal bis zum Morgengrauen, in meiner Mansarde an einem Roman schrieb.
Geboren wurde er eines Nachts, als ich nach einem melancholischen Traum erwachte. Ich hatte im Traum meine Heimatstadt gesehen, Schnee, Winter, den Bürgerkrieg … Vor mir war ein lautloser Schneesturm vorübergezogen, dann hatte ich einen uralten Konzertflügel gesehen und daneben Leute, die gar nicht mehr lebten. Meine Einsamkeit hatte mich im Traum bedrückt, ich hatte mir selber leid getan. Tränenüberströmt war ich aufgewacht. Ich knipste die staubige Glühbirne über dem Tisch an. Sie beleuchtete meine Armut – das billige Tintenfaß, die wenigen Bücher, den Stoß alter Zeitungen. Meine linke Seite schmerzte von der Sprungfeder, mein Herz war von Angst abgeschnürt. Ich hatte das Gefühl, jetzt hier am Tisch sterben zu müssen, und meine jämmerliche Todesangst demütigte mich dermaßen, daß ich mich angstvoll stöhnend umsah und Schutz und Rettung vor dem Tod suchte. Und ich fand Hilfe. Leise miaute die Katze, die ich einmal im Torweg aufgelesen hatte. Das Tier war aufgeregt. Mit einem Satz sprang es auf die Zeitungen, sah mich mit runden Augen an und fragte: Was ist passiert?
Dem mageren rauchgrauen Tier lag daran, daß nichts passierte. Wirklich, wer würde diese alte Katze noch ernähren wollen?
»Das ist ein Anfall von Neurasthenie«, erklärte ich der Katze. »Sie steckt schon in mir, wird sich entwickeln und mich auffressen. Aber noch lebe ich.«
Das Haus schlief. Ich blickte zum Fenster hinaus. Keine der fünf Etagen war erleuchtet, und ich begriff, daß dies kein Haus war, sondern ein Schiff mit vielen Decks, das unterm unbewegten schwarzen Himmel dahinflog. Der Gedanke an diese Bewegung heiterte mich auf. Ich beruhigte mich, auch die Katze beruhigte sich und schloß die Augen.
So fing ich an, den Roman zu schreiben. Ich beschrieb den geträumten Schneesturm. Ich gab mir Mühe zu schildern, wie der Flügel unter der beschirmten Lampe blinkte. Es gelang mir nicht. Aber ich war hartnäckig geworden.
Tagsüber ließ ich mir nur eines angelegen sein – für meine subalterne Arbeit möglichst wenig Kräfte zu verbrauchen. Ich verrichtete sie mechanisch, so, daß der Kopf unbeteiligt blieb. Jede nur halbwegs schickliche Gelegenheit benutzte ich, um unter dem Vorwand einer Krankheit dem Dienst fernzubleiben. Man glaubte mir natürlich nicht, und mein Leben wurde schwierig. Aber ich ertrug alles und gewöhnte mich sogar allmählich daran. Wie ein ungeduldiger Jüngling die Stunde des Rendezvous erwartet, so erwartete ich die Nacht. Dann kam die verfluchte Wohnung zur Ruhe. Ich setzte mich an den Tisch … Die Katze sprang auf die Zeitungen, doch der Roman interessierte sie so sehr, daß sie von den Zeitungen auf die beschriebenen Blätter überzuwechseln versuchte. Ich nahm sie beim Genick und beförderte sie wieder auf ihren Platz.
Eines Nachts hob ich den Kopf und wunderte mich. Mein Schiff flog nirgendwohin, das Haus stand auf seinem Platz, und es war ganz hell. Die Birne beleuchtete nichts, sie war ekelhaft und aufdringlich. Ich machte sie aus, und im Morgengrauen sah ich das scheußliche Zimmer vor mir. Auf dem asphaltierten Hof schlichen mit lautlosem Diebesgang gescheckte Kater umher. Jeder Buchstabe auf dem Papier war auch ohne Lampe deutlich zu erkennen.
»O Gott! Es ist April!« rief ich erschrocken und schrieb mit großen Buchstaben das Wort »Ende« hin.
Ende des Winters, Ende der Schneestürme, Ende der Kälte. Den Winter über hatte ich meine wenigen Bekannten aus den Augen verloren, war abgerissen, hatte mir Rheuma geholt und war ein bißchen verwildert. Aber rasiert hatte ich mich täglich.
Während ich über all das nachdachte, ließ ich die Katze hinaus in den Hof, dann kehrte ich ins Zimmer zurück, schlief ein und hatte wohl zum erstenmal seit dem Winter keine Träume.
Ein Roman bedarf langwieriger Korrekturen. Viele Stellen müssen umgeschrieben, Hunderte von Wörtern durch andere ersetzt werden. Eine große, aber notwendige Arbeit!
Allein die Versuchung war zu stark, und kaum hatte ich die ersten sechs Seiten redigiert, ging ich wieder unter Menschen. Ich lud mir Gäste ein. Unter ihnen waren zwei Journalisten aus der »Dampfschiffahrt«, Arbeitstiere wie ich, ihre Frauen und zwei Schriftsteller. Der eine war jung und verblüffte mich durch den unerreichbaren Schmiß, mit dem er Erzählungen schrieb, der andere war ein älterer ausgekochter Mann, der sich bei näherer Bekanntschaft als fürchterlicher Schweinehund entpuppte.
Eines Abends las ich ihnen etwa ein Viertel meines Romans vor.
Die Frauen waren von meinem Vortrag so erschöpft, daß mich Gewissensbisse plagten. Die Journalisten und Schriftsteller waren ausdauernder. Ihr Urteil war brüderlich aufrichtig, ziemlich streng und, wie ich heute weiß, gerecht.
»Die Sprache!« rief der eine Schriftsteller (der sich hinterher als Schweinehund entpuppte), »die Sprache ist das wichtigste! Deine Sprache taugt nichts.«
Er leerte ein großes Glas Wodka und verschlang eine Sardine. Ich goß ihm nach. Er trank wieder aus und aß ein Stück Wurst.
»Metaphern!« schrie er kauend.
»Ja«, bestätigte der junge Schriftsteller höflich, »die Sprache ist ein bißchen arm.«
Die Journalisten sagten nichts, aber sie nickten zustimmend und tranken. Die Damen nickten nicht und sprachen nicht, sie lehnten den eigens für sie gekauften Portwein ab und tranken Wodka.
»Sie muß ja arm sein«, schrie der ältere Schriftsteller, »eine Metapher ist doch kein Hund, ich bitte das zu bemerken! Ohne sie ist das Leben nackt! Nackt! Nackt! Merken Sie sich das, alter Freund!«
Die Anrede »alter Freund« war offenbar auf mich gemünzt. Mir wurde kalt.
Beim Abschied wurde vereinbart, daß sie wiederkommen sollten. In der Woche danach kamen sie auch. Ich las ihnen die zweite Portion vor. Der Abend gipfelte darin, daß der ältere Schriftsteller völlig überraschend und gegen meinen Willen mit mir Brüderschaft trank und mich mit Leontjitsch anredete.
»Die Sprache ist einen Dreck wert! Aber die Sache ist spannend. Spannend ist sie, daß dich der Teufel in der Luft zerreiße (er meinte mich)!« schrie er und machte sich über die von Dussja zubereitete Sülze her.
Am dritten Abend erschien ein neuer Gast, ebenfalls ein Schriftsteller. Er hatte ein böses Mephistogesicht, schielte auf dem linken Auge und war unrasiert. Er sagte, der Roman sei schlecht, sprach aber den Wunsch aus, den vierten und letzten Teil zu hören. Außerdem kamen eine geschiedene Frau und ein Mann mit einer Gitarre im Futteral. Der Abend war für mich sehr lehrreich. Meine bescheidenen Kollegen von der »Dampfschiffahrt« hatten sich an die wachsende Gesellschaft gewöhnt und äußerten nun auch ihre Meinung.
Der eine fand das siebzehnte Kapitel zu langatmig, der andere Wassenkas Charakter nicht plastisch genug gezeichnet. Beides stimmte.
Die vierte und letzte Lesung fand nicht bei mir statt, sondern bei einem jungen Schriftsteller, der kunstvolle Erzählungen verfaßte. Hier waren schon an die zwanzig Personen versammelt, und ich lernte die Großmutter des Schriftstellers kennen, ein sympathisches Mütterchen, an dem mir nur eines mißfiel – der verschreckte Gesichtsausdruck, der sie den ganzen Abend nicht verließ. Überdies sah ich eine Kinderfrau, die auf einer Truhe schlief.
Der Roman war zu Ende. Und jetzt kam die Katastrophe. Sämtliche Zuhörer versicherten übereinstimmend, mein Roman könne nicht gedruckt werden aus dem einfachen Grunde, weil die Zensur ihn nicht durchlassen werde.
Ich hörte dieses Wort zum erstenmal, und mir fiel jetzt erst auf, daß ich beim Schreiben des Romans nicht ein einziges Mal daran gedacht hatte, ob er durchgehen würde.
Den Anfang machte eine Dame (ich erfuhr später, daß sie ebenfalls geschieden war).
»Sagen Sie, Maksudow, ob man Ihren Roman durchlassen wird?« fragte sie.
»I wo!« rief der betagte Schriftsteller. »Unter keinen Umständen! Davon kann überhaupt keine Rede sein! Darauf gibt es nicht die geringste Hoffnung. Du brauchst dich gar nicht zu beunruhigen, alter Freund, man wird ihn nicht durchlassen.«
»Bestimmt nicht!« antwortete das kurze Ende des Tisches im Chor.
»Die Sprache …«, begann der Bruder des Gitarristen, aber der Betagte unterbrach ihn: »Zum Teufel mit der Sprache!« schrie er und packte sich Salat auf den Teller. »Um die geht’s nicht. Unser Freund hat einen schlechten, aber amüsanten Roman geschrieben. Er hat eine prima Beobachtungsgabe, der alte Spitzbube. Wo er das bloß hernimmt! Hätt ich nicht gedacht! Aber … der Inhalt!«
»Tja, der Inhalt …«
»Eben«, schrie der Betagte, daß die Kinderfrau auffuhr, »weißt du, was verlangt wird? Du weißt es nicht? Da haben wir’s! Na bitte!«
Er zwinkerte und trank dabei. Sodann umarmte er mich, küßte mich ab und schrie:
»Du hast was Unsympathisches an dir, kannst es mir glauben. Glaub’s mir ruhig. Aber ich mag dich. Ich mag dich, und wenn du mich umbringst. Verschlagen ist er, der Schelm! Ein ganz hinterlistiger Bursche! Nicht? Wie? Habt ihr aufgepaßt beim vierten Kapitel? Was hat er zu der Heldin gesagt? Na bitte!«
»Erstens, was sind das für Ausdrücke?« wollte ich sagen, denn ich litt unter seiner Vertraulichkeit.
»Küß mich lieber!« brüllte der betagte Schriftsteller. »Du willst nicht? Da sieht man’s, was du für ein Kamerad bist! Nein, Bruder, es ist nicht einfach mit dir!«
»Stimmt, es ist nicht einfach!« pflichtete ihm die zweite geschiedene Frau bei.
»Erstens …«, wollte ich abermals wütend anfangen, aber wieder wurde nichts daraus.
»Da gibt’s kein Erstens!« schrie der Betagte. »Du hast ein bißchen Dostojewski in dir! Jawohl! Na schön, du magst mich nicht, Gott wird’s dir verzeihen, ich bin dir nicht böse. Aber wir alle lieben dich aufrichtig und wünschen dein Bestes!« Er zeigte auf den Bruder des Gitarristen und auf einen anderen, mir unbekannten Mann mit rotem Gesicht, der sich bei seiner Ankunft für die Verspätung entschuldigt hatte mit der Begründung, er sei im Zentralbad gewesen. »Ich spreche aufrichtig zu dir«, fuhr der Betagte fort, »denn ich bin es gewohnt, jedem die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Du, Leontjitsch, brauchst den Roman nirgendwo anzubieten. Du würdest dir nur Unannehmlichkeiten einhandeln, und wir, deine Freunde, würden leiden bei dem Gedanken an deine Qualen. Glaub mir das! Ich bin ein Mensch mit vielen bitteren Erfahrungen. Ich kenne das Leben! Aber seht doch«, schrie er beleidigt und rief mit einer Handbewegung alle zu Zeugen an, »seht doch, mit was für Wolfsaugen er mich anguckt! Das ist der Dank für meinen gutgemeinten Rat! Leontjitsch!« kreischte er so laut, daß die Kinderfrau hinterm Vorhang von der Truhe aufsprang. »Versteh doch! Versteh doch, die künstlerischen Vorzüge deines Romans sind nicht so groß (vom Sofa her erklang ein weicher Gitarrenakkord), daß du deshalb zum Berg Golgatha gehen müßtest. Versteh doch!«
»V-versteh doch, versteh doch, versteh!« sang der Gitarrist mit angenehmem Tenor.
»Und darum jetzt mein letztes Wort«, schrie der Betagte, »wenn du mich nicht sofort küßt, steh ich auf, geh weg, verlasse den Freundeskreis, denn du hast mich beleidigt!«
Unter unaussprechlichen Qualen küßte ich ihn. Der Chor hatte sich inzwischen vortrefflich eingesungen, zart und ölig schwebte über uns der Tenor:
»V-versteh doch, versteh …«
Katzengleich stahl ich mich aus der Wohnung, das schwere Manuskript unterm Arm.
In der Küche stand die Kinderfrau mit tränenden roten Augen über den Ausguß gebeugt und trank Wasser aus dem Hahn.
Ich weiß nicht warum, aber ich hielt ihr einen Rubel hin.
»Da soll Sie doch …«, sagte sie böse und stieß den Rubel zurück, »es ist bald vier Uhr nachts! Das sind ja Höllenqualen.« Eine wohlbekannte Stimme zerschnitt den fernen Chor: »Wo ist er denn? Abgehauen? Haltet ihn! Da seht ihr’s, Kameraden …«
Aber die wachstuchbespannte Tür hatte mich schon hinausgelassen, und ich lief, ohne mich umzusehen.
3 Mein Selbstmord
»Ja, das ist furchtbar«, sagte ich in meinem Zimmer zu mir selbst, »alles ist furchtbar. Der Salat, die Kinderfrau, der betagte Schriftsteller, das unvergeßliche ›Versteh doch‹ und überhaupt mein ganzes Leben.«
Vor den Fenstern winselte der herbstliche Wind, ein loses Dachblech rasselte, Regen kroch streifig über die Fensterscheiben. Seit dem Abend mit der Kinderfrau und der Gitarre hatte sich vieles ereignet, aber das war alles so ekelhaft, daß ich nicht darüber schreiben möchte. Ich hatte mich vor allem sofort darangesetzt, den Roman im Hinblick darauf, ob man ihn durchlassen würde oder nicht, noch einmal zu kontrollieren. Und ich begriff, man würde ihn nicht durchlassen. Der Betagte hatte völlig recht. Jede Zeile des Romans, so schien es mir, schrie das geradezu hinaus.
Nach dieser Kontrolle gab ich mein letztes Geld aus, um zwei Auszüge abschreiben zu lassen. Die brachte ich der Redaktion einer umfangreichen Zeitschrift. Nach vierzehn Tagen bekam ich die Auszüge zurück. In einer Ecke des Manuskripts stand deutlich: »Ungeeignet!« Mit einer Nagelschere schnitt ich diesen Entscheid heraus, brachte die Auszüge zu einer anderen Zeitschrift und bekam sie nach zwei Wochen mit dem gleichen Vermerk »Ungeeignet« zurück.
Danach starb die Katze. Sie fraß nicht mehr, drückte sich in eine Ecke und brachte mich mit ihrem Miauen zur Raserei. Drei Tage ging das so, am vierten fand ich sie steif in der Ecke liegend.
Ich holte mir einen Spaten vom Hausmeister und verscharrte sie auf einem Ödplatz hinter unserm Haus. Nun war ich ganz allein auf der Welt, aber ich gebe zu, im stillen freute ich mich darüber. Das unglückselige Tier war mir doch eine rechte Last gewesen.
Dann kamen die Herbstregen, meine Schmerzen in der Schulter und im linken Knie setzten wieder ein.
Aber nicht das war das Schlimmste, sondern die Einsicht, daß der Roman schlecht war. Und war er schlecht, so bedeutete das, mein Leben ging zu Ende.
Das ganze Leben lang bei der »Dampfschiffahrt« arbeiten? Da lachen ja die Hühner!
Nacht für Nacht lag ich da, starrte in die dichte Finsternis und murmelte immer wieder »das ist ja furchtbar« vor mich hin. Wäre ich gefragt worden, was für Erinnerungen ich an die Arbeit bei der »Dampfschiffahrt« habe, so hätte ich mit gutem Gewissen sagen können: überhaupt keine.
Schmutzige Galoschen beim Kleiderständer, am Haken eine nasse Mütze mit langen Ohrenklappen – das war alles.
»Das ist ja furchtbar!« wiederholte ich, während mir das nächtliche Schweigen in den Ohren summte.
Nach zwei Wochen machten sich die Folgen der Schlaflosigkeit bemerkbar.
Ich fuhr mit der Straßenbahn zur Samotetschnaja-Sadowaja-Straße, wo in einem Haus, dessen Nummer ich natürlich strengstens geheimhalte, ein Mann wohnte, der dank seiner Tätigkeit das Recht besaß, eine Waffe zu führen.
Unter welchen Umständen wir uns kennengelernt haben, ist nicht so wichtig.
Ich betrat die Wohnung und fand meinen Freund auf dem Sofa liegend. Während er in der Küche auf dem Primuskocher Tee wärmte, zog ich die linke Schreibtischschublade auf und holte den Browning heraus, dann trank ich reichlich Tee und fuhr zurück nach Hause.
Es war gegen neun Uhr abends. Zu Hause war alles wie immer. Aus der Küche roch es nach gebratenem Hammelfleisch, im Korridor schwebte der ewige, mir wohlbekannte Wrasen, in dem die trübe Deckenbirne glomm. Ich trat in mein Zimmer. Das Licht oben spritzte grell auf, und sofort sank das Zimmer wieder in Dunkelheit. Die Birne war durchgebrannt.
»Eins kommt zum andern, und alles paßt zusammen«, sagte ich bitter.
Ich zündete die Petroleumlampe an, die in der Ecke auf dem Fußboden stand. Dann schrieb ich auf ein Blatt Papier: »Hiermit erkläre ich, daß ich den Browning Nr. Soundso (ich habe die Nummer vergessen) dem Parfjon Iwanowitsch (ich fügte den Familiennamen sowie die Straße und Hausnummer hinzu, ganz wie es sich gehört) gestohlen habe.« Ich unterschrieb und legte mich auf den Fußboden neben die Petroleumlampe. Todesangst packte mich. Sterben ist furchtbar. Doch dann stellte ich mir unsern Korridor vor, das Hammelfleisch und die alte Pelageja, den Betagten und die »Dampfschiffahrt« und amüsierte mich bei dem Gedanken, wie man polternd meine Zimmertür einschlagen würde und so weiter.
Ich setzte die Mündung an die Schläfe und tastete mit unsicherem Finger nach dem Abzugsbügel. In diesem Moment hörte ich von unten wohlbekannte Klänge, ein heiseres Orchester spielte, und im Grammophon sang ein Tenor:
»Doch dieser Gott, was vermag er für mein Glück?«
Ach herrje! »Faust«*! dachte ich. Na, das paßt ja wirklich her. Aber ich werde noch Mephistopheles abwarten. Es ist ja das letztemal. Das hör ich niemals wieder.
Das Orchester unterm Fußboden verstummte, dann war es wieder da, und der Tenor schrie immer lauter:
»Verflucht sei Glück, sei Ruhm und Macht!«
Gleich, gleich, dachte ich, wie schnell er singt …
Der Tenor schrie verzweifelt auf, dann dröhnte das Orchester los.
Der zitternde Finger legte sich um den Abzugsbügel, doch in diesem Moment betäubte mich ein Donnerschlag, der Herzschlag setzte aus, und ich hatte den Eindruck, daß eine Flamme aus der Petroleumlampe zur Decke schoß. Ich ließ den Revolver fallen.
Der Donnerschlag wiederholte sich. Von unten drang eine tiefe Baßstimme herauf: »Wer ruft?« Ich wandte mich zur Tür.
* In Deutschland unter dem Titel »Margarethe« bekannte Oper von Gounod. – d. Ü.
4 Den Degen zur Seite