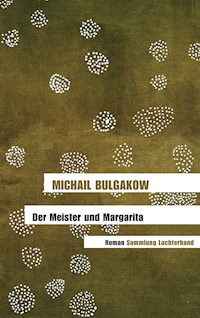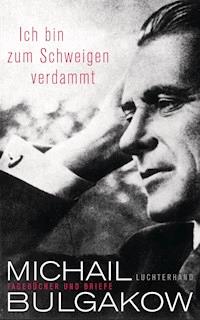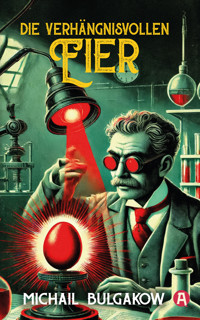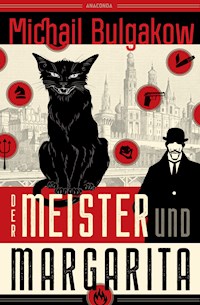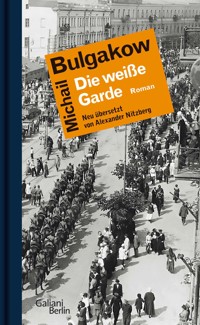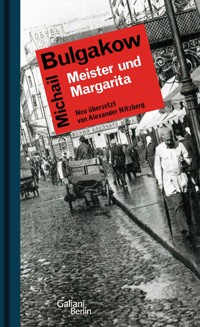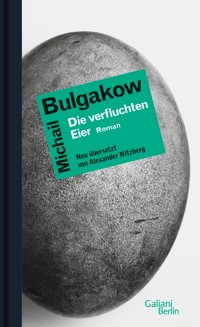Der Meister und Margarita, Das Hundeherz, Die verhängnisvollen Eier (3in1-Bundle) E-Book
Michail Bulgakow
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei teuflische Satiren über die Sowjetunion in einem E-Book
In »Der Meister und Margarita« stürzt der Teufel das Moskau der 1930er-Jahre in ein Chaos aus Hypnose, Spuk und Zerstörung. Es ist die verdiente Strafe für Heuchelei, Korruption und Mittelmaß. Doch zwei Gerechte genießen Satans Sympathie: der im Irrenhaus sitzende Schriftsteller, genannt »Meister«, und Margarita, dessen einstige Geliebte.
Im »Hundeherz« verfällt der geniale Chirurg Professor Filipp Preobraschenski auf die Idee, dem Straßenköter Bello die Hypophyse eines Menschen einzupflanzen. Der Versuch misslingt auf grandiose Weise: Aus Bello wird Genosse Bellski, der flucht und säuft und stiehlt.
»Die verhängnisvollen Eier« ist vielleicht die wildeste von Bulgakows Grotesken. Die autobiografischen »Aufzeichnungen auf Manschetten« berichten vom Leben und Leiden eines Schriftstellers in der Stalinzeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1008
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über den Autor
Michail Bulgakow wurde am 15. Mai 1891 in Kiew geboren und starb am 10. März 1940 in Moskau. Nach einem Medizinstudium arbeitete er zunächst als Landarzt und zog dann nach Moskau, um sich ganz der Literatur zu widmen. Er gilt als der große russische Satiriker und hatte zeitlebens unter der stalinistischen Zensur zu leiden. Seine zahlreichen Dramen durften nicht aufgeführt werden, seine bedeutendsten Prosawerke konnten erst nach seinem Tod veröffentlicht werden. »Der Meister und Margarita« gilt als sein Hauptwerk.
Über die Übersetzerin
Alexandra Berlina wurde in Moskau geboren. Sie studierte in London und promovierte über Lyrikübersetzung. Für ihre Arbeit an »Der Meister und Margarita« erhielt sie u. a. das Johann-Joachim-Christoph-Bode-Stipendium. Neben den Werken Bulgakows übersetzte sie u. a. Texte von O. Henry, Bel Kaufman und Alexei Nawalny.
Michail Bulgakow
3 in 1 Bundle
Die verhängnisvollen Eier
Das Hundeherz
Der Meister und Margarita
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Alle Rechte vorbehalten. Covermotive: Hundeherz Olga_Angelloz / Shutterstock.com; rashadashurov / stock.adobe.com; Morphart / stock.adobe.com; Creative Trendz / stock.adobe.com; Covermotive: Die verhängnisvollen Eier Adobe Stock / sar14ev, Moch Solikin, Vector Tradition, Crowcat; Covermotive: Der Meister und Margarita Katze: shutterstock / Crosiy; Silhouette: shutterstock / Dusty_rat; Hintergrund: English School, (19th century), The Kremlin and the Moskvaretskoi Bridge, Moscow. Photo © Look and Learn / Bridgeman Images Covergestaltung: www.katjaholst.deISBN 978-3-641-32510-7V001 www.anacondaverlag.de
Michail Bulgakow
Die verhängnisvollen Eier
Eine monströse Geschichte
Aus dem Russischen neu übersetzt von Alexandra Berlina
Kapitel 1Professor Persikows Curriculum Vitae
Am Abend des 16. April 1928 betrat Professor Wladimir Persikow – Inhaber des Zoologielehrstuhls an der Staatsuniversität N 4 und Direktor des Moskauer Instituts für Tierkunde – sein Institutslabor an der Alexander-Herzen-Straße, schaltete die matte Leuchtkugel an der Decke ein und sah sich um.
Die entsetzliche Katastrophe nahm an genau jenem unglückseligen Abend ihren Lauf, und der Urgrund dieser Katastrophe war niemand anderer als Professor Wladimir Persikow.
Er war exakt 58 Jahre alt. Ein bemerkenswerter Kopf, ein Kopf wie eine Lokomotive, kahl bis auf zwei Büschel gelbliches Haar an den Seiten.1 Glattrasiertes Gesicht mit hervorstehender Unterlippe, die ihm stets einen etwas schmollenden Ausdruck verlieh. Altmodische kleine Brille in silberner Fassung auf der roten Nase; kleine, glänzende Augen; hoher Wuchs, leichter Rundrücken. Die Stimme knarrend, quiekend, quakend, dazu einige Eigenarten wie diese: Wenn er besonders nachdrücklich und mit großer Sicherheit sprach, krümmte er den Zeigefinger der rechten Hand zu einem Haken und kniff die Augen zusammen. Da er aber dank phänomenaler Gelehrsamkeit auf seinen Fachgebieten immer mit großer Sicherheit sprach, war der gekrümmte Finger eine sehr häufige Erscheinung vor den Augen seiner Gesprächspartner. Und außerhalb seiner Gebiete, nämlich der Zoologie, der Embryologie, der Anatomie, der Botanik sowie der Geografie, sprach Professor Persikow kaum.
Zeitungen las Professor Persikow keine, ins Theater ging er nicht, und seine Frau war 1913 mit einem Operntenor durchgebrannt, nicht ohne ihrem Mann den folgenden Abschiedsbrief zu hinterlassen:
Die Abscheu vor deinen unerträglichen Fröschen bringt mich zum Schaudern. Ihretwegen werde ich mein Leben lang kein Glück kennen.
Der Professor heiratete nicht wieder und hatte keine Kinder. Er war sehr aufbrausend, aber nicht nachtragend, trank gern Moltebeerentee, lebte in Moskau auf dem Pretschistenka-Boulevard in einer Fünf-Zimmer-Wohnung, wobei eines der Zimmer die dürre alte Haushälterin Maria Stepanowna beherbergte, die sich um den Professor kümmerte wie um ein Kind.
1919 musste der Professor drei von seiner fünf Zimmern abtreten. Da sagte er zu Maria Stepanowna: »Wenn die nicht mit diesem Unsinn aufhören, ziehe ich ins Ausland.«
Zweifellos wäre er von jedem Zoologielehrstuhl der Welt mit offenen Armen empfangen worden, denn er war ein Wissenschaftler ersten Rangs, und in Bezug auf Amphibien konnten ihm weltweit nur Professor William Wackle in Cambridge und Professor Giacomo Bartolomeo Beccari in Rom das Wasser reichen. Deutsch und Französisch beherrschte Persikow einwandfrei, zudem las er zwei weitere Fremdsprachen. Und doch zog Persikow nicht ins Ausland, und das Jahr 1920 wurde noch schlimmer als 1919. Die Ereignisse überschlugen sich. Die Große Nikitskaja wurde in Alexander-Herzen-Straße umbenannt. Die ins Eckhaus an ebendieser Straße eingemauerte Uhr blieb stehen und zeigte nun für immer 11 Uhr 15. Schließlich wurden die Erschütterungen dieses denkwürdigen Jahres den Amphibien zu viel, und in den Terrarien des Instituts krepierten erst acht prächtige Laubfrösche, dann fünfzehn gewöhnliche Erdkröten und schließlich ein unendlich wertvolles Exemplar der Großen Wabenkröte.
Unmittelbar nach den Fröschen und Kröten, deren Ableben die Froschlurch-Sammlung des Lehrstuhls verwüstet hatte, verschied auch der Institutswächter, der alte Wlas, obschon er nicht zu der Kategorie der Amphibien gehörte. Der Grund seines Todes aber war der gleiche, und diesen stellte Persikow sogleich fest: Futtermangel.
Der Gelehrte hatte den Nagel auf den Kopf getroffen: Ein Wlas benötigt Mehlspeisen und eine Kröte Mehlwürmer; mit ersteren waren auch letztere verschwunden. Die verbleibenden zwanzig Laubfrösche wollte Persikow mit Kakerlaken durchfüttern, aber selbst diese hatten für das militärische Stadium des Kommunismus offenbar wenig übrig und machten sich davon. So landeten auch die letzten Exemplare in den Senkgruben im Innenhof des Instituts.
Die Todesfälle, insbesondere das Ableben der Wabenkröte, hatten den Professor vollkommen niedergeschmettert. Die Schuld gab er aus irgendeinem Grund ausschließlich dem damaligen Volkskommissar für Bildung.
Im ausgekühlten Institut sprach Persikow, in Hut und Galoschen, zu seinem Assistenten Iwanow, einem überaus eleganten Herrn mit blondem Spitzbart:
»Der Strick ist noch zu gut für ihn! Was denken die sich eigentlich? Das Institut geht zugrunde! Ein unvergleichliches männliches Exemplar, Pipa americana, dreizehn Zentimeter lang …«
Dann kam es noch schlimmer. Nach dem Tod von Wlas froren die Institutsfenster durch, sodass Eisblumen von innen auf dem Glas blühten. Die Hasen, die Füchse, die Wölfe, die Fische waren tot – und auch die Nattern, ausnahmslos. Persikow verbrachte ganze Tage schweigend, bekam irgendwann eine Lungenentzündung, überlebte aber. Sobald er bei Kräften war, nahm er seine Vorlesungen am Institut wieder auf. Zweimal die Woche stand er in seinen Galoschen, mit Ohrenmütze und Schal im Amphitheater, wo die Temperatur seltsamerweise wetterunabhängig stets minus fünf Grad betrug, und weiße Dampfschwaden entströmten seinem Mund, als er vor acht Zuhörern eine Vortragsreihe hielt. Das Thema lautete: »Reptilien des Südens«. Den Rest seiner Zeit verbrachte Persikow zu Hause, in einem mit Büchern vollgestopften Zimmer, unter der wärmsten Decke. Er hustete, schaute in den Feuerschlund des Ofens, den Maria Stepanowna mit vergoldeten Stühlen fütterte, und dachte an die Große Wabenkröte.
Doch alles vergeht. Und so verging das Jahr 1920, dann auch das nächste Jahr, und 1922 wandte sich auf einmal alles zum Besseren. Erstens: Anstelle von Wlas wurde dem Institut Pankrat zugeteilt, ein junger, doch vielversprechender Hausmeister, und im Winter begann man, wenn auch spärlich, zu heizen. Im Sommer fing Persikow mit Pankrats Hilfe vierzehn Erdkröten. Es kam wieder Leben in die Terrarien … 1923 hielt der Professor bereits acht Vorlesungen pro Woche – drei am Institut und fünf an der Universität; 1924 waren es dreizehn, dazu lehrte er noch an den Arbeiterschulen, und im Frühling 1925 ließ er berüchtigterweise 76 Studierende durchfallen, allesamt bei dem Thema »Lurche«.
»So, Sie kennen den Unterschied zwischen Lurchen und Reptilien nicht? Lurche haben keine Nachniere! Nicht vorhanden. So einfach ist das. Schämen Sie sich! Sie sind vermutlich Marxist, ja?«
»Jawohl«, gab der Durchfallende niedergeschlagen zu.
»Nun, wir sehen uns im Herbst wieder«, sagte Persikow darauf höflich und rief dann munter: »Pankrat, den Nächsten!«
Wie Amphibien nach langer Dürre bei dem ersten großen Regen aufleben, lebte auch Persikow 1926 richtig auf. In diesem Jahr erbaute ein amerikanisch-russisches Bauunternehmen 15 Hochhäuser in der Stadtmitte, Ecke der Twerskaja, sowie 300 Arbeiterhäuser mit je acht Wohnungen am Stadtrand, und setzte damit der furchtbaren und lächerlichen Moskauer Wohnkrise von 1919 – 1925 endgültig ein Ende.2
Der Sommer 1926 war eine wunderbare Zeit in Persikows Leben; gelegentlich erinnerte er sich kichernd und händereibend daran, wie eng er es mit seiner Haushälterin in zwei Zimmern gehabt hatte. Jetzt hatte der Professor seine gesamte Wohnung zurückbekommen, es sich gemütlich gemacht, die Regale mit zweieinhalbtausend Büchern sowie diversen Präparaten und Diagrammen gefüllt, wieder die Lampe mit dem grünen Schirm im Arbeitszimmer eingeschaltet.
Auch das Institut war nicht wiederzuerkennen: Es wurde cremeweiß neu gestrichen, der Raum mit den Terrarien bekam eine gesonderte Wasserleitung, die alte Verglasung wurde gegen eine verspiegelte ausgetauscht; geliefert wurden fünf neue Mikroskope, gläserne Präpariertische, 2000 Lumen starke Lichtbogenlampen, Reflektoren, Museumsschränke.
Persikow lebte auf, und die ganze Welt erfuhr es, als im Dezember 1926 seine neue Schrift erschien: Eine weitere Annäherung an die Frage der Vermehrung der Stachelweichtiere, insbesondere der Chitonidae (125 Seiten, Publikationen der Staatsuniversität N 4).
Im Herbst 1927 folgte dann ein großes, 350 Seiten starkes Werk, das anschließend in sechs Sprachen inklusive des Japanischen übersetzt wurde: Die Embryologie der Zungenlosen, der Schaufelfußkröten und der Froschlurche, 3 Rubel, Gosizdat Staatsverlag.
Im Sommer 1928 aber passierte das Unmögliche, das Entsetzliche …
Kapitel 2Der schillernde Kringel
Nun also: Der Professor schaltete die Leuchtkugel ein und sah sich um. Dann knipste er den Reflektor auf dem langen Experimentiertisch an, warf sich einen weißen Kittel über, legte klirrend irgendwelche Werkzeuge zurecht …
Von den 30 000 Automobilen und anderen pferdelosen Fahrzeugen, die Moskau im Jahre 1928 vorzuweisen hatte, rauschten nicht wenige über das glatte Holzpflaster der Alexander-Herzen-Straße; alle zwei Minuten raste zudem eine Straßenbahn am Institut vorbei – die Nummer 16, 22, 48 oder auch die 53. Eine blasse, neblige Mondsichel zeigte sich hoch am Himmel neben der dunklen und schweren Kuppel der Erlöserkathedrale und warf bunte Lichtreflexe durch die verspiegelten Laborfenster.
Professor Persikow aber interessierte sich weder für den Mond noch für den Moskauer Frühlingslärm. Er saß auf einem dreibeinigen Drehhocker, hantierte mit tabakbraunen Fingern am Rädchen eines prächtigen Zeiss-Mikroskops und betrachtete ein ganz gewöhnliches, ungefärbtes, frisches Amöbenpräparat. Als er die Vergrößerung gerade von fünftausendfach auf zehntausendfach umstellte, öffnete sich die Tür einen Spalt breit, darin erschien der Spitzbart, und der Assistent fragte:
»Herr Professor, ich habe das Mesenterium vorbereitet, möchten Sie mal schauen?«
Persikow rutschte flink vom Hocker, ließ das Rädchen auf halbem Weg los und machte sich, eine Zigarette zwischen den Fingern, auf den Weg ins Labor des Assistenten. Dort, auf einer Korkmatte auf dem Glastisch, war ein halb erstickter, vor Schreck und Schmerz erstarrter Frosch gespannt, dessen durchsichtige Gedärme aus dem blutenden Bauch und unter das Mikroskop gezogen waren.
»Sehr gut«, sagte Persikow und drückte das Auge ans Okular.
Das Mesenterium des Frosches, in dem Blutkügelchen ganz klar sichtbar durch die Flüsse der Gefäße eilten, interessierte ihn offenbar sehr. Die Amöben ganz vergessen, verbrachte Persikow anderthalb Stunden am Mikroskop des Assistenten, nicht ohne diesen gelegentlich ans Okular zu lassen. Dabei tauschten die beiden Wissenschaftler lebhafte, für einfache Sterbliche unverständliche Bemerkungen aus.
Schließlich ließ Persikow vom Mikroskop ab und sagte:
»Das Blut gerinnt, kann man nichts machen.«
Der Frosch hob mühsam den Kopf an, und in seinen erlöschenden Augen waren klar die Worte zu lesen: »Was seid ihr denn bloß für Dreckschweine …«
Persikow erhob sich, ging auf steifen Beinen in sein Labor zurück, gähnte, rieb seine stets entzündeten Augenlider, setzte sich auf den Hocker und schaute ins Mikroskop. Die Finger hatte er schon am Rädchen und wollte gerade daran drehen, tat es aber nicht. Mit seinem rechten Auge sah er etwas verschwommen eine mattweiße Scheibe, darauf die bleichen Amöben und in der Mitte einen farbigen Kringel wie eine Haarlocke. So einen Kringel hatte Persikow selbst, ebenso wie Hunderte seiner Schüler, schon sehr oft gesehen; niemand interessierte sich dafür – warum auch? Das schillernde Lichtbündel zeigte unzureichende Fokussierung an und störte nur beim Beobachten. Es war mit einem Dreh am Rädchen auszulöschen und durch reines weißes Licht zu ersetzen. Ja, die langen Finger des Zoologen hatten das Rädchen bereits fest im Griff, doch dann zuckten sie und ließen los. Der Grund dafür war das rechte Auge Persikows. Auf einmal blickte es angespannt, verwundert, ja besorgt. Denn zum Unglück der ganzen Sowjetunion war es kein Mittelmaß, das da am Mikroskop saß. Nein, es war Professor Persikow höchstpersönlich! Seine ganze Geisteskraft, sein ganzes Leben konzentrierten sich nun in seinem rechten Auge. Fünf Minuten lang strengte es sich qualvoll über dem unscharfen Präparat an: Das höhere Wesen betrachtete ein unendlich niedrigeres. Alles war still. Pankrat schlief schon in seinem Kämmerlein im Vorraum. Zart und musikalisch klirrten die Glastüren der Schränke im Nebenraum – Iwanow schloss sein Labor ab. Die Eingangstür ächzte. Erst dann erklang die Stimme des Professors, der wer weiß wen fragte:
»Was in aller Welt ist das? Verstehe ich nicht …«
Ein später Lastwagen rumpelte die Alexander-Herzen-Straße herunter. Die alten Institutsmauern erzitterten, die flache Glasschale mit den Pinzetten klirrte auf dem Tisch. Der Professor wurde bleich und hielt die Hände schützend übers Mikroskop wie eine Mutter, deren Baby Gefahr droht. Nun war keine Rede mehr davon, am Rädchen zu drehen, oh nein, vielmehr hatte Persikow regelrechte Angst, etwas könnte aus seinem Blickfeld verdrängen, was er da gerade sah.
***
Der Morgen strahlte schon in voller Kraft, und ein goldener Lichtstreifen lag über der cremeweißen Institutstreppe, als der Professor sich vom Mikroskop losriss und auf tauben Beinen dem Fenster näherte. Ein zitternder Finger drückte einen Knopf, und schwarze Rollläden verdeckten den Morgen. Die weise, gelehrte Nacht senkte sich wieder auf den Professor. Breitbeinig stand Persikow da, Inbrunst in dem gelben Gesicht, starrte mit tränenden Augen aufs Parkett und sprach:
»Aber wie denn das? Das ist doch ungeheuerlich!« Er hob den Blick zu den Kröten im Terrarium und wiederholte: »Ungeheuerlich ist das, meine Herren!« Doch die Kröten schliefen und antworteten nicht.
Eine Weile stand Persikow still, dann ließ er die Rollläden wieder hinaufsausen, schaltete alle Lichter aus und schaute ins Okular. Sein Gesicht war angespannt, seine buschigen gelben Brauen rückten zusammen.
»Aha, aha«, murmelte er, »weg ist er. Verstehe.« Den irrsinnigen, inspirierten Blick auf die ausgeschaltete Leuchtkugel über seinem Kopf gerichtet, wiederholte er gedehnt: »Verstehe. Ganz einfach.«
Wieder zischten die Rollläden herunter, wieder ging das Licht an. Der Professor schaute ins Mikroskop, grinste ein freudiges Raubtiergrinsen.
»Den fange ich«, verkündete er feierlich und hob den Zeigefinger, »jawohl. Vielleicht geht es ja auch mit der Sonne?«
Wieder schossen die Rollläden hoch. Sonnenlicht war inzwischen reichlich vorhanden; es durchflutete die Straße, lag morgendlich und weiß auf den Institutsmauern. Persikow schaute aus dem Fenster und überlegte sich, wo die Sonnenstrahlen mittags landen würden. Tänzelnd machte er einen Schritt zurück, dann wieder einen vor, streckte sich am Ende bäuchlings aus dem Fenster.
Dann machte er sich an wichtige und geheimnisvolle Arbeit. Bedeckte das Mikroskop mit einer Glashaube. Schmolz ein Stück Siegellack in der bläulichen Flamme des Bunsenbrenners, befestigte damit die Glashaube am Tisch und drückte seinen Daumen in jede warme Lacklasche. Dann drehte er das Gas ab, ging hinaus und schloss sorgsam hinter sich ab.
Halbdunkel herrschte in den Institutsgängen. Der Professor erreichte Pankrats Kämmerlein und klopfte an die Tür. Lange hatte das keinen Erfolg, bis schließlich drinnen etwas knurrte, brummte, feucht hustete, und in dem hellen Rechteck der Tür Pankrat erschien. Seine gestreifte lange Unterhose hatte Schnürchen an den Knöcheln, seine Augen blickten wild, und eine Art Hundewimmern entfuhr seiner Kehle.
»Pankrat«, sagte der Professor und betrachtete ihn über den Brillenrand, »tut mir leid, dass ich dich wecken musste. Was ich sagen will, mein Freund: Morgen früh mein Labor nicht betreten. Da steht ein Objekt, das nicht verschoben werden darf. Verstehst du?«
»Ver …stehe …«, gähnte Pankrat taumelnd, ohne etwas zu verstehen.
»Nein, du musst schon aufwachen, Pankrat«, sagte der Zoologe und stieß Pankrat leicht in die Rippen, woraufhin die Augen des Hausmeisters sich erschrocken öffneten und so etwas wie Bewusstsein darin aufschimmerte. »Ich habe abgeschlossen«, fuhr Persikow fort, »bei mir nicht aufräumen, bis ich wieder da bin. Ist das klar?«
»Jawohl«, krächzte Pankrat.
»Na wunderbar, geh wieder schlafen.«
Pankrat drehte sich um, verschwand im Zimmer und wuchtete sich aufs Bett. Der Professor begab sich in die Eingangshalle. Dort zog er seinen grauen Sommermantel an, setzte den Hut auf, dachte dann an das Bild unter dem Mikroskop und betrachtete ein paar Augenblicke lang seine Galoschen, als sähe er sie zum ersten Mal. Dann zog er die linke Galosche an und wollte die rechte darüber ziehen, doch diese weigerte sich.
»So ein unglaublicher Zufall, dass er mich weggerufen hatte«, murmelte er. »Sonst hätte ich nichts bemerkt. Aber was heißt das? Teufel, das heißt doch etwas Unglaubliches!«
Der Professor grinste, musterte mit zusammengekniffenen Augen die Galoschen, zog die linke aus und die rechte an.
»Gütiger Himmel! Die Folgen sind ja gar nicht auszumalen …« Der Professor warf mit Verachtung die linke Galosche zur Seite, die unverschämterweise nicht auf die rechte passen wollte, und ging eingaloschig zum Ausgang, wobei er unterwegs ein Taschentuch fallen ließ. Die schwere Tür schlug hinter ihm zu. Auf der Treppe suchte er lange nach Streichhölzern, klopfte seine Taschen ab, wurde schließlich fündig, steckte sich eine Zigarette in den Mund und machte sich auf den Weg, ohne diese anzuzünden.
Auf dem ganzen Weg bis zur Kathedrale begegnete der Professor keiner Menschenseele. Vor der Kathedrale blieb er wie angewurzelt stehen, warf den Kopf in den Nacken und starrte auf den goldenen Helm der mittleren Kuppel. Die Sonne leckte genüsslich an ihrer Seite.
»Wieso habe ich das früher nicht gesehen? So ein Zufall …« Da glitt sein Blick nach unten, auf die ungleichen Füße. »Wie dumm von mir. Was soll ich denn jetzt? Zurück zu Pankrat? Ach wo, den bekomme ich nicht wieder wach. Das verdammte Ding wegwerfen wäre aber auch schade. Dann muss ich die wohl tragen …« Mit Abscheu nahm er die Galosche in die Hand.
Ein altes Automobil fuhr gerade vorbei, darin zwei beschwipste Männer, und auf den beiden eine grell geschminkte Frau in seidenen Pluderhosen, die 1928 so beliebt waren.3
»Armer Opa!«, rief sie tief und heiser. »Die andere Galosche versoffen, was?«
»Der Alte hat sich wohl im Alcazar volllaufen lassen«, brüllte der linke Mann. Der rechte steckte den Kopf aus dem Automobil und wollte wissen: »Du, Opa, hat die Nachtbar auf der Wolchonka denn noch auf? Da wollen wir gerade hin!«
Der Professor betrachtete sie streng über die Brille hinweg, wobei ihm die Zigarette aus dem Mund fiel, und vergaß sie sofort. Ein Lichtstreifen bahnte sich den Weg auf den Pretschistenka-Boulevard, und der goldene Helm des Erlösers strahlte. Die Sonne war aufgegangen.
Kapitel 3Die Entdeckung des Professors
Der springende Punkt war dies: Als das geniale Auge des Professors an jenem Abend ins Okular geblickt hatte, war ihm zum ersten Mal aufgefallen, dass ein bestimmter Strahl in dem schillernden Kringel deutlich und kräftig hervorstand. Dieser Strahl war leuchtend rot und ragte aus dem Kringel wie eine winzige Spitze, eine Art ultradünne Nadel.
Das Unglück war eben, dass diese Spitze für einen Moment den erfahrenen Blick des virtuosen Wissenschaftlers auf sich gezogen hatte.
Und dann sah er dort, in diesem Strahl, etwas unendlich viel Wichtigeres als einen Lichteffekt, der zufällig und unschuldig aus dem Zusammenspiel von Objektiv und Spiegel im Mikroskop entsteht. Denn als der Assistent ihn weggerufen hatte, waren einige Amöben anderthalb Stunden lang dem Einfluss des roten Strahls ausgesetzt geblieben. Und während die anderen schlaff und hilflos auf der Scheibe lagen, passierte unter dem spitzen roten Schwert etwas Seltsames. Dort wimmelte es vor Leben. Graue Amöben reckten ihre Scheinfüßchen aus allen Kräften in den roten Streifen und lebten magisch auf. Irgendeine Kraft weckte dort offenbar ihre Energie, sie strömten nur so hin und kämpften um einen Platz in dem Strahl, wo hemmungslose (anders lässt es sich kaum sagen) Fortpflanzung stattfand. Allen Gesetzen zum Trotz, die Persikow in- und auswendig kannte, passierte die Teilung in Windeseile. Als der Professor zu seinem Mikroskop zurückgekehrt war, sah er Amöben im Strahl rasend in zwei Teile zerfallen, die zu neuen Amöben wurden, Sekunden später voll ausgewachsen waren und sich ihrerseits vermehrten. Es wurde eng: erst im roten Strahl, dann auf der ganzen Scheibe, und es entbrannte der unvermeidliche Kampf. Amöben rissen sich in Stücke, verschlangen sich gegenseitig. Zwischen den Neugeborenen lagen zerfetzte Leichen. Die Besten und Stärksten gewannen. Und diese Besten waren furchtbar. Erstens waren sie doppelt so groß wie die anderen, und zweitens legten sie eine besonders rabiate Energie an den Tag. Ihre Bewegungen waren rasch, ihre Scheinfüßchen überlang und aktiv wie die Tentakel eines Oktopus.
Am zweiten Abend studierte der Professor, blass und ausgezehrt – er hatte seit der Entdeckung nur von dicken selbstgedrehten Zigaretten gelebt – die neue Generation von Amöben. Am dritten Abend wandte er sich schließlich der Urquelle zu, also dem roten Strahl.
Das Gas zischte leise im Bunsenbrenner, und draußen ratterte wieder der Morgenverkehr, als der Professor, tabakvergiftet und erschöpft, sich mit halbgeschlossenen Augen in seinem Drehstuhl zurücklehnte.
»Jetzt ist alles klar. Der Strahl hat sie zum Leben erweckt. Ganz neu ist das, unerforscht, ja unentdeckt. Erste Frage: Nur durch elektrisches Licht oder auch durch Sonneneinwirkung?«, murmelte er.
Noch eine Nacht später war das Ergebnis klar. In drei Mikroskopen hatte Persikow drei elektrisch erzeugte Strahlen eingefangen und keinen einzigen von der Sonne. Daraufhin beschloss er:
»Nun also, höchstwahrscheinlich nicht im Sonnenspektrum. Tja. Also wohl nur durch elektrisches Licht herzustellen.« Liebevoll betrachtete er die matte Leuchtkugel unter der Decke, hing noch einen beflügelten Moment lang seinen Gedanken nach und lud dann Iwanow in sein Labor. Dort erzählte ihm der Professor alles und zeigte die Amöben.
Der Privatdozent war erstaunt, ja niedergeschmettert: Wie konnte eine so simple Sache, dieser schmale rote Strahl, verdammt noch mal so lange unbemerkt bleiben? Er hätte doch jedem auffallen können, beispielsweise ihm, dem Privatdozenten Iwanow! Und es war ja wirklich ungeheuerlich …
»Schauen Sie nur, Herr Professor!« Iwanow klebte entsetzt am Okular. »Was ist denn hier los? Sie wachsen doch direkt vor meinen Augen! Schauen Sie nur …«
»Ich schaue es mir schon seit drei Tagen an«, erwiderte Persikow.
Anschließend fand zwischen den beiden Wissenschaftlern ein Gespräch statt, im Laufe dessen der Privatdozent versprach, mithilfe von Linsen und Spiegeln eine Kammer zu bauen, um ganz ohne Mikroskop eine vergrößerte Version des Strahls zu produzieren. Er äußerte die Hoffnung, ja die Zuversicht, dass dies ohne Weiteres funktionieren müsste. Der Professor würde den Strahl bekommen, zweifellos. An dieser Stelle stockte das Gespräch kurz.
»Wenn ich die Arbeit dazu veröffentliche, erwähne ich natürlich, dass Sie die Kammer konstruiert haben«, sagte Persikow, als ihm die Ursache der Pause dämmerte.
»Oh, das ist doch nicht nötig! Aber wenn Sie meinen …«
Ab diesem Augenblick stockte nichts mehr, und auch Iwanow gab sich ganz dem roten Strahl hin. Während Persikow, abgemagert und übernächtigt, kaum vom Mikroskop wich, bastelte Iwanow mithilfe eines Mechanikers im grell erleuchteten Physiklabor an einer komplexen Kombination von Linsen und Spiegeln.
Nach einer Anfrage beim Bildungskommissariat erhielt Persikow drei Pakete aus Deutschland, allesamt mit Linsen und Spiegeln: doppelkonvex, doppelkonkav und sogar konvex-konkav, hochpoliert. Iwanow baute seine Kammer und schaffte es auch tatsächlich, den roten Strahl einzufangen. Und das ziemlich brillant, muss man sagen: Der Strahl war dick, etwa vier Zentimeter im Durchmesser, scharf und stark.
Am 1. Juni kam die Kammer in Persikows Labor, und er begann eifrig, mit Froschlaich zu experimentieren. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Innerhalb von zwei Tagen waren Tausende von Kaulquappen geschlüpft – und nur einen Tag später zu Fröschen herangewachsen, und zwar zu dermaßen aggressiven und gefräßigen Fröschen, dass die Hälfte sogleich von der anderen zerfetzt und verschluckt wurde. Die Verbliebenen laichten gleich darauf, und zwei weitere Tage später war schon die nächste Generation da, nun ohne jeden roten Strahl und in unzähligen Mengen. Im Labor war inzwischen die Hölle los, und nicht nur dort: Die Kaulquappen hatten sich überall im Gebäude verbreitet; in Terrarien und einfach nur auf dem Boden, in jeder Ecke und jedem Winkel sangen schallende Froschchöre, als wäre das ganze Institut ein einziger Sumpf. Pankrat, der sich ohnehin schon vor Persikow gefürchtet hatte, empfand ihm gegenüber nun das reinste Grauen. Eine Woche später spürte auch der Wissenschaftler selbst, dass er langsam den Verstand verlor. Daraufhin füllte sich das Institut mit dem Geruch von Äther und Zyankali. Neben den Fröschen hätte sich auch Pankrat beinahe zu Tode vergiftet, als er seine Maske unvorsichtig abgenommen hatte. Am Ende war die Sumpfbrut vernichtet; das Institut wurde durchgelüftet, der Spuk war vorbei.
Persikow sagte zu Iwanow: »Wissen Sie, die Wirkung dieses Strahls auf das Deutoplasma und die Eizelle im Allgemeinen ist schon beeindruckend.«
Da geschah es, dass der Privatdozent, sonst immer zurückhaltend und kühl, den Professor unterbrach:
»Das sind ja alles nur Details, das Deutoplasma und so weiter … Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen: Sie sind da etwas Unglaublichem auf die Spur gekommen!« Weiter zu reden, kostete ihn offenbar Selbstüberwindung, er tat es aber: »Professor Persikow, was Sie da entdeckt haben, ist der Strahl des Lebens!«
Eine zarte Röte kroch über Persikows blasse, unrasierte Wangen.
»Nicht doch, nicht doch …«, murmelte er.
»Sie werden solchen Ruhm erlangen! Es macht mich schwindelig …« Immer leidenschaftlicher fuhr der Assistent fort: »Verstehen Sie doch, Herr Professor, die Gestalten von H. G. Wells können Ihnen nicht das Wasser reichen! Ich hielt das alles für bloße Märchen … Wissen Sie noch, Die Riesen kommen?«4
»Ist das ein Roman?«
»Ein weltbekannter, den kennen Sie doch!«
»Habe ich vergessen. Gelesen habe ich ihn schon, aber vergessen.«
»Wie vergisst man denn so etwas? Na ja, jedenfalls – schauen Sie bloß hin!« Iwanow fasste einen gigantischen toten Frosch mit aufgeblähtem Bauch am Bein und hob ihn vom Glastisch. Selbst tot wirkte er noch wütend. »Das ist doch ungeheuerlich!«
Kapitel 4Die Erzpriesterwitwe
Wer weiß, ob es Iwanows Schuld war oder ob sensationelle Neuigkeiten ganz von allein durch die Lüfte schweben; jedenfalls begann das ganze riesige, brodelnde Moskau auf einmal von dem Strahl und von Professor Persikow zu reden – jedoch diffus und äußerst vage. Die Nachricht von der wundersamen Entdeckung flog durch die hell erleuchtete Stadt wie ein verwundeter Vogel: Mal verschwand sie aus dem Blickfeld, mal flatterte sie wieder hoch. So ging es bis Mitte Juni, als auf Seite 20 der Iswestija unter der Rubrik »Neues aus Wissenschaft und Technik« ein kurzer Artikel über den Strahl erschien. Ganz emotionslos wurde darin mitgeteilt, ein bekannter Professor der Staatsuniversität N 4 habe einen Strahl erfunden, der die Aktivität niederer Organismen in unglaublichem Maße steigere, und dass dieses Phänomen der Überprüfung bedürfe. Den Namen hatten sie natürlich verdreht: Im Artikel hieß der Entdecker »Pewsikow«.
Der Assistent brachte dem Professor die Zeitung.
»Pewsikow!«, brummte dieser, während er an der Strahlkammer werkelte. »Woher wissen diese Nichtsnutze denn überhaupt davon?«
Leider konnte der Fehler im Namen des Professors ihn nicht von den Ereignissen bewahren, die gleich am nächsten Tag begannen und sein ganzes Leben auf den Kopf stellten.
Und zwar klopfte Pankrat an die Tür und erschien dann im Labor mit einer prachtvollen Hochglanz-Visitenkarte.
»Der tut da draußen warten«, erklärte er zaghaft.
Auf der Visitenkarte stand in eleganter Schrift:
Alfred Bronskij
Mitarbeiter der Moskauer Zeitschriften Rote Flamme, Rotes Magazin, Roter Scheinwerfer und Roter Pfeffersowie der Abendzeitung Rotes Moskau.
»Jag ihn zum Teufel«, sagte Persikow eintönig und ließ die Karte unter den Tisch fallen.
Pankrat machte kehrt, ging hinaus und kam fünf Minuten später zurück, Leid im Gesicht und eine zweite Visitenkarte in der Hand.
»Soll das ein Witz sein?«, zischte Persikow bedrohlich.
»Der kommt von der GPU«, gab Pankrat zurück und wurde bleich.5
Persikow ließ seine Pinzette fallen und schnappte ihm die Karte mit solcher Wucht aus der Hand, dass er sie beinahe zerrissen hätte. Auf der Rückseite stand in schnörkeliger Schrift: »Ich bitte Sie demütig um drei Minuten Ihrer kostbaren Zeit, verehrter Professor, im Auftrag der öffentlichen Presse. Korrespondent der Satirezeitschrift Rote Minna, einer Publikation der GPU.«
»Ruf ihn rein«, keuchte Persikow.
Hinter Pankrats Rücken erschien sogleich ein junger Mann mit glattrasiertem, öligem Gesicht. Auffällig waren seine permanent hochgezogenen, beinahe chinesischen Augenbrauen und die kleinen dunklen Augen darunter, die nicht für eine Sekunde den Gesprächspartner anblickten. Die Kleidung des jungen Mannes war tadellos und modisch: eine schmales Jackett, das ihm bis zu den Knien reichte, Pluderhosen und extrem breite Lackschuhe mit hufartigen Spitzen, dazu eine Zipfelmütze.6 Diese hielt er gerade in den Händen, nebst Gehstock und Notizblock.
»Was wollen Sie?«, fragte Persikow in einem Tonfall, der Pankrat augenblicklich hinter der Tür verschwinden ließ. »Man hat Ihnen doch gesagt: Ich bin beschäftigt!«
Statt einer Antwort verbeugte sich der junge Mann zweimal vor dem Professor, einmal nach links, einmal nach rechts, daraufhin huschten seine Äuglein über das ganze Labor, und er machte eine Notiz in seinem Block.
»Ich bin beschäftigt.« Der Professor blickte angeekelt ins Gesicht des Besuchers, erzeugte jedoch keinerlei Effekt, da die Äuglein ihm stets entwischten.
»Ich bitte tausend Mal um Entschuldigung, hochverehrter Professor«, sagte der junge Mann mit dünner Stimme, »dass ich so hereinplatze und Ihre kostbare Zeit stehle, doch Ihre global weltbekannte Entdeckung nötigt uns geradezu, Sie um eine Erklärung zu bitten.«
»Was für eine weltbekannte Erklärung?«, piepste Persikow und wurde gelb im Gesicht. »Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen irgendwelche Erklärungen abzugeben! Ich bin beschäftigt … furchtbar beschäftigt!«
»Was beschäftigt Sie denn?«, erkundigte sich der junge Mann einschmeichelnd und kritzelte wieder etwas in seinen Block.
»Nun, ich … Was schreiben Sie denn? Wollen Sie etwas abdrucken?«
Der Besucher nickte – und begann auf einmal mit erschreckender Geschwindigkeit seinen Block zu füllen.
»Erstens habe ich keine Absicht, etwas zu veröffentlichen, bevor ich die Arbeit abschließe. Erst recht nicht in diesen Ihren Zeitungen … Zweitens: Woher haben Sie das alles denn?« Persikow wurde immer ratloser.
»Stimmt es, dass Sie den Strahl des Neuen Lebens erfunden haben?«
»Was heißt hier ›Neuen Lebens‹?«, explodierte der Professor. »Was für ein Unsinn! Der Strahl, an dem ich arbeite, ist noch nahezu unerforscht, wir wissen noch nichts! Er scheint die Aktivität von Protoplasma zu erhöhen …«
»Um wie viel?«, fragte der junge Mann sofort.
Da wusste Persikow nun wirklich nicht weiter. So einer, zum Teufel aber auch!
»Das ist eine vollkommen unwissenschaftliche Frage! Wenn es, von mir aus, tausendfach wäre – was würde das überhaupt heißen?«
Gierige Freude leuchtete in den dunklen Äuglein auf.
»Es entstehen also gigantische Organismen?«
»Nichts dergleichen! Das heißt … Nun ja, die von mir auf diese Weise produzierten Organismen sind durchaus größer als die herkömmlichen … Ein paar Sondereigenschaften haben sie auch … Aber das Auffällige hier ist ja gar nicht die Größe, sondern die unglaubliche Reproduktionsgeschwindigkeit.«
Sogleich bereute Persikow, das gesagt zu haben, denn daraufhin füllte der junge Mann eine ganze Seite, blätterte um und schrieb weiter.
»Jetzt hören Sie doch auf mit dem Schreiben!«, krächzte Persikow verzweifelt. Er spürte, dass er dem jungen Mann ausgeliefert war. »Was schreiben Sie denn?«
»Stimmt es, dass Sie innerhalb von zwei Tagen zwei Millionen Kaulquappen aus Froschlaich ausbrüten können?«
»Aus wie viel Froschlaich?!«, verlor der Professor erneut die Beherrschung. »Haben Sie jemals den Laich, sagen wir, eines Laubfrosches gesehen?«
»Halbes Pfund?«, fragte der junge Mann ungeniert.
Persikow lief scharlachrot an.
»Wer misst denn so? Was reden Sie da überhaupt? Das ist doch – nun, ein halbes Pfund Froschlaich, das wäre … Tja, schon … Also eine vergleichbare Menge, vielleicht noch viel mehr!«
Die dunklen Äuglein leuchteten auf, und in einem Schwung war noch eine Seite voll.
»Stimmt es, dass Ihre Entdeckung eine weltweite Revolution in der Tierzucht auslösen wird?«
»So einen Unsinn kann aber auch wirklich nur ein Journalist fragen!«, heulte Persikow auf. »Ich erlaube Ihnen nicht, Nonsens zu schreiben! Sie kritzeln doch das widerlichste Zeug, ich sehe es an Ihrem Gesicht!«
»Ich bräuchte noch eine Fotografie von Ihnen, mein lieber Professor, ich bitte sehr darum.« Damit schloss der junge Mann seinen Notizblock.
»Wie bitte? Ein Bild von mir? Für diese sogenannte Zeitschrift von Ihnen? Zusammen mit diesem Unsinn, den Sie da von sich geben? Nein, nein und nochmals nein! Und überhaupt … Ich bin beschäftigt!«
»Es braucht nicht unbedingt aktuell zu sein. Und Sie bekommen es in aller Bälde zurück!«
»Pankrat!«, brüllte der Professor.
»Ich danke Ihnen vielmals«, sagte der junge Mann, und weg war er.
Pankrat erschien nicht. Stattdessen waren hinter der Tür seltsame rhythmische Geräusche zu hören, etwas Metallisches klopfte auf den Boden, und herein kam ein ungewöhnlich voluminöser Mann, dessen Hemd und Hose aus Deckenstoff genäht schienen. Das Geklapper hatte sein linkes, mechanisches Bein hervorgebracht; in den Händen hielt er eine Aktentasche. Sein Gesicht, gelblich wie Sülze, lächelte freundlich. Er vollführte eine militärische Verbeugung und stand stramm. Sein Bein klickte. Persikow war sprachlos.
»Herr Professor«, begann der Fremde mit angenehmer, leicht kehliger Stimme, »verzeihen Sie einem Normalsterblichen, dass er Ihre Abgeschiedenheit stört.«
»Sind Sie ein Reporter?«, fragte Persikow. »Pankrat!«
»Gewiss nicht! Ich bin Kapitän auf großer Fahrt. Als solcher schreibe ich für den Industrieboten des Rats der Volkskommissare.«
»Pankrat!«, schrie Persikow ganz außer sich. Da ging in der Ecke ein rotes Licht an, und das Telefon klingelte sanft. »Pankrat!«, rief der Professor noch einmal und sagte dann in den Hörer: »Ja, bitte?«
»Verzeihen Sie bitte, Herr Professor«, krächzte das Telefon auf Deutsch, »dass ich störe. Als Mitarbeiter des Berliner Tageblatts …«
»Pankrat!«, brüllte der Professor und gab ebenfalls auf Deutsch zurück: »Ich bin momentan sehr beschäftigt und kann mit Ihnen nicht reden. Pankrat!«
Da schellte es auch schon am Haupteingang.
***
Schreiheisere Stimmen stiegen in der Junihitze in die Höhe, huschten zwischen den Rädern und den blinkenden Scheinwerfern hin und her. »Entsetzlicher Mord in der Bronnaja-Straße! Entsetzliche Hühnerkrankheit bei der Erzpriesterwitwe Drosdowa mit Bild! Der Lebensstrahl: Entsetzliche Entdeckung von Professor Persikow!«
Persikow zuckte so jäh zur Seite, dass ihn beinahe ein Automobil überfahren hätte, und griff wütend nach einer Zeitung.
»Drei Kopeken, der Bürger!«, rief der Junge, presste sich in die Menge und schrie wieder: »Rotes Moskau, Entdeckung der X-Strahlung!«
Bestürzt schlug Persikow die Zeitung auf und sackte an einer Laterne zusammen. In der linken Ecke der zweiten Seite starrte aus einem verschmierten Rahmen ein kahler Mann mit verrückten, blinden Augen und hängendem Unterkiefer – eine Kreatur von Alfred Bronskij. »W. Persikow, der Entdecker des geheimnisvollen roten Strahls« stand darunter. Dann kam der Artikel unter dem Titel »Die Welt vor einem Rätsel«. Er begann wie folgt:
»›Nehmen Sie doch bitte Platz!‹, sagte der eminente Gelehrte Persikow freundlich …«
Der Artikel war mit »Alfred Bronskij (Alonso)« unterzeichnet.
Ein grünliches Licht ging über der Universität auf, der Schriftzug »Sprechende Zeitung« erschien im Himmel, und sogleich füllte eine Menschenmenge die Straße.7
»Nehmen Sie doch bitte Platz!«, rief Alfred Bronskijs unausstehliche dünne Stimme, nun tausendfach vergrößert, »sagte der eminente Gelehrte Persikow freundlich! Es war mir schon lange ein Anliegen, das Moskauer Proletariat mit den Ergebnissen meiner Entdeckung bekannt zu machen!«
Hinter Persikows Rücken war ein metallisches Schaben zu hören, und jemand zerrte an seinem Ärmel. Als er sich umdrehte, sah er das gelbe, runde Gesicht des Mannes mit der Beinprothese. Seine Augen waren tränenfeucht, seine Lippen zitterten.
»Mich beliebten Sie also nicht mit den Ergebnissen Ihrer Entdeckung bekanntzumachen«, sagte er traurig und seufzte tief. »Aus und vorbei ist es mit meinen fünfzehn Rubeln.«
Sehnsüchtig blickte er zum Universitätsdach, zu dem unsichtbaren Alfred hin, der sich im schwarzen Maul des Lautsprechers ereiferte. Auf einmal tat er Persikow leid.
»Keinesfalls hatte ich ihm einen Sitz angeboten«, murmelte der Professor, während verhasste Worte auf ihn vom Himmel niederregneten. »Das ist einfach nur ein Mann von bodenloser Frechheit! Da müssen Sie schon verzeihen, aber wenn man Ihr Labor stürmt, während Sie gerade arbeiten … Ich meine natürlich nicht Sie …«
»Könnten Sie für mich zumindest Ihre Kammer beschreiben, Herr Professor?«, fragte der mechanische Mann mit einschmeichelnder Wehmut. »Ihnen ist es nun eh egal …«
»Aus einem halben Pfund Laich kommen in drei Tagen so viele Kaulquappen gekrochen, dass sie überhaupt nicht zu zählen sind!«, brüllte der Unsichtbare.
Automobile hupten dumpf und begeistert.
»Schpfsch … Oha! Schpfsch …«, raschelte die Menge und reckte die Köpfe hoch.
»So ein Schurke!«, zischte Persikow. Er zitterte vor Empörung. »So geht das doch nicht! Ich werde mich beschweren, jawohl!«
»Eine Schande!«, gab der Mechanische ihm recht.
Da schlug ein gleißender lila Strahl in die Augen des Professors, und alles um ihn herum leuchtete auf – die Laterne, ein Teil des Holzpflasters, die gelbe Wand, die neugierigen Gesichter.
»Der zielt auf Sie!«, flüsterte der Dicke begeistert und zerrte mit seinem ganzen Gewicht an Persikows Ärmel. Etwas ratterte in der Luft.
»Zum Teufel mit allem!«, rief der Professor wehleidig und drängte sich aus der Menge heraus. Der Dicke klebte an seiner Seite. »He, Taxi! Zur Pretschistenka-Straße!«
Ein altes Kabriolett aus dem Jahre 1924, von dem schon der Lack abblätterte, stoppte zischend am Bürgersteig, und der Professor versuchte, den Dicken abzuschütteln und hineinzuklettern.
»Jetzt lassen Sie mich doch!«, fauchte er und versteckte das Gesicht hinter geballten Fäusten vor dem lila Licht.
»Schon gelesen? Schon gehört? Der Professor Persikow wurde in der Bronnaja erstochen, mitsamt all seinen lieben Kleinen!«
»Ich habe keine lieben Kleinen, verdammt noch mal!«, schrie Persikow und war auf einmal im Fokus eines schwarzen Apparats, das ihn sogleich im Profil erschoss, mit offenem Mund und blindwütigen Augen.
»Krrr … bromm … brumm!«, machte das Automobil und bahnte sich den Weg durch die Menge.
Darin saß neben dem Professor der Dicke und hielt seine Seite warm.
Kapitel 5Die Geschichte mit den Hühnern
In dem Städtchen Steklowsk (ehemaliges Troizk) in der Kostroma-Provinz trat eine Frau mit Kopftuch und im grauen Kleid mit Blümchenmuster aus ihrem Häuschen in der Karl-Radek-Straße (ehemalige Kathedralenstraße) und brach in Tränen aus. Diese Frau – und es handelte sich um keine andere als Drosdowa, Witwe des ehemaligen Erzpriesters der ehemaligen Kathedrale – heulte so laut, dass im Haus gegenüber bald ein anderer tuchumwickelter Frauenkopf im Fenster erschien und rief:
»Was denn, schon wieder?«
»Schon die siebzehnte!«, verkündete die ehemalige Erzpriesterwitwe unter Tränen.
»Och Gottchen«, jammerte die andere und schüttelte den Kopf mitsamt dem Tuch, »so etwas! Ja, da zürnt uns wohl der liebe Gott! Ist tot, was?«
»Schau sie dir an!«, schluchzte die Witwe. »Schau sie dir bloß an!«
Das schiefe graue Tor klappte auf und zu, nackte Füße stampften über die staubige, hügelige Straße, und die tränennasse Witwe führte die Nachbarin auf ihren Geflügelhof.
Es war nämlich so: Nachdem ihr Mann, Sawwatij Drosdow, 1926 an der neuen antireligiösen Realität verstorben war, hatte die Drosdowa nicht den Mut verloren, sondern sich in Geflügelzucht hervorgetan. Sobald die Geschäfte in Gang gekommen waren, landete eine dermaßen exorbitante Steuerforderung im Briefkasten der Witwe, dass es mit der Hühnerzucht beinah vorbei gewesen wäre – doch gute Leute wussten Rat. Und zwar sollte die Witwe den örtlichen Behörden mitteilen, dass sie eine sozialistische Geflügelzuchtgenossenschaft gründe. Die Genossenschaft hatte drei Mitglieder: Drosdowa selbst als Vorsitzende, ihre treue Magd Matrjoschka sowie ihre taubstumme Nichte. Sogleich wurde der Witwe die Steuer erlassen, und die Hühnerzucht gedieh weiter – so sehr, dass 1928 etwa zweihundertfünfzig Glucken auf dem staubigen Hof zwischen den Ställen scharrten, darunter sogar edle Cochin-Hennen. Jeden Sonntag wurden die Witweneier nicht nur auf dem örtlichen Stadtmarkt verkauft, sondern auch in der Bezirkshauptstadt Tambow – und gelegentlich erschienen sie sogar in Moskau, im Schaufenster der ehemaligen Tschitschkin-Molkerei.
Nun stolperte aber schon die siebzehnte Henne, diesmal eine heiß geliebte Brahma, über den Hof und übergab sich. »Gack …ack …grlll«, würgte das arme Tier und rollte so hoffnungslos mit den Augen, als sehe es die Sonne zum letzten Mal. Vor ihr hockte das Genossenschaftsmitglied Matrjoschka mit einem Becher Wasser.
»Glucklein, Liebes, komm, ein Schlucklein!«, flehte Matrjoschka sie an und schob den Becher unter den Schnabel, doch die Henne wollte nicht trinken. Sie öffnete den Schnabel und warf den Kopf zurück. Dann erbrach sie Blut.
»Gott im Himmel!«, rief die Besucherin und schlug die Hände über der Brust zusammen. »Das gibt es doch nicht! Kommt ja der reinste Lebenssaft raus! Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Vogel sich so mit dem Magen abquält, wie ein Mensch, so wahr mir Gott helfe!«
Diese Worte dienten der armen Glucke als Sterbegebet. Auf einmal kippte sie um, vergrub den Schnabel hilflos im Staub und verdrehte die Augen. Dann rollte sie auf den Rücken, streckte die Beine in die Höhe und blieb reglos liegen. Matrjoschka ließ den Becher fallen und heulte mit tiefer Stimme auf; die Genossenschaftsvorsitzende heulte mit. Die Besucherin aber beugte sich zu ihr und flüsterte ihr eifrig ins Ohr:
»Ich schwöre, da hat jemand den bösen Blick auf deine Hühner geworfen. So was hab ich noch nie erlebt, so eine Hühnerkrankheit gibt es doch überhaupt nicht! Ich sage dir, die sind verhext, die Hühner.«
»Teufelswerk!«, rief die Witwe gen Himmel. »Die bringen mich noch ins Grab!«
Zur Antwort war ein lautes Kikeriki zu hören, und ein zerrupfter, dürrer Hahn wankte seitwärts aus dem Hühnerstall, als käme er aus der Kneipe. Er rollte mit den Augen, taumelte und breitete adlergleich seine Flügel aus, doch anstatt hochzufliegen, begann er, wie ein angebundenes Pferd in Kreisen über den Hof zu rennen. Beim dritten Kreis blieb er stehen, würgte, hustete, übergab sich, spuckte Blut und fiel schließlich um, die Beine wie Masten zur Sonne gerichtet. Auf dem Hof ertönte das Wehklagen der Frauen, die Hühnerställe antworteten mit rastlosem Gegacker und Gerumpel.
»Ich sag ja, Hexerei! Ruf Pfarrer Sergius, er soll hier ein Gebet sprechen!«
Um sechs Uhr abends, als das feurige Gesicht der Sonne tief zwischen den Visagen der jungen Sonnenblumen stand, hatte Pfarrer Sergius, der Vorsteher der Kathedrale, das Gebet beendet und entledigte sich gerade seiner Stola. Neugierige Köpfe lugten über den Holzzaun und schauten durch die Ritzen. Die verzweifelte Witwe küsste das Kruzifix und reichte Pfarrer Sergius einen angerissenen, tränennassen, kanariengelben Rubelschein, woraufhin dieser seufzte und etwas über den Herrgott murmelte, der uns wohl zürne. Dabei wirkte er, als wüsste er ganz genau, warum und wem der Herrgott zürnte, auch wenn er es nicht sagen würde.
Daraufhin verließ der Menschenauflauf die Straße, und da Hühner früh schlafen gehen, erfuhr niemand, dass zur selben Zeit im Stall von Drosdowas Nachbarn gleich drei Hennen und ein Hahn eingingen. Sie erbrachen genauso wie die von Drosdowa, nur eben in dem verschlossenen Stall und ohne Zeugen. Der Hahn stürzte kopfüber von der Sitzstange und war sofort tot. Was nun die verbliebenen Hennen der Witwe angeht, so starben auch diese allesamt gleich nach dem Gebet. Am Abend herrschte Totenstille in den Ställen, und der Boden war mit starren Geflügelleichen übersät.
Am nächsten Morgen wachte die Kleinstadt auf und war wie vom Blitz getroffen. Die Entwicklung hatte ungeheuerliche Ausmaße angenommen. Bis Mittag waren alle Hühner in der Karl-Radek-Straße tot, bis auf drei im Eckhaus, das der Bezirkssteuerprüfer mietete – aber in der nächsten Stunde krepierten auch diese. Am Abend summte Steklowsk wie ein Bienenstock: Das furchtbare Wort »Pest« rollte durch die Menge. Drosdowas Name kam in die Lokalzeitung, den Roten Kämpfer. Bald war der Artikel »Tatsächlich: Hühnerpest?« auch in Moskau zu lesen.
***
Inzwischen war Professor Persikows Leben seltsam geworden, rastlos, voller Aufregung. Kurzum, das Arbeiten wurde ihm unmöglich gemacht. Am Tag nach Alfred Bronskijs Besuch sah er sich gezwungen, das Telefon im Labor abzuschalten, indem er den Hörer neben dem Apparat liegen ließ. Am Abend darauf saß der Professor in der Straßenbahn, als er sich selbst auf dem Dach eines Hochhauses sah, auf dem in schwarzen Buchstaben Arbeiterzeitung stand. Der Doppelgänger auf dem Dach war flimmerig und grünlich, und doch sah man ihn klar genug auf dem weißen Bildschirm ins Taxi klettern, gefolgt von einer mechanisch angetriebenen, in Decken gehüllten Kugel. Mit geballten Fäusten verdeckte er sein Gesicht vor dem lila Strahl. Alsdann erschien eine feuerrote Unterschrift: »Professor Persikow wird im Automobil von unserem berühmten Reporter, Kapitän Stepanow, interviewt.« Tatsächlich war sogleich auch ein verschwommenes Kabriolett zu sehen, das an der Erlöserkathedrale vorbeifuhr. Darin zappelte der Professor und blickte wie ein gejagter Wolf.
»Das ist ja unmenschlich«, murmelte der Zoologe in der Straßenbahn.
Als er am Abend in seine Wohnung in der Pretschistenka zurückgekehrt war, erhielt er von seiner Haushälterin siebzehn Zettel mit den Telefonnummern von Personen, die während seiner Abwesenheit angerufen hatten, sowie eine mündliche Erklärung, sie, die Haushälterin, sei mit den Nerven am Ende. Der Professor wollte die Zettel allesamt zerreißen, hielt aber inne, als er sah, dass neben einer der Nummern »Volkskommissar für Gesundheit« stand.
»Was ist denn los?«, wunderte sich der weltfremde Wissenschaftler. »Was ist bloß mit denen los?«
Um Viertel nach zehn an dem gleichen Abend klingelte es an der Tür, und der Professor musste sich mit einem blendend gekleideten Bürger unterhalten. Abweisen konnte man ihn schlecht, denn auf seiner Visitenkarte stand zwar kein Name, dafür aber »Bevollmächtigter Leiter der Handelsabteilungen ausländischer Firmen in der Sowjetischen Republik.«
»Der Teufel soll ihn holen«, knurrte Persikow, legte seine Lupe und irgendwelche Diagramme zur Seite und sagte der Haushälterin: »Rufen Sie ihn rein, hier ins Arbeitszimmer, diesen Bevollmächtigten!«
Als dieser den Raum betrat, erkundigte sich der Professor derlei giftig, womit er dienen könne, dass der Bevollmächtigte zusammenzuckte. Unterdes schob Persikow sich die Brille auf die Stirn, dann zurück auf die Nase und betrachtete den Besucher eingehend. Dieser glänzte vor Brillantine und Edelsteinen; vor seinem rechten Auge saß ein Monokel.
»Was für eine widerliche Visage«, dachte Persikow.
Der Besucher erkundigte sich zunächst, ob er eine Zigarre rauchen dürfe, woraufhin Persikow ihn äußerst widerwillig einlud, Platz zu nehmen. Es folgte eine lange Entschuldigung für die späte Stunde: »Man bekommt Sie tagsüber ja nicht zu fassen, Herr Professor – ich meine, Sie sind kaum zu erwischen …« Er kicherte glucksend wie eine Hyäne.
»Stimmt, ich habe zu tun!«, erwiderte Persikow so knapp, dass der Besucher wieder zusammenzuckte.
Trotzdem müsse er, der Bevollmächtigte, sich erlauben, den berühmten Wissenschaftler zu stören. Zeit ist Geld, wie man so sagt … Ob die Zigarre auch nicht störe?
»Hmpf«, erwiderte Persikow. Die Zigarre störe nicht.
»Sie haben doch den Strahl des Lebens entdeckt, nicht wahr?«
»Was für einen Strahl des Lebens denn? Das ist doch nur so ein Zeitungswort!«
Der Besucher kicherte. Die Bescheidenheit, die jeden großen Geist schmückt, wisse er zu schätzen, aber … Es gäbe ja die Telegramme … In Weltstädten wie Warschau und Riga sei der Strahl inzwischen bekannt. Die ganze Welt trage den Namen des Herrn Professors auf der Zunge … Es sei aber auch bekannt, wie schwer Wissenschaftler es in der Sowjetunion haben, entre nous soit dit. Es höre doch niemand mit, oder? Nun ja, hierzulande wisse man Forschung nicht zu schätzen, daher dieser Besuch. Da wolle eben ein gewisser Staat dem Herrn Professor ohne jeglichen Eigennutz bei seiner Laborarbeit helfen. Warum Perlen vor die Räte werfen? Es sei bekannt, wie schwer der Herr Professor es 1920 – 21 gehabt habe, während dieser, hihi … Revolution. Selbstverständlich streng geheim. Der Herr Professor würde den bewussten Staat mit den Ergebnissen seiner Arbeit bekannt machen und dafür großzügige Finanzierung erhalten. Er habe ja diese Kammer gebaut; nun, die technischen Zeichnungen wären spannend …
Da holte der Besucher ein druckfrisches Bündel aus seiner Jackentasche.
Eine erste Kleinigkeit – sagen wir, fünftausend Rubel Vorschuss – könne der Herr Professor gerne sofort haben … Ganz ohne Quittung. Ja, es würde den Bevollmächtigten geradezu beleidigen, wenn der Herr Professor auf einer Quittung bestünde …
»Raus hier!«, brüllte Persikow darauf mit solcher Wucht, dass das Klavier im Wohnzimmer hell klirrte.
Der Besucher verschwand so schnell, dass der wutentbrannte Persikow sich fragte, ob es sich nicht um eine Halluzination gehandelt hatte. Eine Minute später aber hatte er die Antwort.
»Sind’s seine Galoschen?«, brüllte er in der Diele.
»Hat der Herr wohl vergessen«, kam zittrig zurück.
»Wegschmeißen!«
»Aber – er kommt sie ja sicher holen …«
»Dann eben der Hausverwaltung überreichen. Mit Quittung. Dass sie hier sofort weg sind! Jawohl, soll die Verwaltung sich mit den Spionsgaloschen abgeben!«
Die Haushälterin bekreuzigte sich, nahm die prachtvollen Ledergaloschen in die Hand und trug sie durch die Hintertür hinaus. Eine Weile blieb sie draußen stehen, dann verstaute sie die Galoschen im Kabuff.
»Erledigt?«, fragte Persikow wütend.
»Jawohl.«
»Die Quittung!«
»Aber der Verwaltungsvorsitzende, der kann doch nicht schreiben!«
»Ich. Will. Sofort. Eine Quittung. Irgendein Hundesohn dort wird doch wohl schreiben können!«
Die Haushälterin schüttelte nur den Kopf, ging weg und kam eine Viertelstunde später mit einem Zettel zurück. Darauf stand:
»Erhalten von Profe. Persi. 1 (ein) Paar Galo. Kolesow«
»Und das hier?«
»Der Abholzettel.«
Den Abholzettel trat Persikow mit Füßen, die Quittung aber legte er unter einen Briefbeschwerer. Dann verdüsterte irgendein Gedanke sein Gesicht. Er schnappte sich den Hörer, holte Pankrat im Institut ans Telefon und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. Pankrat knurrte etwas, das wohl heißen sollte, alles sei seines Erachtens in bester Ordnung. Doch auch das beruhigte den Professor nur für eine Minute. Mit zerfurchter Stirn blieb er am Hörer kleben und sagte Folgendes:
»Verbinden Sie mich doch bitte mit, Dings, der Lubjanka.8 Merci … So, wem soll ich das denn melden … Da schauen dubiose Gestalten mit Galoschen bei mir rein … Persikow, Professor der Staatsuniversität N 4 …«
Da wurde auf einmal aufgelegt. Persikow schimpfte zwischen den Zähnen und ließ vom Telefon ab.
»Tässchen Tee?«, fragte die Haushälterin zaghaft.
»Nichts mit Tee! Hmpf, zur Hölle noch mal. Sind sie denn alle verrückt geworden?«
Genau zehn Minuten später empfing der Professor weitere Besucher in seinem Arbeitszimmer. Einer davon war ein angenehmer, rundlicher und sehr höflicher Zeitgenosse in bescheidener khakigrüner Feldjacke und Reithosen. Auf seiner Nase saß wie ein gläserner Schmetterling ein Zwicker. Insgesamt hatte er etwas von einem Engel, wenn Engel denn Lackstiefel trügen. Der andere, ein kleiner und mürrischer Mann, war in Zivilkleidung, die ihn jedoch zu beengen schien. Der dritte Besucher verhielt sich seltsam: Er blieb in der halbdunklen Diele stehen und behielt von dort aus das hell erleuchtete, von Rauchschwaden durchzogene Arbeitszimmer im Blick. Dieser Dritte war in Zivil und trug einen Zwicker mit dunklen Gläsern.
Die beiden im Arbeitszimmer zermürbten Persikow mit ihren Fragen zu den fünftausend Rubeln und zum Aussehen des Bevollmächtigten. Auch die Visitenkarte wurde eingehend studiert.
»Weiß der Geier«, murmelte Persikow. »Einfach nur eine abscheuliche Visage. Irgendwie entartet.«
»Hatte er zufällig ein Glasauge?«, krächzte der Kleine.
»Weiß der … Obwohl, nein. Die Augen huschten immer umher.«
»Rubinstein?«, wandte sich der Engel leise an den Kleinen. Dieser schüttelte düster den Kopf.
»Rubinstein gibt doch nichts ohne Quittung her, nie im Leben. Das sieht nicht nach Rubinstein aus. Das ist ein dickerer Fisch.«
Die Geschichte mit den Galoschen erregte äußerst lebhaftes Interesse. Der Engel sagte nur ein paar Worte in den Hörer – »GPU hier. Ja, die staatliche politische Verwaltung. Den Hausverwaltungssekretär Kolesow in Professor Persikows Wohnung, sofort, mit den Galoschen« – und sogleich erschien der bleiche Kolesow, Galoschen in der Hand.
»Wassjenka!«, rief der Engel leise den Mann in der Diele. Dieser erhob sich schlaff und schlenderte, als säßen ihm die Beine zu locker am Leib, ins Arbeitszimmer. Seine Augen waren hinter dem dunklen Zwicker kaum zu sehen.
»Was ist?«, erkundigte er sich knapp und schlaff.
»Die Galoschen.«
Die Augen hinter den getönten Gläsern schweiften über die Galoschen, und für einen Moment erhaschte Persikow, oder so schien es ihm zumindest, einen keinesfalls verschlafenen, sondern erstaunlich stechenden Seitenblick. Sogleich erlosch dieser wieder.
»Und, Wassjenka?«
»Was und? Sind halt Pelenschkowskis Galoschen«, meldete der Mann scheinbar lustlos.
Die Galoschen wurden sogleich in Zeitungspapier eingewickelt und der Hausverwaltung entzogen. Der Engel in der Feldjacke war sichtlich erfreut; er sprang auf und drückte eifrig die Hand des Professors; ja, er hielt sogar eine kleine Rede: Das Handeln des Professors mache ihm Ehre … Der Professor könne ganz beruhigt sein … Man werde ihn nicht mehr stören, weder im Institut noch zu Hause … Maßnahmen werden getroffen, seine Kammer sei nun vollkommen sicher …
»Könnten Sie die Reporter vielleicht erschießen lassen?«, erkundigte sich Persikow mit einem Blick über die Brille.
Diese Frage erheiterte die Besucher ungemein. Selbst der mürrische Kleine lächelte, und auch der Getönte in der Diele schmunzelte. Der Engel erklärte strahlend, dass … nun … es wäre schon eine gute Sache … aber die Presse sei ja doch … anderseits reife bereits ein ähnliches Projekt im Rat für Arbeit und Verteidigung heran … ja nun, auf Wiedersehen!
»Was war das denn für ein Schurke?«
Da hörten alle auf zu lächeln, und der Engel erwiderte nebulös, es werde irgendein unbedeutender Schwindler sein, von keinerlei Interesse … Trotzdem bitte er den Bürger Professor, die Ereignisse des Abends vollkommen geheim zu halten. Daraufhin verabschiedeten sich die Besucher.
Persikow kehrte in sein Arbeitszimmer zu den Diagrammen zurück, doch kam er wieder nicht zum Arbeiten. Der rote Knopf am Telefon leuchtete auf, und eine Frauenstimme erkundigte sich, ob er eine leidenschaftliche und attraktive Witwe mit einer Sieben-Zimmer-Wohnung heiraten wolle.
»Sie sollten sich behandeln lassen! Am besten von Professor Rossolimo!«, brüllte Persikow ins Telefon – das sogleich wieder klingelte.
Da wurde der Professor etwas weich in den Knien, denn es war eine recht bekannte Persönlichkeit aus dem Kreml. Diese fragte ihn lange und teilnahmsvoll zu seiner Arbeit aus und äußerte den Wunsch, das Labor zu besichtigen. Nachdem er aufgelegt hatte, wischte Persikow sich die Stirn ab und ließ den Hörer neben dem Apparat liegen. Sogleich ertönte in der Wohnung über ihm furchtbares Trompetengeheul und Walkürengeschrei – das Radio des Tuchfabrikdirektors brachte ein Wagnerkonzert im Bolschoi. Das Gejohle und Gepolter übertönend, erklärte der Professor seiner Haushälterin, dass er den Fabrikdirektor anklagen, sein Radio zerschlagen, ja aus Moskau wegziehen würde! Offenbar wolle man ihn geradezu aus der Stadt treiben! In seiner Wut zerschmetterte er eine Lupe und schlief schließlich im Arbeitszimmer auf dem Sofa ein, zu den zarten Klängen eines berühmten Pianisten, der im Bolschoi konzertierte.
***
Am nächsten Tag ging es mit den Überraschungen weiter. Mit der Straßenbahn am Institut angekommen, entdeckte Persikow auf der Haupttreppe einen unbekannten Bürger mit modischem grünem Bowler-Hut. Dieser war im Grunde noch zu ertragen: Er musterte Persikow zwar aufmerksam, stellte ihm jedoch keine Fragen. In der Vorhalle aber erwartete den Professor neben einem verdutzten Pankrat ein zweiter Bowler, der sich sogleich erhob und höflich grüßte:
»Guten Morgen, Bürger Professor.«
»Was wollen Sie?«, fragte Persikow wütend und riss sich mit Pankrats Hilfe den Mantel vom Leib. Doch der Bowler beruhigte ihn sogleich. Sanft flüsterte er ihm zu, der Professor sorge sich ganz grundlos: Er, der Bowler, befinde sich nämlich genau zu dem Zwecke hier, den Professor von aufdringlichen Besuchern zu befreien; zu der Tür des Labors würde sich nun niemand mehr Zugang verschaffen – und zu den Fenstern übrigens auch nicht. An dieser Stelle klappte der Unbekannte kurz das Revers seines Jacketts auf und ließ ein Abzeichen sehen.
»Tja … Das ist ja effiziente Arbeit …«, murmelte Persikow und fügte naiv hinzu: »Was werden Sie denn essen, wenn Sie immer hier sind?«
Darauf erklärte der Bowler mit einem schiefen Grinsen, man werde sich abwechseln.
Die nächsten drei Tage vergingen großartig. Zweimal hatte der Professor Besuch aus dem Kreml, und einmal kamen Studenten zur Prüfung. Diese ließ er allesamt durchfallen, und ihren Gesichtern war anzusehen, dass Persikow sie inzwischen mit geradezu übernatürlichem Entsetzen erfüllte.
»Sie und Zoologe? Es langt gerade zum Straßenbahnschaffner!«, kam aus dem Labor.
»Streng, was?«, erkundigte sich der Bowler bei Pankrat.
»So wahr mir Gott helfe! Wenn einer mal die Prüfung schafft, selbst da kommt er schweißnass da raus, und taumelt dann gleich in die Kneipe.«
Drei arbeitsvolle Tage verflogen also im Nu, doch am vierten Tag machte das wirkliche Leben wieder seine Ansprüche deutlich, und zwar in der Form einer schrillen Stimme von der Straße.
»Professor!«, rief diese ins offene Fenster.
Die Stimme hatte Glück: Der erschöpfte Persikow ruhte sich gerade aus, rauchte im Sessel und schaute mit rotumrandeten Augen schlaff in die Gegend. Er konnte nicht mehr. Und daher blickte er mit einiger Neugier aus dem Fenster, woraufhin er auf dem Bürgersteig Alfred Bronskij entdeckte. Den Mann mit der beeindruckenden Visitenkarte erkannte der Professor sogleich an der Zipfelmütze und dem Notizblock. Bronskij verneigte sich hingebungsvoll vor dem Fenster.
»Sie schon wieder?«, fragte der Professor. Er hatte gerade keine Kraft, sich zu ärgern, und irgendwie wollte er gerne wissen, was nun kommen würde. Hinter dem Fenster wähnte er sich in Sicherheit, und tatsächlich drehte sich der wachsame Bowler in der Straße sogleich zu Bronskij. Dieser lächelte zuckersüß.
»Nur ein paar Minütchen, mein lieber Professor!«, rief Bronskij vom Bürgersteig hoch. »Nur ein Frägelchen, ein rein zoologisches. Darf ich?«
»Ich bitte darum«, erwiderte Persikow mit lakonischer Ironie. Dieser Schurke hatte ja doch etwas Amerikanisches an sich, dachte er.
Darauf legte Bronskij die Hände zu einem Trichter zusammen und rief: »Was sagen Sie zu den Hühnern, mein lieber Professor?«
Persikow war verblüfft. Er setzte sich auf die Fensterbank, stieg wieder hinunter, drückte einen Knopf und verlangte lautstark, dass Pankrat den Mann auf dem Bürgersteig hereinlasse.
Als Bronskij im Labor erschien, war Persikow sogar so liebenswürdig, »Nehmen Sie Platz!« zu brüllen.
Mit einem bewundernden Lächeln setzte sich Bronskij auf den Drehhocker.
»Erklären Sie mir doch bitte eins«, sagte Persikow, »da schreiben Sie also für die Zeitung.«
»So ist es«, erwiderte Alfred respektvoll.
»Wie können Sie denn schreiben, wenn Sie nicht einmal anständig reden können? Was heißt hier ›ein Frägelchen‹? Und was soll ich ›zu den Hühnern‹ sagen? Ich rede nicht mit Hühnern! Sie meinten wohl ›über die Hühner‹?«
Bronskij kicherte respektvoll.
»Da haben wir Walentin Petrowitsch für.«
»Wer soll denn dieser Walentin Petrowitsch sein?«
»Leiter der literarischen Abteilung.«
»Aha. Nun gut, ich bin ja kein Philologe, lassen wir Ihren Petrowitsch. Was wollen Sie denn genau in Bezug auf Hühner wissen?«
»Alles, was Sie dazu sagen können, Professor!«
Bronskij zückte den Bleistift. Triumph funkelte in Persikows Augen.
»Da sind Sie bei mir ganz falsch, Gefiederte gehören nicht zu meinen Spezialgebieten. Da hätten Sie Emeljan Portugalow an der Staatsuniversität N 1 fragen sollen. Ich persönlich weiß sehr wenig …«
Bronskij lächelte begeistert: Den Humor des verehrten Professors wusste er zu schätzen. »Scherz: weiß wenig!«, notierte er.
»Falls es Sie aber interessiert, bitte. Nun also, das Haushuhn gehört zu den Hühnervögeln, Galliformes … Aus der Familie der Fasanenartigen.« Persikow sprach nun laut und schaute nicht zu Bronskij, sondern in die Ferne, wo er Tausende Zuhörer zu erblicken schien. »Jawohl, der Fasanenartigen, Phasianidae. Von der Gestalt her handelt es sich um Vögel mit ledrigem Kamm und zwei Lappen unter dem Unterkiefer. Tja … Gelegentlich aber auch nur mit einem zentralen Lappen. Nun, weiter. Die Flügel sind kurz und abgerundet … Der Schwanz mittellang, etwas gestuft, ja man könnte sagen dachförmig, die mittleren Federn sichelartig gebogen. Pankrat, bring mal das Modell Nr. 705 aus dem Modellraum, Haushahn im Querschnitt. Nicht nötig? Bring das Modell nicht, Pankrat! Ich wiederhole, ich bin kein Spezialist. Da müssen Sie schon zu Portugalow. Was wilde Hühner angeht, so fallen mir sechs Arten ein. Portugalow wird sicherlich mehr kennen … In Indien und auf dem malaysischen Archipel … Das Bankivahuhn beispielsweise siedelt im Himalaja-Vorgebirge, in ganz Indien, in Assam und Birma … Das Gabelschwanzhuhn, Gallus varius, auch Grünes Kammhuhn genannt, ist auf Lombok, Sumbawa und Flores heimisch. Auf der Insel Java finden Sie das prächtige Gallus aeneus, in Südostindien kann ich das sehr schöne Sonnerathuhn empfehlen. Irgendwo müsste ich eine Zeichnung haben … Was Ceylon betrifft, so haben wir hier das Ceylonhuhn, Gallus lafayettii, das nirgendwo sonst vorkommt.«
Bronskij kritzelte wie verrückt; die Augen quollen ihm fast aus dem Kopf.
»Wollen Sie sonst noch etwas wissen?«
»Also zu Hühnerkrankheiten, das wäre eigentlich …«, flüsterte Alfred.
»Tja, ich bin da nicht der Spezialist. Da müssen Sie schon Portugalow fragen … Wobei … Nun, Bandwürmer, Saugwürmer, Vogelmilbenkrätze, die Hühnerläuse natürlich, auch bekannt als Federlinge, Flöhe, Hühnercholera, kruppös-diphtherische Schleimhautentzündung … Pneumomykose, Tuberkulose, Hühnerräude … Ach, alles Mögliche!« Persikows Augen funkelten. »Vergiftung, mit Schierling zum Beispiel, Tumore, Rachitis, Gelbsucht, Rheuma … Oh, und die Purpura Schönlein-Henoch! Da bilden sich kleine Flecken auf dem Kamm, etwas schimmelartig …«
Bronskij wischte sich mit einem bunten Taschentuch die Stirn ab.
»Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund der aktuellen Katastrophe, Professor?«
»Was für einer Katastrophe?«
»Wie, haben Sie etwa nicht gelesen, Professor?«
Der verblüffte Bronskij zog eine zerknitterte Iswestija-Seite aus seiner Aktentasche.
»Ich lese keine Zeitungen«, meldete Persikow mürrisch.
»Aber warum denn, Professor?«, fragte Alfred zärtlich, woraufhin prompt die Erklärung kam: »Weil darin immer Unsinn steht.«
»Nun also wirklich, Professor«, wisperte Bronskij sanft und öffnete die Zeitung.
»Was ist denn?«, fragte Persikow und erhob sich sogar. Nun sprangen in Bronskijs Augen Funken. Mit einem scharfen, lackierten Fingernagel unterstrich er die gigantische Schlagzeile über der ganzen Seite: »Hühnersterben in der Republik.«
»Wie?«, fragte Persikow und schob sich die Brille auf die Stirn.