Inhaltsverzeichnis
Inschrift
GOTT IN PADERBORN
SCHNEEFALL
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
DER BANN
WINTERZELGE
DER TOD IM FLUSS
IRENE
ELISABETH
DER VERLORENE SIEG
HELMBRECHT
AUS DER WELT
DAS KRÄNZLEIN
DIE KRÖNUNG
VIA MALA
BRUNNENVERGIFTUNG
Die erste Form der Krankheit:
Die zweite Form der Krankheit:
Die Antwort des ersten Gelehrten:
Die Antwort des zweiten Gelehrten:
Die Antwort des dritten Gelehrten:
Die Antwort des vierten Gelehrten:
Bericht des Notars und Augenzeugen Gabriel de Mussis:
Die ganze Wahrheit:
Hier der Nachweis:
Prozess gegen vier Männer und eine Frau der Vergiftung von Brunnen wegen.
ZEITTAFEL
NACHWORT DES AUTORS
Copyright
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine
Bertolt Brecht, Mutter Courage
GOTT IN PADERBORN
König Karl, den man einmal den Großen nennen wird, errichtet im 8. Jahrhundert nach Christus ein fränkisches Großreich. Er erringt damit die Vormachtstellung in Europa und verbreitet in dieser Zeit das Christentum bis weit in den Norden und Osten der bezwungenen Gebiete. Im Jahre 799 ist auch das mächtige Volk der Sachsen von Karl bis auf kleinere Widerstandsnester niedergerungen.
Massenhaft lässt König Karl die Besiegten taufen, umsiedeln, ins Kloster stecken oder gar umbringen und festigt auf diese Weise seine neu gewonnene Macht. Dem früheren Glauben anzuhängen, ist von nun an strikt untersagt – doch heimlich und im Verborgenen halten viele dennoch an den alten Göttern fest.
König Karl herrscht mit diesem Sieg nunmehr endgültig über ganz Mitteleuropa: Die Völker und Stämme von der Elbe bis hinab nach Rom sind in seiner Gewalt, und der König der Franken gerät bereits in Konflikt mit dem Beherrscher des Ostens, dem Kaiser von Konstantinopel. Wer wird der künftige Herrscher der Welt? Da geschieht Seltsames zuerst in Rom und dann weitab hinter Bergen und Wäldern an der Grenze zu Sachsen in Paderborn.
Der Mann, den wir mitsamt seinen wenigen Begleitern am Rhein abholen mussten und den wir nun zum Palast König Karls nach Paderborn geleiten sollen, muss Furchtbares erlebt haben: Er hat frische Narben im Gesicht, die schlecht heilen. Sie sind mir sofort aufgefallen, als wir ihn von den Männern seines vorherigen Geleits übernommen haben – übrigens hätte er ein König sein können, mit solcher Ehrfurcht wurde er behandelt! Wir haben den Befehl, ihn unter Einsatz unseres Lebens zu beschützen, denn er steht unter der besonderen Huld unseres Herrschers. Dieser Befehl ist eine große Ehre für uns.
Freilich, man will wissen, mit wem man es zu tun hat!
Die Narben sind an beiden Augen. Schräg oberhalb des linken Auges wie von einem sehr unsicher geführten Stich. Am rechten Auge muss mehrfach zugestochen worden sein – bis hinab zum Wangenknochen ist das Messer gerutscht.
Die Unterlippe des Mannes ist auf der linken Seite aufgeschlitzt und tief verschorft, und an seinem Kinn sind noch zwei kleinere Narben. Wenn er spricht, so ist seine Zunge seltsam schwer; er wäre sicher kaum zu verstehen, auch wenn er fränkisch oder sächsisch reden würde. Aber es ist lateinisch, sagen die anderen – ich verstehe kein Wort.
Auch seine Zunge ist verletzt.
Wenn ich im Wald bestimmte Spuren sehe, sage ich: Hier war eine Bärin, sie ist so und so alt und hat zwei Junge. Oder ich sage: Hier war ein Urstier oder ein Luchs oder ein Reh oder ein Hirsch und dergleichen.
Die Zeichen sind klar, deshalb sage ich: Der Mann muss angegriffen worden sein, und zwar mit einem Messer – und von mehreren Männern. Denn einer hat das Messer geführt und hat zugestochen, aber andere haben den Mann dabei festgehalten. Sie haben sich gegenseitig behindert, habe ich mir überlegt; oder sie hatten nicht genügend Zeit oder Raum für ihre Tat: Deshalb waren die Stiche nicht gezielt genug. Der Mann ist natürlich ausgewichen – würde jeder tun.
Getötet werden sollte er aber nicht, sonst wären die Narben nicht im Gesicht, sondern am Hals oder auf der Brust. Ich habe einmal seinen Oberkörper gesehen, als er sich gewaschen hat – keine Narben, auch keine alten. Die Wunden sind auch nicht von einem offenen Kampf; er ist überfallen worden.
Wozu? Ich habe lange nachgedacht. Seine Verwundungen lassen nur eine Erklärung zu: Sie wollten ihm die Augen ausstechen und die Zunge herausschneiden.
Weshalb?
Das ist eine sehr große und sehr schwere Frage – blenden allein genügt doch eigentlich. Er ist ja dann so gut wie tot.
Warum ihm auch noch das Wort nehmen?
Oder warum haben sie ihn nicht gleich umgebracht? Auch diese Frage lässt sich nur sehr schwer beantworten. Aus irgendeinem Grunde sind sie davor zurückgeschreckt – aber warum? Blenden und Die-Zunge-Abschneiden ist doch viel schlimmer als Töten.
Und wenn sie es einmal versucht haben, ihm Auge und Zunge zu nehmen, versuchen sie es jederzeit wieder!
Schrecklicher Gedanke! Deshalb habe ich immer meinen kleinen Hammer aus Silberblech bei mir. Der Hammer ist das Zeichen unseres alten Gottes Donar, des großen Donnerers, der die Menschen vor Schaden bewahrt. Zwar ist er längst entmachtet von dem neuen Gott Jesus Christus, der es mit den Franken hält und unsere alten Götter besiegt hat. Dennoch ist mir nie etwas zugestoßen, was mit dem Unglück dieses Fremden verglichen werden kann.
Wer er wohl ist? Es ist etwas Feierliches um ihn und seine drei Begleiter. Aber ich kann ihn natürlich nicht fragen. – Was geht das dich an!, würde es heißen.
Außerdem würde ich seine Antwort ja gar nicht verstehen. Seine wenigen Begleiter unterhalten sich ebenfalls in dieser fremden Sprache. Wenn er nun ein großer Herr wäre – ein Fürst oder dergleichen – müsste er sich doch eigentlich selbst beschützen, etwa durch eine starke Leibwache. Hat er aber nicht! König Karl schützt ihn.
Er ist ein einziges Rätsel.
In Paderborn war ich schon ein paar Mal und kenne den Weg vom Rhein an die Quelle der Pader recht gut, und ich bin ja nicht allein. Wir Wächter sind dreißig Mann, bis an die Zähne bewaffnet, versteht sich! Aber außer mir sind es lauter Franken, und die reden nicht viel mit einem kleinen Sachsen.
Das bin ich.
Meinen kleinen Hammer aus Silberblech – ich trage ihn natürlich nicht offen bei mir. Das wäre zu gefährlich. König Karl hat die Zeichen der alten Götter bei Strafe verboten.
König Karl ist eigentlich nicht mein König: Er ist Franke. Ich bin Sachse. Wir Sachsen hatten nie Könige. Wenn es Krieg gab, wählten die Götter einen Herzog für alle Sachsen. Die Stammesführer warfen Stäbchen, in die verschiedene Namen eingeritzt waren, in einen Kreis. Die Götter entschieden, wer herrschen sollte, wenn wir in den Kampf zogen. Im Frieden brauchten wir keinen Herrscher.
Mein Volk hat sich diesem König Karl unterworfen. Er hat Schlachten gewonnen – und natürlich ist sein Gott stärker als unsere Götter, das ist klar. Dennoch heißt das keineswegs, dass unsere alten Götter nicht doch noch da sind und wirken – nicht einmal so sehr im Verborgenen: Donar, unser stärkster Gott, der seine Macht im Donner offenbart, er wurde zwar besiegt – seine heilige Eiche in Geismar ist schon vor zwei Menschenaltern gefällt worden -, aber es donnert immer noch, und jeder kann es hören. Und erst neulich habe ich gesehen, wie ein Blitz in eine Linde gefahren ist, dass die Fetzen flogen. Auch die anderen Götter, denen wir von Kindheit an gedient und geopfert haben, leben noch. Klar! Setzen die Hasen nicht Junge im Frühjahr? Werfen die Kühe nicht immer noch und die Pferde und die Schweine und alle anderen Tiere? Blühen nicht die Bäume im Frühjahr und verlieren sie nicht im Herbst ihr Laub und färben es zuvor bunt?
Wer sagt denn all den Tieren und Pflanzen, was sie tun sollen, wenn nicht die Götter?
Der neue Gott? Da hätte er viel zu tun! Ich glaube es nicht. Es ist einfach vernünftiger, wenn er die Arbeit verteilt. Und so stelle ich mir vor, dass er die alten Götter weiterhin wirken lässt, dass er aber wichtige Entscheidungen und den Oberbefehl für sich behält.
So wie König Karl, der jetzt den Oberbefehl über die meisten Stämme auf der Welt besitzt – denn er hat alle besiegt, von den Sachsen im Norden über die Alemannen und die Bayern bis zu den Langobarden, die weit im Mittag, in Italien, wohnen. Widerspenstige Herzöge und Könige hat er gestürzt. Die Gebiete der Sachsen und der anderen Stämme hat er in Gaue eingeteilt und hat Grafen benannt, die tun müssen, was er befiehlt. Und Sendboten berichten ihm von überall. Und wer ihm nicht gepasst hat, den hat er auf einem großen Thing in Verden am Fluss Aller umbringen lassen. Vor siebzehn Jahren sind dort viertausendfünfhundert Männer geköpft worden, wird gesagt. Die Aller soll rot gewesen sein vor Blut.
Ich glaube es aber nicht: Viertausendfünfhundert Männer wehren sich doch, denke ich.
Unsere Anführer übertreiben solche Zahlen, damit wir Sachsen noch mehr Hass auf die Franken bekommen und auf den König; damit sie neue Aufstände anzetteln können. Anführer, damit meine ich die Sachsen, die noch nicht begriffen haben, wer der Stärkere ist. Ich habe es längst begriffen: Deshalb diene ich König Karl – es bringt Vorteile, dem Stärksten zu dienen.
Und die Franken sind nun einmal die Stärksten: Sie haben die Eiche des Gottes Donar gefällt, und er musste es geschehen lassen. Und schon zehn Jahre davor haben sie die Irminsul gestürzt, die hölzerne Weltsäule, die den Himmel stützt, unser wichtigstes Heiligtum. Jeder hielt die Irminsul für den Ort, wo die Götter thronen, aber der Gott der Franken hat diesen Ort ganz einfach beseitigt; er hat gewonnen! Unsere Götter können es nur noch regnen, donnern und blitzen lassen und sonst noch ein paar Dinge in der Natur besorgen.
Sie können keine Toten auferwecken, sie können nicht machen, dass Blinde sehen oder Lahme gehen, sie können kein Wasser in Wein verwandeln. Das alles aber kann der neue Gott, sagen die Priester, und deshalb ist er der Stärkere, und unsere Götter müssen tun, was er will.
Man muss wissen, wann man verloren hat!
Dabei stand alles auf des Messers Schneide. Wir Sachsen waren drauf und dran, den Sieg zu erringen, hatten sogar schon den Rhein erreicht und holten mit aller Kraft aus, diesen König Karl zu stürzen, und unser Herzog Widukind hatte schon nach der Krone König Karls gegriffen. Da wurde er besiegt und abgesetzt; und er hat sich taufen lassen und sich dem neuen Gott unterworfen, obwohl er von dem alten Gott abstammt. Daraus sieht jeder, wie klug unser Herzog Widukind ist. Karl hat ihn deshalb auch nicht ganz gestürzt, sondern ihm ein wenig Macht gelassen – wenig, damit er Karl nicht schaden kann, aber doch so viel Macht, dass er noch Würde besitzt. Jetzt hängt Widukind dem neuen Gott der Franken an, diesem Jesus Christus. Dabei stammt er selbst von Wotan ab: Widukind – Sohn des Wotan!
Wie mit der Macht des Herzogs Widukind ist es auch mit unseren alten Göttern, denke ich. Deshalb würde ich nie etwas ohne meinen kleinen Hammer tun.
Doch der fränkische König ist streng. Und wer dabei erwischt wird, wie er zu den alten Göttern betet oder ihnen opfert oder ein Bild von ihnen bei sich trägt, den trifft sein Zorn mit voller Wucht. Ganze Landstriche hat König Karl entvölkert. Denn wer weiter dem alten Glauben anhing, hat er in den Süden umgesiedelt, wo es nur Christen gibt – also Franken – und niemand einen Aufstand plant.
Aber er ist auch darin stark, dass er nämlich einen Sachsen wie mich, obwohl aus einem feindlichen Stamm, bei einem so wichtigen Kommando wie diesem Geleit mitmachen lässt. Er will die Stärke der Sachsen für sein Reich dienstbar machen – ganz schön mutig. Und ich diene ihm jetzt schon seit zwei Jahren, nie gab es Anlass für mich, darüber zu klagen. Aber für ihn auch nicht.
Was die Götter angeht, so besitze ich nun für mich mehrere – einen sehr starken und großen Gott, nämlich Jesus Christus für die großen Dinge; und unsere alten Götter für alle Fälle -
Vielleicht macht mich König Karl ja eines Tages sogar zu einem Grafen. Aber dazu bin ich jetzt noch viel zu jung. Ich bin bei weitem der Jüngste unter den Wächtern.
Dennoch hat er ausgerechnet mir befohlen, mit den anderen zusammen diesen Fremden samt seinen Begleitern am Rhein abzuholen und zu seinem Palast in Paderborn zu geleiten. Wir müssen den Fremden heil zu ihm bringen, bei seiner Ungnade!
Er hat es uns natürlich nicht selbst befohlen, dazu ist er zu erhaben. Er hat es uns durch einen wichtigen Mann an seinem Hofe ausrichten lassen.
Ich selbst habe den König noch nie aus der Nähe gesehen. Unser Ritt ist seltsam: Wir haben Befehl, unauffällig zu reiten. Aber der Mann ist dem König ja besonderes wichtig – und deshalb müsste er eigentlich mit hohen Ehren, also dem allergrößten Prunk, geleitet werden!
Doch dies geschieht nicht, und auch daraus schließe ich, dass der Mann immer noch in Gefahr, in sehr großer Gefahr, ja, dass er geradezu in tödlicher Gefahr schwebt!
Wir müssen ihn beschützen – beim Zorn des Königs! Das heißt aber auch – beim Lohn des Königs, wenn es uns gelingt. Und König Karl ist großzügig. Das weiß jeder.
Morgen, so hat es geheißen, kommen wir nach Paderborn. Das bedeutet für den Feind die letzte Gelegenheit, um zuzuschlagen, und für uns heißt es doppelte Gefahr!
Es ist ein Abend im Frühsommer und es regnet. Es regnet schon seit Tagen; alles ist nass.
Eine grobe Pferdedecke habe ich über mich gelegt. Die anderen auch. Sogar der Fremde.
»He, du könntest vorausreiten zur Herberge und anzeigen, dass wir bald kommen!«
Natürlich bin ich gemeint, der kleine Sachse. Wenn ich in den Klöstern oder Höfen abends sage, dass wir bald eintreffen, wissen sie immer schon, wer da unterwegs ist und fangen an herumzurennen, als käme König Karl selbst. Alle wissen Bescheid, nur ich nicht, der kleine Sachse! Und wenn ich einen anderen Wächter frage, ernte ich nur stummes Kopfschütteln.
Ich kenne den Weg ganz gut. Wenn ich aber alleine vorausreite, muss ich dennoch höllisch aufpassen, dass ich mich in den dichten Wäldern nicht verirre. Ich verlasse mich dabei ganz auf meinen Silberhammer. Woher sollte Jesus Christus die Wege hier im Norden kennen?
Endlich lichtet sich das Dickicht, und ich sehe im letzten Tagesschimmer eine schwarze Masse an einem vor Nässe glänzenden Wiesenhang aufragen. Nebelschwaden, ein breit ausladender Hof.
Der Fremde wird sich in dem größten Gebäude zur Nacht begeben. Seine Begleiter ebenfalls. Wie immer. Wir Wächter dürfen nicht in die warmen Wohnräume. Wir müssen trotz des Regens draußen bleiben in der Kälte und in all der Nässe. Das heißt, die fränkischen Reiter gehen in die nächste Scheune und hauen sich aufs Ohr. Ich bin dann allein und umkreise die Gebäude wie ein Luchs. Und wenn ich Glück habe, kommt irgendwann ein gähnender Franke heraus und löst mich ab, nachdem er mich beschimpft hat.
Die Kämme der Berge sind dunkel und verhangen.
Da, Pferdegetrappel im Wald unter mir! Ich kralle meine Finger in die Zügel. Es ist deutlich zu hören. Die müssen sich sehr sicher fühlen. Kaufleute? Boten? Krieger? Aufständische Sachsen? Der Atem stockt mir. Aber ich glaube das alles nicht – Sachsen machen so weit in fränkischem Gebiet keinen Lärm, Fremde, die sich unbeobachtet fühlen, vielleicht schon. Straßen für Kaufleute gibt es hier in diesen Wäldern keine. Ein Bote würde alleine reiten. Es sind aber mehrere. Weiß der Teufel, wer reitet da nächtens durch den Wald?
Ich kann nur hoffen, dass mein Gott Donar unserem Fremden wohlgesinnt ist!
Zögernd wende ich mein Pferd. Schritt für Schritt reite ich zurück. Hören sie mich und reiten mir nach und packen mich und ziehen mich vom Pferd? Ich fühle schon, wie sie nach meinen Augen tasten -
Ich fasse nach dem Schwert und lockere die Halterung meines Schildes. Unwillkürlich rücke ich meinen Helm zurecht und ducke mich vor den ersten Pfeilen.
Ich stammle Gebete zu Wotan, dem Größten unserer Götter. Der Wald hier oben ist sehr dicht, und es ist jetzt ganz Nacht.
Ich lausche. Nichts mehr! Sie haben mich nicht gehört und sind weitergeritten. Ich stelle mir alles genau vor – den Weg, den sie nehmen müssen, die Lage des Hofes am Hang. Sie reiten schnurgerade darauf zu. Jetzt lauern sie in der Nähe des Anwesens, das uns Unterschlupf gewähren soll. Sie sind bewaffnet, sie haben sich an verschiedene günstige Stellen verteilt. Wenn wir mit dem Fremden kommen, richten sie die ganze Kraft des Angriffs auf die Mitte – man nimmt das, was man schützen will, in die Mitte -; und sie reißen den Fremden aus unserem Haufen heraus, ehe noch ein Schwert richtig gezogen ist, und weg sind sie.
So jedenfalls würde ich das machen, und ich habe Erfahrung in diesen Dingen.
Das alles erzähle ich unserem Anführer, als ich wieder zu unserer Truppe stoße, nachdem ich zurückgeritten bin. Es ist jetzt Nacht, und ich sehe trotzdem lange die Augen des Mannes auf meinem Gesicht liegen, als gäbe es da etwas zu erforschen.
Dann sagt er: »Sehr gut, sehr gut«, und er legt mir die Hand auf die Schulter.
Sie haben sich dann beraten, und wir sind die ganze Nacht weitergeritten und haben nur zwei-, dreimal eine kurze Rast eingelegt.
Wer ist dieser Fremde?
Schon bald nach Tagesanbruch – es regnet immer noch – sehen wir im Tal Paderborn. Eine Stadt, die man mit Aachen, wo ich schon ein paar Mal gewesen bin, so wenig vergleichen kann wie unseren Pferdestall daheim mit dem des Königs. Am Himmel sind ein paar weiße Stellen, aber immer noch steigen Schwaden an den Berghängen hoch – es wird weiterregnen.
Eine Kolonne von Reitern kommt auf uns zu. Die Reiter sind sehr kostbar gekleidet. Trotz des schlechten Wetters tragen sie teure Pelze und bunte Mäntel aus edlen Stoffen. Unglaublich sind ihre Rosse – Füchse, Rappen, Schimmel -, ich habe noch nie so schöne Reittiere gesehen, und ich verstehe etwas davon!
Das edelste Ross reitet ein Herr in einem weiten, besonders prächtigen und prunkvollen Mantel aus Samt oder Seide – ich kann das nicht so genau unterscheiden – und natürlich mit viel Pelz. Ich dränge mein Pferd neugierig ein Stück vor, komme aber nicht bis in seine Nähe. Er wird von mehreren Männern abgeschirmt.
Es ist ein überaus großer, aber auch feister Mann, mit unförmigem Leib und fleischigem Gesicht, darin ein kurzer Schnauzbart, der ihm an den Mundwinkeln etwas herunterhängt. Seine Stimme ist hell, als er dann zu sprechen beginnt, viel heller, als man erwarten würde.
Dann geschieht etwas Unglaubliches! Dieser sehr mächtige Herr steigt von seinem Ross – und verneigt sich vor unserem Fremden! Er greift nach dessen Zügeln und führt sein Pferd ein paar Schritte weit.
Alle haben dem dicken Herrn ehrerbietig Platz gemacht und sich verbeugt. Jetzt endlich durchfährt es mich wie ein Blitzschlag: Der Herr ist König Karl! König Karl selbst!
Und er hat das Pferd des Fremden mit eigenen Händen am Zügel geführt. Ich habe es selbst gesehen!
Wer um des Himmels willen ist dieser Fremde? Ist es Jesus Christus, der neue Gott selbst? Einen Augenblick glaube ich es wirklich. Aber da sind diese Narben! Ein Gott mit Narben?
Nun, Jesus Christus ist ein gekreuzigter Gott, sagen sie, ein Gott, der nach dem Tode wieder auferstanden ist, so mächtig ist er. Aber seine Narben wären an den Händen und Füßen und nicht im Gesicht – er kann es nicht sein.
Wir alle reiten ins Tal hinab, das ich kenne, der Stadt zu; der König und der Fremde führen den Zug an.
Ein Wind ist aufgekommen. Vor uns erhebt sich ein langes Gebäude mit einem Ziegeldach und einem großen Hof – die Pfalz, der Palast von König Karl.
Der König steigt wieder vom Ross und führt eigenhändig das Pferd des fremden Gastes am Zügel in den Hof des Palastes! Er hält ihm dann auch die Zügel, bis er vom Pferd gestiegen ist.
Ich kenne die Gepflogenheiten bei Hofe nicht: Aber ich hätte jede Wette angenommen, dass es niemanden gibt, dem König Karl auf diese Weise behilflich sein würde, so voller Ehrerbietung! Ihm, dem König selbst, werden die Zügel seines Rosses gehalten, denn er führt die Zügel des Reiches.
Überall stehen Neugierige, Männer, Frauen, Kinder, und verneigen sich.
Wir Wachmänner steigen alle ab und stehen nutzlos in einem großen Kreis auf dem Hof herum. Heimlich strecke und recke ich die vom langen Reiten steifen Beine und Arme.
Die Männer aus der Leibwache des Königs schlagen mit den Schwertern gegen ihre Schilde. Wir machen es ihnen nach. Dabei weiß ich überhaupt nicht: Schlagen wir für den König an die Schilde oder für diesen Fremden? Eigentlich wird ja nur für den König gegen die Schilde geschlagen -
An allen Fenstern Menschen.
Auch der Unbekannte ist jetzt vom Pferd gestiegen. Der König hat ihm dabei unter die Arme gegriffen!
Wir treten in den Palast, in einen riesigen Saal, in dem ein herrlicher Stuhl steht – der Thron. Wir sind im Thronsaal des Königs! Ich war zuvor schon ein paar Mal in Paderborn und habe die Pfalz des Königs gesehen – nicht im Traum hätte ich gedacht, dass ich einmal den Thronsaal betreten dürfte. An den Wänden sind herrliche Farben und Bilder, der Boden ist aus blankem Stein, in dem ich mich spiegeln kann wie in einem See, die Decke ist sehr hoch und aus mächtigen Holzbalken. Wir stellen uns ganz hinten auf.
Die Herren, die mit dem König gekommen sind, stehen um seinen Thron, der König lässt sich nieder. Einer der Herren ordnet ihm dabei den Mantel. Vorher aber hat sich der Fremde auf einen Stuhl gesetzt, der nur für ihn vor dem Thron aufgestellt worden ist. Alle anderen Herren stehen im Halbkreis. Fackeln leuchten.
Der Gast hat sich gesetzt, als der König noch stand!
Jetzt erhebt sich der Fremde und nimmt aus einem Ledersack ein kleines Gerät. Es ist ein Kreuz! Ich kenne dieses Zeichen. Es ist das Zeichen des neuen Gottes. Es glänzt im Fackellicht und ist aus lauterem Gold!
Auch der König hat sich jetzt wieder erhoben!
Ist der Fremde ein Bischof?
Nein! Keinem Bischof der Welt würde der König das Pferd am Zügel führen und ihm beim Absteigen aus dem Sattel helfen. Ich weiß, dass König Karl Bischöfe einsetzt und auch wieder absetzt, wie es ihm passt.
Der seltsame Fremde hält jetzt das Kreuz hoch in die Luft; alle beugen ihre Knie, auch der König. Und mein Nachbar packt mich im Genick und drückt mich ebenfalls nieder.
Der Fremde schlägt über uns das Kreuz, das Zeichen des neuen Gottes.
Am Abend erfahre ich dann alles, als ich endlich einen Pferde-knecht am Hofe erwische, der mit einem Sachsen redet: »Du Dummkopf!«, sagt er auf meine Frage. »Bist du blind?«
»Wer ist denn größer als König Karl?«, frage ich.
»Niemand«, bekomme ich zur Antwort.
»Was dann?«, frage ich weiter.
»Gott ist größer«, sagt er.
»Dann ist der Herr mit den Narben also Jesus Christus?«, frage ich ehrfürchtig.
»Nein, du Dummkopf, aber sein Stellvertreter. Der Stellvertreter Gottes auf Erden!«
»Es ist der Papst«, sagt der Franke, und ich falle vor Schreck schier auf den Rücken.
Der Papst in Paderborn! Am Ende der Welt! Der Papst mitten im Urwald! Der Papst wohnt doch in seinem Palast, und der ist in Rom. Wo immer das auch sein mag. Weit weg!
Und ich habe den Papst beschützt!
Leo III. heißt er, wird gesagt.
Vom Papst ist viel geredet worden bei den fränkischen Kriegern. Manche waren sogar schon in Rom und haben den Papst mit eigenen Augen gesehen. Aber da war es noch ein anderer, der Vorgänger von Leo III., der in der Zwischenzeit gestorben ist.
Dass der Papst überhaupt sterben kann, der Stellvertreter Gottes!
Und die Narben?
Es wird an diesem Abend viel geredet über diese Narben des Papstes. Er hat Feinde in Rom, wird gesagt. Leute, die selbst gerne Papst sein wollten. Sie haben ihn überfallen, und nun sucht er Schutz beim mächtigsten Mann der Welt, bei unserem König!
Und die Narben?
Sie wollten Leo III. nur die Augen ausstechen und die Zunge herausschneiden. Umbringen wollten sie ihn nicht: Sie hatten Angst vor Gott! Immerhin: Er ist der Papst!
Gott aber hat ihm geholfen – die Augen können durch ein Wunder wieder sehen, und die Zunge kann durch ein Wunder wieder reden. So wird gesagt.
Und die Männer im Wald, deren Hufschlag ich gehört hatte? Ich fasste Mut und redete mit dem Anführer der Wache.
Er wollte mich erst wegjagen, dann erkannte er mich und schaute mich nachdenklich an: »Ein Glück, dass du das im Wald rechtzeitig bemerkt hast und gleich zu mir gekommen bist«, sagt er und legt seine Hand auf meine Schulter. »Es waren die Halunken, die dem Papst die Augen ausstechen wollten. Sie sind jetzt übrigens hier am Hof und stellen sich dem Gericht des Königs und geben alles zu. Jetzt können sie keinen Schaden mehr anrichten. Hätten sie Leo III. auf dem Weg hierher erwischt – sie hätten ihn gefangen genommen und König Karl dazu gezwungen, einen neuen Papst einzusetzen. Und Karl hätte dann nicht erreicht, dass ihm der Papst verpflichtet ist.«
»Wird er sie hinrichten lassen?«
»Nein, dazu sind die Familien in Rom zu mächtig. Der König kann ihre Feindschaft nicht noch weiter herausfordern.«
»Hat er Angst vor ihnen?«, frage ich ein wenig enttäuscht.
Er lacht: »Natürlich nicht. Das nennt man Politik, du Dummkopf. «
»Wenn der Papst dem König verpflichtet ist – was soll er denn für ihn tun?«, frage ich gespannt.
»Geheim!« Er winkt mir zu verschwinden. Mir, dem Retter des Papstes!
Wir aber haben dann im folgenden Jahr, anno 800, wie sie sagen, König Karl nach Rom begleitet. Eine sehr weite Reise, wunderbar, von der viel zu erzählen wäre. Dort hat sich der Papst bedankt beim König, weil er ihn vor seinen Feinden geschützt hat, und zu Weihnachten, wie sie zum Fest der Wintersonnwende jetzt sagen, ist König Karl vom Papst zum Kaiser gekrönt worden, was auch immer das heißt.
Dass er Kaiser wird, haben die beiden, der König und der Papst, ja vielleicht in Paderborn ausgemacht, und vielleicht war dies das Geheimnis, das mir der Anführer der Leibwache nicht hatte sagen wollen. Vielleicht hat er aber auch nur angegeben – ein Franke!
Ich war bei der Krönung mit dabei, und wir haben geschrien und dem Kaiser zugejubelt.
Schon vorher hat sich der König mit seiner hellen Stimme bedankt, nämlich bei uns, die wir den Papst sicher nach Paderborn gebracht hatten. Er ist dann auf mich ganz allein zugekommen, ich bin schier in den Boden versunken, und hat sich bei mir besonders bedankt. Ich erhielt eine sehr große Belohnung, die meine Erwartungen weit übertraf.
Was es ist? Das werde ich gerade euch auf die Nase binden! Na ja, könnt ihr euch ja denken: Gold, Pferde, Land, viel Land – reicht das?
Sicher ist der Papst auf seiner Flucht nach Paderborn von Jesus Christus, dem Herrn der Kirche, beschützt worden. Er ist ja sein Stellvertreter. Dennoch bin ich sicher, dass auch unser alter Gott Donar durch meinen Hammer aus Silberblech im Wald bei Nacht und Regen meine Ohren und mein Hirn aufgesperrt hat und so seine Hand über dem Papst ruhen ließ.
Das habe ich Kaiser Karl natürlich nicht gesagt. Der hätte mir womöglich die ganze Belohnung wieder weggenommen.
SCHNEEFALL
Bestimmt gehören Sagen, Legenden und Anekdoten, die sich bisweilen nach dem Leben eines bedeutenden Menschen bilden, nicht zur Geschichtsschreibung – was darin beschrieben wird, ist nicht wirklich passiert.
Dennoch sollte man sie nicht unterschätzen: Sie haben ihren Ursprung im tatsächlichen Geschehen, und was sie über die Menschen, von denen sie handeln, berichten, hängt zumeist eng mit deren tatsächlich gelebtem Leben zusammen, malt es aus, gibt ihm besondere Färbungen. Freilich, die Entstehung von Sagen und Legenden kann vielerlei Ursachen haben: Bewusst gesteuerte Propaganda oder gewollte Überhöhung zum Beispiel. Zieht man dies jedoch mit in Betracht, so liefern uns derartige »Zeugnisse« heute durchaus auch Informationen über die Zeit, zumindest über die Zeit, in der sie entstanden sind.
Aus dem Leben Karls des Großen gibt es viele solcher Legenden und Geschichten. Eine davon wird hier erzählt, nicht nur weil sie seit Jahrhunderten überliefert ist, sondern auch, weil sie ein recht zuverlässiges Licht auf den großen Herrscher wirft. Es geht darin um sein Verhältnis zu seinen Kindern, und nach allem, was wir darüber wissen, hätte die Geschichte wohl tatsächlich so – oder so ähnlich – geschehen können. Die Personen, von denen sie berichtet, hat es gegeben: Einhard, der bei uns Eginhard heißt, war ein wichtiger Vertrauter des Kaisers. Er war auch sein wichtigster Chronist, und sehr vieles, was wir von Karl wissen, geht auf seine »Vita Caroli Magni« zurück.
Und Einhards Frau hieß wirklich Emma oder Imma oder Ima, aber die Tochter Karls, wie die Legende behauptet, war sie nicht – Karl der Große hatte viele Töchter, aber keine mit diesem Namen.
Kaiser Karl der Große hing in ungewöhnlich enger Weise an seiner Familie, vor allem an seinen Töchtern. Ja, es wird berichtet, er brauchte ihre Gegenwart so sehr, dass er keine von ihnen jemals verheiraten wollte, auch nicht in einer »politischen Ehe«, wie es unter Fürsten üblich war.
Solche Ehen, wichtig im Spiel der Mächtigen, wären vorteilhaft für den Kaiser gewesen. Er hat es aber immer abgelehnt, seine Töchter »an den Mann zu bringen«. Man kann sich nun denken, wie eifersüchtig der Kaiser darauf achtete, dass den Töchtern kein männliches Wesen zu nahe kam.
Es geschah aber doch.
Zum engsten Kreis des Kaisers gehörte sein Geheimschreiber, Baumeister und vertrauter Ratgeber Eginhard. Wir wissen nicht mehr, wie dieser Eginhard ausgesehen hat. Die einen reden von ihm als einem hübschen jungen Mann, andere aber sagen, er habe nicht so gut ausgesehen und sei auch gar nicht jung gewesen, doch habe er eine sehr verbindliche Art gehabt. Hätte ihn der Kaiser sonst in diplomatischen Diensten gebraucht? Sicher war er sehr gebildet, denn er war Schüler des großen Alkuin und dessen Nachfolger als Leiter der Palastschule in Aachen.
Vielleicht war er ja zudem auch noch schlagfertig, unterhaltend, ein glänzender Reiter, ein mutiger Krieger, ein gewandter Jäger. Vielleicht konnte er himmlisch tanzen oder herrlich singen oder meisterlich ein Instrument spielen, vielleicht auch hatte er besonders schönes Haar oder besonders schöne blaue oder braune oder schwarze Augen.
Der Fortgang der Geschichte zeigt immerhin, dass er nicht dick gewesen sein kann.
Wichtig ist: Imma, die jüngste Tochter des Kaisers, verliebte sich in Eginhard. Verliebte sich sehr in ihn! Und er verliebte sich in sie!
Ein Essen, bei dem er nicht zugegen war, schmeckte ihr nicht. Sie saß dann nur da, bleich und stumm, und stocherte auf ihrem Teller. Fragte ihr Vater oder eine der Schwestern oder ein Bruder, ob sie krank sei, bekam er mit kaum hörbarer Stimme zur Antwort: »Frauensachen«. Da war der Kaiser still; die Schwestern seufzten. Und die Brüder mussten ihren Mund halten.
Schön und schlimm aber war es, dass der Geliebte meist mit bei Tische saß, oft mit dem Kaiser in wichtigen Gesprächen. Manchmal war Eginhard Gegenstand eines scheuen Blickes. Und auch seine Blicke streiften verstohlen über den Tisch, während er mit dem Kaiser redete oder ihm zuhörte, und blieben an ihrer Hand haften, weil es aufwärts zu ihrem Gesicht viel zu gefährlich gewesen wäre. So geschah es sehr selten, dass ihre Augen sich trafen und kurze, stumme Zwiesprache hielten, um sich dann scheu irgendwo anders hinzuwenden.
Zum Glück sah niemand die Glutwelle, die Imma bei solchen Augentreffen über das Gesicht ging. Auch von ihr, der Prinzessin, wissen wir nicht, wie sie aussah, ob blond, schwarz oder braun, ob sie schlank oder kräftig war, ernst oder heiter. Ob sie groß war oder klein – nein, halt, das wissen wir, sehr klein kann sie nicht gewesen sein. Man wird schon sehen!
Immerhin wissen wir, dass sie eine Prinzessin war, und Prinzessinnen sind immer schön. So wollen wir uns eine hübsche Imma ausdenken, sogar eine schöne, vielleicht ungewöhnlich schöne Imma, denn sie war ja nicht nur eine beliebige Prinzessin, sondern die Tochter des Kaisers.
Freilich, Liebe lässt sich auf Dauer nicht verbergen und auch Verliebtsein nicht! Wäre also jemand aufmerksam gewesen, so hätte er trotz aller Heimlichkeiten sehen können, was für eine errötende Innigkeit da bei Tisch zwischen Töpfen, Tellern und Bechern hin und her wandelte.
Aber sie war so ungeheuerlich, diese Liebe! Es war eine verbotene Liebe, wie nur je eine Liebe verboten war: Eine Liebe zwischen einer kaiserlichen Prinzessin und einem Schreiber! Auch wenn Eginhard hoch geschätzt war beim Kaiser – es war undenkbar!
Aber größer war die Anst des Kaisers um seine Töchter – und nun auch noch um die jüngste und schönste, bei deren Anblick dem alten Kaiser das Herz zerfloss!
Manchmal wurde bei Tisch über die Heirat der Töchter gesprochen, wobei diese rot wurden oder, als sie noch jünger waren, an-fingen zu kichern. Aber später kicherten sie nicht mehr und wurden auch nicht mehr rot. Doch der Kaiser sagte immer, dass noch keine würdigen Freier aufgetaucht seien – keine ebenbürtigen Freier: kaiserliche Prinzen. Und Kaiser Karl hatte dabei ein zufriedenes Gesicht. Denn wo gab es schon kaiserliche Prinzen?
Wehe, wenn Karl von einer solchen Liebe erfuhr!
Wenn sie auf Reisen waren von einem Königshof zum anderen, konnte es geschehen, dass sie drei, vier Worte miteinander wechselten – bevor ein Knecht zu Eginhard trat oder ein Bote oder ein großer Herr. Oder bevor eine der Schwestern zu ihnen kam und einen schwer zu deutenden Blick auf sie beide warf.
Ganz selten schaffte er es, die Hand Immas zu ergreifen, die sie ihm mit schimmernden Augen ließ, und es war für beide, als fließe der große breite Rheinstrom durch ihre Hände. Aber diese Berührungen waren kürzer, als ein Zaunkönig mit dem Schwanz wippt. Auch spürte sie manchmal sein Gewand – oder er den feinen Stoff ihres Oberkleides -, wenn sie sich zufällig nahe kamen.
Sie lebten von der Erinnerung an solche Augenblicke.
Aber oft überwogen für den Geheimschreiber des Kaisers andere Empfindungen: Du bist wahnwitzig! Ohrfeigen gehören dir. Wohin soll das führen? Du gefährdest dich und sie mit. Eine Unachtsamkeit, und der Kaiser merkt es! Und dann? Was hat Alkuin, dein großer Lehrer, dir beigebracht? Drei Dinge sollen dein Leben bestimmen: der Glaube an Gott und die Achtung vor der Vernunft! Dazu die Treue zum Herrscher! Und nun war Eginhard im Begriff, alle drei Regeln zu missachten.
Er schwor sich heilige Eide, ab jetzt der Kaisertochter nur noch ehrfurchtsvoll und höflich zu begegnen. Aber dann sah sie ihn an und er sie -
Man müsste mit Imma einmal vernünftig reden, dachte er, und nahm sich fest vor, das auch zu tun. Aber wann? Er war ja nie allein mit der Kaisertochter.
Ich habe ja auch ihr gegenüber Verantwortung, sagte er zu sich. Verantwortung gegenüber meinem Leben und ihrem Leben. Er sagte es sehr vernünftig.
Ich bin älter als sie und reifer, hob er dann hervor und hörte sich reden, als spräche er in der Fürstenversammlung. Und sie ist ja nur eine Frau, also viel schwächer als ich. Ich muss der Stärkere sein! Keine Frage. Ich darf nicht zulassen, dass sie irgendeine Dummheit begeht, die alles offenbart. Ich darf auf keinen Fall dulden, dass sie in ihr Unglück rennt!
Karl ist streng, wer weiß das nicht? Sehr streng! Bisher hatten wir großes Glück, dass er nichts bemerkt hat. Aber wie lange noch? Erfährt er es, sperrt er sie in ein Kloster – und was geschieht mit mir? Nicht auszudenken!
Aber wenn Eginhard die Kaisertochter sah, waren alle Vorsätze wie weggeblasen. Er sah nur noch sie. Er fühlte sich stark, als könne er sie beschützen. Doch ein wirklicher Schutz wäre nur gewesen, wenn sie sich nicht mehr gesehen und es keine verliebten Blicke mehr gegeben hätte!
Er war ein pflichtbewusster Mann, als er so sprach! Sie musste beschützt werden. Er musste sie vor sich – also vor ihm selbst – beschützen: Eigenartig, dachte er, ich sollte ihr Schutz sein und bin doch ihre größte Gefahr!
Ach, wenn man doch diesen Knoten lösen könnte! Einfach mit dem Schwert durchschlagen wie der große Alexander den gordischen!, dachte er. Wie schwer habe ich es dagegen! Aber Alexander war ein König, und wer bin ich? Gerade das war ja das Problem!
Kein Wunder, dass er durch die weiträumigen Säle und Gänge der Paläste des Kaisers nur noch schlich. Ein Mann, beladen mit Sorgen und Qualen, denn die Entsagung von der Geliebten ist keine kleine Sache. Und täglich musste er dem Kaiser ein freundliches Gesicht zeigen – dem einzigen und ganz unüberwindlichen Hindernis seiner Liebe! Er schlief schlecht. Er schien krank, und immer wieder mitten im Gespräch atmete er tief ein und seufzte dann herzzerbrechend.
Der Kaiser hatte ihn schon mehrmals prüfend von der Seite angesehen.
Der Geliebten ging es ganz ähnlich. Doch ihre Seufzer waren nicht so gefährlich, sie fielen nicht so auf. Und sie seufzte nicht in Gegenwart des Kaisers, und wenn ihr doch ein Seufzer unterlief, so hieß es immer: Frauensachen.
Es war im Winter, im Februar, ein harter Winter, in dem die Palast-bewohner eng zusammenrückten, weil es nur in wenigen Räumen des Königshofes zu Ingelheim einen Kamin gab. Es war schrecklich kalt. Die wenigen, geradezu höllischen Feuer, welche von den Dienern den ganzen Tag geschürt wurden, strahlten ihre Wärme nicht einmal bis zu den kalten Steinwänden, an denen das Wasser herunterlief. Und von den großen Fenstern, vor denen die hölzernen Läden zugeschoben waren, wehte es eiskalt herein. Stellte ein Diener einen Eimer Wasser in der Nähe eines Fensters ab, war es bald von einer Eisdecke überzogen – und das in einem Raum, in dem mächtige Buchenscheite brannten!
Hier in Ingelheim beschloss Eginhard zu handeln.
Handeln, das hieß, er musste mit Imma reden, das Mädchen zur Vernunft bringen. Er musste ihr den Geliebten aus dem Herzen reden – sich selbst!
Bis zu dieser Zeit hatten die beiden über all die Wochen und Monate insgesamt noch kaum hundert Worte miteinander gewechselt – nur Blicke. Liebe braucht nicht viele Worte. Aber sie braucht andere Dinge, welche die beiden auch nicht hatten: Zum Beispiel, dass man mit dem Geliebten oder der Geliebten allein sein kann, dass man sich kennen lernt, dass man den anderen fühlt -
Daran war nicht zu denken. Aber zu denken war schon, dass selbst das kürzeste Zusammensein einer Trennung, wie sie der Schreiber vorhatte, auf keinen Fall förderlich sein konnte.
Das Herz schlug Eginhard nämlich sehr, wenn er sich vorstellte, mit dem schönen Kind allein zu sein. Und in solchen Augenblicken fiel ihm kein einziger Grund zur Trennung ein. Allein schon bei dem Gedanken an die schöne Zweisamkeit durchströmte ihn heftiges Glück, eine Zweisamkeit, bei der doch aber die Trennung erfolgen sollte!
Beklemmung und Glücksschauer jagten über ihn hinweg, als er sich ein Herz fasste und der Tochter des Kaisers nach dem Mittagsmahl entgegentrat, im Gang zu ihrem Gemach.
»Bleib«, sagte er mit einer Stimme, die so belegt klang, dass sie ihm selbst fremd war, und räusperte sich: »Imma, wir müssen einmal miteinander reden.«
Sie wurde feuerrot und nickte.
Schnell sagte er, damit ja kein Missverständnis aufkommen konnte: »Ich meine es ernst.«
Worauf sie noch röter wurde und den Arm um ihn legte und ihn heftig an sich zog.
Es blieb jetzt keine Zeit, viel zu erklären. Jeden Augenblick konnte ein Diener dastehen oder einer der Herren oder ein Bruder oder eine der Schwestern Immas oder gar der Kaiser selbst -
So fragte er nur: »Wann?«, und erschrak, welchen Stoß von Glück diese Frage in ihm auslöste.
»Komm heute Nacht zu mir, wenn mein Vater schläft«, gab sie zur Antwort, und ihre Augen leuchteten in der Düsternis des Ingelheimer Königshofes wie zwei Kaiserkronen.
Dann war sie weg.
Er stand in dem dunklen Gang und wusste nicht, was er denken, fühlen oder sagen sollte. Wie Feuer sich prasselnd und lodernd in ein Büschel Tannenreisig frisst, um dann funkensprühend auf dem Herd zu tanzen, begann Vorfreude in seinem Innern zu leuchten.
Wenn mein Vater schläft, hatte sie gesagt. Es klang so, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Nein, es klang so, als hätte sie schon sehr lange darauf gewartet. Wie sollte er denn da vernünftig mit ihr reden?
Was hatte er sich eigentlich gedacht bei dem Plan? Dass sie zu ihm kommen würde? Unsinn! Dass sie sich irgendwo im Freien zusammen an einen Wiesenrain setzen würden? Blödsinn – dann hätte er im Sommer handeln müssen! Und mit der Tochter des Kaisers an einem Wiesenrain! Schwachsinn.
Draußen regnete es.
Der Gedanke, sie in ihrer Kammer aufzusuchen, machte ihn fast krank vor Freude! Aber die Gefahr – mein Gott, die Gefahr!
Die Zeit war heran, der Weg nicht schwer zu finden. Eginhard stellte sich die Palastanlage vor mit allen Gebäuden: Er musste einfach aus seiner Kammer quer über das Geviert des Hofes gehen zu dem Haus, das der kaiserlichen Verwaltung genau gegenüber-lag. Dort waren zu ebener Erde die Kammern der Söhne und Töchter des Kaisers. Diese Kammern lagen wie Perlen auf einer Schnur entlang eines Ganges, und es würde ratsam sein, die Türen nicht zu verwechseln.
Der Weg über den nassen Hof – weit war es nicht, kaum hundert Schritte. Aber die Räume des Kaisers blickten zum Hof, im ersten Stock, er musste sogar gerade unter dem Schlafgemach des Herrschers entlanggehen. Kaiser Karl könnte also womöglich von einem der Fenster aus sehen, wie sein Geheimschreiber in der Nacht an ihm vorbei über den Hof zur Türe seiner jüngsten Tochter -
Es goss in Strömen, als sich Eginhard über den weiten Platz mit seinen Pfützen bewegte. Es war schwarz wie im Grab – der Kaiser konnte ihn nicht sehen. Drüben tastete sich Eginhard an einer Mauer entlang. Das Herz schlug ihm bis in den Hals, aus vielerlei, ganz unterschiedlichen Gründen.
Imma lag fast in gänzlicher Dunkelheit. Nur von dem Eisenbecken, das gefüllt war mit Glut, um ihre Kammer eine Spur zu erwärmen, glomm rötliches Licht hinauf zu den Balken der Decke.
Auch der Prinzessin schlug das Herz. Die Tochter des Kaisers trifft sich mit einem Schreiber! Nachts in ihrer Kammer! So etwas durfte man nicht einmal denken!
Aber allein der Gedanke an Eginhard war von einer so schweren Süße! Eginhard war zwar viel älter als sie, aber sein Gesicht war so – so lieb und so schutzbedürftig, ein wenig wie ein Kind. Dabei so gescheit und erwachsen und – sie konnte es nicht anders ausdrücken – so rein! Es war so offen, so zuverlässig, ach, man konnte nur -
Und ihr Vater? Keinen Schritt konnte man machen, ohne dass er wissen wollte, was man tat, wo man war, was man vorhatte – grässlich! Und er hatte immer versprochen, die Schwestern und sie zu verheiraten. Aber nichts war geschehen, nichts, nichts, nichts! Die anderen, Rotrud, Berta und Gisela, waren längst zu alt zum Heiraten; bei ihr war es allerhöchste Zeit!
Ihr erster Gedanke, wenn sie morgens erwachte, war Eginhard! In jeder Ader fühlte sie Eginhard. In jedem Knecht auf dem Hof sah sie Eginhard! Jeder Schritt, den sie hörte, war Eginhard! Jeder Herzschlag war Eginhard! Ihre Arme lagen in Gedanken immer um Eginhard! Wenn sie am Abend einschlief, war das Kissen in ihren Armen Eginhard!
Freilich, man musste vernünftig sein. Und Eginhard war nicht vernünftig, sein Verstand verließ ihn, sobald er sie sah. Es war so süß, wie er versuchte, ihr seine Liebe zu zeigen, ohne dass es jemand bemerkte. Und er war immer so verlegen, wenn sie ihm zulächelte!
Wie lange hatte sie darauf warten müssen, dass er überhaupt zu ihr sprach, über etwas anderes als nur das Alltägliche. Und dann gleich das: Wir müssen uns treffen! Das Herz war ihr stehen geblieben. Am liebsten hätte sie ihn gepackt und geschüttelt und geschüttelt und umarmt und geküsst und geküsst. Sie hatte noch niemanden geküsst: Wen sollte die Tochter des Kaisers küssen? Und wer sollte sie küssen? Ein Wahnsinniger?
Und Eginhard? War er verrückt geworden? Aber sie hatte einfach gesagt: Komm heute Nacht zu mir, wenn mein Vater schläft.
Sie hatte es nicht wirklich gesagt! Es war undenkbar! Ihr Vater war der Kaiser. Ach, wenn er doch ein Reiter wäre oder ein Jäger oder ein Bauer, seufzte sie. Aber sie reckte ihr Kinn – er war der Kaiser! Was denn sonst?
Auf jeden Fall musste man endlich – für alle Zukunft – vernünftig sein. Noch einmal: Eginhard war nicht vernünftig, das sah sie jeden Tag. Er war ein Mann -
Deshalb musste sie es sein, die handelte. Sie hatte ihn herbestellt – was war dabei? Ihr Vater bestellte seinen Schreiber oft in der Nacht zu sich, und sie arbeiteten bis zum Morgen. Natürlich wusste sie, was Männer wollen, sie war kein Kind mehr, doch sie hatte Eginhard aus ganz anderen Gründen herbestellt, als er vielleicht dachte! Man musste endlich reden miteinander – es konnte so nicht weitergehen, auf keinen Fall! Und man brauchte Zeit, um miteinander zu reden, viel Zeit! Und ungestört musste man sein. Es gab gar keinen anderen Weg, als sich zu treffen, während der Vater schlief. Und das war eben nachts! Noch einmal, was war dabei? Sie hatte das sehr gut gemacht, dass sie ihn nachts bestellt hatte!
Sie lächelte in die Dunkelheit – natürlich musste sie ihn enttäuschen, doch das war nur heilsam für ihn! Es war heilsam für beide. Sie war sehr vernünftig. Und er sah ja sicher alles genauso wie sie, wenn sie erst einmal miteinander sprachen.
Ihr schlug das Herz.
Da klopfte es leise an die Türe -
Seltsam scheu betrat er die Kammer. Sie horchte auf jedes Knarren des Fußbodens und der Türangeln. Er näherte sich ihr. Er spürte, wie ihre Hand zitterte. Sie fühlte seine Hand nass wie seine Oberkleidung. Draußen regnete es immerfort.
Er zog sie an sich. Er spürte ihr Beben, er hörte ihren schweren Atem. Er sah ihren Umriss im schwachen Schein der Glut. Es war der Umriss einer Frau. Er fühlte die sehr warme Hand, die weich war wie Wolle.
Sie nahm seinen Geruch war, nach Nässe, Leder – ein männlicher Geruch, der sie erschreckte und anzog. Sie legte den Arm um ihn und fühlte sein Beben.
Er fühlte ihr Zittern, ihre Hüfte, ihren Busen, ihre langen, gelösten Haare. Er spürte ihren Körper durch ihr wollenes Hemd, das sie für die Nacht trug. Der Körper einer Frau! Er hatte noch nie den Körper einer Frau gespürt. Ihre Brüste drückten gegen seine Brust, ein fremdes, erregendes Gefühl.
Als er sie an sich zog, jetzt mit Kraft, spürte sie die Härte zwischen seinen Schenkeln.
Sie löste sich aus seinen Armen und machte sich an dem eisernen Wärmbecken zu schaffen, nahm einen Kienspan und hielt ihn über die Glut, bis eine Flamme das Zimmer erhellte. Sie zündete mit der Flamme eine Kerze an: Licht! Vernunft!
Sie setzte sich auf einen Stuhl. Sie atmete schwer.
Er sah die junge Frau im Schein der Kerze. Sie sah den Mann, der groß und breit vor ihr stand in dem ungewiss flackernden Licht.
Und beide dachten jetzt genau dasselbe: Die Vernunft kommt nachher zu ihrem Recht, wenn wir miteinander reden.
Wir haben ja viel Zeit -
Sie lernten aneinander ihre Körper kennen, den des anderen und den eigenen. Und sie erzählten sich lange und ausführlich, was jeder beim anderen entdeckt hatte und wie wunderbar diese Entdeckungen waren. Sie konnten nicht zu Ende kommen mit Küssen und Erzählen, und sie konnten einander nicht deutlich genug spüren lassen, wie schön das alles war.
Die Vernunft würde schon noch zu ihrem Recht kommen. Bestimmt. Bald. Die Nacht würde ja noch lange dauern. Draußen war Regen. Hier war es warm. Man würde das nächste Mal vernünftig reden. Oder das übernächste Mal. Die Nächte des Winters waren ja noch so lange lang -
Schließlich trennten sie sich. Die Kerze war heruntergebrannt und rauchend ausgegangen. Sie öffneten die Tür leise. Die Angst, gehört zu werden, sprang Imma wieder an – dieses Raubtier, das die ganze Nacht geschlafen hatte. Sehr kalte Luft kam ihnen im Flur entgegen. Imma wurde noch einmal kräftig an die Brust Eginhards gedrückt.
Dann ging er.
Alles war gut. Sie legte sich aufs Bett, und sie hatte sich noch nie so unsagbar wohl gefühlt wie jetzt.
Hatte es an die Tür geklopft?
Eginhard kehrte zurück: »Wir sind verloren!«, flüsterte er.
Es hatte doch niemand -
»Schau hinaus«, sagte er.
»Hinaus? Wo?«
»Hier«, sagte er. Seine Stimme klang selbst beim Flüstern heiser. Er schob vorsichtig einen der Fensterläden auf die Seite. Eisig wehte es herein: Eine eigenartige Helle erfüllte die Kammer – draußen lag Schnee! Und darüber spannte sich ein Himmel voller Sterne.
Alles hatte sich verwandelt, während sie beieinander gewesen waren. Sie blickten hinaus auf den weiten weißen Hof, durch den Eginhard zurückmusste – jedes Gebäude war klar zu erkennen, rechts das Haus Kaiser Karls, in dem er jetzt lag und schlief, quer dazu, den Hof nach hinten begrenzend, das Haus der kaiserlichen Verwaltung, in dem Eginhard liegen müsste und schlafen. Links waren Speichergebäude.
Dahinter ragte, mächtig und schwarz, vor dem funkelnden Sternenhimmel die Aula Regia, die Königshalle mit dem Thronsaal des Kaisers, über alle anderen Gebäude und ihre weißen Dächer: Ort des kaiserlichen Gerichts, Ort der Strenge und der Milde, Ort der Kaisermacht – Mittelpunkt des Reichs, wenn der Kaiser hier in Ingelheim weilte.
»Ein Frosteinbruch! Der Regen hat sich in Schnee verwandelt. Ich muss aber zurück.« Sie fühlte, wie er zitterte. »Man wird im Schnee meine Spur sehen, wie sie aus diesem Hause kommt, in dem deine Kammer ist, und in meine Türe geht. Wir sind verloren – es gibt keinen Ausweg.«
»Wenn es noch einmal schneit«, sagte sie verwirrt und praktisch.
»Der Himmel voller Sterne – wo soll denn da der Schnee herkommen? « Seine Hand war eiskalt.
»Aber er würde die Spur zudecken. Es hat doch vorher auch -«
»Lass, es wird nicht mehr schneien, glaub mir!«
Er weiß solche Dinge besser, dachte sie, er ist ja ein Gelehrter: Sie waren verloren.
Er dachte an das Blutgericht von Verden, bei dem Karl viertausendfünfhundert Sachsen hatte hinrichten lassen.
Sie dachte an Herzog Tassilo von Bayern, den ihr Vater grausam hatte scheren lassen und in ein Kloster sperren.
Sie standen bebend in der grimmigen Frostnacht, Imma presste die Hand vor den Mund. Eginhard sah so elend aus in dem bleichen Mondlicht. Es musste doch einen Ausweg geben! Niemand hatte sie entdeckt, alles war gut gegangen. Es musste doch weitergehen, es konnte doch nicht plötzlich alles aus sein!
Wozu bin ich die Tochter des Kaisers?, dachte sie. Wer kann helfen, wenn nicht die Tochter des Kaisers?
Sie hörte ihn schwer atmen. Wolken von Dampf stiegen wie Rauch in den Sternenhimmel.
»Ich hab’s«, sagte sie, »es ist ganz leicht. Du glaubst es nicht.« Sie kicherte.
»Und wie?«
»Ich trage dich, ganz einfach«, sagte sie schlicht, »wer will dann deine Spuren erkennen?«
Sie sah ihm an, wie er überlegte: »Über den Hof? Und wie kommst du zurück – da sind doch dann zwei Spuren. Eine hin, die andere zurück.«
»Na und«, sagte sie und war die Gescheitere und freute sich schon auf das Tragen. »Ich war eben drüben, im Haus der Verwaltung, es geht ja da auch zur Küche.«
»Und was hast du gemacht in der Küche?«
»Ich hab’s«, sagte sie glücklich, »ich gehe halt in der eigenen Spur zurück. Dann bin ich für alle noch drüben. Niemand sucht mich dort. Und bis jemand auf den Gedanken kommt, nach mir zu fragen, bin ich längst wieder hier, und niemand hat etwas bemerkt – mein Vater schon gar nicht.«
»Es könnte gehen. Aber kannst du mich denn tragen?« Er drückte sie an sich.
»Ich dich? Die Tochter Kaiser Karls einen Schreiber? Dass ich nicht lache.«
Sie streifte ein Obergewand über das Wollhemd; und er war dann doch ganz schön schwer, als sie ihn auf dem Rücken hatte, huckepack. Es war weiter als vermutet, und sie stolperte immer wieder im Schnee über die Säume ihres Gewandes. Aber sie schaffte es, ohne zu stürzen, laut und glücklich schnaufend und dampfend, denn die Liebe war für sie keine Last. Sie war barfuß, aber die Kälte spürte sie nicht.
Als sie zurück war, musterte sie stolz ihre Spur. Jeder würde meinen, dass eines der Kinder des Kaisers in aller Frühe hinüber-gegangen war in das Küchen- und Vorratshaus. Niemand würde sich dafür interessieren.
Aber eines war klar: Das nächste Mal musste die Vernunft das Wort haben!
Vielleicht war es das Wetter, das den Kaiser nicht schlafen ließ – Schneefall nach dem Dauerregen -, vielleicht war es aber auch seine Hüfte oder sein Bein, in denen immer wieder heftige Schmerzanfälle tobten.
Der alte Mann stand hoch über dem Hof an einem Fenster und schaute hinaus in die Winternacht. Hinauf zu dem Gefunkel der Sterne und hinab auf das Leichentuch, das die Welt nun überzogen hatte.

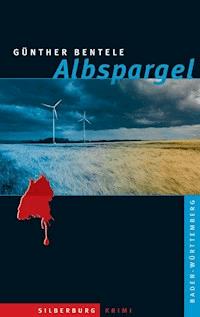


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









