Inhaltsverzeichnis
Lob
DREIUNDZWANZIG WEBSTÜHLE
LABYRINTH
EIN APFEL FÜR DIE WELT
DIE SCHÖNE VENEZIANERIN
GEWÖLBE
NOTIZ
BERICHT
VORBERICHT I
VORBERICHT II
EINGABE
BRIEF
EINGABE
BRIEF
BRIEF
BERICHT
EINGABE
BRIEF
PROTOKOLL
JUNKER JÖRG
DIE BAUERN VON KINDELBRÜCK
DER ALBTRAUM DES PROFESSORS
DER UHRMACHER
VOM SCHICKSAL DER SCHÖNEN MAGELONE IN NÖRDLINGEN
DER DREIFACHE STURZ
I.
II.
III.
BARBARA
DAS THEMA DES KÖNIGS
KUNERSDORF
NACHWORT DES AUTORS
ZEITTAFEL
Copyright
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Bertolt Brecht
DREIUNDZWANZIG WEBSTÜHLE
Mit furchtbarer Wucht war in der Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest über Europa hereingebrochen und hatte eine zuvor einsetzende Verringerung der Bevölkerung, durch Kriege und Hungersnöte bedingt, dramatisch verstärkt. Über zwanzig Millionen Menschen, so schätzt man, hatte die Seuche das Leben gekostet. Zwar wütete die Pest auf dem Lande nicht so schrecklich wie in den Städten, aber wer sollte den Bauern ihre Erzeugnisse abkaufen? Über die Hälfte der Städter war gestorben.
So stürzte der Massentod den Markt für die Erzeugnisse der Bauern ins Bodenlose. Er machte andererseits die Überlebenden durch umfangreiche Erbschaften oft ungeheuer reich, da sich große Vermögen in den Händen weniger konzentrierten. Dazu kamen Reichtum aus dem wachsenden Fernhandel und die zunehmende Differenzierung des Handwerks mit einer generellen Begünstigung der Geldwirtschaft. Eine mögliche Anlage von Kapital bot das neu entstehende Verlagswesen, bei dem der Verleger Werkzeuge, Maschinen und Rohstoffe stellte und der einfachen Bevölkerung ihre Arbeitskraft bezahlt wurde.
Der Besitz von Geld entwickelte sich ab jetzt über Jahrhunderte hinweg zum entscheidenden Machtfaktor der Neuzeit. In unserer Geschichte versucht ein Bauer, in der Stadt Fuß zu fassen. Die Pest hat ihn reich gemacht.
Ein Mann, der von sich behauptete, er sei im vollen Besitz seines Verstandes, ging eines Tages hin und kaufte dreiundzwanzig Webstühle. Der Mann erstand auch dreiundzwanzig Knäuel Leinengarn, wie sie Weber brauchen. Der Mann konnte keine Zeile weben.
Dieser Mann war ich.
Noch vor ein paar Jahren war ich ein Nichts im Dreck, ein kleiner Bauer in einem Dorf – und jetzt!
Der Anfang freilich war furchtbar, und das Opfer, das ich erbringen musste, war noch schrecklicher. Denn die Veränderungen, die ich hier beschreibe, sind alle durch die Seuche geschehen, die unter dem Namen Schwarzer Tod oder Pest so großen Schrecken verbreitet hat.
In unserer Nachbarstadt waren es Tausende, die jämmerlich zugrunde gingen. Bei uns im Dorf waren es nur wenige.
Die Menschen starben wie die Fliegen. Ich meine, sie beendeten ihr Leben so sinnlos wie Fliegen, aber auch so rasch wie Fliegen. Ich will vom Überleben berichten.
Als die Pest ausbrach, war ich nur ein kleiner Bauer im Dorf Wegschlag, dem Ritter Herrn Ruger von Wegschlag zugehörig. Ihm gehörten der Grund und Boden, das Dorf, und ihm gehörte meine Arbeitskraft, wie überall die Bauern den Herren gehören. Ich musste meine Arbeit dem Herrn als Abgaben geben, in Form von Getreide und Kleinvieh, und ich musste für ihn Fronarbeiten leisten: Burggräben ausheben, Erde und Steine karren und vieles andere, was jedem Bauern zuwider ist, weil er lieber auf seinen Äckern arbeitet als beim Herrn Ritter auf der Burg.
In diesem Sommer des Jahres 1349 starrten alle wie gelähmt auf die Seuche. Wir hörten die täglichen Schreckensnachrichten aus der Stadt, brachten Gott und seinen Heiligen Opfer, machten Bet- und Bußprozessionen, stellten Kerzen auf, lagen Tage und Nächte auf den Knien vor den Altären und riefen die Jungfrau und die vierzehn Nothelfer an, uns in Schutz zu nehmen vor dem Zorn Gottes und seiner Zuchtrute.
Noch war im Dorf niemand krank geworden; hier leben die Menschen nicht so gedrängt wie in der Stadt.
Nur in unserer Mühle, eine Viertelstunde vom Ort, unten am Fluss, fraß die Pest um sich wie ein grausiges Geschwür. Erst starb der Müller, dann seine jüngste Tochter, dann Kinder, Knechte, Mägde, die alte Mutter der Müllerin. Die älteste Tochter überlebte und kam weinend ins Dorf gelaufen und berichtete dem Schultheißen. Der hat sie nicht im Dorfe behalten, und was aus ihr geworden ist, weiß kein Mensch.
Der Schultheiß war kein Unmensch, sondern hat nur die Befehle des Herrn von Wegschlag ausgeführt. Die Bestimmungen waren hart, diktiert von der Angst vor der Seuche: Niemand in den Dörfern unseres Herrn Ritters durfte einen Fremden aufnehmen, kein Fremder durfte ein Dorf betreten. Bei Strafe des Erhängens.
Der Herr verschanzte sich auf seiner Burg und ließ den Schultheißen nur ein einziges Mal zu sich kommen, nämlich um ihm diese strengen Befehle zu übergeben.
Aber die Krankheit holte bald darauf die Frau des Herrn von Wegschlag und vier seiner sechs Kinder, dazu noch drei Waffenknechte und ein kleines Mädchen, Tochter einer unverheirateten Magd, als dessen Vater Herr von Wegschlag angesehen wurde. Den Herrn selbst und den größeren Teil des Gesindes verschonte die Seuche.
Der Schultheiß, so wurde im Dorf gesagt, habe die Krankheit von der Burg in das Dorf geschleppt, als er die Befehle des Herrn von Wegschlag empfing. Viele sagten aber, es sei umgekehrt gewesen: Der Schultheiß habe die Seuche in die Burg gebracht, weil die Tochter des Müllers zu ihm gekommen war. Aber ich denke, dass nur ich es weiß, wie die Seuche wirklich in das Dorf gelangt ist.
Doch ganz sicher weiß ich es auch nicht.
Jede Nacht fuhren sie die Toten aus der Stadt und warfen sie in tiefe Gruben: Besser eine Grube ausheben, als in der Grube liegen, wurde gesagt. Die Seuche war auf ihrem Höhepunkt.
In der ganzen Gegend streiften berittene Knechte, die jeden Fremden ergriffen, aber auch jeden, der aus der Stadt entwichen war und die Krankheit weiter verbreiten konnte.
Es war ein glühend heißer Tag gewesen. Am Abend stand ich voll Sorgen in unserem Hof am Etter des Dorfes, einem breiten Gestrüpp aus Schlehen und Dornen, das sich wie ein Ring um Dörfer zieht und sie ähnlich vor Feinden und Gesindel schützt wie eine Steinmauer eine Stadt.
Mond. Überall das Lärmen der Grillen.
Und ich denke gerade, dass ich und meine Frau hoffentlich davonkommen und dass ich manches nach der Pest besser einrichten muss. Ich hänge an meiner Frau und ich hänge am Leben.
Da höre ich ein Knacken im Gestrüpp und denke zuerst, ein Marder oder ein entlaufener Hund. Aber das Knacken und Rascheln sind zu plump und zu laut.
Ich bin kräftig und habe keine Angst vor einem Gegner, gegen den man sich mit Fäusten wehren kann. Mit einem Satz springe ich in das Gebüsch und packe einen Kerl – einen feisten, schweren Mann, der in meinen Fäusten hängt wie ein voller Maltersack.
»Lass mir das Leben«, winselt er. »Um Jesu Christi willen, tu mir nichts.«
Ich schweige erschrocken.
»Du wirst es nicht bereuen«, jammert er.
Ich zögere, dann erst packt der Schreck mich tödlich: Seine Kleidung ist städtisch, auch sein glatt rasiertes Gesicht, soweit ich das im Mondschein beurteilen kann, seine weichen, schlaffen Gesichtszüge. Ich fahre zurück: Würde der mich anstecken?
Seine Augen sind starr auf mich gerichtet.
Es ist nicht meine Sache, blind in etwas hineinzugehen. Ich bin es gewohnt, die Dinge zu bedenken. Der Kerl war aus der Stadt in unser Dorf gekommen. Das war kein Zufall. Er war auf meinen Hof geraten. Zufall?
»Was wollt Ihr?«
Er starrte noch immer. Was er wolle? Er wolle Sicherheit vor der Krankheit!
»Es gibt keine Sicherheit«, sagte ich, »nicht vor dieser Seuche. Nirgendwo!«
Ich brauchte nur laut zu rufen und ein paar Dutzend Bauern würden ihn an den nächsten Baum hängen. Ich schaute hoch zu meinem Nussbaum, der seine Äste in die Mondnacht reckte. Es gibt Mutige, aber die meisten würden ihn nicht anrühren. Vielleicht würden sie ihn mit Steinen totwerfen.
Er war meinem Blick gefolgt: »Ich bin Kaufmann«, sagte er, und seine Stimme gewann an Festigkeit, als könne die Tatsache, dass er Kaufmann war, ihm helfen. »Ich heiße Friedrich Haller und ich würde nicht rufen an deiner Stelle«, fuhr er fort, »ich bin nicht zufällig auf deinen Hof gekommen, ich gebe dir Geld, viel Geld!«
»Nicht zufällig?«
»Du bist besonnen. Ich weiß das. Du denkst, bevor du handelst.«
»Woher wollt Ihr das wissen?«
»Ein guter Kaufmann weiß viel, sonst ist er keiner. Du bist ein Bauer, der auf dem Wochenmarkt und auf dem Viehmarkt seinen Vorteil abwägt. Die wenigsten können das. Ich habe dich schon beobachtet, da war noch keine Pest. Man muss den Markt und seine Teilnehmer kennen, auch im Kleinen. Man erzählte sich von dir. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Mich hat das beeindruckt.«
»Wo bleibt mein Vorteil, wenn Ihr mich ansteckt?«
»Vielleicht bist du jetzt schon angesteckt – wozu mich also noch umbringen?« Herr Haller hatte seine Fassung wiedergefunden und sagte es kalt.
»Und was ist mein Vorteil?«
»Geld«, sagte Herr Haller.
»Geld für mein Leben? Und wenn Ihr mich ansteckt?« Und das Leben meiner Frau und des ganzen Dorfes?
»Geld für mein Leben«, sagte er und kickte einen Stein weg.
»Und mein Leben? Und das meiner Familie?«
»Du hast keine«, sagte er. »Ich habe dich sorgfältig herausgesucht und weiß das. Du hast vor drei Jahren geheiratet. Ihr seid kinderlos.«
Ich war beeindruckt. Er wusste wirklich viel. »Das Leben meiner Frau.«
»Erhöht den Preis.«
»Ich liebe meine Frau.«
»Das erhöht den Preis noch weiter, selbstverständlich.« Er sah mich an: »Es ist sinnlos, jetzt noch um Hilfe zu rufen. Vielleicht habe ich dich ja schon angesteckt.«
»Ich kann Euch töten, alleine. Ich bin stärker.«
»Du hast nichts davon. Besser du ergreifst deinen Vorteil.«
»Es gibt keinen Vorteil, wenn Ihr mich angesteckt habt!«
»Wenn du überlebst, bekommst du viel Geld. Das ist deine Chance. Wenn du mich tötest, gehst du leer aus, in jedem Fall. Du solltest mir dankbar sein«, versicherte Herr Haller.
»Dankbar?«
Er hat recht, überlegte ich. Geld konnte man immer brauchen. Ich hatte fast noch nie Geld gehabt. Der Herr Ritter hatte Geld, weil er unsere Abgaben an Getreide und Fleisch verkaufte; der Schultheiß hatte etwas Geld. Wenn ich Gemüse oder Obst auf den Markt brachte, gab es manchmal Geld. Aber meist wurde getauscht: eine Hose beim Schneider gegen ein Fass mit eingestampftem Sauerkraut.
»Und warum kommt Ihr erst jetzt aus der Stadt? Die Pest wütet schon seit Mai.«
»Da hätte ich dich noch nicht bezahlen können. Mach nie ein Geschäft, das du nicht bezahlen kannst.«
»Und jetzt kannst du?«
»Erbschaften«, sagte er trocken.
»Erbschaften?«
»Erbschaften, Verwandtschaft«, sagte Herr Haller.
»Die Pest?«
Er nickte. »Reiche Leute. Das Geld und den Besitz lassen sie den Erben.«
»Das seid Ihr?«
»Der Vater ist gestorben, drei Brüder, zwei Onkel, ein Vetter, eine Schwester und eine Tante. Wer übrig bleibt, gewinnt!«
»Und Ihr seid allein übrig?«
»Ein kleiner Bruder und zwei kleine Schwestern. Sie wollen essen. Für sie vermehre ich unser Vermögen.«
Nicht für sie, dachte ich. Aber was geht es mich an? Wer übrig bleibt, gewinnt! Aber wer würde übrig bleiben?
»Und das Risiko?«
»Muss abschätzbar sein.«
»Das ist es nicht!«, sagte ich. »Nicht für mich und meine Frau.« Aber es war zu spät. Ich hätte ihn an den Galgen bringen müssen, bevor ich auch nur ein Wörtlein mit ihm geredet hatte.
»Daher das viele Geld, das ich dir gebe. Es ist der Ausgleich.«
Mir schwindelte.
Es lag nicht mehr in meiner Macht. Er hatte recht. Brachte ich ihn um – dann starb ich vielleicht doch noch; und wenn nicht, ging ich leer aus. Es starben vielleicht auch meine Frau und das ganze Dorf! Aber wenn ich mir sein Leben abkaufen ließ und überlebte, dann war ich auf jeden Fall reich! Wer übrig bleibt, gewinnt! Ich musste aber sorgfältig verhandeln: Sein Leben war kostbar, mein Leben war kostbar, das Leben meiner Frau war kostbar, das Leben des Dorfes war kostbar. Er musste alles auf Heller und Pfennig bezahlen.
»Es ist nicht nur ein Risiko. Es ist ein Geschäft«, sagte er, »du bist vernünftig. Nur mit Vernünftigen kann man Geschäfte machen.«
So ging ich darauf ein.
»Es ist gut für alle«, sagte er, »für meine Geschwister, für dich und für mich.«
Was sollte ich sagen?
»Bargeld lacht«, sagte er.
Wir versteckten den Kaufmann Friedrich Haller in der Scheune hinter dem Stroh, wohin nie jemand kam und wo auch niemand suchte. Meine Frau hatte Angst. Ich sah es ihr an.
Aber dann sah sie das Geld. Herr Haller hatte es außerhalb des Etters versteckt und holte es.
Meine Frau brachte Friedrich Haller Essen und Trinken. Und wir beteten zu dritt, dass Gott der Herr die Pest von der Erde vertilgen möge.
Ich hatte noch nie so viel Geld gesehen. Aber es war mir auf einmal bei Weitem nicht genug.
»Noch einmal. Was ist Euch Euer Leben wert?«, fragte ich ihn, der gekrümmt und schmutzig hinter dem Stroh kauerte. »Sicher mehr, als Ihr mir gegeben habt.«
Er sah mich an: »Ich kann dir nicht alles geben, was ich habe«, sagte er, »ich brauche auch etwas für mich.«
Die Antwort war lächerlich. Das wusste er selbst. »Reden wir von dem Geld, das Ihr nicht dabeihabt – Eure Häuser, Eure Gärten und Weinberge, Eure Gold- und Silberpokale, die großen Erbschaften«, sagte ich lächelnd. Er hatte sich in meine Hand gegeben, eine Hand, die zitterte vor Angst, das sollte er merken.
»Das meiste bekomme ich erst, wenn das Sterben vorüber ist.«
»Wer bleibt, gewinnt«, sagte ich und ging.
Er hatte mich ausgesucht. Gut so. Er brauchte einen guten Mann, einen, mit dem man Geschäfte machen konnte, wenn der auch Angst hatte, einen vernünftigen Mann. Er hatte ihn gefunden.
Vier Tage später fühlte sich meine Frau matt. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Sie war bleich, ihr Kopf schmerzte. In ihrer Achselhöhle stand eine große schwarze Beule und bald zeigten sich zwei noch größere in der Lende. Sie fror und stöhnte vor Schmerzen.
Sie starb nach vier Tagen, in denen ich sie pflegte, wie ein Mann seine Frau pflegen soll. Es fehlte ihr an nichts, ich brachte ihr Trinken. Essen wollte sie nichts mehr, ich kühlte ihre Beulen, ich legte ihr feuchte Tücher auf die Stirne, ich hielt ihre Hand, bis sie es nicht mehr fühlte. Ich lief nicht davon, wie es die meisten Ehemänner getan hätten. Meine Frau selbst versuchte, mich dazu zu überreden. Ich blieb und betete laut mit ihr.
Das Risiko war groß. Aber ich wurde nicht krank. Auch der Kaufmann hinter meinem Strohbarn wurde nicht krank.
Ob sie sich bei ihm angesteckt hat, als sie ihm Essen brachte, weiß ich nicht. Die Pest fliegt durch die Luft. Sie kriecht aus der Erde. Sie senkt sich von den Gestirnen herab. Gott straft. Niemand weiß es.
»Was bezahlt Ihr für das Leben meiner Frau?«, fragte ich den Kaufmann.
Fortgehen konnte er nicht: In der Stadt würde er immer noch angesteckt, die Bauern würden ihn immer noch aufhängen.
»Handel ist das Recht dessen, der einen Mangel ausgleichen kann«, hatte er einmal gesagt. Ich hatte es mir gemerkt.
Meine Frau hatte in den vier Tagen, bevor die Krankheit sie erfasste, mit den Nachbarn zu tun gehabt. Es starben im Dorf dreiundzwanzig Menschen, sechs Frauen, vier Männer, dreizehn Kinder.
Es wurde Herbst. Nebel kam auf und bedeckte das Land. Es gab wenig zu tun auf dem Hof. Herr Haller erhielt etwas von seinem Geld zurück, weil er mir Rechnen, Lesen und Schreiben beibrachte. Buchstaben, Zahlen bis zehn, bis hundert, bis tausend, bis zehntausend. Zusammenzählen, Abziehen, Malnehmen, Teilen.
»Du lernst schnell«, sagte er, »du wärst ein guter Kaufmann.«
»Deshalb habt Ihr mich doch ausgesucht.«
Wir saßen hinter dem Stroh. Er redete. Ich hörte zu: über die Führung der Bücher. Über Einkauf im Ausland. Er rechnete mir vor, und ich rechnete es nach, ich rechnete Tage und Nächte: Wie viel kosten Fuhrwerke? Die Wagen, die Fuhrleute, die Knechte, die Pferde, das Geleit von Bewaffneten, der Vorspann bei Steigungen? Was muss ich an Bestechungsgeldern aufbringen, damit ich in den Städten nicht alle Waren auslegen muss?
Ich lernte, Risiken abzuschätzen, wir kalkulierten die Gewinne. Ich lernte, dass Geld arbeiten kann, dass es sich durch diese Arbeit vermehren kann. Ich erfuhr, wie in den oberitalienischen Städten Banken entstanden waren, die halfen, Geld arbeiten zu lassen. Freilich brauchte man dazu Geld. Wer hat, dem wird gegeben werden. Steht schon in der Bibel.
Er redete ohne Unterlass. Schlechtes Gewissen braucht Luft. Vielleicht war es bei mir dasselbe. Ich weiß es nicht, aber ich schrieb, las und rechnete, wann immer es mir möglich war.
So verging die Zeit. Die Gruben vor der Stadt wuchsen weiter.
Die ersten Fröste. Die Pest erlischt nicht, wie ein Feuer ausgeht oder wie eine Kerzenflamme. Sie stirbt langsam: immer weniger Tote. Dann kommt die Nacht, in der die Karren nicht aus der Stadt fahren. In der nächsten Nacht sind es vier Tote, dann zwei, dann viele Nächte keiner mehr, dann doch noch einer, dann eine ganze Woche keiner – die Pest ist erloschen. Die Stadttore gehen auf. Die Menschen liegen sich in den Armen und zittern dennoch vor dem nächsten Tag.
Jetzt begann mein neues Leben.
Mein Kaufmann war zurückgekehrt in die Stadt.
Was sollte ich mit meinem vielen Geld machen? Saatgut kaufen, damit der Feldbau wieder richtig in Ertrag genommen werden konnte? Ich hatte in der Zwischenzeit rechnen gelernt. Das bisschen, das ich selbst brauchte, war leicht anzubauen. Getreide verkaufen?
An wen? Die meisten der hungrigen Mäuler in der Stadt waren tot. Meine Nachbarn kamen im Herbst und Winter nach dem Dreschen mit ihren Getreidefuhren aus der Stadt zurück – nur wenig hatten sie verkaufen können. Die meisten saßen auf ihren vollen Säcken und konnten das Korn nicht einmal mahlen lassen. Das Geld fehlte, und der neue Müller, den der Ritter auf die Mühle gesetzt hatte, nahm kein Mehl zur Bezahlung.
Herr Ruger von Wegschlag fluchte, denn die Abgaben seiner Bauern füllten ihm die Burgscheunen, nicht aber die Geldkatze.
Es war eine gute Ernte gewesen. Die vollen Scheunen wurden zur Last. Viele verfütterten die ausgedroschenen Körner an Kühe, Kälber und Schweine! Immerhin ließ sich das Fleisch in der Stadt noch zu einem annehmbaren Preis verkaufen.
Ich zählte mein Geld, einmal, zweimal, vielmals. Ich würde gut davon leben können, sehr gut. Aber würde ich es auch behalten?
Nein, wenn es der Ritter erfuhr, war es weg! Der Ritter gierte nach Geld wie ein Ertrinkender nach Luft. Denn er hatte schon vor der Pest um seine Burg eine neue Mauer errichten wollen; wir Bauern hatten in Frondiensten die Gruben für die Fundamente ausheben müssen. Aber um weiterzubauen, brauchte er Geld. Die Abgaben der Bauern lagen in seinen Scheunen wie Dreck.
Ich ging in die Stadt.
»Wollt Ihr von Eurem Geld etwas zurückhaben?«, fragte ich meinen Kaufmann.
Er sah mich an.
»Verkauft mir eines der Häuser, die Ihr geerbt habt, samt dem Hofgrund.«
Sehr viele Häuser standen leer. Ganze Gassen waren öde, zwischen dem Pflaster wucherte Unkraut; die Türen waren verrammelt, die Fenster mit Brettern verschlagen. Niemand kaufte Häuser. Häuser waren billig. So bezahlte ich nur wenig und behielt mein Geld. Ich lebte in der Stadt. Das Leben in der Stadt ist teuer. Aber ich hatte ein Haus und ich hatte Geld.
Ich dachte an meine verstorbene Frau und an den Preis, den sie hatte bezahlen müssen. Mein Geld war viel wert.
Aber da war mein Ritter.
Ihm gehörte meine Arbeitskraft.
Ich lebte in der Stadt. Meine Felder lagen brach: Weshalb sollte ich Mäusefutter anbauen? Mein Vieh hatte ich verkauft, einzeln – niemandem war es aufgefallen, dann war ich verschwunden. Keinen roten Heller vom Erlös hatte ich Herrn von Wegschlag entrichtet.
Aber er forderte mich zurück, mich und meine Arbeitskraft, und seinen Anteil an meinem Erlös.
»Ihr müsst mich verstecken!«, sagte ich zu Herrn Haller. »Ein Jahr lang muss man in der Stadt wohnen, am besten im eigenen Haus, auf eigenem Hofplatz. Dann hat der Grundherr nichts mehr zu bestimmen: Stadtluft macht frei! Jeder weiß das.«
»Mag sein. Es geht mich nichts an«, war seine kühle Antwort. »Ich habe für mein Leben bezahlt. Warum sollte ich wegen deines Herrn etwas riskieren? Man bezahlt einen Preis nur einmal. Was du verlangst, ist Betrug.«
Ich war allein.
Gefährlich waren die Nächte. Herr von Wegschlag war verantwortlich für die Verteidigung der Stadt: In der Nacht schützten die Stadtmauern, die Gräben und das geschlossene Tor; seine Knechte beschützten nur den, der beschützt werden soll.
Und das war nicht ich.
Zweimal schickte Herr Ritter von Wegschlag Boten zu mir: »Komm zurück.«
Das dritte Mal blieben die Boten stumm: Als ich an einem Morgen in mein Haus zurückkehrte, war die Haustüre eingeschlagen, das Bett zerfetzt, die Möbel waren zertrümmert.
Ich war in einer Herberge gewesen. In einer Herberge wird beschützt, wer bezahlt.
Sie lauerten mir auf, Tag und Nacht: Der Herr Ritter wusste, dass ich Geld hatte.
Ich hatte Herrn Haller damals nicht um Gottes willen bei mir aufgenommen, sondern für Geld. Jetzt ging ich wieder zu ihm: »Ich bezahle.«
Wir verhandelten: Mein Preis war geringer, als seiner gewesen war. Denn ich konnte ihn nicht anstecken. Eine Frau hatte er nicht.
Er war ein ehrlicher Geschäftsmann – aber ein Geschäftsmann! Er ließ keinen Gewinn aus: Leben um Geld – Freiheit um Geld. Die Summe war ungeheuer. Doch es blieb mir etwas Geld übrig.
Meine Träume waren zerronnen: Keine Pferde und keine Wagen konnte ich mehr kaufen und schon gar kein Schiff für mich auf Reisen schicken oder einen Teil der Ladung übernehmen. Es gab keinen Handel mehr für mich.
Er versteckte mich sieben Monate lang in seinem Hinterhaus. Dann war ich frei. Freier Bürger mit allen Rechten.
Wenn du in eine Stadt ziehst, musst du ein Handwerk können oder Äcker besitzen oder hart als Tagelöhner arbeiten, sonst verhungerst du. Ich konnte kein Handwerk, meine Äcker waren längst aufgegessen – ein Fehler, ich hätte sie nicht verkaufen müssen. Als Tagelöhner wollte ich nicht arbeiten. Da hätte ich Bauer bleiben können.
Der Rest meines Geldes? Ich konnte mir ausrechnen, wann ich das letzte Stück Brot essen würde.
Ich hatte die Kosten meiner Freiheit zu gering veranschlagt. Ein Rechenfehler! Eine Fehlkalkulation. Wie hatte Herr Haller zu mir gesagt: »Wer sich verkalkuliert, ist erledigt.«
Ich sah mich als Bettler in den Straßen der Stadt herumlungern, in Lumpen gehüllt, dreckig, verwahrlost. Und ich hatte mich schon als Kaufmann gesehen – Kontore, Diener. Ich selbst in kostbare Pelze gehüllt auf edlem Ross. Auf einem Ross, wie es Herr von Wegschlag niemals in seinen Stall würde stellen können.
Man darf Ziele haben als Kaufmann, aber keine Träume!
Dennoch, ich hatte noch Geld. Und die wichtigste Eigenschaft des Geldes ist, dass man es vermehren kann. Aber wie?
Ich war abgemagert zum Skelett. Denn ich gönnte mir nichts. Am liebsten hätte ich gebettelt. Aber man kannte mich. Niemand hätte mir auch nur einen Bissen gegeben. Ich aß nur so viel, wie man braucht, damit man nicht verhungert. Zwar: Für einen Bettler hatte ich immer noch viel Geld. Aber ich hütete es wie meinen Augapfel – es sollte für mich arbeiten.
Ich trank von den öffentlichen Brunnen, wo es nichts kostet und die angeblich von den Juden vergiftet worden waren. Sie sollten die Pest ausgelöst haben. Ich hatte das nie geglaubt. Sie haben die Juden bei lebendigem Leib verbrannt und ein halbes Jahr später sind die Henker dennoch an der Pest gestorben.
Einmal begegnete mir Herr Haller. Sein Blick glitt über meine Kleidung und blieb in meinem Gesicht hängen. Er verzog den Mund und ging weiter. Er war mir nichts mehr schuldig.
Aber ich ihm auch nicht. Ich war niemandem etwas schuldig. Mein letztes Geld gehörte nur mir allein.
Ich hatte viel Zeit. Ich ging durch die Straßen und sah den Handwerkern bei ihrer Arbeit zu. Ich ging auf die Marktplätze und rechnete aus, welche Stückzahlen der verschiedenen Waren ich mir für mein Geld würde kaufen können. Es war nichts als eine Rechenübung. Was hätte ich mit Kannen aus Zinn machen sollen, die ich nicht füllen konnte? Oder was mit Seilen? Höchstens mich aufhängen. Aber dazu hatte ich noch zu viel Hoffnung.
Wie unbegründet meine Hoffnung war, sagte mir jeden Tag mein Magen.
Dennoch war es eine gute Übung. Einem Schreiner sah ich zu, wie er Webstühle machte. Was kostet ein solches Gerät? Ich wollte es eigentlich gar nicht wirklich wissen. Mein Geld, so rechnete ich mehr aus Gewohnheit aus, hätte für mehr als zwanzig Webstühle gereicht. Aber was sollte ich mit zwanzig Webstühlen? Ich hatte nicht einmal Verwendung für einen: Ich war kein Weber.
Ich sah den Webern zu. Ich sah, dass sie sehr kunstvoll weben konnten. Aber auch sehr einfach. Das einfache Weben war nicht schwer.
Eines Tages sagte ich zu einem Schreinermeister: »Mach mir dreiundzwanzig Webstühle.« Für dreiundzwanzig Webstühle reichte mein Geld.
In meinem Haus war Platz für nicht mehr als zwei Webstühle.
Ich musste die Webstühle bezahlen, bevor der Meister seine Säge und seinen Hobel anfasste: Er kannte mich als Hungerleider. Und er war nicht der Mann, der sich verkalkulieren würde.
»Willst du einen Handel mit Webstühlen aufmachen? Völlig sinnlos«, versicherte er mir. »Alle Weber in der Stadt haben schon einen Webstuhl. Und jeder Schreiner kann Webstühle bauen. Es ist sehr einfach. Du kannst also die Webstühle nirgendwo verkaufen.«
»Ich verkaufe keinen. Ich verschenke alle dreiundzwanzig.«
Er sah mich an, als hätte ich zwei Köpfe auf drei Hälsen. Und ich sah ihm an, dass er mir keinen einzigen Webstuhl gemacht hätte, wenn sie nicht schon bezahlt gewesen wären. Er tippte sich an die Stirn: »Es muss auch Dumme geben. Helf dir Gott – die Dummheit des einen ist der Reichtum des anderen!« Er klimperte mit meinem Geld in seiner Geldkatze.
Es sprach sich herum. Auf der Straße liefen mir die Kinder nach.
Es dauerte einige Wochen, bis die Webstühle fertig waren. Es waren hungrige Wochen für mich. Aber ich habe sie überlebt.
Ich kaufte auch dreiundzwanzig Spulen gesponnenes Leinengarn, wie es die Weber benützen. Ich hatte die Kosten eingeplant.
An einem Abend kam der Zunftmeister der Leineweber zu mir: »Du gehörst nicht zur Zunft. Du darfst nicht weben. Du darfst dir auch keine Leinenspulen kaufen: Die Zunft teilt sie zu, damit niemand zu viel webt und die Preise versaut. Nur die Zunft bestimmt die Preise. Auch bist du kein Meister. Du darfst nicht einmal ein Sacktuch weben.«
»Ich webe gar nichts«, sagte ich, »du kannst ganz beruhigt sein.«
»Wozu dann die Webstühle?«, fragte er. »Und die Knäuel?«
»Ich verschenke sie«, sagte ich.
Es waren arbeitsame Wochen für mich. Ich ging in die Dörfer, zuerst in unser Dorf. Ich redete mit den Leuten. Die Bauern jammerten; ihnen ging es immer noch schlecht. Zwar hatten viele auf Viehzucht umgestellt und verkauften das Fleisch, aber Großvieh braucht lange, bis es schlachtreif ist. Und es will fressen. Und dann konnte es nicht einmal leicht verkauft werden.
»Aber wir müssen leben«, sagten sie, »unsere Kinder wollen essen, und die alten Kleider kann man nicht ewig ausbessern. Uns schenkt niemand etwas.«
»Doch ich«, sagte ich, »ich schenke jedem, der will, einen Webstuhl.«
Auf diese Weise verschenkte ich alle dreiundzwanzig Webstühle.
Und jeder, der mir einen Webstuhl abnahm, bekam eine der dreiundzwanzig Leinenspulen dazu.
»Was soll ich mit einem Webstuhl?«, fragten die Bauern.
»Weben«, sagte ich.
»Und wie?«, fragten sie.
Ich zeigte es ihnen. Manche begriffen schnell, manche begriffen langsam. Aber alle lernten es. Es ist nicht schwer, einfache Leinwand zu weben.
Man kann wahre Meisterwerke weben. Aber die Bauern sollten keine Meisterwerke weben.
»Und was sollen wir mit der Leinwand? Wem sollen wir sie verkaufen?«
»Mir«, sagte ich, »es ist der Mietlohn für eure Webstühle, und ihr bekommt noch etwas heraus.«
»Du hast sie uns doch geschenkt«, sagten sie.
»Ihr müsst sie ja auch nicht mehr zurückgeben.«
Die meisten Bauern begriffen rasch: Geld! Sie hatten die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mehr Geld, als sie jemals verdient hatten. Überhaupt Geld zu verdienen. Die Arbeit war zu Hause – Frauen und Kinder konnten mitarbeiten.
Sie begriffen, dass die Webstühle besser waren als Äcker, deren Ernte sie nicht mehr loswurden. Arbeit gegen Geld!
Und der Ritter?
Der konnte froh sein, dass seine Bauern ein gutes Auskommen hatten. Ja, er konnte das, was sie seither als Abgaben von Getreide entrichtet hatten, als Geld einstreichen, nachdem das Getreide des letzten Jahres sinnlos in seinen Scheunen verrottete.
Herr von Wegschlag war zufrieden.
Die Zunft der Weber in der Stadt?
Die Bauern wohnten nicht in der Stadt: Die Zunft war nicht zuständig. Der Ritter, der auch Richter war, sprach ein klares Urteil. Er strich weiterhin sein Geld ein und die Weberzunft zog ab.
Und ich?
Meine Kalkulation war richtig gewesen. Ich kalkulierte nie mehr falsch. Ich kaufte von dem, was mir der Handel mit den Leinwandballen der Bauern einbrachte, neue Webstühle und neues Garn – immer mehr Webstühle und immer mehr Garn. Und mein Handel weitete sich aus.
Die Bauern der ganzen Gegend bauten jetzt überall Flachs an, mehr als Getreide. Den Flachs kaufte ich auf und ließ ihn von den Bauern brechen, hecheln, spinnen und weben. Es sah schön aus, wenn der Flachs im Juni seine blauen Blüten entfaltete. Das ganze Land war blau. Blaues Land nannte man es jetzt.
Natürlich machten es mir viele nach. Die Konkurrenz schläft nicht – sie schläft nie!
Herr Haller wurde mein Partner, und ich wurde seiner und war nun doch zu einem Fernhandelskaufmann geworden, der in der Welt neue Märkte für Leinwand erschließen konnte.
Ich baute mir ein Haus aus Stein, und ihr könnt sehen, wie ich jetzt lebe: geschnitzte Holzdecken und geschnitzte Möbel, Goldpokale, Silberbecher, silberne Kerzenleuchter, Pelze, Gobelins, Teppiche aus dem Morgenland. Und ich habe Angestellte, Schreiber, Mägde und Knechte. Man braucht das alles, damit man Kredit bekommt.
Freilich, wie hätte das neue Leben erst meiner Frau gefallen!
LABYRINTH
Wie eine furchtbare Last lag im 14. und 15. Jahrhundert die Erinnerung an die Große Pest auf den Menschen. Das Vertrauen in das Leben war durch die Erfahrung des ringsum erlittenen Todes zerstört worden. Die Menschen suchten mit oft fanatischer Frömmigkeit vor allem in der Kirche nach Trost und Hoffnung und wurden immer wieder enttäuscht, weil sich viele Diener der Kirche kaum mehr um ihre seelsorgerischen Aufgaben kümmerten und stattdessen ein bequemes Leben oder Macht suchten – häufig sogar ihre Ämter schlecht oder gar nicht ausgebildeten »Mietlingen« überließen.
Wir finden in fast allen mittelalterlichen Chroniken über die Zeit um 1400 Berichte einer seltsamen Krankheit, welche vor allem am Niederrhein, aber auch im Elsass und anderen Regionen die Menschen fast seuchenartig erfasste und sie in Massen zu eigenartig zuckenden Tanzbewegungen zu zwingen schien. Unsere Beschreibung der Krankheit folgt einer der zeitgenössischen Darstellungen in der Königsfelder Chronik aus Straßburg.
Die Krankheit erhielt den Namen Veitstanz, weil man glaubte, die Fürsprache des Heiligen Veit könne die Kranken heilen. Eine Krankheit mit denselben Symptomen existiert auch heute noch unter dem Namen Chorea Huntington. Die Ursachen sind genetisch angelegt, und die Krankheit, die immer tödlich verläuft, ist zum Glück sehr selten.
Die Chorea Huntington tritt immer als Einzelerkrankung auf. Der Veitstanz aber war eine Massenerscheinung. Die Massenerkrankungen müssen indes von Einzelerkrankungen ausgelöst worden sein. Man vermutet zwar als Ursache für den Veitstanz oft auch Getreidepilze, die ähnliche Symptome bewirken konnten.
Allerdings hätten Einzelerkrankungen allein nicht den Massenwahn der Menschen auslösen können, die gruppenweise wie enthemmt tanzend das Land durchzogen. Deshalb erklärt man heute dieses ungewöhnliche Verhalten als Massenpsychose. Die wirklichen Ursachen dieses Massenwahns, so vermutet man heute, waren übergroße Lebensangst, betrogene Erwartungen, Enttäuschungen, Irrwege des Lebens, wie sie für die damalige Zeit typisch waren; der Tanz als eine Flucht aus dem Lebenslabyrinth der Wirklichkeit – heute vielleicht vergleichbar mit dem Ausbrechen aus der Lebenswirklichkeit durch Drogen.
Wir sehen viele Menschen der damaligen Zeit daher mit ihren Ängsten wie Gefangene, die keinen Ausgang aus ihrer seelischen Not finden können. Wir sehen sie durch Irrwege tappen wie in einem Labyrinth. Und Darstellungen von Labyrinthen finden sich tatsächlich vermehrt in jener Zeit, vor allem in Kirchen. Vielleicht sollten diese, in Stein geritzt, die uralten Irrtümer menschlichen Daseins zeigen. Sie könnten ebenso auf die unerklärbaren Fügungen Gottes hinweisen. In dieser Zeit aber sind sie sicher auch ein Symbol für die Hilflosigkeit vieler Menschen und ihr verworrenes Leben.
Die Beschäftigung mit dem so oft überlieferten Phänomen des Veitstanzes führt uns abseits der historischen Ereignisse tief hinein in den seelischen Zustand der Menschen der beginnenden Neuzeit.
Überliefert ist ein kleines Gedicht aus dem Jahre 1418:
Viel hundert fingen zu Straßburg anZu tanzen und springen, Frau und Mann,Auf offnem Markt, Gassen und Straßen,Tag und Nacht, ihrer nicht viel aßen,Bis ihnen das Wüten wieder gelag (gestoppt wurde),St. Veits Tanz ward genannt die Plag.
Damals nun lebte, so denken wir es uns, ein junger Mann, den die Natur zu einem Mathematikgenie gemacht hatte. Der aber aus religiösen Gründen und wegen seines einfachen Herkommens niemals auch nur die geringste Chance erhielt, seine einmalige Begabung zu seinem Lebensweg zu machen. Eines Tages durchzogen wilde Tänzer das Dorf, in dem er wohnte.
Im Chor der Klosterkirche des Heiligen Egidius zu L. am Niederrhein findet sich, eingeritzt in eine breite, blank getretene Steinplatte, eine seltsame Figur. Vor undenklichen Zeiten eingemeißelt, erinnert das Gebilde im Stein an eine aufgebrochene Frucht, einen Apfel vielleicht – denn die Hälften neigen sich einander zu wie die Hälften eines Kernhauses. Andererseits wird die Figur gefügt aus einem geordneten Muster paralleler Linien, wie man es in Äpfeln so nicht finden kann.
Fährt nun der fromme Beter mit dem Finger oder seinem Blick eine dieser Rillen entlang, so lenkt sie ihn unweigerlich in das Innere des Liniengefüges. Immer wieder wird er dabei auf Wege zurückgeführt, die er schon entlanggeglitten ist. Soviel er auch diese seltsamen Pfaden entlangstreicht, er endet meist in blinden Gängen und findet kaum mehr aus ihnen hinaus – und wenn, dann meist durch Glück, das manche auch Zufall nennen.
Solche Gebilde haben vor sehr langer Zeit die Griechen erfunden und sie Labyrinth genannt.
In vielen sehr alten Kirchen sind solche Labyrinthe zu finden. Der Fromme, der in diese Kirchen kommt, um Wege zu suchen – den Weg zu Gott, den Weg zu sich selbst oder den Weg durch die Welt -, er wird in die Ausweglosigkeit geführt, wenn er sich auf diese steinalten Figuren einlässt. Und es lässt sich schwer sagen, weshalb man solche verwirrenden Gebilde gerade in Kirchen antrifft.
Die Sonne stach an diesem heißen Julimorgen des Jahres 1407, Wolken stiegen auf. Gewitter hingen am Himmel, leise Donner rollten. Da wurde zwischen dem fernen Grollen ein anschwellender Lärm hörbar, Trommeln, Klopfen, Schlagen, Singen. Frauen- und Männerstimmen sangen, schrien, kreischten, brüllten. Manchmal klang es wie Wut und Zorn, dann wieder wie Begeisterung und Verzweiflung.
Ein ungewöhnlicher Zug kam das Rheinufer entlang.
Er kam getanzt, gehüpft, gesprungen, gewirbelt, gedreht. Die Männer, Frauen und Halbwüchsigen, ja sogar Kinder in dem lärmenden Haufen trugen buntscheckige Kleider wie Narren, Männer- und Frauenkleider durcheinander. Manche waren halb nackt, manche hatten sich Tischtücher um die Hüften gebunden. Man sah Frauen wie Männer mit bloßem Oberkörper, Frauen mit Hosen und Männer mit Röcken. Gesichter und Körperteile waren mit Dreck und Schlamm und grellbunten Farben beschmiert. Viele hatten sich Zweige und Blumen um den Kopf gewunden.
Beim Näherkommen sah man ihre Münder aufgerissen, Speichel rann heraus. Die Augen waren stier auf irgendwelche Punkte am Himmel gerichtet.
Die Menschen schienen zu keiner langsamen Bewegung fähig. Sie sprangen und zuckten; ihre Glieder zappelten, ihre Beine stampften, die Arme fuchtelten, die Hände wedelten, der Kopf nickte ständig oder fuhr hin und her, als wolle er zu allem Nein sagen. Die Körper schüttelte es, als hielte sie ein unsichtbarer Riese. Manche wanden sich, als litten sie furchtbare Qualen; dabei kam ein kreischendes Lachen aus ihrem Mund. Manche zitterten, als herrschte strenger Frost oder als hätte sie große Furcht befallen. Manche warf es hin und her, als bebte die Erde. Viele torkelten und schwankten wie betrunken.
Sie kamen nur sehr langsam vorwärts. Einige drehten sich um sich selbst, andere kreisten paarweise umeinander. Manche hielten sich zu zweit, zu dritt oder zu viert an den Händen und hopsten im Kreise. Man sah Ketten von Menschen, die einander an den Schultern hielten. Meist machten die Tänzer mit ein paar Schritten das rückgängig, was sie vorwärtsgegangen waren. Einzelne fielen mitten im Tanz zuckend zu Boden.
Eine Musik, nach der man hätte tanzen können, gab es nicht. Auf das Kreischen, Trommeln und Toben konnte man eigentlich nicht tanzen. Ein Takt, nach dem sich die Tänzer hätten richten können, war nicht zu hören – eine Musik von Teufeln, ein Höllentanz.
Die Fischer und Bauern, Fährleute und Tagelöhner der Dörfer am Rhein hatten von den Tänzern gehört. Schon vor einem Menschenleben, wussten manche, hatte es solche Tänze gegeben. In der Zwischenzeit war es still geworden um dieses Tanzen, aber es war nie ganz erloschen. In den letzten Wochen hatten sich die Nachrichten darüber verdichtet.
Die Menschen hatten den Lärm näher kommen hören. Sie verließen die Arbeit und standen vor ihren Häusern. Eine ängstliche Spannung lag über ihnen. Misstrauisch beobachteten sich Nachbarn. Misstrauisch betrachteten die Leute sich selbst.
Die Wartenden erblickten fassungslos die schreiende, lachende und heulende Tanzprozession. Sie sahen in Gesichter, die sie kannten und die zu frommen, arbeitsamen und ehrbaren Menschen aus Nachbardörfern gehörten. Nur ausnahmsweise gab einer der Tänzer einen Gruß zurück, meist tobten die Männer und Frauen blicklos und grußlos vorüber.
Jetzt erfasste der Tanz auch einzelne Zuschauer. Ihre Gesichter veränderten sich. Ein Zucken lief darüber, die Augen wurden starr, die Glieder begannen zu schlenkern und zu zittern. Bis auf diesen Tag gesetzte Menschen wanden sich und zuckten. Dann stimmten sie in das Kreischen der Vorüberziehenden ein, rissen sich Kleidungsstücke vom Leib, lösten sich vom Rand der Straße und hielten sich torkelnd und drehend an den Händen. Sie brachen aus Gärten und Äckern Blumen, Zweige, Blätter und Ähren, beschmierten sich mit Dreck und waren nach kurzer Zeit vom Strudel der Tobenden verschlungen.
Oft wurde einer, der zu zucken und zu schreien begann, von Freunden, Nachbarn oder Verwandten zurückgehalten. Aber die Seuche schien den Befallenen riesige Kräfte zu verleihen, Kräfte, denen Liebe oder Fürsorge der Gesunden nicht gewachsen waren. Die Tobsüchtigen rissen sich los, wie von einem Strudel erfasst, und rannten in den wimmelnden Haufen, als stürzten sie in einen Wildbach.
Dann wälzte sich der gespenstische Zug weiter zum nächsten Dorf, in dem das Gleiche geschah. So schwoll die Tanzsekte, wie die Tänzer auch genannt wurden, wie ein Strom nach einem Gewitter und breitete sich aus wie Feuer in einer dürren Wiese.
Wen das Toben nicht ergriff, stand wie gelähmt vor der Tatsache, dass Nachbarn, Freunde, Kinder, Ehefrau und Ehemann Haus, Hof und Heimat verließen und wie besinnungslose Narren in immer größer werdenden Haufen durch die Gegend taumelten.
Arme waren sehr viel mehr betroffen als Reiche. Aber man sah auch Reiche, die in plötzliche Zuckungen verfielen.
Einer der grausigen Tänzer war ein Mann mit dem Namen Adrian, fast noch ein Junge, der durch seine Länge und seine spindeldürre Körperbeschaffenheit auffiel. Er war einer der Ersten, die in seinem Dorf von der Seuche erfasst wurden.
Die Verwandlung Adrians in einen Narren und Tänzer hatte niemanden gekümmert. Er war allein. Seine Mutter war im Winter gestorben. Wer sein Vater war, wusste niemand. Als unehelich Geborener hatte er kein Handwerk erlernen dürfen, es hätte auch niemand für das Lehrgeld aufkommen können. Er hatte auch sonst nicht viel gelernt, was man in einem Dorf brauchen konnte – hier einen Handgriff beim Dreschen oder beim Stellen einer Reuse, dort beim Mistaufladen oder beim Tragen von Säcken. Er hatte dafür Brot bekommen oder ein Stück Wurst.
An Gleichaltrige hatte er sich nicht angeschlossen. Sie mochten ihn nicht. Und er selbst blieb lieber allein in seiner Kammer und spielte mit Steinchen.
Als er älter wurde, spielte er immer noch mit Steinchen.
Seiner Mutter hatte er in dem Gärtchen geholfen, das ein Kaufmann sie bebauen ließ, weil sie in seiner Familie ein paar Mal als Amme eingesprungen war. Aber nun war seine Mutter seit ein paar Monaten tot, und er hatte niemanden mehr, der ihn fragte, ob er Hunger hatte oder Durst oder etwas zum Anziehen.
Die Bauern im Dorf merkten, dass Adrian arbeiten konnte und mit einem Stück Brot und einem Becher Wasser zufrieden war.
Einmal ließ ihn ein Bauer im Winter Säcke aus der Scheune auf den Hof tragen. Adrian trug eine Stunde lang, immer zwei Säcke auf einmal. Er musste sie alleine schleppen, der Bauer überwachte das Tragen. Als die Säcke im Hof an einer Wand darauf warteten, in die Mühle gefahren zu werden, stöhnte der Bauer: »Jetzt muss ich sie zählen, du kannst mir glauben, das ist schlimmer als Säcke tragen, viel schlimmer. Jedes Jahr dasselbe.«
Und er begann, die ersten beiden zu zählen, indem er mit dem Zeigefinger darauf deutete und erst einen Finger und dann zwei Finger der anderen Hand ausstreckte, dann seufzend den dritten -
Adrian sagte kurz: »Ich habe viermal acht Säcke getragen und dann noch einmal drei. Das ist doch nicht schwer.«
Der Bauer starrte ihn an: »Viermalachtsäckeunddannnocheinmaldrei -«
Adrian sagte ruhig: »Ich habe bei jedem Gang zwei Säcke getragen. Wenn ich zweimal gegangen war, dann hatte ich also vier Säcke getragen, wenn ich viermal gegangen war, dann waren es acht Säcke.«
Der Bauer bekreuzigte sich.
»Als ich sechsmal gegangen war, hatte ich ein Dutzend Säcke getragen. Das waren aber noch nicht alle Säcke.«
Das Gesicht des Bauern war rot angelaufen.
»Ich habe zwei Dutzend Säcke getragen und dann noch viermal zwei und einmal drei. Was soll’s. Das ist so. Du kannst es nachzählen.«
Der Bauer sah aus, als hätte er zu viel getrunken.
»Du kannst es auch anders sagen«, fuhr Adrian fort, »ich bin sechzehnmal mit zwei Säcken gegangen, das sind also zweiunddreißig Säcke, und dann bin ich noch einmal gegangen und habe dabei drei Säcke auf einmal getragen, weil ich nicht noch ein weiteres Mal gehen wollte. Die waren aber dann doch zu schwer, die drei Säcke zusammen.«
»- die waren aber dann doch zu schwer, die drei Säcke zusammen -«
»Man kann sie auch einzeln zählen«, sagte Adrian und warf Steinchen gegen die Scheunenwand und zählte, »eins, zwei, drei, vier Steine«, sagte er und lachte. »Ist doch nicht schwer, das Zählen.«
Der Bauer hatte tief Luft geholt: »Steine gegen meine Mauer, ich hau dir gleich eine runter. Bis vier, das kann ich auch noch zählen, auch bis zehn und ein Dutzend, was glaubst denn du? Aber die ganze Mauer vollgepflastert mit Säcken, das kann niemand.«
»Es sind fünfunddreißig Säcke.«
Der Bauer glotzte: »Fünfunddreißig Säcke!«, stotterte er. »He, mach dich nur lustig über mich. Das Lachen wird dir vergehen! Dafür sorge ich. Weißt du überhaupt, was das ist, fünfunddreißig?«
»Fünfunddreißig. Das sind fünf mal sieben Säcke. Auch so herum kann man es sagen.«
Die Säcke wurden von den beiden auf den Wagen geladen. Als Adrian dabei laut zu zählen begann, verbot es ihm der Bauer und fuhr sie alleine in die Mühle: »Du bleibst da. Der Müller kann auch zählen, und besser als du.«
Als der Bauer von der Mühle zurückkam, starrte er Adrian an: »Es waren fünfunddreißig Säcke! Wer hat dir das beigebracht?«, fragte er. »Das kann ja nicht einmal der Amtmann so schnell.«
Adrian warf Steinchen um Steinchen gegen das Scheunentor und schwieg.
»He, lass das, das Steinewerfen! Muss man alles hundertmal sagen?«
Er beriet sich mit der Bäuerin: »Der Teufel hat es ihm beigebracht«, sagte er, und die Bäuerin nickte.
»Immerhin, er ist fleißig. Wir können ihn im Stall gebrauchen und auf dem Acker.«
Die Bäuerin sagte nichts.
Dennoch, der Müller erzählte es dem Amtmann.
Adrian war nun Knecht auf dem Hof des Bauern, obwohl die Bäuerin dagegen gewesen war: »Was willst du mit so einem?«
»Einen billigeren kriegst du nicht, und kräftig ist er – Essen und eine Kammer. Was schadet uns das? Er wird sich rechnen.«
Die Bäuerin wollte etwas sagen.
»Schon gut, wenn er wieder anfängt zu zählen und zu rechnen, schmeiß ich ihn vom Hof«, sagte der Bauer.
Der Bauer sah Adrian dann immer wieder von der Seite an. Die Bäuerin hatte einen schmalen Mund.
Das Frühjahr verging, die Äcker in der Sommerzelge wurden gepflügt und geeggt, die Sommersaat wurde ausgebracht, dann kam der Juni, die Heuernte.
Da trat der Amtmann auf den Hof des Bauern: »Ich habe im Winter von deinem Knecht Adrian gehört«, sagte er und kaute auf einem Strohhalm.
»Was soll sein mit dem Adrian?«, sagte der Bauer, »nichts ist mit Adrian.«
»Der Müller hat von dir gehört, dass er zählen kann und rechnen – schneller, als eine Schwalbe fliegt.«
»Der übertreibt, der Müller.«
»Ich möchte mit dem Adrian reden.«
Aber der war mit den Ochsen Heu holen. So sagte der Bauer.
»Schick ihn zu mir.«
Aber der Bauer schickte ihn nicht.
Und als der Amtmann seinen Knecht sandte und nach ihm fragen ließ, bekam er die Antwort: »Der Adrian hat keine Zeit für solche Dummheiten. Der wird gebraucht.«
Adrian war in seiner Kammer gewesen und hatte den Amtmann gesehen und gehört.
In seiner Kammer waren viele Steine. Die Steine hatten alle Farben und Formen, wie man sie im Kies des Rheins findet: grünliche, schwarze, rote, gelbe, graue, bläuliche, durchsichtige, weiße, gestreifte und einfarbige, runde, längliche, kurze, raue, glatte und viele andere. Er hatte sie am Rheinufer gesammelt und in seiner Kammer aufgereiht.
Da gab es Reihen zu drei Steinen und zu zwei, zu vieren und zu fünfen, zu sechsen und zu siebenen, zu achten und zu neunen. Er spielte mit diesen Steinen tagsüber, wann immer er freie Zeit finden konnte, und am Abend, solange er sie sehen konnte. Er brachte sie in immer anderen Gruppen zusammen. Er wechselte die Farben der Gruppen. Er freute sich, dass immer alles so seltsam aufging, und er erfand immer noch weitere Möglichkeiten zu rechnen.
Da es auf einem Bauernhof nicht viel zu rechnen gab – er hatte längst alles gezählt, in Verhältnisse gebracht und wieder und wieder anders zusammengesetzt -, erfand er immer weitere Aufgaben und löste sie, während er auf dem Ochsenkarren saß oder während er alle diese langweiligen Arbeiten machte: Hacken, Graben, Säen, Pflügen, Eggen, Rechen, Ausbreiten, Aufladen, Ausmisten, Holzmachen und alles, was es an Mühseligkeiten auf einem Bauernhof sonst noch gab.
Er wusste, wie viel Malter Weizen ein Morgen Acker gab, und konnte ausrechnen, wie viel aus drei oder vier Morgen zu gewinnen waren: Er wusste, wie viel Rüben in jeder Reihe im Boden steckten, und konnte daraus die Gesamtmenge berechnen. Er wusste, wie viele Eier jedes Huhn gelegt hatte, und rechnete aus, wie viele Eier es zusammen waren. Er wusste, wie viele Melkeimer Milch jede Kuh gegeben hatte, und rechnete aus, wie viele Melkeimer man brauchte, wenn man die Gesamtmenge der Milch an einem Tag erhalten würde. Er erkannte an der Anzahl der Hiebe, wie stumpf oder scharf eine Axt war, wenn sie einen Baum von bestimmter Dicke fällten.
Er konnte noch viel, viel mehr.
Einmal hatte er auf dem Boden einen Kreis gezogen und herausgefunden, dass der Kreis in vier Teile zerlegt werden konnte, die gleich groß waren, und von vier Linien durchschnitten wurde, die sich im selben Winkel kreuzten, den man dem Bau von Häusern und Scheunen zugrunde legte.
Er hatte diese Eigenschaften des Kreises an einer großen Schüssel nachgeprüft und war dabei von der Bäuerin mit Wörtern wie »vom Teufel besessen« und »Dummkopf« aus der Küche gejagt worden.
Der Knecht des Amtmanns hatte eines Tages mit ihm geredet: »Was der Amtmann von dir will? Kann ich mir nicht denken. Aber er will etwas von dir.«
Adrian wartete und wartete -
Einmal wäre es ihm fast gelungen, den Amtmann nach dem Gottesdienst zu sprechen. Aber der Bauer, der seinen billigen Knecht nicht an den Amtmann verlieren wollte, hatte es gesehen und ihn zu sich gerufen und ihm eine Arbeit gegeben. Seither musste er nach der Kirche sofort nach Hause und in den Stall, und der Bauer achtete sorgsam darauf, dass dieser Anweisung nach jedem Gottesdienst strikt Folge geleistet wurde.
Dann endlich stand der Knecht des Amtmanns wieder auf dem Hof des Bauern: »Der Amtmann braucht deinen Knecht Adrian dringend für Arbeiten auf dem Amt.«
Adrian hörte es. Er hörte auch, wie der Bauer sagte: »Ich schick ihn dann. Vorerst brauche ich ihn selbst.«
Adrian wartete, dass ihn der Bauer zum Amtmann schickte. Es geschah nichts. Tag um Tag verging, der Bauer schickte ihn nicht. Und als Adrian den Bauern nach dem Knecht des Amtmanns fragte, bekam er zur Antwort, dass der Knecht nicht von Adrian geredet habe: »Geh an deine Arbeit, sonst werfe ich dich hinaus, dann kannst du zum Amtmann gehen. Du träumst wohl mit offenen Augen!«
In dieser Zeit begann man im Dorf, über die seltsamen Ereignisse zu reden, bei denen anständige Menschen unter Verrenkungen zu besinnungslosen Tänzern wurden. Diese Tanzseuche breitete sich von den Dörfern stromabwärts aus. Und es war grausig, sagten diejenigen, die mit eigenen Augen gesehen hatten, wie Bauern von einem Augenblick auf den anderen begonnen hatten, zu tanzen und zu springen, und alles verloren, was ihnen im Leben Ordnung, Sicherheit, Ehre und Anerkennung der Mitbürger oder der übrigen Dorfbewohner gegeben hatte.
Wie bei den meisten, die urplötzlich befallen wurden, veränderte sich bei Adrian zuerst sein Gesicht. Er sah den Zug sich nähern, er sah die ersten Tänzer in das Dorf einbiegen. Seine Augen waren auf die tanzenden und johlenden Ankömmlinge gerichtet. Sein Gesicht hatte einen Ausdruck zunehmender Spannung.
Dann stürzte er sich in den Haufen. Er riss sich einen Teil seiner Kleider vom Leib, er band sich einen grünen Zweig um den Kopf, er beschmierte Gesicht und Hände mit nasser Erde, er sprang wild wie die anderen, er sang. Die Spannung auf seinem Gesicht war einem fast glücklichen Ausdruck gewichen. Und als er den Bauern am Rande der Dorfstraße stehen sah und bei ihm seine Frau, streckte er den beiden die Zunge heraus.
Wusste er, was mit ihm geschah? Manchmal blickte er aus dem Toben und Schreien hoch, als tauche er vom Grunde eines Meeres auf.

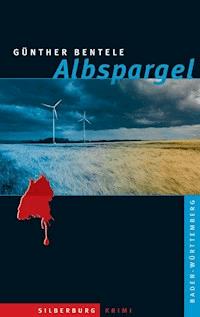


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









