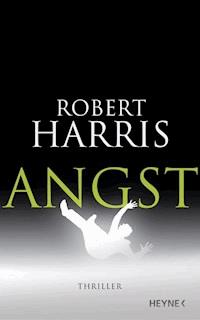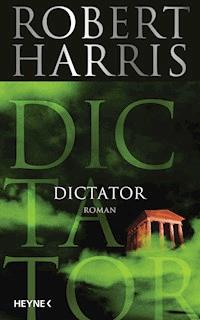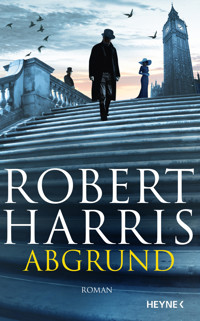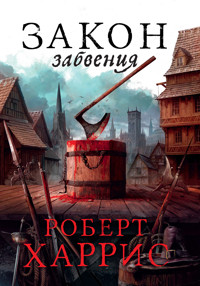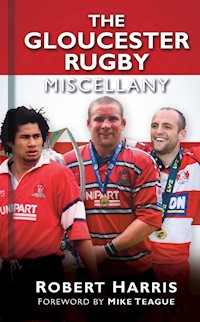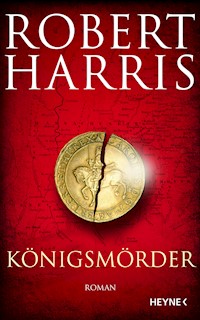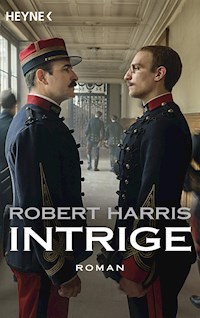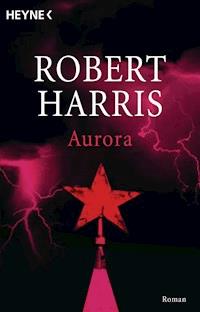
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als der britische Historiker Kelso Einzelheiten über ein bislang unbekanntes Notizbuch Stalins zugespielt bekommt, wittert er eine Sensation. Kurze Zeit später wird der Informant ermordet, und es beginnt eine lebensgefährliche Jagd, die Kelso quer durch Russland führt.
Auf geniale Weise verbindet Robert Harris wie schon in „Vaterland“ und „Pompeji“ historische Fakten und Fiktion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Während eines Moskauaufenthalts wird der britische Historiker Fluke Kelso von einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter aufgesucht. Nachdem Alkohol in Strömen geflossen ist, behauptet dieser, in Stalins Todesnacht dem Chef der Geheimpolizei dabei geholfen zu haben, ein geheimes Notizbuch Stalins beiseitezuschaffen. Kelsos Nachforschungen ergeben rasch, daß der Alte die Wahrheit gesagt hat. Als sein Informant kurze Zeit später bestialisch ermordet aufgefunden wird, ist sich der Historiker sicher, daß das Notizbuch hochbrisante Informationen enthält und daß er nicht der einzige ist, der sich 45 Jahre nach Stalins Tod dafür interessiert. Die Jagd nach dem Buch führt durch ein Moskau der verlassenen Paläste und elenden Plattenbausiedlungen, bis Kelso die Notizen schließlich in Händen hält. Sie übertreffen all seine Erwartungen und bringen ihn auf eine Spur, die direkt zu Stalins fast ein halbes Jahrhundert lang gehütetem Geheimnis führt...
Der Autor
Robert Harris, Jahrgang 1956, arbeitete als Fernsehjournalist bei der BBC und als Kolumnist für die Sunday Times, bevor er sich ganz der Schriftstellerei zuwandte. Seine Romane Vaterland und Enigma haben sich mehr als sechs Millionen mal verkauft und sind in dreißig Sprachen übersetzt worden. Er lebt mit seiner Familie in Berkshire, England.
Inhaltsverzeichnis
In Erinnerung an Dennis Harris 1923-1996 und für Matilda
Prolog
Rapawas Geschichte
»Der Tod löst alle Probleme – kein Mensch, kein Problem.«
J. W. Stalin, 1918
Vor langer Zeit – lange bevor Sie auf der Welt waren, mein Junge – stand eines Nachts ein Leibwächter auf der rückseitigen Veranda eines großen Hauses in Moskau und rauchte eine Zigarette. Es war eine kalte Nacht, in der weder Mond noch Sterne zu sehen waren, und der Mann rauchte, gleichsam um sich aufzuwärmen, als auch um sich die Zeit zu vertreiben. Er hielt seine Bauernpranken dicht an die glimmende Pappröhre einer georgischen papirosa.
Dieser Leibwächter hieß Papu Rapawa. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, ein Mingrelier von der Nordostküste des Schwarzen Meers. Und das Haus selbst – oder besser: die Festung – war ein zaristisches Herrenhaus, das fast eine halbe Straße im Diplomatenviertel einnahm, nicht weit vom Fluß entfernt. Irgendwo in der frostigen Dunkelheit am hinteren Ende des ummauerten Grundstücks lag ein Kirschgarten und dahinter eine breite Straße – die Sadowaja-Kudrinskaja – und noch weiter hinten der Moskauer Zoo.
Es herrschte kein Verkehr. Wenn es so still war wie jetzt und der Wind aus der richtigen Richtung wehte, konnte man ganz schwach das Heulen der Wölfe in ihren Käfigen hören.
Inzwischen hatte das Mädchen zu schreien aufgehört, was eine Wohltat war, weil es Rapawa schwer zugesetzt hatte. Das Mädchen konnte kaum älter als fünfzehn gewesen sein, nicht viel älter als seine kleine Schwester. Als er sie gepackt hatte, um sie dann abzuliefern, hatte sie ihn angeschaut – sie hatte ihn dermaßen angeschaut... also, um ehrlich zu sein, mein Junge, darüber wollte er lieber nicht reden, selbst heute, nach fünfzig Jahren, noch nicht.
Jedenfalls war das Mädchen schließlich verstummt – daran erinnerte er sich zumindest, und er sog genüßlich an seiner Zigarette –, als das Telefon läutete. Das muß so gegen zwei Uhr gewesen sein. Er würde es nie vergessen. Zwei Uhr nachts am 2. März 1953. In der kalten Stille der Nacht hörte sich das Läuten so laut an wie eine Feuerglocke.
Also, normalerweise – das sollten Sie wissen – taten in der Nachtschicht vier Mann Dienst: zwei im Haus und zwei auf der Straße. Aber wenn ein Mädchen gebracht wurde, reduzierte der Chef das Wachpersonal gern auf ein Minimum, zumindest im Haus, und deshalb war Rapawa in der bewußten Nacht allein. Er warf seine Zigarette weg, eilte durch die Wachstube, an der Küche vorbei und in die Diele. Das Telefon war ein altmodischer Vorkriegsapparat, so einer, der an der Wand befestigt ist, und... mein Gott, machte der einen Lärm! Rapawa nahm den Hörer mitten in einem Läuten ab.
»Lawrenti?« sagte ein Mann.
»Er ist nicht da, Genosse.«
»Dann holen Sie ihn. Hier ist Malenkow.« Die üblicherweise bedächtige Stimme war jetzt heiser vor Panik.
»Genosse...«
»Holen Sie ihn. Sagen Sie ihm, daß etwas passiert ist, und zwar in Blischnjaja.«
»Wissen Sie, was Blischnjaja bedeutet, mein Junge?« fragte der alte Mann.
Es waren nur sie beide in dem kleinen Zimmer im 22. Stock des Hotels Ukraina. Sie saßen auf zwei billigen Schaumstoffsesseln so dicht beieinander, daß sie sich mit den Knien fast berührten. Eine Nachttischlampe warf ihre verschwommenen Schatten auf die Fenstervorhänge – das eine Profil wirkte knochig, wie von der Zeit abgenagt, das andere eher fleischig und deutete ein mittleres Alter an.
Ja, sagte Fluke Kelso, der Mann mittleren Alters. Ja, er wisse, was Blischnjaja bedeute. (Verdammt noch mal, natürlich weiß ich, was das bedeutet, wäre es beinahe aus ihm herausgeplatzt. Schließlich habe ich nicht umsonst in Oxford zehn Jahre lang russische Geschichte gelehrt.)
Blischnjaja ist das russische Wort für »nahe«. »Nahe« war im Kreml der vierziger und fünfziger Jahre die Abkürzung für »Nahe Datscha«. Und die Nahe Datscha befand sich in Kunzewo, nicht weit von Moskau entfernt – versehen mit einem doppelten Sicherheitszaun, bewacht von dreihundert Mann einer NKWD-Sondertruppe und acht getarnten 30-Millimeter-Flakgeschützen, alle in dem Birkenwald verborgen, um den alleinigen, bejahrten Bewohner der Datscha zu beschützen.
Kelso wartete darauf, daß der alte Mann weitersprach, aber Rapawa war plötzlich anderweitig beschäftigt. Er wollte ein Streichholz aus einem Heftchen abreißen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er schaffte es nicht. Die Finger konnten das dünne Holz nicht greifen. Er hatte keine Fingernägel.
»Und was haben Sie dann getan?« Kelso beugte sich vor und zündete Rapawa die Zigarette an, hoffte, die Frage mit der Geste so zu überspielen, damit das Zittern in seiner Stimme nicht auffiel. Auf dem kleinen Tisch zwischen ihnen, verborgen zwischen den leeren Flaschen, den schmutzigen Gläsern, dem Aschenbecher und den zerknüllten Marlboro-Schachteln, stand ein Miniatur-Kassettenrecorder, den Kelso dort hingestellt hatte, als er glaubte, daß Rapawa nicht hinschaute. Der alte Mann nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette und betrachtete dann dankbar die Glutspitze. Er warf das Streichholzheftchen auf den Boden.
»Sie wissen über Blischnjaja Bescheid?« sagte er endlich, nachdem er sich wieder in seinem Sessel zurückgelehnt hatte. »Dann wissen Sie auch, was ich getan habe.«
Dreißig Sekunden nach dem Entgegennehmen des Anrufs hatte der junge Rapawa an Berijas Tür geklopft.
Lawrenti Pawlowitsch Berija, Mitglied des Politbüros, angetan mit einem losen roten Seidenkimono, aus dem der Bauch wie ein großer weißer Sack hervorquoll, nannte Rapawa auf mingrelisch eine Fotze und versetzte ihm einen Stoß gegen die Brust, der ihn bis in den Flur zurücktaumeln ließ. Dann drängte er sich an ihm vorbei und tappte in Richtung Treppe davon, wobei seine schweißigen Füße feuchte Abdrücke auf dem Parkett hinterließen.
Durch die offene Tür konnte Rapawa ins Schlafzimmer hineinsehen – das große Holzbett, eine schwere Messinglampe in Form eines Drachens, das rote Laken, die weißen Gliedmaßen des Mädchens, ausgestreckt wie die eines Opfertiers. Ihre Augen waren weit aufgerissen, aber dunkel und blicklos. Sie unternahm keinen Versuch, sich zu bedecken. Auf dem Nachttisch standen ein Wasserkrug und mehrere Medizinflaschen. Etliche große weiße Tabletten waren auf den blaßgelben Aubusson-Teppich heruntergefallen.
Sonst konnte er sich an nichts erinnern, auch nicht daran, wie lange er dort gestanden hatte, bis Berija keuchend die Treppe wieder heraufkam, ganz aufgebracht von seinem Gespräch mit Malenkow. Er warf dem Mädchen die Kleider zu, schrie es an, es solle verschwinden, und zwar plötzlich, und dann befahl er Rapawa, den Wagen vorzufahren.
Rapawa fragte ihn, wen er sonst noch dabeihaben wollte. (Er dachte an Nadaraja, den Kommandanten der Leibwache, der normalerweise den Chef überallhin begleitete. Und vielleicht Sarsikow, der zu diesem Zeitpunkt sinnlos betrunken seinen Wodkarausch im Wachhaus neben dem Hauptgebäude ausschlief.) Woraufhin Berija, der Rapawa gerade den Rücken zukehrte und damit beschäftigt war, seinen Schlafrock abzuwerfen, einen Moment innehielt und einen Blick über die fleischige Schulter warf – überlegte, überlegte... Man konnte sehen, wie die kleinen Augen hinter dem randlosen Kneifer flackerten.
»Niemand«, sagte er schließlich. »Nur dich.«
Der Wagen stammte aus Amerika – ein Packard, zwölf Zylinder, dunkelgrüne Karosserie, Trittbretter von einem halben Meter Breite – ein Prachtexemplar. Rapawa holte ihn aus der Garage und setzte damit auf der Wspolny-Straße zurück, bis er sich direkt vor dem Haupteingang befand. Er ließ den Motor laufen, damit die Heizung auf Touren kam, sprang heraus und nahm neben der hinteren Beifahrertür die für das NKWD übliche Haltung ein, linke Hand auf der Hüfte, Mantel und Jacke leicht auseinandergezogen, Schulterhalfter freigelegt, rechte Hand am Griffstück der Makarow-Pistole, die Straße in beiden Richtungen überprüfend. Beso Dumbadse, gleichfalls ein Mingrelier, kam um die Ecke gerannt, um zu sehen, was los war, und zwar gerade in dem Moment, als der Chef aus dem Haus kam und auf den Gehsteig heraustrat.
»Was hatte er an?«
»Woher zum Teufel soll ich wissen, was er anhatte, mein Junge?« sagte der alte Mann gereizt. »Was zum Teufel spielt das auch für eine Rolle, was er anhatte?«
Aber jetzt, wo er darüber nachdachte, fiel es ihm wieder ein: Der Chef trug Grau – einen grauen Mantel, einen grauen Anzug, einen grauen Pullover, keine Krawatte –, und mit seinem Kneifer, seinen abfallenden Schultern und seinem großen, runden Schädel sah er deshalb nichts ähnlicher als einer Eule – einer alten, bösartigen grauen Eule. Rapawa öffnete die Tür, Berija stieg hinten ein, und Dumbadse, der ungefähr zehn Meter entfernt war, machte mit den Händen eine kleine Geste – Und was zum Teufel soll ich tun? – , woraufhin Rapawa die Achseln zuckte – woher zum Teufel sollte er das wissen? Er rannte um den Wagen herum zum Fahrersitz, glitt hinter das Lenkrad, schaltete in den ersten Gang, und die Fahrt ging los.
Er war die fünfundzwanzig Kilometer hinaus nach Kunzewo schon ein dutzendmal gefahren, immer bei Nacht und immer als Teil des Konvois des Generalsekretärs – und das war jedesmal ein Schauspiel, mein Junge, das kann ich Ihnen versichern. Fünfzehn Wagen mit verhängten Hinterfenstern, das halbe Politbüro – Berija, Malenkow, Molotow, Bulganin, Chruschtschow – plus deren Leibwächter: aus dem Kreml heraus, durch das Borowizki-Tor, die Rampe hinunter, Beschleunigung auf 120 Stundenkilometer, an jeder Kreuzung hält die Miliz den Verkehr auf, und zweitausend NKWD-Leute säumen die Regierungsroute. Und man wußte nie, in welchem Wagen der Generalsekretär saß, bis zur letzten Minute, wenn sie von der Landstraße in die Wälder abbogen, einer der großen Sils ausscherte und sich an die Spitze des Konvois setzte, während alle anderen die Fahrt verlangsamten, damit der »rechtmäßige Erbe« Lenins vorausfahren konnte.
Aber in jener Nacht war nichts dergleichen. Die breite Straße war menschenleer. Sobald sie den Fluß überquert hatten, holte Rapawa aus dem großen amerikanischen Wagen heraus, was in ihm steckte. Das Tachometer zeigte mehr als 140 an, während Berija so still dasaß wie ein Felsbrocken. Nach zwölf Minuten lag die Stadt hinter ihnen. Nach fünfzehn, am Ende der Landstraße hinter Poklonnaja Gora, drosselte Rapawa das Tempo, um die versteckte Abzweigung nicht zu verpassen. Im Scheinwerferlicht blitzten die hohen, weißen Stämme der Silberbirken auf.
Wie still der Wald doch dalag, wie dunkel und grenzenlos – gleich einem sanft säuselnden Meer. Rapawa hatte das Gefühl, als würde der Wald sich den ganzen Weg bis zur Ukraine hin erstrecken. Ein Waldweg brachte sie nach einem Kilometer zum ersten Zaun, an dem ein rot-weißer Schlagbaum in Hüfthöhe die Weiterfahrt versperrte. Zwei in Umhänge gehüllte und mit Maschinenpistolen bewaffnete NKWD-Männer kamen, die Mützen tief ins Gesicht gezogen, aus dem Schilderhaus, sahen Berijas versteinertes Gesicht, salutierten stramm und hoben den Schlagbaum. Der Weg wand sich weitere hundert Meter, vorbei an den geduckten Schatten großer Sträucher, und dann fielen die starken Scheinwerfer des Packards auf die zweite Sperre, eine fünf Meter hohe Mauer mit Schießscharten. Unsichtbare Hände öffneten von innen die eisernen Tore.
Und dann sah man die Datscha.
Rapawa hatte etwas Ungewöhnliches erwartet – obwohl er keine Ahnung hatte, was genau: Wagen, Männer, Uniformen, die Hektik einer Krisensituation. Aber in dem zweigeschossigen Haus brannte noch nicht einmal ein Licht, abgesehen von einer gelben Lampe über dem Eingang. In ihrem Kegel wartete jemand – die unverwechselbare dickliche und schwarzhaarige Gestalt des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Georgi Maximilianowitsch Malenkow. Aber etwas war überaus merkwürdig, mein Junge: Er hatte seine glänzenden neuen Schuhe ausgezogen und sie unter einen der dicken Arme geklemmt.
Berija war aus dem Wagen, noch bevor dieser richtig zum Stehen gekommen war, und gleich darauf hatte er Malenkow beim Ellenbogen und hörte ihm zu, nickte, redete leise, schaute unruhig umher, und Rapawa hörte, wie er sagte: »Ihn bewegt? Haben Sie ihn bewegt?« Und dann schnippte Berija mit den Fingern in Rapawas Richtung, und Rapawa begriff sofort, daß ihm befohlen wurde, ihnen ins Haus zu folgen.
Bei seinen früheren Fahrten zur Datscha hatte er immer entweder im Wagen auf das Wiedererscheinen des Chefs gewartet, oder er war in die Wachstube gegangen, um mit den anderen Fahrern ein Gläschen zu trinken und zu rauchen. Sie sollten eins bedenken: Drinnen war verbotenes Territorium. Außer den Mitarbeitern des Generalsekretärs und geladenen Gästen ging nie jemand nach drinnen. Jetzt, wo er in die Diele trat, hatte Rapawa plötzlich das Gefühl, vor Panik ersticken zu müssen – richtig körperlich zu ersticken, als hätte ihm jemand die Hände um die Kehle gelegt.
Malenkow ging auf Strümpfen voraus, und sogar der Chef ging auf Zehenspitzen, also folgte Rapawa ihrem Beispiel und versuchte, sich möglichst lautlos zu bewegen. Niemand sonst war zu sehen. Das Haus machte einen verlassenen Eindruck. Die drei Männer schlichen einen Korridor entlang, an einem Klavier vorbei und in ein Eßzimmer, wo acht Stühle um einen Tisch herumstanden. Das Licht war eingeschaltet. Die Vorhänge waren zugezogen. Es lagen einige Papiere auf dem Tisch, daneben stand ein Gestell mit Dunhill-Pfeifen. In einer Ecke stand ein aufziehbares Grammophon. Über dem Kamin hing ein vergrößertes Schwarzweißfoto in einem billigen Holzrahmen: der Generalsekretär als jüngerer Mann, der an einem sonnigen Tag mit dem Genossen Lenin irgendwo in einem Garten saß. Am entgegengesetzten Ende des Zimmers befand sich eine Tür. Malenkow drehte sich zu ihnen um und legte den plumpen Zeigefinger auf die Lippen, dann öffnete er ganz langsam die Tür.
Der alte Mann schloß die Augen und hielt sein leeres Glas zum Nachfüllen hin. Er seufzte.
»Wissen Sie, mein Junge, die Leute kritisieren Stalin, aber eines muß man ihm lassen: Er hat wie ein Arbeiter gelebt. Ganz im Gegensatz zu Berija – der hat sich eingebildet, er wäre ein Fürst. Aber das Zimmer des Genossen Stalin war das Zimmer eines einfachen Mannes. Das muß man Stalin lassen. Er ist immer einer von uns gewesen.«
In der Zugluft der aufschwingenden Tür flackerte in der Ecke unter einem kleinen Lenin-Bild eine rote Kerze. Die einzige andere Lichtquelle war eine Leselampe auf einem Schreibtisch. In der Mitte des Zimmers stand ein großes Sofa, das als Bett hergerichtet worden war. Von ihm hing eine braune Armeedecke bis auf einen Tigerfell-Teppich am Boden herunter. Auf dem Teppich lag ein kleiner, dicker, rotgesichtiger Mann in einer schmutzigen weißen Weste und langer wollener Unterhose auf dem Rücken. Er atmete schwer und schien zu schlafen. Er hatte sich in die Hose gemacht. Das Zimmer war heiß und stank nach menschlichen Ausscheidungen.
Malenkow hielt sich mit seiner dicklichen Hand den Mund zu und blieb stehen, um die Tür zu schließen. Berija ging schnell auf den Teppich zu, knöpfte seinen Mantel auf und kniete sich hin. Er befühlte Stalins Stirn, zog mit den Daumen beide Augenlider zurück und entblößte blicklose, blutunterlaufene Augäpfel.
»Josef Wissarionowitsch«, sagte er leise, »ich bin’s, Lawrenti. Lieber Genosse, wenn Sie mich hören können, bewegen Sie bitte die Augen. Genosse?« Dann zu Malenkow, ohne den Blick von Stalin abzuwenden: »Und Sie sagen, er könnte so schon seit zwanzig Stunden hier liegen?«
Hinter der vorgehaltenen Hand machte Malenkow ein würgendes Geräusch. An seinen glatten Wangen liefen Tränen herunter.
»Lieber Genosse, bewegen Sie die Augen! Die Augen, lieber Genosse... Genosse? Ach, scheiß drauf.« Berija zog die Hände zurück, stand auf und wischte sich die Finger am Mantel ab. »Es ist tatsächlich ein Schlaganfall. Er ist hinüber. Wo sind Starostin und die anderen? Und die Butusowa?«
Malenkow schluchzte inzwischen richtiggehend, und Berija mußte sich zwischen ihn und Stalin stellen – mußte ihm buchstäblich die Sicht versperren, damit er ihm zuhörte. Er packte Malenkow bei den Schultern und begann, sehr leise und sehr schnell auf ihn einzureden, als hätte er ein Kind vor sich, sagte ihm, er solle Stalin vergessen. Stalin sei jetzt Geschichte. Stalin sei hinüber, und jetzt komme es nur darauf an, wie sie reagierten, daß sie zusammenhielten. Also, wo waren die Jungs? Immer noch in der Wachstube?
Malenkow nickte und wischte sich mit dem Ärmel die Nase ab.
»Gut«, sagte Berija. »Und jetzt tun Sie folgendes.«
Malenkow sollte seine Schuhe wieder anziehen und den Wachen sagen, daß Genosse Stalin schlafe, daß er betrunken sei, und weshalb zum Teufel man ihn und den Genossen Berija für nichts und wieder nichts aus dem Bett geholt habe? Er sollte ihnen sagen, sie sollten das Telefon nicht anrühren und keinen Arzt rufen. (»Hören Sie mir überhaupt zu, Georgi?«) Vor allem keinen Arzt, weil der Generalsekretär alle Ärzte für jüdische Giftmischer hielt – Sie erinnern sich doch? So, und wie spät war es jetzt? Drei Uhr? Um acht – nein, lieber um halb acht – sollte Malenkow damit beginnen, die Führerschaft zusammenzurufen. Er sollte sagen, daß er und Berija eine Zusammenkunft des gesamten Politbüros wünschten, hier in Blischnjaja, um neun Uhr. Er sollte sagen, sie machten sich Sorgen wegen Josef Wissarionowitschs Gesundheitszustand und daß eine kollektive Entscheidung über eine ärztliche Behandlung getroffen werden müßte.
Berija rieb sich die Hände. »Das sollte reichen, damit sie sich vor Angst in die Hose machen. So, und jetzt wollen wir ihn auf das Sofa heben. Du«, sagte er zu Rapawa, »pack ihn an den Beinen.«
Der alte Mann war beim Reden tiefer in seinem Sessel zusammengesackt; seine Beine waren ausgestreckt, seine Stimme monoton. Plötzlich schnaufte er heftig und richtete sich im Sessel auf. Er schaute sich nervös im Hotelzimmer um. »Ich muß pissen, mein Junge. Muß pissen.«
»Da drüben.«
Er erhob sich mit der bedächtigen Würde eines Betrunkenen. Durch die dünne Wand konnte Kelso hören, wie der Urin in die Toilettenschüssel prasselte. Kein Wunder, dachte er. Der hatte eine Menge abzuladen. Mittlerweile hatte er Rapawas Erinnerungen fast vier Stunden lang geschmiert: zuerst mit Baltika-Bier in der Bar des Ukraina, dann mit Subrowka in einem Lokal auf der anderen Straßenseite und schließlich mit schottischem Single Malt in der beengten Intimität seines Zimmers. Es war, als holte man einen Fisch ein, einen Fisch aus einem Fluß aus Alkohol. Sein Blick fiel auf das Streichholzheftchen auf dem Boden, wo Rapawa es hingeworfen hatte. Er bückte sich und hob es auf. Auf der Klappe stand der Name einer Bar oder eines Nachtklubs – ROBOTNIK – und eine Adresse in der Nähe des Dinamo-Stadions. Die Toilettenspülung rauschte. Kelso ließ die Streichhölzer rasch in seine Tasche gleiten. Dann tauchte Rapawa auch schon wieder auf, lehnte sich an den Türrahmen und knöpfte seinen Hosenschlitz zu.
»Wie spät ist es, mein Junge?«
»Fast eins.«
»Muß gehen. Die glauben sonst, ich wäre Ihr Liebster.« Rapawa machte mit der Hand eine obszöne Geste.
Kelso tat, als müßte er lachen. Natürlich, er würde in einer Minute gleich ein Taxi rufen. Natürlich. »Aber vorher wollen wir noch die Flasche hier leer machen« – er griff nach dem Scotch und vergewisserte sich dabei verstohlen, daß das Band immer noch lief –, »machen Sie die Flasche leer, Genosse, und erzählen Sie die Geschichte zu Ende.« Der alte Mann runzelte die Stirn und schaute auf den Teppich. Das sei bereits die ganze Geschichte gewesen. Da war nichts mehr zu erzählen. Sie beförderten Stalin auf das Sofa, und das war’s. Malenkow ging hinaus, um mit den Wachen zu reden. Rapawa fuhr Berija nach Hause. Der Rest ist allgemein bekannt. Ein oder zwei Tage später war Stalin tot. Und nicht lange danach war Berija tot. Malenkow – also, Malenkow hing, nachdem man ihn kaltgestellt hatte, noch viele Jahre herum (Rapawa hatte ihn einmal gesehen, in den Siebzigern, als er den Arbat entlangschlurfte), aber jetzt war sogar Malenkow tot. Nadaraja, Sarsikow, Dumbadse, Starostin, die Butusowa – tot, alle tot. Die Partei war tot. Im Grunde war sogar das ganze verdammte Land tot.
»Aber Sie haben doch bestimmt noch mehr zu erzählen«, sagte Kelso. »Bitte, setzen Sie sich wieder hin, Papu Gerassimowitsch, wir wollen die Flasche noch leer machen.«
Er sprach höflich und ohne allzu großen Nachdruck, weil er das Gefühl hatte, daß das Anästhetikum aus Alkohol und Eitelkeit seine Wirkung verlieren könnte und daß Rapawa, wenn er wieder zu sich kam, vielleicht plötzlich bewußt wurde, daß er zuviel redete. Er spürte wieder, wie Ungeduld in ihm hochstieg. Himmel, sie waren immer so verdammt schwierig, diese alten NKWD-Leute – schwierig und vielleicht ja auch immer noch gefährlich. Kelso war Historiker, erst Mitte Vierzig, also dreißig Jahre jünger als Papu Rapawa, aber er war nicht mehr ganz in Form – um ehrlich zu sein, er war eigentlich nie sonderlich in Form gewesen –, und er hätte vermutlich keine Chance, wenn der alte Mann handgreiflich wurde. Schließlich war Rapawa ein Überlebender der Lager am Polarkreis. Er hatte bestimmt nicht vergessen, wie man jemandem weh tun konnte – das ging dann wahrscheinlich sehr schnell, dachte Kelso, und würde vermutlich ziemlich schlimm enden.
Er füllte Rapawas Glas, goß sich selbst noch etwas ein und zwang sich, einfach weiterzureden.
»Also, da sind Sie, gerade mal fünfundzwanzig Jahre alt, im Schlafzimmer des Generalsekretärs. Näher hätten Sie doch gar nicht herankommen können – so mitten ins innerste Heiligtum. Also weshalb hat Berija Sie da mit hineingenommen?«
»Sind Sie taub, mein Junge? Er hat mich gebraucht, um Stalin auf das Sofa zu legen.«
»Aber weshalb ausgerechnet Sie? Weshalb nicht einen von Stalins angestammten Leibwächtern? Schließlich waren die es doch, die ihn gefunden und dann Malenkow informiert haben. Oder weshalb hat Berija nicht einen seiner dienstälteren Männer nach Blischnjaja mitgenommen? Weshalb hat er gerade Sie mitgenommen?«
Rapawa schwankte und starrte unverwandt das Glas mit dem Scotch an. Später gelangte Kelso zu dem Schluß, daß die ganze Nacht im Grunde an dieser einen Sache gehangen hatte: daß Rapawa noch einen Drink brauchte, daß er ihn in genau diesem Moment brauchte und daß diese beiden Sachen zusammengenommen stärker waren als sein Drang zu verschwinden. Er kam heran und ließ sich schwer in seinen Sessel fallen, leerte das Glas in einem Zug und hielt es Kelso dann zum Nachfüllen hin.
»Papu Rapawa«, fuhr Kelso fort, während er einen Doppelten in das Glas goß. »Neffe von Awxenti Rapawa, Berijas ältestem Kumpel im georgischen NKWD. Jünger als die anderen Leibwächter. Neu in der Stadt. Vielleicht ein bißchen naiver als die anderen? Richtig? Vielleicht genau die Sorte von eifrigem jungem Mann, bei der der Chef dachte: Ja, den könnte ich gebrauchen, ich könnte Rapawas Jungen gebrauchen, er würde ein Geheimnis bewahren.«
Das Schweigen dehnte sich aus und wurde so beherrschend, bis es beinahe greifbar war, fast so, als wäre jemand ins Zimmer getreten und hätte sich zu ihnen gesellt. Rapawas Kopf begann, von einer Seite zur anderen zu rucken, dann lehnte er sich vor, verschränkte die Hände hinter dem ausgemergelten Nacken und starrte auf den abgewetzten Teppich. Rapawas Haar war kurz geschoren. Von der Schädeldecke aus verlief eine alte, schrumpelige Narbe bis fast zur Schläfe. Sie sah aus, als hätte einmal ein Blinder die Wunde dort mit einem groben Bindfaden geflickt. Und diese Finger: geschwärzte gelbe Kuppen, und alle ohne Nagel.
»Stellen Sie Ihr Gerät ab, mein Junge«, sagte er ruhig. Er deutete mit einem Kopfnicken auf den Tisch. »Stellen Sie es ab. Und nun nehmen Sie das Band heraus – ja, genau –, und legen Sie es dahin, wo ich es sehen kann.«
Genosse Stalin war ein relativ kleiner Mann – ein Meter zweiundsechzig –, aber er war schwer. Mein Gott, war der schwer! Es war, als bestünde er keineswegs nur aus Fett und schweren Knochen, sondern aus irgendeinem massiveren Material. Sie zerrten ihn über den Fußboden, sein Kopf torkelte und schlug gegen die gebohnerten Dielen, und dann mußten sie ihn hochheben, mit den Beinen voran. Rapawa fiel auf – es mußte ihm einfach auffallen, denn er war mit dem Gesicht ganz nahe an Stalins Füßen –, daß der zweite und der dritte Zeh am linken Fuß des Generalsekretärs miteinander verwachsen waren – das Teufelszeichen! Als er sich unbeobachtet fühlte, bekreuzigte er sich kurz.
»Also, junger Genosse«, sagte Berija, als Malenkow gegangen war, »möchtest du auf der Erde bleiben, oder würdest du lieber darunter sein?«
Anfangs konnte Rapawa nicht glauben, daß er richtig gehört hatte. Ab diesem Augenblick wußte er, daß sein Leben nie mehr so sein würde wie zuvor und daß er von Glück sagen konnte, wenn er diese Nacht überlebte. »Ich würde gern auf ihr bleiben, Chef«, flüsterte er.
»Guter Junge.« Berija formte Daumen und Zeigefinger zu einer Zange. »Wir müssen einen Schlüssel finden. Ungefähr so groß. Sieht aus wie ein Schlüssel, mit dem man eine Uhr aufzieht. Er bewahrt ihn an einem Messingring mit einem Stück Schnur daran auf. Durchsuch seine Kleidung!«
Der vertraute graue Waffenrock hing über der Rückenlehne eines Stuhls. Eine graue Hose war säuberlich darüber gefaltet. Daneben stand ein Paar hohe schwarze Kavalleriestiefel mit um ein paar Zentimeter erhöhten Absätzen. Rapawas Gliedmaßen bewegten sich ruckartig. In welchen Traum war er da hineingeraten? Der Vater und Lehrer des Sowjetvolks, der Inspirator und Organisator des Sieges des Kommunismus, der Gestalter des Fortschritts der gesamten Menschheit, lag beschmutzt auf dem Sofa, sein eisernes Gehirn war zur Hälfte zerstört, und sie beide durchsuchten sein Zimmer wie Diebe? Trotzdem tat er, wie ihm befohlen, und fing mit dem Waffenrock an, während sich Berija mit der Routine eines alten Tschekisten an den Schreibtisch machte – er zog Schubladen heraus, kippte sie aus, durchsuchte den Inhalt, fegte ihn in die Schubladen zurück und setzte sie wieder ein.
In dem Waffenrock war nichts und in der Hose auch nichts, abgesehen von einem schmutzigen Taschentuch, das steif vor getrocknetem Rotz war. Inzwischen hatten sich Rapawas Augen an das Halbdunkel gewöhnt, und er war jetzt eher imstande, seine Umgebung wahrzunehmen. An einer Wand hing ein großer chinesischer Druck von einem Tiger. An einer anderen – und das war das allermerkwürdigste – hatte Stalin Fotos von Kindern angeheftet. Überwiegend Kleinkindern. Keine richtigen Fotoabzüge, sondern aus Zeitungen und Zeitschriften herausgerissene Abbildungen. Es mußten mehrere Dutzend gewesen sein.
»Irgend etwas gefunden?«
»Nein, Chef.«
»Nimm dir das Sofa vor.«
Sie hatten Stalin auf den Rücken gelegt und die Hände auf dem Bauch gefaltet, so daß es aussah, als ob der alte Bursche tatsächlich schlief. Sein Atem ging schwer. Er schnarchte beinahe. Von nahem betrachtet, sah er den Bildern von ihm nicht sehr ähnlich. Das Gesicht war dicklich, rotfleckig und mit flachen Pockennarben übersät. Schnurrbart und Augenbrauen waren weißlichgrau. Die Kopfhaut schimmerte durch das schüttere Haar. Rapawa beugte sich über ihn – oh, dieser Gestank, es war, als verweste er bereits – und schob seine Hand in den Spalt zwischen den Kissen und der Rückenlehne des Sofas. Er fuhr mit den Fingern über die ganze Länge, beugte sich zuerst nach links über die Füße des Generalsekretärs, dann bewegte er sich nach rechts auf den Kopf zu, bis er mit der Spitze des Zeigefingers endlich etwas Hartes berührte. Er mußte sich strecken, um es herausholen zu können, wobei sein Arm sanft auf Stalins Brustkorb drückte.
Und dann – etwas Fürchterliches, etwas Entsetzliches, Grauenhaftes. Als er den Schlüssel herausholte und flüsternd den Chef anrief, gab der Genosse Generalsekretär ein Grunzen von sich und öffnete ruckartig die Augen – die gelben Augen eines Tiers, angefüllt mit Wut und Angst. Sogar Berija zuckte zusammen, als er das sah. Kein anderer Teil des Körpers bewegte sich, aber aus der Kehle drang eine Art gequältes Stöhnen. Zögernd kam Berija näher und schaute auf Stalin hinab, dann schwenkte er seine Hand vor dessen Augen. Da schien Berija eine Idee zu kommen. Er nahm Rapawa den Schlüssel ab und ließ ihn an seiner Schnur ein paar Zentimeter über Stalins Gesicht kreisen. Die gelben Augen richteten sich sofort auf den Schlüssel, folgten ihm die ganze Kreisbewegung, ohne ihn jemals aus dem Blick zu lassen. Berija, der inzwischen lächelte, ließ den Schlüssel mindestens eine halbe Minute lang weiterkreisen, dann riß er ihn abrupt fort und fing ihn mit der Handfläche auf. Er schloß die Finger darum und zeigte Stalin die Faust.
Was für einen Laut der ausstieß, mein Junge! Eher tierisch als menschlich. Und dieser Laut verfolgte ihn aus jenem Zimmer heraus und den Korridor entlang und über all diese Jahre hinweg, von jener Nacht bis hin zur heutigen.
Die Scotch-Flasche war leer, und Kelso kniete vor der Minibar wie ein Priester vor dem Altar. Er fragte sich, was seine Gastgeber, die zum Geschichtssymposium geladen hatten, wohl denken würden, wenn sie die Rechnung bekamen. Aber das war im Augenblick weniger wichtig als die Aufgabe, den alten Mann weiter abzufüllen und am Reden zu halten. Er zog beide Hände voller Miniflaschen heraus – Wodka, noch mehr Scotch, Gin, Weinbrand, irgendein Kirschwasser aus Deutschland – und trug sie durchs Zimmer zum Tisch. Als er sich hinsetzte und die Fläschchen losließ, fielen ein paar davon auf den Boden, aber Rapawa schien das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Er war jetzt kein alter Mann im Hotel Ukraina mehr, er war ins Jahr 1953 zurückgekehrt – er war ein verängstigter junger Mann von fünfundzwanzig am Steuer eines dunkelgrünen Packards. Vor ihm lag die Straße nach Moskau im weißen Scheinwerferlicht, und Lawrenti Berija saß unverrückbar wie ein Fels im Fond des Wagens.
Der große Wagen jagte den Kutusowski-Prospekt entlang und durch die stillen westlichen Vororte. Um halb vier überquerte er auf der Borodinski-Brücke die Moskwa und steuerte auf den Kreml zu, in den sie auf der dem Roten Platz abgewandten Seite, durch das Südwesttor, hineinfuhren.
Sobald sie durchgewinkt worden waren, lehnte sich Berija vor und erteilte Rapawa Anweisungen – nach der Rüstkammer links, dann scharf rechts durch eine schmale Öffnung in einen Innenhof. Dort gab es keine Fenster, nur ein halbes Dutzend kleine Türen. Die eisigen Pflastersteine schimmerten in der Dunkelheit so rot wie frisches Blut, und als Rapawa aufschaute, sah er, daß sie sich unterhalb eines riesigen roten Neonsterns befanden.
Berija verschwand schnell durch eine der Türen, und Rapawa mußte sich anstrengen, um Schritt zu halten. Ein kurzer, mit Steinplatten ausgelegter Gang brachte sie zu einem Käfigfahrstuhl, der älter war als die Revolution. Eisengerassel und das Dröhnen eines Motors begleitete ihren langsamen Aufstieg durch zwei totenstille, unbeleuchtete Etagen. Dann kam der Käfig mit einem Ruck zum Halten, und Berija stemmte die Türen auf. Er stürmte weiter, den Korridor entlang, mit schnellen Schritten, wobei er den Schlüssel an der Schnur schwingen ließ.
Fragen Sie mich nicht, wo wir hingegangen sind, mein Junge, denn das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Zuerst war da ein langer, teppichbelegter Korridor mit prächtigen Büsten auf Marmorsockeln, dann kam eine eiserne Wendeltreppe, die sie hinabsteigen mußten, und dann ein riesiger Ballsaal von der Größe eines Ozeandampfers, mit zehn Meter hohen Spiegeln und vergoldeten Stühlen an den Wänden. Schließlich, bald nach dem Ballsaal, kam ein breiter Korridor mit glänzenden gelbgrünen Wänden, einem Fußboden, der nach Bohnerwachs roch, und einer großen, schweren Tür, die Berija mit einem Schlüssel aufschloß, den er in einem Bund an einer Kette mit sich trug.
Rapawa folgte ihm hinein. Hinter ihm wurde die Tür langsam durch ein Druckluftscharnier, das noch aus der Zarenzeit zu stammen schien, zugezogen.
Es war kein umwerfendes Büro. Acht mal sechs Meter groß. Es hätte einem Fabrikdirektor in Wologda oder Magnitogorsk gehören können – es befanden sich darin lediglich ein Schreibtisch, auf dem zwei Telefone standen, ein kleiner Teppich auf dem Fußboden, ein Tisch und ein paar Stühle, ein Fenster mit zugezogenen Vorhängen. An der Wand hing eine dieser großen, rosafarbenen, aufrollbaren Landkarten der UdSSR – so wie die UdSSR damals eben noch existierte –, und neben der Karte befand sich eine weitere, aber kleinere Tür, auf die Berija sofort zusteuerte. Auch dafür besaß er einen Schlüssel. Die Tür öffnete sich zu einer Art Kabuff, in dem ein verrußter Samowar zu sehen war, eine Flasche armenischer Schnaps und irgendwelches Zeug zum Aufgießen von Kräutertee. Außerdem war da ein Wandsafe mit einer dicken Messingtür, worauf der Name des Herstellers stand – nicht in kyrillischen Buchstaben, sondern in irgendeiner westlichen Sprache. Der Safe war nicht sonderlich groß – fünfundzwanzig Zentimeter breit, wenn überhaupt. Quadratisch. Gut gebaut. Gerader Griff, auch aus Messing.
Berija schien zu bemerken, daß Rapawa ihn betrachtete, und wies ihn grob an, nach draußen zu verschwinden.
Fast eine Stunde verging.
Während er auf dem Korridor stand, versuchte Rapawa, sich wach zu halten, indem er das Ziehen seiner Pistole übte, sich einbildete, jedes Knarzen in dem großen Gebäude wäre ein Fußtritt, jedes Stöhnen des Windes eine Stimme. Er versuchte sich den Generalsekretär vorzustellen, wie er in seinen Kavalleriestiefeln diesen breiten, gebohnerten Korridor entlangschritt, und dann versuchte er, dieses Bild mit der dahinsiechenden Gestalt in Einklang zu bringen, die – im eigenen, widerwärtigen Fleisch gefangen – draußen in Blischnjaja lag.
Und wissen Sie was, mein Junge? Ich habe geweint. Vielleicht habe ich auch ein bißchen um mich selbst geweint – ich kann nicht abstreiten, daß ich fürchterliche Angst hatte –, aber im Grunde habe ich um den Genossen Stalin geweint. Ich habe um den Genossen Stalin mehr geweint, als ich es beim Tod meines Vaters getan habe. Und das gilt für die meisten Jungen, die ich kannte.
Eine ferne Turmuhr schlug vier.
Gegen halb fünf kam Berija endlich wieder zum Vorschein. Er trug eine kleine Ledertasche bei sich, die ziemlich vollgestopft war – bestimmt mit Papieren, aber vielleicht auch mit anderen Dingen, das vermochte Rapawa nicht zu sagen. Ihr Inhalt stammte vermutlich aus dem Safe, vielleicht auch die Tasche selbst. Vielleicht hatte die aber auch nur im Büro herumgelegen. Vielleicht – Rapawa konnte es nicht beschwören, aber es war durchaus denkbar – hatte Berija die Tasche jedoch schon bei sich gehabt, als er aus dem Wagen ausgestiegen war. Jedenfalls hatte er jetzt offenbar das, was er gesucht hatte, und er lächelte.
»Er lächelte?«
»Sie haben richtig gehört, mein Junge. Ja – er lächelte. Aber es war kein freudiges Lächeln, es war eher...«
»Wehmütig?«
»Ja, eine Art wehmütiges Lächeln. Ein Lächeln, wie wenn er etwas einfach nicht fassen könnte. Fast so, als hätte er gerade beim Kartenspielen verloren.«
Sie kehrten auf demselben Weg zurück, auf dem sie gekommen waren, nur stießen sie diesmal in dem von Büsten gesäumten Gang auf einen Wachtposten. Er fiel praktisch auf die Knie, als er den Chef sah. Aber Berija würdigte den Mann keines Blickes und ging einfach weiter – der unverfrorenste Diebstahl, der mir je untergekommen ist. Im Wagen sagte er nur: »Wspolny-Straße.«
Inzwischen war es fast fünf Uhr, die ersten Straßenbahnen fuhren, und es waren Leute auf den Straßen – überwiegend Babuschkas, die schon unter dem Zaren und unter Lenin Regierungsbüros geputzt hatten und es von morgen an auch unter jedem anderen tun würden. Vor der Lenin-Bibliothek schaute ein riesiges Stalin-Plakat in Rot, Weiß und Schwarz auf die Arbeiter herab, die vor der Metrostation in einer Schlange standen. Auf Berijas Schoß lag die geöffnete Tasche, über die er sich gebeugt hatte. Die Innenbeleuchtung war eingeschaltet. Er las in etwas und trommelte dabei nervös mit den Fingern.
»Ist im Kofferraum ein Spaten?« fragte er.
Rapawa bejahte. So einer, um das Auto aus dem Schnee freizuschaufeln.
»Und ein Werkzeugkasten?«
»Ja, Chef.« Ein großer Kasten: Wagenheber, Radschlüssel, Radmuttern, Reserve-Andrehkurbel, Zündkerzen...
Berija grunzte und wendete seine Aufmerksamkeit wieder seiner Lektüre zu.
Der Boden von Berijas Grundstück war mit glitzernden Eisstacheln übersät und steinhart, viel zu hart für den Spaten. Rapawa mußte sich in den Schuppen am hinteren Ende des Gartens auf die Suche nach einer Spitzhacke machen. Er zog seinen Mantel aus und schwang die Hacke, wie er es gewohnt war, als er noch die georgische Erde auf der Scholle seines Vaters bearbeitete, schwang sie in einem großen, geschmeidigen Bogen über seinen Kopf, ließ die Masse und die Wucht des Werkzeugs die ganze Arbeit tun. Die Spitze bohrte sich fast bis zum Schaft in die gefrorene Erde. Er zerrte sie wieder heraus, änderte seine Stellung und ließ die Hacke wieder niedersausen.
Er arbeitete im Licht einer Sturmlampe, die in dem kleinen Kirschgarten an einem Ast in seiner Nähe hing, und er arbeitete mit hektischem Tempo, sich ständig der Tatsache bewußt, daß in der Dunkelheit hinter ihm, unsichtbar auf der anderen Seite des Lichts, Berija auf einer Steinbank saß und ihn beobachtete. Bald schwitzte er so stark, daß er trotz der Märzkälte innehalten, seine Jacke ausziehen und die Ärmel aufkrempeln mußte. Das Hemd klebte ihm am Rücken. Er mußte unwillkürlich an jene Männer denken, die Ähnliches taten wie er jetzt – jene Männer, die an weitaus wärmeren Tagen im Wald auf die Erde einhieben, während er sein Gewehr auf sie richtete, um sie zu bewachen, und die sich dann widerspruchslos mit dem Gesicht nach unten in die frisch ausgehobenen Gruben legten. Er erinnerte sich an den Geruch der feuchten Erde und die heiße, schläfrige Stille des Waldes, und er fragte sich, wie kalt es sein würde, wenn Berija ihm jetzt befahl, sich hinzulegen.
Eine Stimme kam aus der Dunkelheit. »Mach es nicht so breit. Es soll kein Grab werden. Du machst dir nur unnötige Arbeit.«
Nach einer Weile begann er, zwischen der Spitzhacke und dem Spaten zu wechseln, hackte Erdbrocken los und sprang dann in das Loch, um sie herauszuschaufeln. Zuerst stand er bis zu den Knien darin, dann bis zur Taille, und schließlich bis zur Brust. Das war der Zeitpunkt, an dem Berijas Mondgesicht über ihm auftauchte und ihm sagte, er solle aufhören, er habe gute Arbeit geleistet, es würde reichen. Der Chef lächelte sogar dabei und streckte die Hand aus, um Rapawa aus dem Loch zu ziehen. Und in diesem Moment, als er die weiche Hand ergriff, war Rapawa von einer derartigen Zuneigung erfüllt – einem derartigen Aufwallen von Dankbarkeit und Ergebenheit: So etwas würde er niemals wieder empfinden.
Sie handelten, Rapawas Erinnerung zufolge, wie Kameraden, als sie beide jeweils ein Ende des langen Werkzeugkastens ergriffen und ihn gemeinsam in das Loch absenkten. Hinterher schoben sie die Erde wieder hinein, stampften sie fest, und dann hämmerte Rapawa mit der Rückseite des Spatens die leichte Erhebung flach und warf totes Laub darüber. Als sie sich über den Rasen auf den Rückweg zum Haus machten, zeigte sich gerade der allererste Anflug von Morgengrau am östlichen Himmel.
Gemeinsam hatten Kelso und Rapawa die Fläschchen geleert und waren zu einer Art hausgemachtem Pfefferwodka übergegangen, den der alte Mann in einem verbeulten blechernen Flachmann bei sich hatte. Gott allein wußte, woraus der Wodka hergestellt worden war. Durchaus möglich, daß es Haarwaschmittel war. Rapawa roch daran, mußte niesen, dann zwinkerte er und füllte Kelsos Glas bis zum Rand mit der öligen Flüssigkeit. Sie hatte die Farbe einer Taubenbrust. Kelso spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte.
»Und Stalin starb«, sagte er, um nicht trinken zu müssen. Er brachte die Worte nicht mehr klar heraus. Sein Kiefer war taub.
»Und Stalin starb.« Rapawa schüttelte traurig den Kopf. Dann beugte er sich plötzlich vor und stieß mit Kelso an. »Auf den Genossen Stalin!«
»Auf den Genossen Stalin!«
Sie tranken.
Und Stalin starb. Und alle waren von Trauer überwältigt. Das heißt, alle außer dem Genossen Berija, der vor den Tausenden von Trauernden auf dem Roten Platz seine Gedenkrede hielt, als verläse er eine Fahrplanansage der Eisenbahn, und hinterher mit den Jungs Witze darüber machte. Das sprach sich herum.
Also, Berija war ein schlauer Mann, viel schlauer, als Sie es sind, mein Junge – er hätte Sie zum Frühstück verspeisen können. Aber schlaue Leute machen alle denselben Fehler. Sie halten alle anderen Leute für dumm. Aber nicht alle anderen Leute sind dumm. Sie brauchen nur ein bißchen mehr Zeit, das ist alles.
Der Chef hatte geglaubt, er würde die nächsten zwanzig Jahre an der Macht sein. Er hielt sich gerade drei Monate.
Es war an einem Spätvormittag im Juni. Rapawa hatte Dienst mit der üblichen Mannschaft – Nadaraja, Sarsikow, Dumbadse –, als die Nachricht kam, daß in Malenkows Büro im Kreml eine Sondersitzung des Präsidiums stattfand. Und weil es sich um Malenkows Büro handelte, dachte der Chef sich nichts dabei. Wer war denn schon der dicke Malenkow? Der dicke Malenkow war ein Nichts, nur ein dämlicher Braunbär. Und der Chef führte Malenkow an einem Ring durch die Nase herum.
Deshalb trug er, als er in den Wagen stieg, um an der Sitzung teilzunehmen, nicht einmal eine Krawatte, sondern nur ein offenes Hemd und einen abgetragenen alten Anzug. Weshalb sollte er eine Krawatte umbinden? Es war ein heißer Tag, Stalin war tot, Moskau war voller Mädchen, und er würde zwanzig Jahre an der Macht sein.
Die Kirschbäume am hinteren Ende des Gartens waren kurz zuvor abgeblüht.
Sie kamen an Malenkows Gebäude an, und der Chef ging hinauf, um mit ihm zu reden, während die übrigen im Vorzimmer neben dem Eingang herumsaßen. Und dann erschienen, einer nach dem anderen, die großen Männer, all die Genossen, über die Berija hinter ihrem Rücken zu spotten pflegte – der alte »Steinarsch« Molotow, dieser fette Bauer Chruschtschow, der Tölpel Woroschilow und schließlich Marschall Schukow, der aufgeblasene Pfau mit seinem ganzen Lametta. Sie gingen alle nach oben. Nadaraja rieb sich die Hände und sagte zu Rapawa: »Also, Papu Gerassimowitsch, was hältst du davon, wenn du in die Kantine gehen und uns Kaffee holen würdest?«
Der Tag verging, und von Zeit zu Zeit wanderte Nadaraja nach oben, um zu sehen, was sich tat, und er kam immer mit derselben Botschaft zurück: Die Sitzung dauert immer noch an. Kein Grund zur Aufregung. Es kam oft vor, daß das Präsidium stundenlang tagte. Aber gegen acht Uhr sah der Kommandant der Leibwache langsam besorgt aus, und um zehn, als der Sommerabend dunkelte, befahl er allen, ihm nach oben zu folgen.
Sie stürmten an Malenkows protestierenden Sekretären vorbei in den großen Sitzungssaal. Er war leer. Sarsikow versuchte zu telefonieren, aber die Leitung war tot. Einer der Stühle war umgekippt, und auf dem Fußboden um ihn herum lagen ein paar zusammengefaltete Papierfetzen, und auf jedem stand in roter Tinte und in Berijas Handschrift ein einziges Wort: »Alarm!«
Sie hätten unter Umständen kämpfen können, aber welchen Sinn hätte das gehabt? Die ganze Sache war ein Hinterhalt, eine Operation der Roten Armee. Schukow hatte sogar Panzer auffahren lassen – gleich zwanzig T 34, die er an der Rückfront von Berijas Haus postierte (wie Rapawa später erfuhr). Im Kreml selbst standen gepanzerte Fahrzeuge. Es war hoffnungslos. Sie hätten keine fünf Minuten durchgehalten.
Sie wurden auf der Stelle voneinander getrennt. Rapawa wurde in ein Militärgefängnis in einem der nördlichen Vororte gebracht, wo man nach Strich und Faden auf ihn einprügelte, ihn beschuldigte, kleine Mädchen beschafft zu haben, ihm Zeugenaussagen und Fotos der Opfer zeigte und schließlich eine Liste mit dreißig Namen, die Sarsikow (der große, kräftige, stolze Sarsikow – als was für ein »harter Bursche« hatte er sich doch herausgestellt) ihnen schon am zweiten Tag geliefert hatte.
Rapawa schwieg. Die ganze Sache widerte ihn an.
Und dann, eines Abends, ungefähr zehn Tage nach dem Putsch – denn Rapawa konnte nie etwas anderes als einen Putsch darin sehen –, wurde er zusammengeflickt, durfte sich waschen, erhielt eine saubere Gefängnisuniform und wurde in Handschellen ins Büro des Direktors hinaufgebracht, wo ein hohes Tier aus dem Ministerium für Staatssicherheit auf ihn wartete. Es war ein fies aussehender, niederträchtiger Kerl, zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt, der behauptete, er sei Stellvertretender Minister, und der über die Privatpapiere des Genossen Stalin reden wollte.
Rapawa wurde mit Handschellen an den Stuhl gefesselt. Die Wachen wurden angewiesen, das Zimmer zu verlassen. Der Stellvertretende Minister saß am Schreibtisch des Direktors. An der Wand hinter ihm hing ein Stalin-Bild.
Es habe den Anschein, sagte der Stellvertretende Minister – nachdem er Rapawa eine Weile gemustert hatte –, als hätte der Genosse Stalin in den letzten Jahren die Gewohnheit gehabt, sich Notizen zu machen, die ihm seine gewaltigen Aufgaben erleichtern sollten. Manchmal seien diese Notizen auf ein gewöhnliches Blatt Briefpapier geschrieben worden und manchmal in ein Notizbuch, das in schwarzes Wachspapier eingeschlagen war. Das Vorhandensein dieser Notizen sei nur bestimmten Mitgliedern des Präsidiums bekannt und natürlich dem Genossen Poskrebyschew – langjähriger Sekretär des Genossen Stalin –, den der Verräter Berija kürzlich unter falschen Anschuldigungen zu Unrecht gefangengesetzt habe. Alle Zeugen stimmten darin überein, daß der Genosse Stalin diese Papiere in einem Safe in seinem Privatbüro aufbewahrte, zu dem nur er selbst einen Schlüssel gehabt habe.
Der Stellvertretende Minister lehnte sich vor. Seine dunklen Augen bohrten sich in Rapawas Gesicht.
Nach dem tragischen Tod des Genossen Stalin seien Versuche unternommen worden, diesen Schlüssel ausfindig zu machen. Er sei nicht auffindbar. Deshalb habe das Präsidium beschlossen, den Safe in Gegenwart aller aufbrechen zu lassen, damit sie feststellen konnten, ob der Genosse Stalin etwas von historischem Wert hinterlassen habe beziehungsweise etwas, was dem Zentralkomitee bei seiner schweren Aufgabe helfen könne, den Nachfolger des Genossen Stalin zu benennen.
Der Safe sei also unter Aufsicht des Präsidiums aufgebrochen worden – und leer vorgefunden, bis auf ein paar unbedeutende Kleinigkeiten wie den Parteiausweis des Genossen Stalin.
»Und jetzt«, sagte der Stellvertretende Minister und stand langsam auf, »kommen wir zum Kern der Sache.«
Er wanderte um den Schreibtisch herum und setzte sich direkt vor Rapawa auf die Kante. Oh, er war ein massiger Kerl, ein ganz schwerer Brocken.
»Wir wissen vom Genossen Malenkow«, sagte er, »daß Sie in den früheren Morgenstunden des 2. März zusammen mit dem Verräter Berija zu der Datscha in Kunzewo hinausgefahren sind und daß Sie beide mehrere Minuten mit dem Genossen Stalin allein waren. Wurde etwas aus dem Zimmer entfernt?«
»Nein, Genosse.«
»Überhaupt nichts?«
»Nein, Genosse.«
»Und wohin sind Sie von Kunzewo aus gefahren?«
»Ich habe den Genossen Berija in sein Haus zurückgefahren, Genosse.«
»Direkt zu seinem Haus zurück?«
»Ja, Genosse.«
»Sie lügen.«
»Nein, Genosse.«
»Sie lügen. Wir haben einen Zeugen, der Sie beide kurz vor Tagesanbruch im Kreml gesehen hat. Ein Wachmann hat Sie auf dem Korridor gesehen.«
»Ja, Genosse. Jetzt erinnere ich mich. Genosse Berija sagte, er müßte etwas aus seinem Büro holen.«
»Etwas aus dem Büro des Genossen Stalin!«
»Nein, Genosse.«
»Sie lügen! Sie sind ein Verräter! Sie und der englische Spion Berija sind in Stalins Büro eingebrochen und haben seine Papiere gestohlen! Wo sind diese Papiere?«
»Nein, Genösse...«
»Verräter! Dieb! Spion!«
Jedes Wort von einem Schlag ins Gesicht begleitet.
Und so weiter.
»Ich will Ihnen etwas sagen, mein Junge. Niemand weiß genau, was mit dem Chef passiert ist, sogar heute noch nicht – nicht einmal jetzt, wo Gorbatschow und Jelzin uns mit Haut und Haaren an die Kapitalisten verkauft haben und zulassen, daß die CIA in unseren Akten herumschnüffelt. Die Akten über den Chef sind immer noch geschlossen. Sie haben ihn auf dem Boden eines Wagens aus dem Kreml herausgeschmuggelt, in einen Teppich eingerollt, und manch einer behauptet, Schukow habe ihn noch am gleichen Abend erschossen. Andere wiederum sagen, er sei erst in der Woche darauf erschossen worden. Die meisten aber sagen, man habe ihn noch fünf Monate am Leben gelassen – fünf Monate! – , ihn in einem Bunker unter dem Moskauer Militärbezirk pausenlos verhört und dann nach einem Femegericht erschossen.
Auf alle Fälle wurde er erschossen. Weihnachten war er längst tot.
Und das haben sie mit mir gemacht.«
Rapawa hielt seine verstümmelten Finger hoch und bewegte sie. Dann knöpfte er unbeholfen das Hemd auf, zog es aus dem Hosenbund und drehte seinen ausgemergelten Körper so, daß Kelso den Rücken sehen konnte. Über die Wirbel zogen sich glänzende, aufgerauhte Flächen von transparentem Narbengewebe – wie Fenster, durch die man das Fleisch darunter sehen konnte. Bauch und Brustkorb sahen aus, als wären sie blauschwarz tätowiert worden.
Kelso sagte nichts. Rapawa lehnte sich zurück, ohne das Hemd wieder zuzuknöpfen. Die Narben und Tätowierungen waren die Medaillen seines Lebens. Er trug sie mit Stolz.
Kein Wort, mein Junge. Hören Sie mir überhaupt noch zu? Von mir haben sie kein einziges Wort bekommen.
Die ganze Zeit über hatte er nicht gewußt, ob der Chef noch lebte oder ob der Chef selbst geredet hatte. Aber das spielte keine Rolle: Papu Gerassimowitsch Rapawa würde auf jeden Fall den Mund halten.
Weshalb? Aus Loyalität? Ein wenig vielleicht – die Erinnerung an diese helfende Hand, die ihn aus der Grube zog. Aber er war kein so junger Narr, um nicht zu wissen, daß Schweigen seine einzige Hoffnung war. Wie lange, glauben Sie, hätte man ihn leben lassen, wenn er sie zu dieser Stelle geführt hätte? Was er unter diesem Baum vergraben hatte, war sein eigenes Todesurteil. Also Vorsicht, Vorsicht – kein einziges Wort.
Als der Winter kam, lag er zitternd auf dem Boden seiner ungeheizten Zelle und träumte von Kirschbäumen, den sterbenden und fallenden Blättern, den Ästen, die sich dunkel gegen den Himmel abzeichneten, dem Heulen der Wölfe.
Und dann, um Weihnachten herum, schienen sie wie gelangweilte Kinder plötzlich das Interesse an der ganzen Geschichte zu verlieren. Das Schlagen ging noch eine Zeitlang weiter – Sie müssen verstehen, inzwischen war es für beide Seiten eine Sache der Ehre –, aber die Fragen hörten auf, und schließlich, nach einer besonders langen und einfallsreichen Sitzung, hörte auch das Schlagen auf. Der Stellvertretende Minister kam nicht mehr, und Rapawa vermutete, daß Berija tot war. Außerdem vermutete er, daß irgend jemand zu dem Schluß gelangt war, daß Stalins Papiere, selbst wenn sie existieren sollten, besser ungelesen blieben.
Rapawa rechnete damit, jeden Moment seine sieben Gramm Blei verabreicht zu bekommen. Der Gedanke, daß das nicht geschehen könnte, kam ihm überhaupt nicht, nicht, nachdem Berija liquidiert worden war. Deshalb hatte er keinerlei handfeste Erinnerungen an die Fahrt durch den Schneesturm zum Gebäude der Roten Armee in der Komissariatski-Straße und an den improvisierten Gerichtssaal mit seinen hohen, vergitterten Fenstern und den drei Richtern. Er vergrub sein Denken unter einer Schneedecke. Er betrachtete den Schnee durch das Fenster hindurch, sah, wie er in Böen über die Moskwa und am Kai entlang wehte und die Straßenlampen auf der anderen Seite des Flusses einhüllte – große, weiße Säulen aus Schnee auf einem Todesmarsch aus dem Osten. Die Stimmen um sich herum hörte er nur wie aus der Ferne. Später, als es dunkel war und er nach draußen gebracht wurde, damit rechnete, erschossen zu werden, fragte er, ob er eine Minute auf der Treppe stehenbleiben und die Hände in den Schnee stecken dürfe. Ein Wärter fragte, warum, und Rapawa sagte: »Um noch ein letztes Mal Schnee zwischen den Finger zu fühlen, Genosse.«
Alle lachten darüber. Als sie dann begriffen, daß er es ernst meinte, lachten sie noch lauter. »Wenn es etwas gibt, Georgier, an dem es dir nie mangeln wird«, sagten sie zu ihm, als sie ihn in den Transporter stießen, »dann ist es Schnee.« Auf diese Weise erfuhr er, daß er zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit in der ostsibirischen Provinz Kolyma verurteilt worden war.
Im Jahr 1956 erließ Chruschtschow eine Amnestie für zahlreiche GULag-Gefangene, aber niemand amnestierte Papu Rapawa. Papu Rapawa wurde einfach vergessen. In den folgenden anderthalb Jahrzehnten vermoderte und fror Papu Rapawa wechselweise in den Wäldern Sibiriens – moderte dahin in den kurzen Sommern, in denen alle Gefangenen in der eigenen Fieberwolke aus Mücken schufteten, und fror in den langen Wintern, in denen das Eis die Sümpfe in Fels verwandelte.
Man sagt, daß die Leute, die die Lager überlebt haben, alle gleich aussehen, weil es – nachdem ein Mensch einmal nur noch aus Haut und Knochen bestanden hat – keine Rolle spielt, ein wie gutes Fleischpolster er sich später wieder zulegt oder wie sorgfältig er sich kleidet – er wird immer wie ein Gerippe wirken. Kelso hatte im Laufe der Zeit genügend GULag-Überlebende interviewt, um jetzt, wo Rapawa ihm das alles erzählte, eindeutig das skelettartige Lageraussehen in seinem Gesicht zu erkennen, diese Augenhöhlen, dieses Kiefergelenk. Er erkannte die hervortretenden Hand- und Knöchelgelenke und den Höcker des Brustbeins.
Er sei nicht amnestiert worden, sagte Rapawa, weil er einen Mann getötet habe, einen Tschetschenen, der versucht habe, ihn zu vergewaltigen – ihm einen Dolch in den Bauch gestoßen, den er sich aus einem Stück Säge angefertigt habe.
»Und was ist mit Ihrem Kopf passiert?« fragte Kelso.
Rapawa betastete die Narbe. Er könne sich nicht erinnern. Manchmal, wenn es besonders kalt sei, tue die Narbe weh und löse Träume aus.
»Was für Träume?«
Rapawa öffnete seine dunkle Mundhöhle, antwortete dann aber nichts darauf.
Fünfzehn Jahre ...
Man brachte ihn im Sommer 1969 nach Moskau zurück, an dem Tag, an dem die Yankees einen Mann auf den Mond schickten. Rapawa verließ die Unterkunft für ehemalige Gefangene, wanderte auf den heißen und von Menschen wimmelnden Straßen herum und konnte sich auf nichts einen Reim machen. Wo war Stalin? Das war es, was ihn verblüffte. Wo waren die Statuen und die Bilder? Wo war der Respekt? Die Jungen sahen alle aus wie Mädchen, und die Mädchen sahen alle aus wie Nutten. Das Land steckte bereits zur Hälfte in der Scheiße. Trotzdem – das müsse man zugeben – gab es damals noch Arbeit für alle, sogar für alte seki wie ihn. Sie schickten ihn in die Lokschuppen am Leningrader Bahnhof, als Arbeiter. Er war erst einundvierzig und kräftig wie ein Bär. Alles, was er auf der Welt besaß, steckte in einem Pappkarton.
»Haben Sie je geheiratet?«
Rapawa zuckte die Achseln. »Natürlich habe ich geheiratet. Nur so kam man an eine Wohnung.« Er habe geheiratet und sich in einer Unterkunft eingerichtet.
»Und was ist dann passiert? Wer war sie?«
»Sie ist gestorben. Damals war es ein anständiger Wohnblock, mein Junge, vor all den Drogen und Verbrechern.«
»Wo haben Sie gewohnt?«
»Scheißverbrecher ...«
»Hatten Sie Kinder?«
»Einen Sohn. Er ist auch gestorben. In Afghanistan. Und eine Tochter.«
»Ihre Tochter ist auch tot?«
»Nein. Sie ist eine Hure.«
»Und Stalins Papiere?«
So betrunken, wie er war, brachte Kelso es nicht fertig, diese Frage irgendwie beiläufig klingen zu lassen. Der alte Mann warf ihm einen durchtriebenen Blick zu, voller Bauernschläue.
»Reden Sie ruhig weiter, mein Junge«, sagte Rapawa sanft. »Stalins Papiere? Was soll mit Stalins Papieren sein?«
Kelso zögerte. »Ähm... angenommen, die existieren noch... könnte man sie... eventuell...«
»Sie würden sie gern einsehen?«
»Aber ja.«
Rapawa lachte. »Und ich soll sie Ihnen verschaffen, mein Junge? Fünfzehn Jahre in Kolyma, und wofür? Damit ich Ihnen helfe, noch mehr Lügen zu verbreiten? Aus reiner Hilfsbereitschaft?«
»Nein, dafür nicht. Aber im Interesse der Geschichte.«
»Geschichte? Daß ich nicht lache, mein Junge.«
»Na schön – dann eben für Geld.«
»Wie bitte?«
»Für Geld. Als Beteiligung am Gewinn. Eine Menge Geld.«
Rapawa war wieder ganz der listige Bauer und zupfte sich an der Nase. »Wieviel Geld?«
»Eine Menge. Wenn alles wahr ist. Glauben Sie mir: eine Menge Geld!«
Die momentane Stille wurde von Stimmen auf dem Gang unterbrochen, Stimmen, die sich auf englisch unterhielten. Kelso vermutete, daß es seine Historiker-Kollegen waren – Adelman, Duberstein und die anderen –, die spät von einem Abendessen zurückkehrten und sich wohl fragten, wohin er verschwunden war. Plötzlich kam es ihm ungeheuer wichtig vor, daß niemand – und schon gar nicht einer seiner Kollegen – etwas von Papu Rapawa erfuhr.
Jemand klopfte leise an die Tür. Kelso hob Schweigen gebietend eine Hand. Dann knipste er ganz leise die Nachttischlampe aus.
Sie saßen beieinander und lauschten dem Geflüster, das durch die Dunkelheit verstärkt wurde, aber trotzdem noch gedämpft und undeutlich klang. Es folgten ein weiteres Klopfen und dann ein lautes, von den anderen rasch zum Verstummen gebrachtes Auflachen. Vielleicht hatten sie gesehen, wie das Licht ausging. Vielleicht dachten sie, er hätte eine Frau bei sich – das hätte schließlich seinem Ruf entsprochen.
Nach ein paar weiteren Sekunden verklangen die Stimmen, und auf dem Gang war es wieder still. Kelso schaltete das Licht ein. Er lächelte und klopfte sich aufs Herz. Das Gesicht des alten Mannes war starr wie eine Maske, doch dann lächelte er und begann zu singen – er hatte eine zittrige, überraschend melodiöse Stimme...
Kolyma, Kolyma,Was für ein wundervolles Nest!Zwölf Monate Winter,Sommer den ganzen Rest...
Nach seiner Freilassung war er nur das eine und sonst nichts: Papu Rapawa, Eisenbahnarbeiter, der einige Zeit in den Lagern gewesen war, und wenn jemand mehr wissen wollte – Ehrlich? Erzähl mal, Genosse! – , dann hatte er immer seine Fäuste oder eine Brechstange parat.
Zwei Männer beobachteten ihn von Anfang an. Antipin, der im Lenin-Schuppen Nr. 1 Vorarbeiter war, und ein Krüppel in der Wohnung im Erdgeschoß, der Senka hieß. Was waren die doch für ein prachtvolles Paar von Kanarienvögeln! Man konnte regelrecht hören, wie sie dem KGB etwas vorsangen, noch bevor man den Raum verlassen hatte. Die anderen kamen und gingen – die Männer, die ihn zu Fuß oder aus geparkten Wagen heraus beschatteten, die Männer, die »Routinefragen, Genosse« stellten –, aber Antipin und Senka waren die getreuen Beschatter, obwohl sie nie etwas herausbekamen, keiner von beiden. Rapawa hatte seine Vergangenheit in einem Loch begraben, das noch wesentlich tiefer war als jenes, das er für Berija ausgehoben hatte.
Senka war vor fünf Jahren gestorben. Was aus Antipin geworden war, entzog sich seiner Kenntnis. Der Lenin-Schuppen Nr. 1 gehörte jetzt einem privaten Kollektiv, das französischen Wein importierte.
»Stalins Papiere, mein Junge? Wen interessieren die schon groß? Ich fürchte mich jetzt vor nichts und niemandem mehr. – Eine Menge Geld, haben Sie gesagt? Also... also...« Er beugte sich vor und spuckte in den Aschenbecher, dann schien er einzunicken. Nach einer Weile murmelte er: »Mein Junge ist gestorben. Habe ich das schon erzählt?«
»Ja.«
»Er starb in einem nächtlichen Hinterhalt auf der Straße nach Mazar-i-Sharif. Einer der letzten, die man nach Afghanistan geschickt hat. Umgebracht von Steinzeitteufeln mit geschwärzten Gesichtern und Yankee-Raketen. Kann sich irgend jemand vorstellen, daß Stalin zugelassen hätte, daß das Land von solchen Wilden gedemütigt wird? Nicht auszudenken! Er hätte sie zu Staub zermalmt und das Pulver in Sibirien verstreut!« Nachdem der Junge tot war, hatte Rapawa sich das Wandern angewöhnt. Lange Wanderungen, die einen Tag und eine Nacht dauern konnten. Er durchquerte die Stadt von Perowo bis zu den Seen, vom Bitsewski-Park bis zum Fernsehturm. Und auf einer dieser Wanderungen – »es muß vor sechs oder sieben Jahren gewesen sein, ungefähr um die Zeit des Putsches« – sei er ganz zufällig in einen seiner eigenen Träume hineinspaziert. Zuerst habe er sich keinen Reim darauf machen können. Dann habe er begriffen, daß er in der Wspolny-Straße war. Er habe sich schnell aus dem Staub gemacht. »Mein Junge war Funker in einer Panzereinheit gewesen. Spielte gern an Funkgeräten herum. Kein Kämpfer.«
»Und das Haus?« sagte Kelso. »Stand das Haus noch?«
»Er war neunzehn.«
»Und das Haus? Was ist aus dem Haus geworden?«
Rapawas Kopf sackte herunter.
»Das Haus, Genosse...«
»Da war ein roter Halbmond und ein roter Stern. Und das Haus wurde von Teufeln mit geschwärzten Gesichtern bewacht...«
Danach konnte Kelso nichts Vernünftiges mehr aus ihm herausholen. Die Augenlider des alten Mannes flatterten und fielen zu. Sein Mund erschlaffte, gelber Speichel rann heraus.
Kelso beobachtete ihn ein oder zwei Minuten lang, spürte, wie sich in seinem Magen ein Druck aufbaute, dann stand er plötzlich auf und bewegte sich, so schnell er konnte, ins Badezimmer, wo er sich heftig und ausgiebig erbrach. Er legte die heiße Stirn an das kühle Emaillebecken und leckte sich die Lippen. Seine Zunge kam ihm riesig vor und schmeckte bitter, wie eine aufgequollene schwarze Frucht. Irgend etwas steckte ihm in der Kehle. Er versuchte, es durch Husten herauszubekommen, und als das nicht funktionierte, versuchte er es mit Schlucken und mußte sich prompt abermals übergeben. Als er den Kopf zurückzog, schienen sich die Badezimmerarmaturen aus ihren Verankerungen gelöst zu haben und in einem langsamen Stammestanz um ihn herum zu kreisen. Ein silbriger Schleimfaden spannte sich in einem schimmernden Bogen von seiner Nase zum Toilettensitz.
Halt durch, befahl er sich. Auch das geht vorüber.
Er klammerte sich wieder an das kühle weiße Becken wie ein ertrinkender Mann. Der Horizont kippte, und das Zimmer kam ins Rutschen.