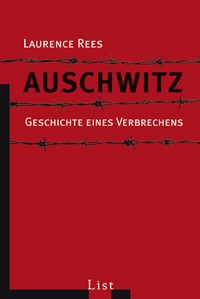
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dieser ebenso fundierten wie erschütternden Darstellung gelingt es Laurence Rees, dem Leser die unfaßbaren Geschehnisse des Holocaust nachvollziehbar vor Augen zu führen – mit einem beunruhigenden Fazit: Der Holocaust ist kein düsterer Alptraum, kein singulärer Exzeß, sondern Ergebnis der menschlichen Veranlagung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
»Auschwitz« steht für ein einmaliges, unfaßbares Verbrechen. Doch es steht nicht außerhalb von Raum und Zeit. Die dortige Ermordung von etwa 1,3 Millionen Menschen – überwiegend Juden – war Abschluß und Höhepunkt der nationalsozialistischen Umsiedlungs- und Vernichtungspolitik, die auf verschiedenen Entscheidungsebenen mehrere Stadien durchlief. Laurence Rees hat in 15 Jahren Recherche Zeitzeugen in ganz Europa befragen können, die hier erstmals über ihr Erleben sprechen. In seinem ausgewogenen, fundierten und erschütternden Buch gelingt es ihm, dem Leser das unfaßbare Geschehen begreifbar zu machen.
Der Autor
Laurence Rees ist einer der führenden Regisseure und Produzenten historischer Dokumentationen. Seine Serien für die BBC erreichen weltweit ein Millionenpublikum. Er ist Autor mehrerer Bücher.
Laurence Rees
Auschwitz
Geschichte eines Verbrechens
Aus dem Englischen vonPetra Post, Udo Rennert, Ilse Strasmanund Andrea von Struve
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.list-taschenbuch.de
Bildnachweis:
Archiv Walter Frentz: 2; Auschwitz Museum: 13, 25–27;
Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz: 3; Hans Friedrich: 4;
Helena Citrónavá: 19; Jüdisches Museum Frankfurt am
Main: 6–10; Kazimierz Piechowski: 17; Oskar Gröning: 16;
Ullstein Bild: 5; Wendy Davenport: 18;
Yad Vashem: 1, 11, 12, 15, 20–24, 28
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1. Auflage März 2007 4. Auflage 2009 © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 / Ullstein Verlag Umschlaggestaltung: RME – Roland Eschlbeck und Kornelia Bunkofer (nach einer Vorlage von Büro Jorge Schmidt, München) Titelabbildung: Corbis Satz: LVD GmbH, Berlin eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany eBook ISBN 978-3-8437-0189-1
Inhalt
Einführung
1. Die Anfänge
2. Befehle und Initiativen
3. Todesfabriken
4. Korruption
5. Hemmungsloses Morden
6. Befreiung und Vergeltung
Danksagung
Anmerkungen
Einführung
Es steht viel Verstörendes in diesem Buch; trotzdem meine ich, daß die Arbeit notwendig war. Nicht nur, weil Umfragen1 gezeigt haben, daß im allgemeinen Bewußtsein noch Verwirrung über die Geschichte von Auschwitz herrscht, sondern auch weil ich hoffe, daß dieses Buch etwas Spezifisches beiträgt.
Es ist das Resultat von 15 Jahren der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in Fernsehsendungen und Büchern, und es ist ein Versuch zu zeigen, daß man eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte am besten versteht, wenn man es durch das Prisma eines Ortes betrachtet: Auschwitz. Für Auschwitz gibt es, anders als für den Antisemitismus, ein ganz bestimmtes Anfangsdatum (die ersten polnischen Gefangenen kamen am 14. Juni 1940 hierher), und ebenso gibt es, anders als für die Geschichte des Völkermords, ein genau definiertes Ende (das Lager wurde am 27. Januar 1945 befreit). Zwischen diesen zwei Daten erlebte Auschwitz eine komplexe und befremdliche Geschichte, die in vielerlei Hinsicht die Undurchschaubarkeit der Rassen- und Volkspolitik der Nationalsozialisten spiegelte. Auschwitz war nicht als ein Lager geplant, in dem Juden vernichtet werden sollten, es war ja auch nicht nur mit der »Endlösung« befaßt – obwohl die zum beherrschenden Merkmal wurde –, und es veränderte sich ständig, oft als Reaktion auf das wechselnde Kriegsglück der Deutschen anderswo. Auschwitz war mit seiner destruktiven Dynamik die Verkörperung der Grundwerte des NS-Staates.
Die Beschäftigung mit Auschwitz bietet uns noch etwas anderes als Einsichten in den Nationalsozialismus; sie gibt uns die Möglichkeit zu verstehen, wie Menschen sich unter extremsten Bedingungen verhalten haben. Aus dieser Geschichte erfahren wir viel über uns selbst.
Dieses Buch beruht auf ungewöhnlichen Forschungen – etwa einhundert hierfür geführten Interviews mit ehemaligen NS-Tätern und mit Überlebenden des Lagers –, und stützt sich darüber hinaus auf Hunderte von weiteren Gesprächen aus meiner früheren Arbeit über das »Dritte Reich«, darunter mit vielen ehemaligen Mitgliedern der NSDAP.2 Wenn man Überlebende und Täter persönlich trifft und mit ihnen sprechen kann, ist das von größtem Vorteil. Es bietet Möglichkeiten zu einem Niveau an Einsichten, die sich kaum aus geschriebenen Quellen allein erschließen würden. Ich bin eigentlich seit meiner Schulzeit an dieser historischen Epoche interessiert, aber den tiefsten Eindruck, den ich vom »Dritten Reich« bekam, kann ich an einem ganz bestimmten Gespräch mit einem früheren Mitglied der NSDAP im Jahr 1990 festmachen. Ich arbeitete an einem Film über Joseph Goebbels und sprach deshalb mit Wilfred von Oven, der eng mit dem berüchtigten Reichspropagandaminister zusammengearbeitet hatte. Als wir nach dem eigentlichen Interview noch bei einer Tasse Tee zusammensaßen, fragte ich diesen intelligenten und charmanten Menschen: »Wenn Sie Ihre Erfahrungen aus dem ›Dritten Reich‹ in einem einzigen Wort zusammenfassen könnten, wie würde das lauten?« Während Herr von Oven einen Augenblick über die Frage nachdachte, vermutete ich, daß sich seine Antwort auf die schrecklichen Verbrechen des Regimes beziehen würde – Verbrechen, die er offen zugegeben hatte – und auf das Elend, das der Nationalsozialismus über die Welt gebracht hatte. »Na ja«, sagte er schließlich, »wenn ich meine eigenen Erfahrungen mit dem ›Dritten Reich‹ in ein Wort fassen soll, dann ist es das Wort – paradiesisch.«
»Paradiesisch«? Das vertrug sich nicht mit dem, was ich in meinen Geschichtsbüchern gelesen hatte. Es paßte auch nicht zu diesem eleganten, gebildeten Mann, der da vor mir saß und der übrigens auch nicht so aussah und nicht so sprach, wie ich mir einen alten Nationalsozialisten vorgestellt hatte. Aber »paradiesisch«? Wie konnte er so etwas sagen? Wie konnte ein intelligenter Mensch auf diese Weise an das »Dritte Reich« und seine Greuel denken? Überhaupt, wie war es möglich, daß im 20. Jahrhundert Menschen aus Deutschland, Angehörige eines Kulturvolks im Herzen Europas, solche Verbrechen begangen hatten? Das waren die Fragen, die an diesem Nachmittag vor Jahren in meinem Kopf Gestalt annahmen und die mich noch heute beschäftigen.
Bei meiner Suche nach Antworten halfen mir zwei historische Zufälle. Zum einen machte ich mich an die Befragung ehemaliger Nationalsozialisten genau zu dem richtigen Zeitpunkt, an dem nämlich die meisten nichts mehr zu verlieren hatten, wenn sie offen sprachen. Fünfzehn Jahre zuvor hatten sie einflußreiche Stellungen bekleidet und waren Stützen der Gesellschaft gewesen und hätten deshalb nicht geredet. Heute sind die meisten von ihnen, auch der charmante Herr von Oven, tot.
Wir brauchten oft Monate, in einigen Fällen Jahre, ehe sie uns gestatteten, ein Interview aufzuzeichnen. Man weiß nie genau, was die Waagschale zu unseren Gunsten senkte und Menschen veranlaßte, sich mit dem Filmen einverstanden zu erklären, aber in vielen Fällen wollten sie offenbar, da sie dem Ende des Lebens näher rückten, ihre Erfahrungen aus dieser bedeutenden Zeit – mit allen Fehlern und Schwächen – protokollieren lassen. Außerdem glaubten sie, daß die BBC ihren Beitrag nicht verzerren würde. Ich möchte hinzufügen, daß nur die BBC uns die notwendige Unterstützung bei diesem Unternehmen bieten konnte. Die Durchführung des Projekts nahm so viel Zeit in Anspruch, daß nur eine öffentlich-rechtliche Anstalt dieses Engagement auf sich nehmen konnte.
Zum anderen hatte ich das Glück, daß mein Interesse mit dem Fall der Berliner Mauer und der Öffnung Osteuropas zusammentraf; nicht nur die Archive, auch die Menschen wurden der Forschung zugänglich. Ich hatte 1989 unter dem Kommunismus in der Sowjetunion gefilmt, und damals war es schwer gewesen, jemanden dazu zu bringen, daß er sich anders als in Propagandasprüchen über die Geschichte seines Landes äußerte. Jetzt, in den neunziger Jahren, war es plötzlich, als sei ein Damm gebrochen, und all die unterdrückten Erinnerungen und Meinungen purzelten heraus. In den baltischen Staaten erzählten mir Menschen, wie sie die Nationalsozialisten als Befreier willkommen geheißen hätten; auf den wilden Kalmückensteppen hörte ich aus erster Hand von Stalins rachsüchtigen Deportationen ganzer Volksgruppen; in Sibirien traf ich ehemalige Kriegsteilnehmer, die zweimal eingesperrt worden waren – einmal von Hitler und einmal von dem sowjetischen Diktator, und in einem Dorf bei Minsk begegnete ich einer Frau, die mitten in den scheußlichsten Partisanenkrieg der neueren Geschichte geraten war und nach einigem Nachdenken fand, daß die Partisanen der Roten Armee schlimmer gewesen wären als die Deutschen. Alle diese Überzeugungen wären mit den Menschen gestorben, wenn der Kommunismus nicht zusammengebrochen wäre.
Ich traf auf noch Erschreckenderes, als ich durch diese kurz zuvor befreiten Länder reiste, von Litauen bis zur Ukraine und von Serbien bis Weißrußland: auf bösartigen Antisemitismus. Ich hatte damit gerechnet, daß mir die Menschen erzählen würden, wie sehr sie den Kommunismus haßten; das schien nur natürlich. Aber daß sie Juden haßten? Das schien mir grotesk, zumal an den Orten, die ich aufsuchte, kaum noch Juden lebten – dafür hatten Hitler und die Nationalsozialisten gesorgt. Dennoch fand der alte Mann im Baltikum, der 1941 den Deutschen geholfen hatte, Juden zu erschießen, daß er 60 Jahre zuvor richtig gehandelt hätte. Und selbst einige von denen, die gegen die Deutschen gekämpft hatten, vertraten antisemitische Überzeugungen. Ich weiß noch, was mich ein ukrainischer ehemaliger Kämpfer beim Essen fragte. Der Mann hatte tapfer mit den ukrainischen nationalistischen Partisanen sowohl gegen die deutsche Wehrmacht als auch gegen die Rote Armee gekämpft und war dementsprechend drangsaliert worden. »Was halten Sie von der Ansicht«, fragte er mich, »daß es eine von New York ausgehende internationale Verschwörung des Finanzjudentums gibt, die alle nichtjüdischen Regierungen zu vernichten versucht?« Ich starrte ihn einen Augenblick an. Ich selbst bin kein Jude, und es ist für mich immer ein Schock, wenn ich unerwartet auf nackten Antisemitismus stoße. »Was ich davon halte?«, antwortete ich schließlich. »Ich halte das für absoluten Quatsch.« Der alten Partisan trank einen Schluck Wodka. »Tatsächlich«, sagte er, »ist das Ihre Meinung. Sehr interessant …«
Besonders erschreckend fand ich, daß diese antisemitischen Anschauungen nicht auf die ältere Generation beschränkt waren. Ich erinnere mich an eine Frau am Flugschalter der Lithuanian Airways, die, als sie hörte, was für einen Film wir machen wollten, sagte: »Sie interessieren sich also für die Juden, ja? Aber denken Sie daran – Marx war Jude!« Ebenfalls in Litauen zeigte mir ein Armeeoffizier von Mitte Zwanzig das ehemalige Fort bei Kaunas, wo 1941 Massaker an den Juden verübt worden waren, und sagte: »Sie haben das Wesentliche nicht erfaßt, wissen Sie? Es geht nicht um das, was wir den Juden angetan haben. Es geht um das, was die Juden uns angetan haben.« Ich würde nicht behaupten, daß alle Menschen – oder auch nur die Mehrheit – in den Ländern Osteuropas, die ich besucht habe, diese Ansichten teilen. Aber daß diese Art Vorurteil überhaupt so offen geäußert wird, ist beunruhigend.
Daran sollten die Menschen denken, die der Meinung sind, daß die Geschichte in diesem Buch heute keine Bedeutung mehr hat. Und auch diejenigen, die glauben, der ätzende Antisemitismus sei irgendwie auf die Nationalsozialisten oder gar Hitler beschränkt gewesen. Tatsächlich ist die Ansicht, die Vernichtung der Juden sei irgendwie von ein paar Verrückten einem widerstrebenden Europa aufgezwungen worden, eine der gefährlichsten überhaupt. Die deutsche Gesellschaft war auch nicht »einzigartig« in ihrer Mordlust, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gelangten. Wie denn auch, wo doch viele Juden noch in den zwanziger Jahren vor dem Antisemitismus in Osteuropa flohen und in Deutschland Zuflucht suchten?
Trotzdem ist etwas an der Denkart der Nationalsozialisten, das nicht in Übereinstimmung mit der anderer Täter in anderen totalitären Regimen steht. Zu diesem Schluß kam ich jedenfalls, nachdem ich mich dreimal mit dem Thema Zweiter Weltkrieg befaßt hatte, jeweils mit einem Buch und einer Fernsehserie: zuerst Nazis: A Warning from History (»Nazis – eine Warnung der Geschichte«), dann War of the Century (»Jahrhundertkrieg«) über den Krieg zwischen Stalin und Hitler und schließlich Horror in the East (»Grauen im Osten«), ein Versuch, die japanische Psyche in den dreißiger Jahren und während des Zweiten Weltkriegs zu verstehen. Eine nicht geplante Folge war, daß ich meines Wissens der einzige Mensch bin, der eine wesentliche Zahl von Tätern aller drei großen totalitären Kriegsmächte getroffen und befragt hat: Deutschlands, Japans und der Sowjetunion. Und ich kann sagen, daß die NS-Kriegsverbrecher, denen ich begegnet bin, anders waren.
In der Sowjetunion unter Stalin war das Klima der Angst so alles beherrschend, wie es das in Deutschland unter Hitler bis zu den letzten Kriegstagen nicht gewesen ist. Die Beschreibung eines ehemaligen sowjetischen Luftwaffenoffiziers von öffentlichen Versammlungen in den dreißiger Jahren, wo jeder als »Volksfeind« denunziert werden konnte, verfolgt mich noch heute. Niemand konnte sicher sein, daß es nicht um Mitternacht bei ihm klopfte. Egal wie man sich bemühte, alles richtig zu machen, egal wie viel Schlagworte man herunterrasselte, Stalins Bösartigkeit war so groß, daß nichts, was man sagte oder tat, einen retten konnte, wenn man einmal ins Scheinwerferlicht geraten war. Im nationalsozialistischen Deutschland dagegen konntest du, wenn du nicht gerade zu einer Risikogruppe gehörtest – Juden, Kommunisten, »Zigeuner«, Homosexuelle, »Arbeitsscheue« und natürlich alle, die das Regime bekämpften –, relativ angstfrei leben. Trotz der neueren wissenschaftlichen Arbeiten, die zu Recht betonen, daß die Gestapo bei ihrer Arbeit sehr auf Denunziationen aus der Bevölkerung angewiesen war3, bleibt doch die Tatsache bestehen, daß die Mehrheit der deutschen Bevölkerung bis zu dem Augenblick, in dem Deutschland den Krieg zu verlieren begann, sich so geborgen und glücklich fühlte, daß sie auch dann dafür gestimmt hätte, Hitler an der Macht zu halten, wenn es freie und faire Wahlen gegeben hätte. In der Sowjetunion dagegen hatten nicht einmal Stalins engste und treueste Mitarbeiter das Gefühl, sie dürften ruhig schlafen.
Diejenigen, die auf Stalins Befehl Verbrechen begingen, kannten oft die Gründe dafür nicht; die Leiden, die sie anderen zufügten, waren reine Akte der Willkür. Der ehemalige sowjetische Geheimpolizist zum Beispiel, der Kalmükken in Züge mit dem Ziel Sibirien verfrachtet hatte, wußte auch heute noch nicht genau, was hinter dieser Politik gesteckt hatte. Er hatte eine stereotype Antwort parat, wenn er gefragt wurde, weshalb er sich daran beteiligt hatte – pikanterweise die, die allgemein den Nationalsozialisten immer zugeschrieben wird. Er sagte, er habe »auf Befehl« gehandelt. Er hatte ein Verbrechen begangen, weil man es ihm befohlen hatte und weil er wußte, daß er erschossen werden würde, wenn er es nicht ausführte, und er verließ sich darauf, daß seine Vorgesetzten schon wüßten, was sie taten. Das bedeutete natürlich, daß er, als Stalin gestorben war und der Kommunismus im Niedergang war, befreit weitermachen und die Vergangenheit hinter sich lassen konnte. Es kennzeichnet Stalin auch als grausamen, tyrannischen Diktator, für den es viele Parallelen in der Geschichte gibt, nicht zuletzt in unserer Zeit Saddam Hussein.
Und dann bin ich japanischen Kriegsverbrechern begegnet, die einige der entsetzlichsten Greueltaten der neueren Geschichte begangen haben. Japanische Soldaten schlitzten in China schwangeren Frauen den Bauch auf und erstachen die Föten mit dem Bajonett, sie fesselten Bauern und benutzten sie zum Scheibenschießen; sie folterten Tausende von unschuldigen Menschen auf eine Weise, die den schlimmsten Praktiken der Gestapo gleichkommen, und sie führten lange vor Dr. Mengele und Auschwitz mörderische medizinische Experimente durch. Diese Menschen wurden für undurchschaubar gehalten. Aber bei näherer Betrachtung waren sie es nicht. Sie waren in einer höchst militaristischen Gesellschaft aufgewachsen und dann einer militärischen Ausbildung brutalster Art unterworfen worden; man hatte ihnen, seit sie Kinder waren, befohlen, ihren Kaiser (der auch ihr Oberkommandierender war) zu vergöttern, und sie lebten in einer Kultur, die den allzu menschlichen Wunsch, sich anzupassen, quasi zur Religion erhob. All das steckte in einem ehemaligen Soldaten, der mir erzählte, wie er aufgefordert worden war, an der Massenvergewaltigung einer chinesischen Frau teilzunehmen: Er hatte das weniger als Sexualakt betrachtet, denn als Zeichen, daß er endlich von der Gruppe akzeptiert worden war, deren Mitglieder ihn bis dahin zum Teil gnadenlos schikaniert hatten. Wie die sowjetischen Geheimpolizisten, die ich getroffen hatte, hatten diese Japaner versucht, ihre Taten fast ausschließlich mit Hinweisen auf von außen einwirkende Gründe zu rechtfertigen – das Regime selbst.
Im Denken vieler NS-Kriegsverbrecher zeigt sich etwas anderes, und es ist in diesem Buch verkörpert in dem Interview mit Hans Friedrich, der zugibt, daß er als Mitglied einer SS-Einheit im Osten selbst Juden erschossen hat. Noch heute, wo das NS-Regime seit langem besiegt ist, tut ihm nicht leid, was er getan hat. Es wäre leicht für ihn, sich hinter dem »Befehlsnotstand« zu verstecken oder zu sagen: »Ich stand zu sehr unter dem Einfluß der Propaganda«, aber seine innersten Überzeugungen sind so stark, daß er das nicht tut. Er hat es damals für richtig gehalten, Juden zu erschießen, und tut es allem Anschein nach auch heute noch. Es ist eine ekelhafte, verabscheuungswürdige Haltung – aber sie fasziniert mich. Und zeitgenössische Aussagen zeigen, daß er damit nicht allein ist. In den Unterlagen von Auschwitz ist zum Beispiel nicht ein einziger Fall belegt, wo ein SS-Mann belangt worden wäre, weil er sich geweigert hätte, an den Tötungen teilzunehmen. Dagegen gibt es viel Material, das zeigt, daß das eigentliche Problem mit der Disziplin im Lager – aus der Sicht der SS-Führung – Diebstahl war. Gewöhnliche SS-Männer scheinen mit der NS-Führung einig gewesen zu sein, daß es richtig war, die Juden zu töten, aber mit diesem Grundsatz Himmlers, der ihnen persönliche Bereicherung versagte, waren sie nicht einverstanden. Und die Strafen für einen SS-Mann, der beim Stehlen erwischt worden war, konnten drakonisch sein – sicherlich schlimmer als dafür, daß sich jemand weigerte, sich aktiv am Töten zu beteiligen.
So bin ich, nicht nur durch die Interviews, sondern auch durch nachfolgende Forschungen4 in den Archiven und Gespräche mit Wissenschaftlern zu dem Schluß gekommen, daß einzelne, die innerhalb des NS-Systems Verbrechen begangen hatten, eher die persönliche Verantwortung für ihre Taten übernahmen, als es bei Kriegsverbrechern, die Stalin oder Hirohito dienten, der Fall war. Natürlich ist das eine Verallgemeinerung, und es wird in jedem Regime Menschen geben, die diesem Muster nicht entsprechen. Diesen Regimen war ja auch viel gemeinsam – nicht zuletzt die Abhängigkeit von einer intensiven ideologischen Propaganda von oben. Aber als Verallgemeinerung ist das brauchbar, was um so merkwürdiger ist, als die SS streng trainiert wurde und das Klischee vom deutschen Soldaten als Roboter weit verbreitet ist. Wie wir sehen werden, trug die Neigung einzelner Nationalsozialisten, die Verbrechen begangen haben, um persönlich Herr der Lage zu bleiben, zur Entwicklung sowohl von Auschwitz als auch der »Endlösung« bei.
Sinnvoll ist es auch, wenn man zu verstehen versucht, warum so viele der ehemaligen Nationalsozialisten, denen ich in den letzten 15 Jahren begegnet bin, lieber eine innere Rechtfertigung für ihre Verbrechen suchen (»ich fand das richtig«) als eine äußere (»es wurde mir befohlen«). Eine Erklärung ist sicher, daß die Nationalsozialisten sich bewußt auf längst bestehende Überzeugungen stützten. Antisemitismus existierte in Deutschland lange vor Adolf Hitler, und sehr viele Menschen gaben den Juden – zu Unrecht – die Schuld an Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg. Tatsächlich war das politische Programm der Nationalsozialisten Anfang der zwanziger Jahre schlicht nicht von dem zahlloser anderer nationalistischer rechter Gruppierungen zu unterscheiden. Hitler war kein originaler politischer Denker, was er mitbrachte, war die Originalität seiner Führerschaft. Als zu Beginn der dreißiger Jahre die Weltwirtschaftskrise Deutschland erfaßte, wandten sich Millionen Deutsche freiwillig den Nationalsozialisten zu, weil sie von ihnen eine Beseitigung der Mißstände erhofften. Bei den Wahlen 1932 wurde niemand gezwungen, für die Nationalsozialisten zu stimmen, trotzdem gelangten sie an die Macht und bauten diese im Rahmen der bestehenden Gesetze aus.
Ein weiterer Grund dafür, daß so viele Menschen das NS-Glaubenssystem verinnerlichten, war die Arbeit von Joseph Goebbels5, dem erfolgreichsten Propagandisten des 20. Jahrhunderts. Im allgemeinen Bewußtsein wird er oft als plumper Polemiker abgetan, berüchtigt wegen des infamen Films Der ewige Jude, in dem Szenen mit Juden unterbrochen waren von Aufnahmen von Ratten. In Wirklichkeit war seine Arbeit großenteils viel raffinierter und hinterlistiger. Hitler war es, der sich für solche Haßfilme wie Der ewige Jude begeisterte; Goebbels mochte diese kümmerliche Methode nicht und zog den viel subtileren Jud Süß vor, ein Drama, in dem die schöne »arische« Jungfrau von einem Juden vergewaltigt wurde. Goebbels eigene Publikumsforschung (er war von dieser Wissenschaft besessen) zeigte, daß er recht hatte: Die Kinobesucher zogen Propagandafilme vor, in denen, wie er es ausdrückte, die Kunst nicht so sichtbar würde.
Goebbels fand es besser, vorhandene Vorurteile des Publikums zu verstärken, als zu versuchen, jemandes Meinung zu ändern. Wenn es aber nötig war, die Ansichten der Deutschen zu verändern, war seine Methode die, »im Konvoi zu fahren – immer in der Geschwindigkeit des langsamsten Schiffes«6, und dann die Botschaft, die er dem Publikum nahebringen wollte, ständig zu wiederholen, in immer neuer Weise. Dabei versuchte er selten, die Zuschauer unter Druck zu setzen: Er zeigte Bilder und erzählte Geschichten, die gewöhnliche Deutsche zu den gewünschten Schlußfolgerungen führten; so ließ er sie in dem Glauben, sie seien von selbst darauf gekommen.
In den dreißiger Jahren versuchte Hitler nicht oft, der Bevölkerung seine Politik gegen ihren Willen aufzuzwingen, und fand damit Goebbels’ Beifall. Sicher, es war ein radikales Regime, aber doch eines, das auf die Zustimmung der Mehrheit Wert legte und bei der Dynamik, die es sich wünschte, in großem Maß auf persönliche Initiativen von unten angewiesen war. Und das hieß wiederum, daß die Nationalsozialisten bei der Verfolgung der Juden vorsichtig vorgingen. Obwohl der Judenhaß für Hitler eine zentrale Rolle spielte, stellte er ihn bei den Wahlen Anfang 1933 nicht unverhohlen in den Vordergrund. Er verbarg seinen Antisemitismus nicht, aber er und die Nationalsozialisten betonten bewußt andere Dinge, so etwa den Wunsch, das »Unrecht von Versailles« wiedergutzumachen, den Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen und ein Gefühl von Nationalstolz wiederherzustellen. Kurz nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, gab es den ersten Ausbruch von Gewalttätigkeit gegen die deutschen Juden, großenteils inszeniert von der SA. Dann kam der Boykott jüdischer Geschäfte (den der glühende Antisemit Goebbels unterstützte), aber der dauerte nur einen Tag. Die NSFührung sorgte sich um die öffentliche Meinung im In- wie im Ausland; vor allem wollte sie vermeiden, daß Deutschland wegen seines Antisemitismus zum Paria wurde. 1935 wurden dann die »Nürnberger Gesetze« erlassen, mit denen den Juden die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wurde, und 1938 wurden in der Pogromnacht, der sogenannten Kristallnacht, Synagogen in Brand gesteckt und Tausende von Juden eingesperrt – das waren die auffallendsten weiteren Maßnahmen gegen die Juden vor dem Krieg. Aber insgesamt wurde die antisemitische Politik in vielen kleinen Schritten entwickelt, und viele Juden versuchten in den dreißiger Jahren in Hitler-Deutschland durchzuhalten. Die antijüdische Propaganda wurde (ausgenommen fanatische Randerscheinungen wie Julius Streicher mit seinem schändlichen Schmutzblatt Der Stürmer) mit Goebbels’ Geschwindigkeit des »langsamsten Schiffes« fortgesetzt, und keiner der offen antisemitischen Filme wie Der ewige Jude oder Jud Süß erschien vor dem Krieg.
Die Vorstellung, daß die Nationalsozialisten in vielen kleinen Schritten gegen die Juden vorgingen, läuft dem verständlichen Wunsch zuwider, für die wesentliche Entscheidung für die »Endlösung« und die Gaskammern von Auschwitz einen bestimmten Zeitpunkt herauszustellen. Aber so einfach ist das nicht. Es dauerte Jahre, bis die Tötungsmaschinerie so perfektioniert war, daß Eisenbahnverbindungen jüdische Familien fast bis ans Krematorium brachten. Ein Historiker hat das Verhalten des NS-Regimes als »kumulative Radikalisierung«7 bezeichnet, wo eine Entscheidung oft in eine Krise führte, die noch radikalere Entscheidungen verlangte. Ein Beispiel dafür, wie sich Ereignisse zu einer Katastrophe aufschaukeln können, war der Nahrungsmangel im Ghetto von Łódz im Sommer 1941. Die Lage war so, daß ein NS-Funktionär anfragte: »Es ist ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnellwirkendes Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen.«8 So wird der Gedanke der Vernichtung als Akt der Menschlichkeit vorgestellt. Wobei man natürlich nicht vergessen sollte, daß die Politik der NS-Führung diese Lebensmittelkrise im Ghetto von Łódz überhaupt erst heraufbeschworen hatte.
Das soll nicht heißen, daß Hitler nicht für das Verbrechen verantwortlich war – das war er! –, aber er war verantwortlich in viel unheilvollerer Weise als der, daß er etwa seine Untergebenen an einem bestimmten Tag zusammengerufen und ihnen seinen Beschluß aufgezwungen hätte. Alle maßgeblichen Nationalsozialisten wußten, daß ihr »Führer« eines bei der politischen Arbeit besonders schätzte: Radikalismus. Hitler hat einmal gesagt, er hätte es gern, wenn seine Generäle wie Hunde an der Leine zerrten (aber genau da enttäuschten sie ihn meist). Seine Vorliebe für die Radikalität sowie seine Methode, innerhalb der nationalsozialistischen Führung die Konkurrenz zu fördern, indem er oft zwei Leuten mehr oder weniger dieselbe Aufgabe stellte, bewirkten eine erhebliche Dynamik in Politik und Verwaltung – und eine starke innere Instabilität. Jeder wußte, wie Hitler die Juden haßte, jeder hatte 1939 seine Rede im Reichstag gehört, in der er die »Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa« androhte für den Fall, daß es ihnen gelingen sollte, »die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen«. Jeder in der NS-Führung wußte, welche Art von Maßnahmen gegenüber den Juden er vorschlagen mußte – je radikaler, desto besser.
Hitler war während des Zweiten Weltkriegs sehr in Anspruch genommen von einer Aufgabe: dem Versuch, ihn zu gewinnen. Er beschäftigte sich weniger mit der »Judenfrage« als mit der komplizierten militärischen Strategie. Seine Haltung in der Judenpolitik entsprach wahrscheinlich den Instruktionen, die er den Gauleitern von Danzig, Westpreußen und dem Warthegau gab, als er sagte, er wünschte ihre Gebiete »germanisiert« zu sehen, und wenn sie diese Aufgabe erledigt hätten, würde er keine Fragen stellen, wie sie das bewerkstelligt hätten. Man kann sich leicht vorstellen, daß Hitler im Dezember 1941 zu Himmler gesagt hat, er wünschte die »Vernichtung« der Juden, und er würde hinterher nicht nachfragen, wie er das gemacht hätte. Wir wissen nicht, ob so ein Gespräch so stattgefunden hat, denn Hitler bemühte sich während des Krieges, Himmler als Puffer zwischen sich und der Durchführung der »Endlösung« zu benutzen. Hitler kannte das Ausmaß des Verbrechens, das die Nationalsozialisten vorhatten, und wollte nicht, daß irgendein Schriftstück ihn damit in Verbindung brachte. Aber seine Handschrift ist überall zu erkennen – von seinen Haßreden bis zu dem engen Zusammenhang zwischen Himmlers Treffen mit Hitler in seinem ostpreußischen Hauptquartier Wolfsschanze und der folgenden Radikalisierung der Verfolgung und Ermordung der Juden.
Es ist kaum zu vermitteln, mit welcher Begeisterung führende Nationalsozialisten einem Mann dienten, der in solchen Dimensionen zu träumen wagte. Hitler hatte davon geträumt, Frankreich innerhalb von Wochen niederzuwerfen – das Land, in dem die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg jahrelang steckengeblieben war –, und es war ihm gelungen. Er hatte davon geträumt, die Sowjetunion zu erobern, und im Sommer und Herbst 1941 sah es fast so aus, als würde er gewinnen. Und er träumte davon, die Juden zu vernichten, was sich in gewisser Weise als die einfachste dieser Aufgaben erweisen sollte.
Hitlers Ambitionen bewegten sich in imposanten Größenordnungen – aber sie waren alle destruktiv, die »Endlösung« von der Idee her ganz besonders. Es ist von Bedeutung, daß 1940 zwei Nationalsozialisten, die in der Folge zu Führungspersönlichkeiten bei der Entwicklung und Durchführung der »Endlösung« werden sollten, jeder für sich bekannten, daß der Massenmord den »kulturellen Werten«, auf die beide Wert legten, zuwiderliefe. Heinrich Himmler schrieb, die »physische Ausrottung eines Volkes« sei »undeutsch«, und Reinhard Heydrich hielt fest, die biologische Vernichtung wäre »des deutschen Volkes als einer Kulturnation unwürdig«.9 Aber im Lauf der folgenden 18 Monate wurde die »physische Ausrottung eines Volkes« genau die politische Linie, die sie sich zu eigen machten.
Wenn man verfolgt, wie Hitler, Himmler, Heydrich und andere Führungspersönlichkeiten die »Endlösung« und Auschwitz schufen, bietet das Gelegenheit, einen dynamischen und radikalen Entscheidungsprozeß von großer Komplexität zu sehen. Es war kein ausgearbeiteter Plan von oben für das Verbrechen durchgesetzt worden und auch keiner von unten erdacht und nur von der Spitze akzeptiert worden. Es wurden nicht einzelne Nationalsozialisten durch grobe Drohungen genötigt, selbst zu morden. Nein, dies war ein gemeinsames Unternehmen von Tausenden von Menschen, die sich entschlossen, nicht nur teilzunehmen, sondern Initiativen zur Lösung des Problems beizutragen, wie man in nie zuvor versuchtem Ausmaß Menschen töten und ihre Leichen beseitigen könnte.
Wenn wir den Weg nachvollziehen, den einerseits die Nationalsozialisten gingen und andererseits diejenigen, die sie verfolgten, gewinnen wir tiefe Einsicht in die Conditio humana. Und was wir da erfahren, ist meist nicht schön. In dieser Geschichte hat Leiden fast nie mit Erlösung zu tun. Obwohl es in einigen seltenen Fällen außergewöhnliche Menschen gegeben hat, die sich großartig verhalten haben, ist dies doch überwiegend eine Geschichte der Erniedrigungen. Man kann kaum umhin, sich dem Urteil von Else Baker anzuschließen, die im Alter von acht Jahren nach Auschwitz geschickt wurde: »Das Maß menschlicher Verderbtheit ist unendlich.« Wenn es aber einen Funken Hoffnung gibt, dann liegt er in der Familie als der stützenden Kraft. Heldentaten wurden von Menschen im Lager zugunsten von Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder Kind vollbracht.
Vielleicht zeigen Auschwitz und die »Endlösung« vor allem, mit welcher Macht die Umstände das Verhalten beeinflussen, in stärkerem Maße, als wir vielleicht wahrhaben wollen. Diese Auffassung bestätigt einer der zähesten und mutigsten Überlebenden der Todeslager, Toivi Blatt, der in Sobibór zur Arbeit gezwungen wurde und dann die Flucht wagte: »Ich bin gefragt worden«, sagt er, »›Was hast du gelernt?‹, und ich denke, für mich steht nur eines fest – niemand kennt sich selbst. Der nette Mensch auf der Straße, den du fragst, ›Wo ist die Nordstraße?‹, und der einen halben Block mit dir geht und sie dir zeigt und nett und freundlich ist. Dieser selbe Mensch könnte unter anderen Umständen ein richtiger Sadist sein. Niemand kennt sich selbst. Wir können alle gut oder schlecht sein in unterschiedlichen Situationen. Manchmal denke ich, wenn jemand richtig nett zu mir ist, ›Wie ist der in Sobibór?‹.«10
Diese Überlebenden (und wenn ich ehrlich sein soll, die Täter ebenso) haben mich gelehrt, daß menschliches Verhalten brüchig und unberechenbar ist und oft von den Umständen abhängt. Natürlich hat jeder einzelne die Wahl, wie er sich verhalten will, aber für viele Menschen sind die Umstände der entscheidende Faktor bei dieser Wahl. Sogar ungewöhnliche Persönlichkeiten – Adolf Hitler selbst zum Beispiel –, die Herren des eigenen Schicksals zu sein scheinen, waren in erheblichem Maße bestimmt von ihrer Reaktion auf frühere Lebenslagen. Der Adolf Hitler der Geschichte war wesentlich geformt von der Wechselwirkung zwischen dem Vorkriegs-Hitler, einem ziellos treibenden Nichtsnutz, und den Geschehnissen des Ersten Weltkriegs, eines globalen Konflikts, über den er keine Kontrolle hatte. Ich kenne keinen seriösen Fachmann, der glaubt, daß Hitler ohne die Veränderung, die er in jenem Krieg durchmachte, und die tiefe Bitterkeit, die er fühlte, als Deutschland verlor, zur Bedeutung aufgestiegen wäre. Wir können also über die Aussage »Ohne Ersten Weltkrieg kein Hitler als Reichskanzler« hinausgehen und sagen: »Ohne Ersten Weltkrieg keine Persönlichkeit, die zu dem Hitler wurde, den die Geschichte kennt.« Und während natürlich Hitler selbst entschied, wie er sich verhalten wollte (und dabei eine Reihe von Entscheidungen traf, mit denen er sich all die Schmähungen verdiente, die man auf ihn häuft), wurde er doch erst durch diese spezifische historische Situation möglich.
Diese Geschichte zeigt uns jedoch auch, daß, wo einzelne einem Schicksal ausgeliefert sind, in Gemeinschaften zusammenwirkende Menschen eine höhere Kultur schaffen können, die es ihrerseits einzelnen erlaubt, sich anständiger zu verhalten. Wie die Dänen ihre Juden retteten und, als sie bei Kriegsende zurückkehrten, dafür sorgten, daß sie herzlich empfangen wurden, ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Die dänische Kultur eines starken und weitverbreiteten Glaubens an die Menschenrechte trug dazu bei, daß die Mehrheit der Menschen sich uneigennützig verhielt. Aber man sollte auch wieder nicht übermäßig ins Schwärmen geraten ob dieser dänischen Erfahrung. Auch die Dänen standen unter dem starken Einfluß von Faktoren außerhalb ihrer Kontrolle: dem Zeitpunkt des nationalsozialistischen Angriffs auf die Juden (als nämlich deutlich wurde, daß die Deutschen den Krieg verloren), der Geographie ihres Landes (das die relativ geradlinige Flucht über einen schmalen Meeresarm ins neutrale Schweden gestattete) und dem Fehlen konzertierter Bemühungen der SS, die Deportation zu erzwingen. Dennoch darf man vernünftigerweise davon ausgehen, daß es einen Schutzmechanismus gegen Greuel wie Auschwitz in einzelnen Menschen gibt, die dann miteinander dafür sorgen, daß der kulturelle Sittenkodex ihrer Gesellschaft sich solchem Unrecht entgegenstellt. Die offen darwinistischen Ideale des Nationalsozialismus, die jedem »arischen« Deutschen sagten, er oder sie seien rassisch überlegen, standen natürlich dazu im Widerspruch.
Schließlich liegt aber doch tiefe Traurigkeit über diesem Thema, die sich nicht besiegen läßt. Während der ganzen Zeit, die ich daran arbeitete, kamen die Stimmen, die ich am deutlichsten hörte, von denen, die wir nicht befragen konnten: von den 1,1 Million Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden, und ganz besonders von den mehr als 200 000 Kindern, die dort umkamen, denen man das Recht aufzuwachsen und zu leben verweigert hat. Ein Bild vor allem haftet mir im Gedächtnis, seit ich davon gehört habe. Es ist das von den leeren Kinderwagen. »Eine der im KL inhaftierten Frauen sagte später aus, daß sie Zeugin war, wie eine große Anzahl Kinderwagen vom Lager in Richtung des Bahnhofs Auschwitz geschoben wurde. Jeweils fünf Kinderwagen wurden in einer Reihe geschoben, und der Vorbeimarsch dauerte über eine Stunde.«11
Die Kinder, die in diesen Kinderwagen mit ihren Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern, Onkeln und Tanten in Auschwitz ankamen – und die alle dort starben –, sind es, die wir nicht vergessen dürfen; ihrem Gedächtnis ist dieses Buch gewidmet.
Laurence Rees,
London, Juli 2004
1. Die Anfänge
Am 30. April 1940 erreichte Hauptsturmführer Rudolf Höß ein ehrgeiziges Ziel. Er war nach sechs Jahren im aktiven Dienst der SS im Alter von 39 Jahren zum Kommandanten eines der ersten deutschen Konzentrationslager in den neu eingegliederten Ostgebieten ernannt worden. Anfang Mai nahm er seine Arbeit in einer kleinen Stadt in einer Gegend auf, die 8 Monate zuvor noch Südwestpolen gewesen und jetzt Teil von Oberschlesien war. Der Name des Ortes lautete polnisch Oświęcim – deutsch Auschwitz.
Höß war zwar zum Kommandanten befördert worden – aber ein Lager existierte noch nicht. Es gab nur einen »verwahrlosten und von Ungeziefer wimmelnden Komplex« ehemaliger polnischer Kasernen am Rande der Stadt, und dort sollte er nun die Errichtung eines Lagers überwachen. Die Umgebung hätte kaum deprimierender sein können. Die Landschaft zwischen Sola und Weichsel war flach und trist, das Klima feucht und ungesund.
Niemand, einschließlich Rudolf Höß, hätte an jenem Tag vorhersagen könne, daß dieses Lager in den folgenden Jahren zum Schauplatz des größten Massenmords der Geschichte werden würde. Der Entscheidungsprozeß, der zu dieser Umgestaltung führte, gehört zum Schockierendsten, das die Welt je gesehen hat, und bietet tiefe Einsichten in die Arbeitsweise des NS-Staats.
Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Hermann Göring – diese und andere führende Nationalsozialisten fällten Entscheidungen, die zur Vernichtung von mehr als einer Million Menschen in Auschwitz führten. Aber wesentliche Voraussetzung für dieses Verbrechen war auch die Denkart der vielen kleineren Funktionäre wie etwa Höß. Ohne Höß’ Führung durch das bis dahin unerforschte Gebiet des Massenmords in einem solchen Ausmaß hätte Auschwitz nie so reibungslos funktionieren können.
Äußerlich war an Rudolf Höß wenig Auffälliges. Er war mittelgroß, mit regelmäßigen Zügen und dunklen Haaren, weder häßlich noch besonders gutaussehend. Der amerikanische Anwalt Whitney Harris1, der Höß in Nürnberg verhört hat, fand, er sähe aus »wie ein normaler Mensch, wie ein Verkäufer im Lebensmittelladen«. Mehrere polnische Auschwitz-Häftlinge bestätigen diesen Eindruck. Sie erinnern sich an Höß als an einen ruhigen und beherrschten Mann, die Art von Mensch, an dem man täglich vorbeigeht, ohne ihn wahrzunehmen. Damit war Höß scheinbar weit entfernt von dem Bild des speichelsprühenden SS-Monsters mit wutrotem Gesicht – und das macht ihn natürlich zu einer noch erschreckenderen Figur.
Als Höß seinen Koffer in das Hotel gegenüber der Bahnstation von Auschwitz trug, das die Operationsbasis der SS-Leute sein sollte, bis angemessene Quartiere im Lager geschaffen worden wären, brachte er auch den mentalen Ballast eines Erwachsenenlebens mit, das dem Nationalsozialismus geweiht war. Wie bei den meisten glühenden Nationalsozialisten waren seine Persönlichkeit und seine Überzeugungen durch seine Reaktion auf die vorhergegangenen 25 Jahre deutscher Geschichte geformt – die turbulentesten Jahre, die das Land je gesehen hatte. Er war im Jahr 1900 als Sohn streng katholischer Eltern in Baden-Baden geboren und stand in seinen frühen Jahren unter starken Einflüssen: einem dominierenden Vater, der auf Gehorsam bestand; dem Dienst im Ersten Weltkrieg, den er als einer der jüngsten Unteroffiziere des deutschen Heeres erlebte; seiner heftigen Verzweiflung ob der Niederlage, die er als Verrat empfand; seinem Dienst in einem paramilitärischen Freikorps im Baltikum Anfang der zwanziger Jahre mit dem Versuch, die angebliche kommunistische Bedrohung an den Grenzen Deutschlands abzuwehren, sowie der Verwicklung in gewalttätige politische Machenschaften der Rechten, die ihn 1923 ins Zuchthaus brachten.
Viele Nationalsozialisten kamen aus einem ähnlichen Schmelztiegel, nicht zuletzt auch Adolf Hitler. Hitler, der Sohn eines beherrschenden Vaters2, hatte seinen leidenschaftlichen Haß auf diejenigen gerichtet, von denen er glaubte, daß sie den Krieg verloren hätten, in dem er gerade gekämpft hatte (und in dem er wie Höß mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden war), und hatte in einem gewaltsamen Putsch versucht, an die Macht zu gelangen genau in dem Jahr, in dem an anderem Ort Höß an einem politischen Mord beteiligt war.
Hitler, Höß und andere rechte Nationalisten hatten das dringende Bedürfnis zu verstehen, weshalb Deutschland den Krieg verloren und einen so demütigenden Frieden geschlossen hatte. In den Jahren gleich nach dem Krieg glaubten sie die Antwort gefunden zu haben: Es war doch klar, meinten sie, daß die Juden schuld waren. Schon 1919 glaubten sie, die Verbindung zwischen dem Judaismus und der gefürchteten Weltanschauung des Kommunismus sei in München zweifelsfrei bewiesen worden, als im Frühling für kurze Zeit die revolutionäre Räterepublik errichtet worden war – die Mehrheit ihrer Führer war jüdisch. Und Walther Rathenau, Außenminister in der Weimarer Republik, war auch Jude!
Es spielte keine Rolle, daß eine große Zahl deutscher Juden im Krieg tapfer gekämpft hatte und viele gestorben waren. Und auch nicht, daß Tausende deutscher Juden weder links standen noch gar Kommunisten waren. Für Hitler und seine Anhänger war es so viel leichter, für Deutschlands mißliche Lage den Sündenbock in den deutschen Juden zu suchen. Dabei konnte die neu gegründete Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) auf viele Jahre deutschen Antisemitismus aufbauen. Und von Anfang an behaupteten ihre Anhänger, daß ihr Haß auf die Juden sich nicht etwa auf beschränkte Vorurteile stützte, sondern auf wissenschaftliche Fakten.3 Solche pseudointellektuellen Angriffe wirkten stark bei Männern wie Rudolf Höß, der versichert hat, er habe den primitiven, gewalttätigen, geradezu pornographisch-wüsten Antisemitismus, wie ihn Julius Streicher in seiner Zeitschrift Der Stürmer vertrat, stets verachtet. »Nach meiner Ansicht diente man dem Antisemitismus nicht mit einer wüsten Hetze, wie es der Stürmer tat«4, schrieb Höß nach dem Untergang des Nationalsozialismus im Gefängnis. Seine Betrachtungsweise sei kühler, rationaler, meinte er. Er behauptete: »Ich selbst habe persönlich nie Juden gehasst«; das Problem sei für ihn die »internationale Verschwörung des Weltjudentums«; er stellte sich darunter vor, daß die Juden insgeheim an den Hebeln der Macht säßen und einander über nationale Grenzen hinweg unterstützten. Das habe, so meinte er, zu Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg geführt. Und so etwas mußte seiner Auffassung nach vernichtet werden: »Als fanatischer Nationalsozialist war ich fest davon überzeugt, daß unsere Idee in allen Ländern … Eingang fände und allmählich vorherrschend würde … Damit würde ja auch die Vorherrschaft des Judentums beseitigt werden.«5
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 1928 widmete sich Höß einem anderen geliebten Glaubensinhalt rechter Nationalisten, der wie der Antisemitismus dazu beitrug, die nationalsozialistische Bewegung zu definieren: der Liebe zum Boden. Juden waren verhasst, weil sie meist in Städten wohnten; »wahre« Deutsche dagegen verloren die Liebe zur Natur nie. Es war kein Zufall, daß Himmler selbst Landwirtschaft studiert hatte und daß in Auschwitz später auch eine landwirtschaftliche Versuchsstation errichtet wurde.
Höß schloß sich den Artamanen an, einer der bäuerlichen Gemeinschaften, die zu der Zeit in Deutschland blühten; er heiratete und ließ sich nieder mit dem Ziel, Bauer zu werden. 1934 kam der Augenblick, der sein Leben verändern sollte. Heinrich Himmler, Hitlers »Reichsführer-SS«, bot ihm an, die Landwirtschaft aufzugeben und ganz in den aktiven Dienst der SS einzutreten, der Elite-»Schutzstaffel«, die einst als Hitlers Leibgarde gegründet worden war. Inzwischen gehörte zu ihren Pflichten die Überwachung der Konzentrationslager.6 Himmler kannte Höß schon eine ganze Weile, denn der war bereits im November 1922 in die NSDAP eingetreten, mit der Mitgliedsnummer 3240.
Höß hatte die Wahl. Er mußte nicht mitmachen – niemand wurde zur SS eingezogen. Aber er entschied sich zum Beitritt. In seiner Autobiographie nennt er die Gründe: »Durch das in Aussicht gestellte schnelle Vorwärtskommen, also Beförderung, und die damit verbundenen finanziellen Vorteile wurde ich mit dem Gedanken vertraut, daß ich … von unserem bisherigen Weg abgehen müsse …«7 Das war nur die halbe Wahrheit. Denn das schrieb er, nachdem der Nationalsozialismus besiegt war, und ließ das weg, was für ihn der entscheidende Faktor gewesen sein muß: seine damalige Gemütsverfassung. 1934 dürfte Höß das Gefühl gehabt haben, er erlebte den Beginn einer neuen und wunderbaren Welt mit. Hitler war seit einem Jahr an der Macht, und schon bekämpfte man die inneren Feinde des Nationalsozialismus – die linken Politiker, die »Arbeitsscheuen«, die Asozialen, die Juden. Überall im Land begrüßten die Deutschen, die solchen Risikogruppen nicht angehörten, diese Entwicklung. Typisch war die Reaktion Manfred von Schröders, eines Bankierssohns aus Hamburg, der 1933 in die NSDAP eintrat. Alles sei wieder in Ordnung und sauber gewesen und ein Gefühl von nationaler Befreiung, von einem Neuanfang habe geherrscht.8 Höß hatte jetzt die Möglichkeit, an dieser Revolution mitzuwirken, auf die er seit dem Ende des Ersten Weltkriegs gehofft hatte. Die Mitgliedschaft in der SS bedeutete Prestige, Privilegien, ein aufregendes Leben und die Chance, den Kurs des neuen Deutschland mitzubestimmen. Was wäre er daneben als Bauer! Wen überrascht es da, daß er sich für Himmlers Angebot entschied? Im November 1934 nahm er seine Arbeit im Konzentrationslager Dachau bei München auf.
Im allgemeinen Bewußtsein herrscht heute, besonders in England und den USA, Unklarheit über die Aufgaben der verschiedenen Lager im NS-Staat. Konzentrationslager wie Dachau, das im März 1933 errichtet wurde, weniger als zwei Monate, nachdem Adolf Hitler Reichskanzler geworden war, unterschieden sich grundsätzlich von Todeslagern wie Treblinka, die erst mitten im Krieg errichtet wurden. Zur Verwirrung trägt weiterhin die komplexe Geschichte von Auschwitz bei, dem berüchtigtsten aller Lager, das sowohl Arbeitslager als auch Todeslager wurde. Man muß die Bedeutung dieses Unterschieds kennen, um zu begreifen, wie sich die Deutschen in den dreißiger Jahren die Existenz solcher Lager wie Dachau rational erklärten. Keiner der Deutschen, mit denen ich Fernsehinterviews gemacht habe, nicht einmal ehemals fanatische Nationalsozialisten, waren über die Todeslager »glücklich«, aber viele waren in den dreißiger Jahren sehr zufrieden gewesen mit dem Vorhandensein von »normalen« Konzentrationslagern. Sie hatten gerade den Alptraum der Weltwirtschaftskrise durchgemacht und miterlebt, daß die Demokratie den Niedergang des Landes nicht hatte verhindern können, wie sie sagten. Das »Gespenst des Kommunismus« ging immer noch um. Bei Wahlen zu Beginn der dreißiger Jahre schienen sich die Deutschen aufzuspalten in Richtung der Extreme: viele Menschen stimmten für den Kommunismus.
Die ersten Häftlinge in Dachau im März 1933 waren überwiegend politische Gegner der Nationalsozialisten. Juden wurden in dieser Frühzeit verhöhnt, gedemütigt und zusammengeschlagen, aber es waren die linken Politiker9 früherer Regierungen, die als akute Bedrohung empfunden wurden. Und als Höß in Dachau ankam, glaubte er fest, »wirkliche Gegner des Staates mußten sicher verwahrt … werden«.10 Die folgenden dreieinhalb Jahre in Dachau spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Das sorgfältig ausgearbeitete System des ersten Lagerkommandanten von Dachau, Theodor Eicke, war nicht einfach nur brutal: Es sollte den Willen der Häftlinge brechen. Eicke lenkte den Terror und den Haß der NS-Bewacher auf ihre »Feinde« in systematische und geordnete Bahnen. Dachau ist berüchtigt wegen des dort geübten Sadismus: Stock- und Peitschenhiebe waren gang und gäbe. Häftlinge wurde ermordet, und ihr Tod als »auf der Flucht erschossen« abgetan. Und es starben eine erhebliche Zahl von Häftlingen in Dachau. Aber die wahre Macht des Regimes zeigte sich dort weniger in körperlichen Mißhandlungen, so schlimm sie auch waren, als in den psychischen Torturen.
Eine der ersten Neuerungen in Dachau war es, daß dort – anders als in normalen Gefängnissen – keiner der Gefangenen erfuhr, zu was für einer Strafe er verurteilt war. In den dreißiger Jahren wurden die meisten Häftlinge aus Dachau nach rund einem Jahr wieder entlassen, im Einzelfall konnte es auch kürzer oder länger dauern – ganz nach Laune der Obrigkeit. Auf jeden Fall gab es keinen festen Termin für die Entlassung, auf den sich der Häftling einrichten konnte, nur die permanente Ungewißheit; man wußte nie, ob man morgen oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr freikäme. Höß, der selbst im Gefängnis gesessen hatte, erkannte die verheerende Wirkung dieser Maßnahme sofort: »Die ungewisse Haftdauer [war] der Faktor, der die schlimmste, die stärkste Wirkung auf die Psyche der Häftlinge ausübte«, schrieb er. »Das sei das Zermürbendste, das jeden noch so festen Willen Lähmende … Schon allein deswegen wurde ihnen das Lagerleben zur Qual.«11
Zu dieser Ungewißheit kam die Art, wie die Bewacher mit den Emotionen der Gefangenen spielten. Josef Felder, zuvor Reichstagsabgeordneter der SPD, gehörte zu den ersten Häftlingen in Dachau. Er erinnerte sich, daß, als er seelisch einen Tiefpunkt erreicht hatte, sein Wärter einen Strick nahm und ihm zeigte, wie er am besten die Schlinge knüpfen sollte, damit er sich erhängen könnte.12 Nur mit enormer Selbstüberwindung und in dem Gedanken »Ich habe eine Familie« konnte er diesem Hinweis widerstehen. Von den Häftlingen wurde erwartet, daß sie ihre Quartiere und Kleidung tadellos in Ordnung hielten. Bei Inspektionen fanden die Wärter ständig etwas auszusetzen und konnten, wenn sie Lust hatten, den ganzen Block für eingebildete Verstöße bestrafen. Jeder konnte auch tagelang »stillgelegt« werden mit dem Befehl, schweigend und bewegungslos auf der Pritsche zu liegen.
Auch das System mit den »Kapos« wurde in Dachau erfunden; es wurde in allen Konzentrationslagern eingeführt und spielte schließlich auch in Auschwitz eine erhebliche Rolle. Die Lagerverwaltung ernannte einen Gefangenen pro Block oder pro Arbeitskommando zum Kapo, der damit große Macht über seine Mitgefangenen hatte. Natürlich wurde diese Macht oft mißbraucht. Kapos konnten im ununterbrochenen Kontakt mit den anderen Gefangenen fast mehr als die SS-Bewacher durch Willkür das Leben im Lager unerträglich machen. Allerdings waren die Kapos selbst in Gefahr, wenn sie ihre Herren von der SS nicht zufriedenstellten. Himmler drückte das so aus: »Seine [des Kapos] Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß die Arbeit getan wird – also muß er seine Männer antreiben. Sobald wir nicht mit ihm zufrieden sind, bleibt er nicht mehr Kapo und kehrt zu den anderen Häftlingen zurück. Er weiß, daß sie ihn schon am ersten Abend totschlagen werden.«13
Aus Sicht der Nationalsozialisten stellte das Lagerleben die Außenwelt im Kleinen dar. »Der Gedanke des Kampfes ist so alt wie das Leben selbst«, sagte Hitler schon 1928 in einer Rede. »In diesem Kampf gewinnt der Stärkere, Fähigere, während die weniger Fähigen, Schwachen, verlieren. Der Krieg ist der Vater aller Dinge … Der Mensch lebt nicht und erhebt sich nicht über die Tierwelt mit den Prinzipien der Humanität, sondern nur mit Hilfe des brutalen Kampfes.«14 Diese darwinistische Einstellung steckte im Kern des Nationalsozialismus und war in der Verwaltung aller Konzentrationslager offensichtlich. Die Kapos zum Beispiel konnten zu Recht die ihnen Unterstellten mißhandeln, denn sie hatten sich im Lebenskampf »als überlegen erwiesen«.
Vor allem lernte Höß in Dachau die wesentliche Philosophie der SS kennen. Theodor Eicke hatte von Anfang an einen Grundsatz gepredigt – Härte. »Jeder, der auch nur die geringste Spur von Mitleid mit diesen Staatsfeinden erkennen läßt, muß aus unseren Reihen verschwinden. Ich kann nur harte, zu allem entschlossene SS-Männer gebrauchen. Weichlinge haben bei uns keinen Platz.«15 Jede Form des Mitgefühls, jede Form von Erbarmen war damit ein Beweis der Schwäche. Wenn ein SS-Mann solche Empfindungen verspürte, war das ein Zeichen dafür, daß es dem Feind gelungen war, ihn zu übertölpeln. Die NS-Propaganda predigte, es seien oft die unwahrscheinlichsten Stellen, an denen der Feind lauern konnte. Eins der Werke antisemitischer Propaganda richtete sich an Kinder; es war ein Buch mit dem Titel Der Giftpilz, das vor der heimtückischen Gefahr der Juden mit dem Bild eines Pilzes warnte, der äußerlich schön anzusehen, aber in Wirklichkeit giftig war. So wurden auch SS-Männer konditioniert, ihre eigenen Gefühle von Teilnahme zu verachten, wenn sie etwa die Bestrafung eines Häftlings mit Prügeln sahen. Man brachte ihnen bei, daß ein Gefühl von Mitleid nur hervorgerufen wurde durch die Tricks des Opfers. Als »Staatsfeinde« nutzten diese gerissenen Kreaturen angeblich jeden Kniff bei dem Versuch, ihre arglistigen Ziele zu verfolgen – nicht zuletzt, indem sie an das Erbarmen derjenigen appellierten, die sie gefangenhielten. Die Erinnerung an den »Dolchstoß«, das Märchen, daß Juden und Kommunisten in der Heimat die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg geplant hätten, war immer gegenwärtig und passte perfekt in dieses Bild eines gefährlichen, aber unsichtbaren Feindes.
Die einzige Gewißheit für Angehörige der SS war die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Befehle, die sie empfingen. Wenn ein Vorgesetzter jemanden einzusperren, jemanden hinzurichten befahl, dann mußte der Befehl seine Ordnung haben – selbst wenn es demjenigen, der dieses Urteil auszuführen hatte, nicht einleuchtend erschien. Der einzige Schutz gegen das Krebsgeschwür des Selbstzweifels im Angesicht von Befehlen, die nicht direkt erklärlich waren, war Härte. Sie wurde zum Kult in der SS.
Während er lernte, wie man Gefühle wie Mitleid und Erbarmen unterdrückte, nahm Höß die Empfindung von Bruderschaft in sich auf, die in der SS ebenfalls sehr stark war. Eben weil ein SS-Mann wußte, daß er Dinge würde tun müssen, die Schwächere nicht leisten konnten, entstand ein machtvoller Korpsgeist, in dem die Loyalität der Kameraden wesentliche Stütze und Rückhalt bot. Die Grundwerte der SS – bedingungslose Loyalität, Härte, Schutz des Reiches vor inneren Feinden – wurden fast zur Ersatzreligion, es war eine besondere und leichtverdauliche Weltsicht. Er sei der SS dankbar gewesen für die intellektuelle Führung, die sie bot, sagte Johannes Hassebroek, Kommandant eines anderen Konzentrationslagers. Viele seien unsicher gewesen, bis sie der Organisation beitraten, und verstanden nicht, was geschah – alles sei so ein Durcheinander gewesen. Die SS habe eine Reihe von schlichten Ideen geboten, die sie begreifen konnten und an die sie glaubten.16
Noch etwas lernte Höß in Dachau, das für Auschwitz Bedeutung bekommen sollte. Er beobachtete, daß die Häftlinge ihre Gefangenschaft besser ertragen konnten, wenn die SS ihnen Arbeit gab. Er erinnerte sich an seine eigene Haft in Leipzig und Brandenburg und wie er, nur, weil er arbeiten durfte (er hatte Tüten geklebt), in der Lage gewesen war, jeden Tag mehr oder weniger positiv anzugehen. Jetzt sah er, daß Arbeit in Dachau eine ähnliche Rolle spielte. Sie ermöglichte es den Gefangenen, »sich selbst in Zucht zu halten, um so besser den niederziehenden Einwirkungen der Haft Widerstand leisten zu können«.17 Höß war so überzeugt von der lindernden Wirkung der Arbeit im Konzentrationslager, daß er sogar den »Sinnspruch«, den man in Dachau benutzt hatte, für Auschwitz übernahm: Arbeit macht frei – er ließ es groß über das Eingangstor setzen.
Höß war das Muster eines SS-Mannes und machte in Dachau schnell Karriere. Im April 1936 wurde er Rapportführer, die rechte Hand des Lagerkommandanten. Im September 1938 wurde er zum Untersturmführer befördert und ins Konzentrationslager Sachsenhausen versetzt, wo er bis zu seiner Ernennung zum Kommandanten des neuen KL Auschwitz blieb. Er war bereit, seine große Aufgabe zu übernehmen: ein Musterlager für das neue NS-Reich zu schaffen. Er glaubte zu wissen, was von ihm erwartet wurde, zu welchem Zweck er die Anlage errichtete. Seine Erfahrungen in Dachau und Sachsenhausen zeigten ihm den Weg. Doch seine Vorgesetzten hatten andere Pläne, und im Lauf der folgenden Monate und Jahre entwickelte sich das von Höß gebaute Lager in Auschwitz in eine andere Richtung.
Während Höß seine Arbeit in Auschwitz in Angriff nahm, tat sein Vorgesetzter in Berlin etwas sehr Ungewöhnliches – er entwarf eine Denkschrift für den »Führer«. Himmler schrieb seine zaghaft so genannten »Gedanken zur Behandlung Fremdvölkischer im Osten«. Er gehörte zu den schlauesten Machthabern des NS-Staats und wußte, daß es unklug war, Gedanken schriftlich zu fixieren. In den obersten Rängen wurde die NS-Politik oft nur mündlich formuliert. Sobald seine Ansichten auf Papier standen, konnten sie, das wußte Himmler, von seinen Konkurrenten in der Luft zerrissen werden. Und wie viele der Führungspersönlichkeiten hatte er etliche Feinde, die danach strebten, Teile seiner Macht an sich zu reißen. Aber die Lage in Polen, das die Deutschen seit dem Herbst 1939 besetzt hielten, verlangte nach seiner Ansicht, daß er eine Ausnahme machte und Hitler ein schriftliches Dokument zukommen ließ. Es ist in der Geschichte der nationalsozialistischen Rassenpolitik von größter Bedeutung, nicht zuletzt, weil Himmlers Worte den Kontext klärten, innerhalb dessen das neue Lager Auschwitz seine besondere Aufgabe bekam.
Himmler war in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Festigung des Deutschen Volkstums an der größten und hastigsten ethnischen Neuordnung eines Landes beteiligt, die je geplant worden war, aber das Unternehmen entwickelte sich gar nicht so, wie es sollte. Statt in Polen, für dessen angebliche Untüchtigkeit die Nationalsozialisten nur Verachtung übrig hatten, Ordnung einzuführen, hatten Himmler und seine Mannschaft Gewalttätigkeit und Chaos einbrechen lassen.
In ihrer grundsätzlichen Haltung gegenüber den Polen waren sich die Nationalsozialisten absolut einig: Es war Abscheu. Die Frage war, wie man damit umgehen sollte. Eins ihrer größten »Probleme« betraf die polnischen Juden. Während in Deutschland weniger als ein Prozent Juden lebten (1940 waren es noch rund 300 000), die überwiegend assimiliert waren, gab es in Polen drei Millionen Juden, die großenteils in eigenen Gemeinden lebten und leicht an ihren Bärten und anderen Kennzeichen ihres Glaubens zu erkennen waren. Als Polen gleich nach Kriegsbeginn zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt wurde (entsprechend dem Geheimen Zusatzprotokoll zum Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939), blieben über zwei Millionen polnische Juden in dem von Deutschen besetzten Teil Polens. Was sollte mit ihnen geschehen?
Ein anderes selbstgeschaffenes Problem des NS-Staats war es, Hunderttausenden von Volksdeutschen, die gerade nach Polen umgesiedelt wurden, ein Heim zu bieten. Einer Vereinbarung zwischen Deutschland und der Sowjetunion zufolge durften Volksdeutsche aus dem Baltikum, Bessarabien und anderen Regionen, die jetzt Stalin besetzt hielt, nach Deutschland auswandern – »heim ins Reich«, wie das Schlagwort lautete. Für Männer wie Himmler, die von der Idee der rassischen Reinheit des »deutschen Bluts« besessen waren, war es ein Glaubensakt, alle die Deutschen, die zurückkehren wollten, unterzubringen. Aber wo? Dazu kam ein dritter Punkt: Wie sollten die 18 Millionen nichtjüdischen Polen, die jetzt unter deutscher Kontrolle standen, behandelt werden? Wie mußte man das Land organisieren, damit sie nicht zur Gefahr wurden?
Im Oktober 1939 hatte Hitler eine Rede gehalten, die denjenigen ein paar Leitlinien bot, die sich mit diesen Fragen plagten. Er hatte Ziele klargemacht: »Als wichtigste Aufgabe aber: eine Ordnung der ethnographischen Verhältnisse, das heißt, eine Umsiedlung der Nationalitäten, so daß sich am Abschluß der Entwicklung bessere Trennungslinien ergeben, als es heute der Fall ist.«18 Das hieß, daß das von Deutschen besetzte Polen geteilt werden mußte: In dem einen Teil würde die Mehrheit der Polen leben, der andere Teil würde Deutschland einverleibt werden. Die heimkehrenden Volksdeutschen würden dann nicht im »Altreich« sondern in diesem neuen Teil angesiedelt werden; sie kämen zwar »heim ins Reich« – aber nicht in das Reich, mit dem sie rechneten.
Blieben die polnischen Juden. Bis zum Beginn des Krieges war es NS-Politik gewesen, die unter ihrer Kontrolle lebenden Juden zunehmend Schikanen durch unzählige restriktive Vorschriften auszusetzen – durchsetzt mit nicht offiziellen (aber sanktionierten) heftigen Ausschreitungen. Hitlers Meinung von Juden hatte sich seit der Mitte der zwanziger Jahre kaum geändert; damals schrieb er in Mein Kampf: »Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber … unter Giftgas gehalten … dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen.«19 Hitler haßte die Juden, eindeutig, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, und vielleicht hat er auch privat den Wunsch geäußert, sie alle sterben zu lassen, aber es gab noch keine Pläne, sie zu vernichten.
Lucille Eichengreen20 wuchs in den dreißiger Jahren in einer Hamburger jüdischen Familie auf und erinnert sich nur allzu gut, unter welchen Bedingungen Juden leben mußten. »Bis 1933 war es ein gutes, angenehmes Leben«, sagt sie. »Aber als Hitler an die Macht kam, sprachen plötzlich die anderen Kinder aus unserem Haus nicht mehr mit uns; sie warfen mit Steinen und riefen uns Beschimpfungen nach. Wir wußten nicht, womit wir das verdient hatten. Die Frage war also immer – warum? Wenn wir zu Hause fragten, war die Antwort meist: ›Das geht vorbei. Das wird sich normalisieren.‹« Später teilte man den Eichengreens mit, daß Juden dort nicht mehr wohnen bleiben könnten. Man wies ihnen eine Wohnung in einem der »Judenhäuser« zu, die zum Teil jüdischen Besitzern gehörten. Ihre erste neue Wohnung war noch fast so groß wie die alte, aber im Laufe der Zeit wurden ihnen immer kleinere Unterkünfte zugewiesen, bis sie schließlich in einem einzigen möblierten Zimmer für die ganze Familie landeten. »Ich glaube, wir haben das mehr oder weniger akzeptiert«, sagt Lucille. »Es gab ein Gesetz, es war Vorschrift, man konnte nichts tun.«
Die Illusion, die antisemitische Politik der Nationalsozialisten würde sich »normalisieren«, wurde in der Pogromnacht am 9. November 1938 zunichte gemacht. SA zerstörte das jüdische Hab und Gut und nahm Tausende von deutschen Juden fest. Sie nannte das einen »Racheakt«, weil der junge Herschel Grynszpan den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris ermordet hatte. »Auf dem Weg zur Schule sahen wir, daß die Synagoge brannte«, erzählt Lucille Eichengreen, »daß die Schaufenster jüdischer Geschäfte eingeschlagen waren und die Ware auf der Straße lag – und die Deutschen lachten … Wir hatten große Angst. Wir glaubten, daß sie uns gleich packen und uns sonstwas antun würden.«
Bei Kriegsbeginn 1939 war den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, sie durften keine Nichtjuden heiraten, keine Geschäfte besitzen oder in bestimmten Berufen arbeiten; nicht einmal ihre Führerscheine galten noch. Diskriminierung durch Vorschriften, in Verbindung mit dem gewalttätigen Ausbruch zur »Kristallnacht«, in der mehr als 1000 Synagogen angesteckt, 400 Juden getötet und 30 000 jüdische Männer für Monate in Konzentrationslagern eingesperrt wurden, veranlassten eine große Zahl deutscher Juden auszuwandern. Bis 1939 hatten 450 000 von ihnen das »Großdeutsche Reich« (Deutschland, Österreich und das Sudetenland) verlassen – das waren mehr als die Hälfte der dort lebenden Juden. Die Nationalsozialisten waren es zufrieden, vor allem weil Adolf Eichmann, der »Juden-Experte«, nach dem Anschluß Österreichs 1938 ein System entwickelt hatte, mit dem den Juden der größte Teil ihres Geldes abgenommen wurde, bevor sie das Land verlassen durften.
Aber die Nationalsozialisten hatten Schwierigkeiten, ihre für die deutschen Juden entwickelten Maßnahmen zur Lösung des selbstgeschaffenen Problems auf die Juden in Polen zu übertragen. Zum einen hatten sie dort Millionen von Juden unter ihrer Kontrolle, nicht nur ein paar hunderttausend, zum anderen waren die meisten arm, und wohin sollte man sie mitten im Krieg schicken? Schon im Herbst 1939 glaubte Adolf Eichmann eine Antwort gefunden zu haben: Die Juden sollten nicht in andere Länder auswandern, sondern in die unwirtlichste Region im NS-Reich selbst. Außerdem konnte er den idealen Ort bereits vorschlagen – im polnischen Distrikt Lublin, um die Stadt Nisko herum. Diese abgelegene Landschaft nahe der östlichen Grenze des deutschen Einflußgebiets schien ihm perfekt geeignet zu sein für ein »Judenreservat«. Das von den Deutschen besetzte Polen sollte also in drei Teile unterteilt werden: einen von Deutschen besiedelten Teil, einen polnischen Teil und einen jüdischen Teil, etwa auf einer westöstlichen Linie. Eichmanns ehrgeiziger Plan fand Zustimmung, und mehrere tausend Juden aus Österreich wurden in die Region deportiert. Die Bedingungen waren haarsträubend. Es waren so gut wie keine Vorbereitungen getroffen worden, und viele Menschen starben. Das kümmerte die Nationalsozialisten wenig. Im Gegenteil, es kam gut an. Wie Hans Frank, einer der ältesten Parteigenossen in Polen, es seinem Stab gegenüber im November 1939 ausdrückte: »Bei den Juden nicht viel Federlesens. Eine Freude, endlich einmal die jüdische Rasse körperlich angehen zu können. Je mehr sterben, um so besser.«21
Während nun Himmler im Mai 1940 seine Denkschrift schrieb, wußte er nur zu gut, daß die interne Verschiebung von Juden ins östliche Polen ein furchtbarer Fehlschlag gewesen war. Großenteils deshalb, weil die Deutschen drei verschiedene Wanderungsbewegungen gleichzeitig durchzuführen versuchten. Die ankommenden Volksdeutschen mußten nach Polen transportiert und untergebracht werden. Das hieß, daß Polen aus ihren Häusern vertrieben und woandershin deportiert werden mußten. Gleichzeitig wurden Juden nach Osten geschafft in eine Region, die auch erst von Polen geräumt werden mußte. Kein Wunder, daß das zu fürchterlichem Chaos und Verwirrung führte.
Im Frühjahr 1940 war der Nisko-Plan aufgegeben und das von Deutschen besetzte Polen schließlich doch in nur zwei Teile geteilt. Einmal die Regionen, die offiziell »germanisiert« und Teile des neuen Reiches geworden waren: Westpreußen mit Danzig (Gdańsk), der Warthegau mit Posen (Poznań) und Łódz, und Oberschlesien mit Kattowitz (Katowice; zu diesem Distrikt gehörte auch Auschwitz). Das größte Gebiet aber mit Warschau, Krakau und Lublin, das sogenannte Generalgouvernement, war als Lebensraum für die Mehrheit der Polen bestimmt.
Himmlers größtes Problem war, daß er Hunderttausenden repatriierten Volksdeutschen angemessenen Wohnraum anbieten mußte – eine Schwierigkeit, die sich ihrerseits darauf auswirkte, wie er mit Polen und Juden umzugehen gedachte. Der Fall der Irma Eigi22





























