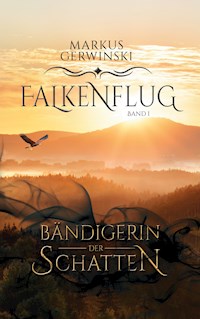
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Falkenflug
- Sprache: Deutsch
Im Schatten eines heraufziehenden Krieges wachsen die leibeigene Bauerstochter Gunid und Ragald, der Sohn ihres Lehnsherrn, als beste Freunde auf. Mit dem Erwachsenwerden schiebt sich die Standesgrenze zwischen sie. Doch als Ragald im Kampf gegen die plündernden Horden der Jattar vermisst wird, folgt Gunid seiner Spur. Auf ihrer Suche findet sie sich bald in eine Geschichte um Verrat und finstere Mächte verstrickt. Nicht nur die feindlichen Krieger, sondern auch schattenhafte Ungeheuer bedrohen das Königreich. Und zu ihrer Verwunderung muss Gunid erkennen, dass sie Macht über diese Dämonen besitzt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Sandra, Gefährtin im Leben und Schreiben
Inhaltsverzeichnis
TEIL 1: Ein Junge und ein Mädchen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
TEIL 2: Das Feldlager
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
TEIL 3: Feindesland
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
TEIL 1
Ein Junge und ein Mädchen
1
Sie war acht, er war sechs, als sie zum ersten Mal miteinander rauften. Gunid kam vom Bach herauf und hielt mit beiden Händen den Korb, der schwer von nasser Wäsche war. Das Gras ging ihr bis fast zur Hüfte und strich ihr sonnenwarm über die Schienbeine. Manchmal stach ihr ein vertrockneter Wegerich in den bloßen Fuß, doch sie war es gewohnt und ging einfach weiter. Sie hatte schon gelernt, dass die Bienen, die überall um sie herumsummten, sehr viel übler stechen konnten, und so nahm sie sich in acht.
„Heda!“
Als sie die helle Stimme krähen hörte, blickte sie auf. Rechts von ihr, ein Stück den Hang hinauf, stand ein Junge. Ein Edelknabe, soviel erkannte sie auf den ersten Blick: Er trug ein Hemd aus gutem Leinen, und es war genauso wenig vom Schweiß der Arbeit getränkt wie seine schwarzen Locken.
„Meinst du mich?“, rief sie zurück.
Er nickte und winkte ihr. „Komm herüber!“
Einen Moment lang stand sie unschlüssig da und runzelte die Stirn. Verärgerung und Neugier rangen in ihr miteinander, und die Neugier siegte. Sie bog von ihrem Weg ab und stieg das kurze Stück zu ihm hinauf.
Ein Edelknabe, ohne Zweifel, jünger und kleiner als sie. Nun, wo sie vor ihm stand und auf ihn hinunterblickte, konnte sie auch die blauen Hosen sehen und die Schuhe aus dunklem Leder. „Was willst du von mir?“
Von oben bis unten maß er sie mit einem arroganten Blick und wandte sich in Richtung Bach. „Folge mir.“
Sie blieb stehen. „Warum?“
„Weil ich es befehle.“
Gunid schüttelte den Kopf, dass ihr die braunen Strähnen ums Gesicht flogen. „Das geht nicht“, erklärte sie ruhig. Der Korb zog schwer an ihren Armen. „Vom Bach komme ich gerade, und ich soll die Wäsche zum Haus bringen.“
Er fuhr herum. Sein rundes Gesicht zeigte Verblüffung, dass sie zu widersprechen wagte. Es reizte sie zum Schmunzeln.
Ein paarmal klappte er den Mund auf und zu, bevor er seine Haltung wiederfand und fragte: „Wie heißt du?“
„Gunid. Und du?“
„Ragald.“
„Der Sohn von Ritter Adolar?“
Der Junge straffte sich und hob so weit die Nase, dass er die Augen nach unten verdrehen musste, um ihr ins Gesicht zu sehen, gerade so, als wäre er der Größere. „Höchstpersönlich!“
Gunid konnte nicht mehr anders, sie prustete los. Je röter er im Gesicht wurde, desto lauter musste sie lachen, bis ihr schließlich die Tränen über die Wangen rollten.
„Und du wirst jetzt mit mir kommen!“ Aus seinem Befehlston war ein Quengeln geworden, das sie an ihren kleinen Bruder Wulf erinnerte. „Ich will nämlich schwimmen lernen, und du bleibst am Ufer und hältst das Seil und ziehst mich raus, wenn ich … äh … was falsch mache. Und hör auf zu lachen!“
Sie schüttelte wieder nur den Kopf und wandte sich ab, um sich ihren Weg durch das Gras zurück zum Trampelpfad hinab zu bahnen. Immer noch musste sie viel zu sehr kichern, als dass sie hätte antworten können.
„Komm sofort zurück, du dumme Gans!“
Augenblicklich versiegte ihr das Lachen in der Kehle. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm herum. „Was hast du gesagt?“
Noch immer ragte er vom Bauch an aufwärts aus dem Grasmeer, das Gesicht hochrot, und deutete mit einem Finger auf sie. „Ich habe gesagt, du sollst –“
Weiter kam er nicht. Gunid hatte den Korb abgestellt – er kippte sofort auf dem Hang um und rollte herunter –, war das halbe Dutzend Schritte wieder hinaufgelaufen und hatte sich auf ihn gestürzt.
„Lass mich los! Lass mich los! Das ist ein Befehl! Lass mich los!“
„Nenn mich nie wieder eine dumme Gans, hörst du?“
„Ich bin dein Herr! Lass mich los!“
Er war viel kleiner als sie und kein echter Gegner. Im Handumdrehen hatte sie ihn am Hals unter den Arm geklemmt und saß mit ihm im Gras.
„Lass mich los! Ich krieg’ keine Luft! Lass mich los!“
„Nenn mich nie wieder eine dumme Gans!“
„Ich bin dein –“
„Nenn mich. Nie. Wieder. Eine. Dumme Gans!“ Sie drückte ein wenig zu.
Als sie wieder lockerließ, musste er husten. Stumm zappelte er eine Zeit lang in ihrem Griff, stemmte seine Ärmchen gegen ihren Arm, gegen ihren Rücken, ihre Schulter, gegen alles, was er greifen konnte. Soviel musste sie ihm lassen, er wehrte sich sehr viel länger als Wulf.
„Du bist keine dumme Gans“, keuchte er schließlich. „Und jetzt lass mich los.“
„Sag bitte.“
„Du lässt mich sofort los, oder Vater wird dich –“
„Dann erzähl es ihm doch!“, höhnte sie. „Erzähl deinem Vater, dass dich ein Mädchen im Ringen besiegt hat! Er wird bestimmt alle seine Wachen ausschicken, damit sie mich einfangen und bestrafen!“
Wieder hing er stumm in ihrem Griff, doch diesmal wehrte er sich nicht. Sie konnte es beinahe in seinem Kopf knarren hören, als er nachdachte.
„Bitte lass mich los.“
Augenblicklich fiel er auf die Nase, da sie den Griff so plötzlich löste, dass er keine Gelegenheit hatte, sich abzufangen. Ein paar Schritte weit kullerte er den Abhang hinunter, und sie musste wieder lachen. Als er sich schließlich aufraffte und sie böse anfunkelte, war sein Hemd voller grüner Grasflecken, und in den schwarzen Locken, die ihm der Schweiß an die Stirn klebte, hingen Halme und Blüten.
Er sah sie böse an, die Fäustchen geballt, die Augen feucht glitzernd, aber immerhin weinte er nicht. Sie grinste. Einen Moment lang schauten sie einander so ins Gesicht, dann drehte er sich um und rannte, zuerst einfach von ihr weg, dann den Hang hinauf der Burg zu.
Gunid stand auf, strich sich das Gras vom Kittel und stieg zu ihrem Korb hinab, der umgestürzt am Ende einer Spur von nasser Wäsche lag. Als sie die Flecken auf den frisch gewaschenen Hemden und Schurzen und Tüchern sah und an die Maulschellen dachte, die sie dafür von ihrer Mutter bekommen würde, bekam sie gute Lust, dem Knaben hinterherzurennen und ihn ordentlich zu verdreschen. Doch sie zügelte sich.
Sommer und Herbst gingen vorüber, und der Winter hatte sich weiß über das Land gelegt, ehe sie einander das nächste Mal begegneten. Besuch war ins Lehen gekommen. Fardol Iringar Havegard, Baron zu Havegard und noch eine Reihe anderer Titel, die sich Gunid nicht merken konnte, war mit großem Gefolge angereist, und Ritter Adolar hatte das halbe Dorf – darunter Gunids Familie – zur Fron eingezogen, um die hohen Gäste angemessen zu bewirten.
Da saß sie nun in Küchendünsten und schnitt Karotten, umgeben von einem Dutzend anderer Kinder aus dem Dorf, während das Gesinde, angetan mit seinen besten Trachten, herein- und hinauseilte und Krüge mit Bier und Wein, Körbe mit Brot und Schalen mit Butter und Schmalz in den Rittersaal trug. Einige der älteren Burschen drehten die Wildsauen, die die edlen Herrschaften noch am Nachmittag selbst im Wald erlegt hatten, an Spießen über dem großen Feuer am anderen Ende der Küche. Stimmengewirr, das Knacken der Scheite und Rauchgeruch erfüllten die Luft, und nach den kalten Wintertagen in der zugigen Kate ihrer Eltern war es hier drin fast schon zu warm.
Mutter hatte sie ermahnt, sich zu benehmen, aber natürlich tuschelte sie mit Jope und Lirin rechts und links von sich. Immer wenn einer der Diener an ihrer Reihe vorbeikam und ein paar Worte zu Bine sagte, die direkt beim Feuer saß, gab diese das Gehörte sofort weiter, und es wanderte von Mund zu Mund, bis es Gunid erreichte.
„Sie reden über Schiffe“, flüsterte Lirin und säbelte an der Lauchstange auf ihrem Brettchen herum. „Ganz viele Schiffe. Mit bunten Segeln.“
„Wo sind diese Schiffe?“ flüsterte Gunid zurück.
„Na, im Meer! Au!“ Gunid hatte ihr einen Knuff versetzt. „Was soll das?“
„Natürlich im Meer, wo sonst!“, zischte Gunid. „Sind sie im Norden, im Westen, im Süden –“
„Ist doch egal. Es sollen ganz viele Krieger darauf sein …“
Jope schob schniefend ein Brett mit klein geschnittenen Zwiebeln von sich, wischte sich die dunklen Kirschaugen und beugte sich herüber. „Was erzählst du? Wovon reden sie?“
Ungeduldig winkte Gunid ab. „Da kommen Schiffe mit vielen bunten Kriegern. Lirin, also, wo sind –“
„Hört!“, ertönte plötzlich von der Tür zum Rittersaal her die tiefe, volle Stimme des obersten Dieners. „Hört!“
Es dauerte einen Moment, bis das Geklapper der Töpfe, Löffel, Messer, Schneidbretter und Fleischgabeln verstummt war. Gunid drehte sich auf ihrer Bank herum, in der einen Hand noch das Messer, in der anderen die halbe Karotte. Vom Koch bis zum Küchenjungen schaute alles den Diener an, der herausgeputzt in seiner samtenen Livree in der Tür stand.
„Ragald, der Sohn unseres Herrn, wird vermisst“, rief er in die Menge. „Hat ihn hier in der Küche jemand gesehen?“
Gunid sah sofort unter dem Tisch nach. Gemurmel erhob sich um sie her und schwirrte durch die Küche. Der Koch trat an die Tür und besprach sich mit dem Diener. „Wie sieht er überhaupt aus?“, fragte Jope. Gunid sagte es ihr: „Klein. Mit schwarzen Haaren. Und blauen Augen.“
„Woher willst du das denn wissen?“, spöttelte Lirin. Bevor Gunid ihr einen Schubs versetzen konnte, erhob der Diener wieder die Stimme: „Da der junge Herr nirgends in der Burg zu weilen scheint“, verkündete er, „wird das Fest in Kürze unterbrochen, um nach ihm zu suchen.“
Der kriegt was zu hören, dachte Gunid, und wusste selbst nicht so recht, ob schadenfroh oder mitfühlend.
„Meister Koros wird diejenigen auswählen, die sich der Suche anschließen“, fuhr der Diener fort und deutete auf den Koch. „Die übrigen fahren in der Vorbereitung der Speisen fort.“
Er drehte sich um und stolzierte zurück in den Rittersaal. Wie auf Befehl ging die ganze Küche in Stimmengewirr unter. Der Koch klatschte in die fleischigen Hände und fing an, die jungen Burschen und Mägde neu einzuteilen. „Und was ist jetzt mit den Schiffen los?“, fragte Jope.
„Wahrscheinlich haben sie den jungen Herrn mitgenommen“, näselte Gunid und widmete sich wieder ihrer Karotte.
Irgendwann war alles Gemüse gewaschen, geschält und geschnitten, und die Kinder durften gehen. Gunid lief mit ein paar anderen zum Tor hinaus, wo die Wachen und einige der edlen Gäste im Schnee standen und zum Wald hinüberspähten. Die Dämmerung hing rötlich und grau über den Baumwipfeln, und hin und wieder ertönte von einer der Suchmannschaften ein Jagdhorn.
Neugierig musterte Gunid die Menge am Tor. Sie hatte noch nie so viele hohe Herrschaften auf einem Haufen gesehen. Es war ein alter Mann dabei mit eisengrauen Locken, die ihm über den dunklen Pelzkragen seines Umhangs fielen. Er unterhielt sich mit einer rundlichen, rotwangigen Frau, die man, wäre nicht das prächtig bestickte Kleid gewesen, für eine einfache Bäuerin hätte halten können. „… kann ich mir nicht vorstellen. Gewiss war ihm einfach nur langweilig, und er ist heimlich der Jagdgesellschaft gefolgt und hat den Weg aus dem Wald hinaus nicht mehr gefunden …“
Sogar ein Kind sah sie, ein vielleicht fünfjähriges Mädchen in einem weißen, silberdurchwirkten Kleid mit einer Haube, unter der sich Strähnen goldblonden Haares hervorringelten. Neugierig musterte Gunid das Mädchen, doch außer stumm den Wald anzustarren, tat es nichts. Gerade wollte sie es ansprechen, als ein Bewaffneter herzutrat, der das Wappen des Barons zu Havegard am Gürtel trug: einen silbernen Schwan auf blauem Grund. „Herrin?“ Ein blasses Gesichtchen hob sich ihm entgegen. „Der Abend dämmert, und der Wind wird kalt. Ihr solltet besser hineingehen.“
„Mir ist nicht kalt“, widersprach das Mädchen und schaute wieder zum Wald hinüber.
Der Bewaffnete seufzte. „Es ist eine Weisung des Barons, Eures Vaters.“
Noch einmal sah das Mädchen zu ihm hinauf, drehte sich dann wortlos um und ging gemessenen Schrittes in die Burg.
Gunid zupfte Jope am Ärmel und lief voraus, den Torpfad hinab und unten an der Mauer entlang. Sie blieb erst stehen, sobald sie außer Sicht der Erwachsenen waren.
„Hast du die gesehen?“, fragte sie ihre Freundin, richtete sich kerzengerade auf und stolzierte in übertrieben würdevoller Pose durch den Schnee. Jope presste sich die Fäuste gegen die Wangen und kicherte. Eine dunkle Strähne löste sich unter dem dicken Tuch, das ihre Mutter ihr als Mütze um den Kopf gewickelt hatte.
„Ich glaube, die müssen so laufen“, plapperte sie drauflos. „Du weißt schon, edles Blut und so.“
„Pff, da kann ich ja froh sein, dass ich eine Hörige bin!“ Gunid grinste. „Die darf bestimmt auch nie das hier machen.“ Sie bückte sich, um einen Schneeball zu formen, und sah die Spur.
Jope trat neben sie. Die Fußstapfen kamen hinter der Burg hervor, Abdrücke von kleinen Schuhen in kleinen Schritten, und zogen sich den Hügel hinab, zwischen verschneiten Sträuchern hindurch dem Bach zu. Näher an der Burgmauer verloren sie sich im Gewirr hunderter anderer Fährten, hinterlassen vom Gesinde, von den Wachen und der Jagdgesellschaft vom Nachmittag. Hätten sich Gunid und Jope nicht selbst eine Stelle gesucht, an der sie nicht gesehen werden konnten, sie wären niemals darauf gestoßen.
„Lauf zu den Wachen“, sagte Gunid und begann, der Spur zu folgen. „Sag ihnen, was wir gefunden haben.“
„Wie – was –“ Etwas ängstlich schaute Jope über ihre Schulter zur Burg hinauf. „Sollen wir nicht lieber die Erwachsenen suchen lassen?“
„Bis sie hier sind, ist es dunkel!“ rief Gunid. „Lauf, sag ihnen Bescheid! Ich gehe vor und suche Rag– äh – den jungen Herrn.“
Sie hastete durch die Sträucher, und die Zweige zerrten an den dicken Fußlappen, in die sie der Kälte wegen ihre Beine gehüllt hatte. Von weit weg, auf der anderen Seite des Burghügels, ertönten gedämpft die Jagdhörner, die noch immer den falschen Wald absuchten. Die Spur führte hinab, und an einigen Stellen musste Gunid mehr rutschen als laufen.
Beim Schrein der Göttin Vesas tauchte sie in den Wald ein. Die Spur folgte nun einem Wildwechsel und kreuzte Fährten von Hasen, Füchsen und unzähligen Vögeln. In den Geruch nach Schnee mischten sich Baumpilze und eine Ahnung von dem Laub, das unter der weißen Decke vor sich hinmoderte und an einigen aufgewühlten Stellen zutage trat. Hin und wieder schlug ihr ein Zweig ins Gesicht.
Es wurde jetzt rasch dunkel, doch ihr blieb immer noch ein wenig Licht, als vor ihr ein klägliches Wimmern durch das Gehölz drang. „Ragald?“, rief sie, und für einen Moment wurde das Geräusch lauter. Im ersten Moment lief sie schneller, bis ihr verspätet bewusst wurde, was die jammernde Stimme gesagt hatte. „Vorsicht“, hatte sie geweint.
Gunid blieb stehen und tastete sich die letzten Schritte behutsam voran, immer eine Hand gegen einen kräftigen Baum gestützt. So kam es, dass sie sich noch rechtzeitig festhalten konnte, als ihr Fuß schließlich ins Leere trat. Unter ihr fiel jäh die Uferböschung des Baches ab. Kein Rauschen oder Plätschern hatte sie gewarnt, der Bach lag verborgen unter einer dicken Eisdecke. Und auf dem Eis lag der Junge.
Im Dämmerlicht war er nicht mehr als ein dunkler Schatten auf der weißen Platte. Bäuchlings lag er da, alle viere von sich gestreckt, und unter seinem Jammern konnte sie es leise knistern hören. Schlagartig ging ihr durch den Kopf, was ihre Mutter ihr über das Eis auf dem Bach erzählt hatte. Es mochte noch so dick aussehen, mit einem unachtsamen Schritt konnte man darin einbrechen und hinabgezogen werden.
„Ragald?“, rief sie noch einmal.
„Leise“, schluchzte der Junge zurück. „… du machst sonst eine Waline.“
„Eine was?“
„Du machst, dass der Schnee rutscht …“
Sie schaute an der Böschung hinunter. Der Schnee hing in dicken Verwehungen zwischen den Sträuchern und Baumwurzeln. Eine breite Spur direkt vor ihr zeigte an, wo der Junge abgeglitten sein musste.
„Bleib ganz ruhig“, sagte sie halblaut und war froh, dass der Schnee ihre Worte auch so noch weit trug. „Ich mache keine Lawine. Ich hole dich rauf.“
Er gab keine Antwort, sondern schluchzte nur weiter vor sich hin. Gunid sah nach beiden Seiten. Im letzten, grauen Licht konnte sie einen Pfad ausmachen, vielleicht drei Dutzend Schritte rechts von ihr, der zum Ufer hinabführte. Sie trat zurück in den Wald und machte sich auf den Weg.
Das Gestrüpp zerrte an ihrem dicken Wollkleid, als sie hindurchzubrechen versuchte. Der Wald stand hier dicht, wie überall am Bach entlang, und als sie endlich die Stelle erreichte, an der es flacher hinabging, war sie völlig ermattet. Trotzdem trieb sie sich weiter voran. Die ganze Zeit tönte ihr Ragalds Jammern in den Ohren, voller Todesangst. Sie stellte sich vor, es wäre ihr kleiner Bruder Wulf, der auf dem Eis lag. Es hätte ihm auch ähnlich gesehen, sich so in Schwierigkeiten zu bringen.
Schritt für Schritt tastete sie sich den flacheren Teil der Böschung hinunter, bis sie schließlich um die Biegung kam und Ragald sah. Der Junge hatte sich nicht bewegt und mühte sich noch immer, so leise wie möglich zu schluchzen. „Ich bin da“, sagte sie, während sie beide Hände auf einen Felsen stützte und sich daran vorbeidrückte. „Ganz ruhig. Ich bin doch da.“
Sie kniete sich ans Ufer, zwei Schritte von ihm entfernt, und brach von einer jungen Weide einen Zweig ab, den sie ihm hinhielt. Ein spitzer Stein drückte ihr ins Knie, und die Kälte des gefrorenen Bodens drang durch die Fußlappen, doch sie blieb, wo sie war. Ragald fasste den Zweig, aber sobald sie zu ziehen begann, brach er ab.
„Tausend Schatten!“, entfuhr es ihr halblaut, während sie den Zweig von sich warf und sich hektisch umsah. Sie griff nach dem dicksten Ast der Weide, an den sie heranreichte, und zog daran, doch sie konnte ihn nicht brechen, nur ein wenig biegen. Es wurde immer dunkler.
Als sie sich mit ihrem ganzen Gewicht an den Ast hängte, beugte sich sein Ende direkt vor Ragalds Händen bis auf die Eisfläche hinunter. Ragald griff zu.
„Ja, gut so“, ermunterte sie ihn und ließ vorsichtig los. Der Ast hob den Jungen wie von selbst ein Stück weit an, und Ragald kam vorsichtig auf die Füße. Das Eis knirschte unter seinem Gewicht, aber noch hielt es.
„Zieh dich an dem Ast hoch“, sagte sie und ließ ganz los, um sich dem Jungen entgegenzurecken. Der Junge gehorchte und zog sich, eine Hand nach der anderen, in die Höhe. Nur noch seine Zehenspitzen berührten das Eis, den größten Teil seines Gewichts trug nun die Weide. Das Mädchen hielt ihm die Hand entgegen.
Eine qualvolle Ewigkeit verging, bis er nah genug ans Ufer gekommen war, um sie zu ergreifen. Gunid zog ihn mit einem Ruck zu sich heran, und im nächsten Augenblick lag er heulend an ihrer Schulter und klammerte sich an sie. „Ganz ruhig“, sagte sie und kraulte die schwarzen Locken unter seiner verrutschten Mütze. „Ganz ruhig.“ Er war wirklich nicht anders als Wulf.
Der letzte Streifen Licht verging, als sie Hand in Hand aus dem Wald heraustraten. Über ihnen, hoch oben auf dem Hügel, wimmelten Lichter auf den Mauern der Burg, und vor ihnen, nur einige hundert Schritte entfernt, kamen ihnen eher noch mehr Lichter entgegengetanzt.
„Warum bist du eigentlich weggelaufen?“, fragte sie ihn.
Seine kleine Hand in dem gefütterten Fäustling drückte ihre. „Verrätst du es auch niemandem?“
Sie lächelte beruhigend auf ihn hinab. „Natürlich nicht. Ich sag’ kein Wort.“
„Versprochen?“
Sie hob die freie Hand. „Hoch und heilig versprochen.“
Die Lichter kamen näher. Ragald schluckte und sah aus großen Augen zu ihr herauf.
„Ich hab’ gesehen, wie du in die Burg gekommen bist“, stieß er, noch immer etwas weinerlich, hervor. „Und ich hatte Angst vor dir.“
Gunid blieb stehen und starrte ungläubig auf ihn herab. Jederzeit sonst hätte sie losgelacht, doch nach dem, was sie gerade mit ihm durchgemacht hatte, war ihr nicht danach.
„Das brauchst du nicht“, sagte sie stattdessen und ergriff ihn feierlich bei beiden Schultern. „Hörst du? Du brauchst keine Angst vor mir zu haben.“
Der verheulte kleine Junge lächelte sie schüchtern an. Im nächsten Moment waren sie von Fackellicht und Erwachsenen umgeben, die sich besorgt bei ihrem jungen Herrn erkundigten, ob ihm etwas geschehen sei.
2
Sie war vierzehn, er war zwölf, als seine Zeit als Page endete und seine Ausbildung zum Ritter begann.
Es war eine unbeschwerte Zeit gewesen seit jenem Abend im Winter. Ragald, das wurde ihr schnell klar, war ohne Mutter oder Geschwister aufgewachsen und entsprechend einsam. Die Kinder des Gesindes oben auf der Burg behandelten ihn als hohen Herrn, und er hatte es schwer gehabt, Spielkameraden zu finden.
Sie fand schnell Gefallen daran, sich mit ihm zu treffen und ihm beizubringen, wie ein Kind aus dem Volk einfach herumzutollen. Sie rannte mit ihm über die Hügel, kletterte mit ihm auf Bäume, balgte sich mit ihm, und bald schon musste sie den anderen Kindern im Dorf öfters was auf die Nase geben, die sie als „Rittersbraut“ zu verspotten begannen. Besonders Wulf tat sich hier als Schandmaul hervor, was ihn allerdings nicht daran hinderte, mit Gunid und ihrem neuen Freund gemeinsam die Gegend unsicher zu machen.
Trotzdem gab es Gelegenheiten, zu denen sich Ragald mit ihr allein treffen wollte, und heute war einer dieser Tage. Gunid stand am Schrein der Vesas, die Ellbogen auf den Opferbalken gestützt und das Kinn auf die Hände, und betrachtete versonnen das Standbild der Göttin. Ein kleines Dach, auf dem sich allmählich das Herbstlaub zu sammeln begann, schützte die geschnitzte Figur vor Wind und Wetter. Seltsam, dachte sie wieder mal, dass die Herrin des Regens und der Nebel ein Dach über dem Kopf brauchte, doch ihre Gedanken trieben schnell weiter. Sie blickte der Göttin ins Gesicht, das von der Kapuze ihres wallenden Mantels halb verhüllt war, und fragte sie stumm, ob wohl Baragor, der große, muskulöse Gehilfe des Schmieds, mit ihr zum nächsten Scheunentanz gehen würde.
„Gunid!“
Sie schrak aus ihrem Tagtraum auf und fuhr herum, dass ihre beiden braunen Zöpfe flogen. Ragald kam auf sie zu, und er rannte. Von der Feier zu seiner Erhebung in den Knappenstand war er noch immer herausgeputzt, doch es schien ihm gleichgültig zu sein, dass er den neuen, goldgelben Wappenrock mit dem schwarzen Raben auf der Brust und die guten, blauen Hosen verstaubte und verschwitzte. Sie hatte ihn selten so aufgeregt erlebt und noch nie mit einem solchen leuchtenden Lächeln.
„Was ist denn –“, begann sie, als er sie erreichte, doch er nahm sofort ihre Hände und sprudelte hervor: „Gunid, ich muss dir unbedingt etwas zeigen, es ist wundervoll! Komm mit!“ Er ergriff ihr Handgelenk und zog sie regelrecht hinter sich her.
Lachend folgte sie. „He, mein Kleiner, was ist denn mit dir los?“, fragte sie. Statt einer Antwort warf er nur kurz mit verschwörerischem Lächeln einen Blick über die Schulter. Sie verdrehte die Augen. Wenn Jungen schon mal versuchten, geheimnisvoll zu tun!
Ohne Widerstand ließ sie sich von ihm zur Burg ziehen. Er war immer noch kleiner als sie, aber nur um wenige Fingerbreit, und ihr an Kraft inzwischen fast ebenbürtig. Ihre letzte Rangelei lag nun schon einige Zeit zurück, und sie hatte sich anständig ins Zeug legen müssen, um ihn niederzuringen.
Wie immer liefen sie, anstatt zum Haupttor, zu dem kleinen Seitenausgang, den er damals benutzt hatte, als er – wie sie sich immer noch mit einem Schmunzeln erinnerte – vor ihr geflohen war. Quietschend schwang die Tür nach außen, und Hühner stoben vor ihnen auf, als sie den Burghof betraten. Niemand beachtete sie, als sie an der Mauer entlang zum Eckturm hasteten. Gunid war auf der Burg bekannt, und im übrigen sah sie mit ihrem braunen Kittel, der weißen Schürze und dem Kopftuch aus wie eine beliebige Magd aus dem Gesinde.
Seine Stiefel polterten die hölzernen Stufen ungeduldig hinauf. Er hatte sie schon einmal hierher mitgenommen, erinnerte sie sich. Es war lange hergewesen, aber allmählich dämmerte ihr, wohin er sie führen wollte. Auf dem zweitobersten Treppenabsatz liefen sie beinahe eine ältere Magd über den Haufen. Ihr Schimpfen mischte sich mit dem Klimpern des Schlüsselbundes, den Ragald vor der obersten Tür so aufgeregt aus dem Gürtelbeutel zog, dass er ihn beinahe fallen ließ. Nach einigem Nesteln aber hatte er den Schlüssel im Schloss, drehte ihn mit einigen Rucken um, holte tief Luft – und öffnete die Tür langsam und ruhig.
Aus dem Raum drang eine stechende Mischung von Gerüchen. Ragald schritt zwischen zwei Reihen von Boxen entlang, solchen für Pferde nicht unähnlich, aber mit Gittertüren vom Boden bis zur Decke versehen. In jeder spannte sich eine Querstange zwischen den Wänden, und in dem Sand, der den Boden bedeckte, befanden sich jeweils ein hölzerner Block und eine flache Wasserschale. Im Augenblick waren sie verwaist, doch ein lang gezogenes Kreischen von der offenen Falltür im Dach her, durch die ein Strahl Sonnenlicht hereinfiel, verriet, wo sich die Bewohner aufhielten. Im Vorbeigehen nahm Ragald einen Falknerhandschuh aus dickem, steifem Leder von einem Haken an einem der Deckenbalken, trat an die Leiter und stieg zur Turmplattform hinauf.
Sobald auch Gunid den Kopf ins Freie hinausstreckte, fand sie sich von Greifvögeln umgeben. In der Falknerei, daran erinnerte sie sich, wurden die edlen Tiere nur Nachts untergebracht, wenn sie schliefen. Den Tag verbrachten sie hier draußen auf der Turmplattform, die Läufe mit Lederriemen locker an die runden Blöcke gebunden, auf denen sie saßen, wenn sie nicht gerade zum Fliegen hinausgeführt wurden. Von seinem Platz neben der Falltür her musterte ein Wanderfalke sie aus drohend schwarzen Augen. Neben ihm hatte sich ein großer, schwarzbrauner Königsadler in den Schatten des kleinen Daches zurückgezogen, wie es bei jedem der Blöcke in Reichweite der Riemen aufgestellt war. Gegenüber klappte ein Habicht den Schnabel auf und zu, und auf dem Block daneben putzte ein zweiter sein Gefieder.
Eingeschüchtert blieb Gunid neben der Falltür stehen, während Ragald so selbstverständlich zwischen den Raubvögeln dahinschritt, wie sie den Schafspferch ihrer Eltern betrat. Es gab nicht viel, was ihr Angst einjagte, doch ein Blick auf die Krallen dieser Vögel genügte, um ihr das Herz bis zum Hals schlagen zu lassen. Nicht, dass sie es ihrem jungen Freund gegenüber jemals zugegeben hätte.
Ragald streifte den Falknerhandschuh über und trat an einen der Blöcke heran. Der Vogel darauf ließ noch einmal das Kreischen ertönen, das ihnen schon unten in der Falknerei entgegengeschollen war. Er war kleiner als die anderen Greifvögel, rötlich-braun gefiedert, und als der Junge seine Fußriemen löste, hüpfte ihm das Tier sofort auf den Handschuh.
Gunid ertappte sich dabei, dass sie krampfhaft mit einer Hand die hochgeklappte Falltür umklammert hielt, als Ragald mit dem Tier auf der Hand zu ihr zurückkam. Angstvoll beobachtete sie, wie sich der schwarz-gelbe Schnabel, spitz wie ein Krummdolch, dem Gesicht ihres Freundes näherte. Um so verblüffter beobachtete sie, wie der Raubvogel seinen Kopf an Ragalds Wange schmiegte.
„Gunid“, strahlte der Junge, atemlos vor Glück und von der Hatz den Turm herauf, „das ist Lif.“
Gunid zwang sich, den Griff um die Falltür ein wenig zu lockern. „Lif?“
Ragald nickte. Noch einmal rieb der Greifvogel seinen Kopf am Hals des Jungen. „Vater hat ihn mir geschenkt. Zur Erhebung in den Knappenstand. Mein erster eigener Vogel. Verstehst du? Mein erster eigener Vogel!“
Sie vermied es, ängstliche Seitenblicke auf die anderen Tiere zu werfen, und rang sich ein Lächeln und ein Nicken ab. Ehe sie noch etwas sagen konnte, hatte Ragald schon den Handschuh mitsamt Vogel abgestreift und hielt ihn ihr hin. „Hier, nimm ihn mal.“
Ihr Blick ging ungläubig zwischen dem Raubtier auf Armeslänge vor sich und ihrem jungen Freund hin und her. „Ich soll –?“
Ihr Zögern schien ihn zu sich zu bringen. Allmählich schwand der Eifer aus seinem Gesicht, und er musterte sie mit wachsender Verwirrung.
„Er tut dir nichts“, begann er schließlich. „Er ist ganz zahm, siehst du?“ Sein Finger ging zum Brustgefieder und kraulte Lif unterhalb des Schnabels. Der Vogel spreizte in sichtlichem Behagen die Flügel.
Sie holte tief Luft und hielt ihm die Hand hin. „Ich habe gar keine Angst …“, murmelte sie, wenig überzeugend.
Er streifte ihr den Handschuh über. Gunid wappnete sich gegen das Gewicht des Vogels und staunte, wie leicht er wog. Die dunklen Augen und der Schnabel waren jetzt nur noch eine Handspanne vor ihrem Gesicht.
„Er ist ein Bronzebussard“, erklärte ihr Ragald stolz. „Aus den Steppen südlich des Akkaral.“
„Die Steppen? Ist das nicht da, wo die Flotte der Jattar zuletzt gelandet ist und alles gebrandschatzt hat?“ Sie war froh, für einen Moment ein anderes Gesprächsthema zu finden. Er nickte.
„Ja, genau. Vater sagt, die Steppenleute hätten den Jattar Tribut angeboten, darunter hunderte dieser Vögel.“ Wieder streichelte er Lif am Kinn.
„Und was geschah?“ Noch immer vermied sie es, den Vogel anzusehen.
Ragald hob die Schultern. „Den Jattar war es egal. Städte, Dörfer, Tempel, sogar die Zeltlager der Nomaden, angeblich haben sie alles niedergebrannt.“
Lif trat von einer Klaue auf die andere und zwang so ihre Aufmerksamkeit wieder zu sich her. Sein Schnabel senkte sich, und sie gewann den Eindruck, er schnuppere an ihrem Arm. Als sie vorsichtig den Handschuh hob, blickte ihr der Vogel gerade ins Gesicht. Sie schloss die Augen, nahm all ihren Mut zusammen und hob langsam den zitternden Finger der anderen Hand seiner Brust entgegen. Nachdem sie sein Gefieder berührt hatte und ihr Finger immer noch an ihrer Hand hing, ließ sie seufzend den angehaltenen Atem entweichen. Lif spreizte die Flügel.
„Er mag dich.“ Ragald strahlte, und sie fasste sich ein Herz und streichelte den Vogel weiter. „Ein schönes Tier“, sagte sie, doch es klang ihr in den eigenen Ohren immer noch kläglich.
Als sie den Turm wieder verließen, verbrachte sie den halben Weg die Treppe hinab damit, ihm zu beteuern, dass sie nie vor irgendeinem dieser Vögel Angst gehabt hatte.
Sie sahen sich nun seltener, was nicht nur daran lag, dass Ragalds Ausbildung ihn in Anspruch nahm. Wie es der Brauch forderte, beherbergte Ritter Adolar auf seiner Burg stets eine Handvoll Knappen, die bei ihm und seinem Waffenmeister das Kriegshandwerk erlernten. Nun, da Ragald endlich in ihr Alter aufgerückt war, hatte er plötzlich auch Kameraden auf der Burg.
Nicht, dass er Gunid allzu sehr fehlte. Während Ragald lernte, mit Schwert, Spieß und Schild umzugehen, war sie neben ihrer Arbeit auf dem Hof viel zu beschäftigt mit ihren ersten Erfahrungen, Verehrer abzuweisen … oder zumindest eine Weile zappeln zu lassen. Es dauerte nicht lange, bis sie die Heuschober im Dorf auf besondere Weise zu schätzen lernte.
Dennoch verbrachte sie immer noch viel Zeit mit ihrem kleinen Freund, der ihr mittlerweile über den Kopf wuchs. Ihre Angst vor Lif verlor sich allmählich, und zusammen mit Ragald und seinem Vogel auf die Beizjagd zu gehen, wurde ihr zur willkommenen Gelegenheit, auf andere Gedanken zu kommen, wann immer ein Stelldichein mit einem der Burschen aus dem Dorf weniger angenehm verlaufen war als erhofft. Die erlegten Kaninchen und Schnepfen, die Gunid von diesen Ausflügen mit nach Hause brachte, nahm ihre Mutter zwar mit einem Stirnrunzeln entgegen, schien aber über das zusätzliche Fleisch im Topf nicht ernsthaft unglücklich; vor allem, wo die Erträge aus Feld und Vieh immer knapper wurden, je mehr der Männer des Dorfes in den Krieg zogen.
„Noch vor einem Jahr haben wir kaum gewusst, dass es überhaupt einen König gibt“, mampfte Wulf. „Mittlerweile raubt er uns jedes Paar Hände für die Ernte.“
„Jedes Paar Hände.“ Gunid schüttelte den Kopf. „Du übertreibst mal wieder maßlos.“ Mit einem Stück Brot tunkte sie den Rest Eintopf in ihrer Schale auf.
„Du übertreibst mal wieder maßlos“, äffte er sie näselnd nach. „Fehlt uns Tirak, oder fehlt uns Tirak?“
„Pff! Das sagst du doch nur, weil du endlich mal selber ordentlich anpacken musst, du fauler Sack!“
Im Herdfeuer zischte es. Anscheinend war der Regen endlich durch den undichten Schornsteinaufsatz gesickert.
„Tirak fehlt an allen Ecken und Enden“, warf Mutter ernst ein. Das Feuer zeichnete die Furchen in ihrem Gesicht mit tiefen Schatten nach, die sie unendlich alt aussehen ließen. „Und Godrich und Witha sind kein Ersatz für einen erfahrenen Knecht. Im Grunde macht Vater jetzt alles allein.“
„Ist er darum immer so schlecht gelaunt in letzter Zeit?“, fragte Gunid und rieb sich versonnen die Wange.
„Auch.“ Mutter erhob sich und nahm ihr die leere Schale ab.
„Auch?“ Wulf mochte ein Quälgeist sein, doch er besaß einen wachen Verstand.
„Ich meine, ja“, verbesserte sich Mutter hastig. „Ja, er ist schlecht gelaunt, einfach weil er jeden Tag todmüde vom Feld kommt. Möchtest du noch etwas?“
Mit einem Kopfschütteln schob Wulf ihr die leere Schale hin und musterte Mutter aus nussbraunen Augen, die sehr denen seiner Schwester glichen. „Was ist es noch?“
Mutter stellte die Schalen ineinander und brachte sie zu dem Zuber bei der Herdstelle hinüber. Der prasselnde Regen vor dem Fensterladen tränkte das Schweigen.
„Er macht sich Sorgen, nicht wahr?“, bohrte Wulf nach. „Wegen der Jattar.“
„Ach, Wulf, deute doch nicht wieder jedes meiner Worte wie ein Omen der Vesas!“ Es plätscherte und klirrte leise, als sie die Schalen im Zuber versenkte. „Er ist häufig müde. Schluss, aus! Und ihm fehlt Tirak, nicht nur als Knecht, sondern einfach, weil er Tirak ist. Die beiden waren schon Freunde, als sie nicht einmal halb so viele Sommer zählten wie du jetzt.“
Gunid reckte sich und lehnte sich gegen den Balken in ihrem Rücken. Aus dem Schornstein fuhr ein Windstoß in die Feuerstelle und ließ kleine Funkenteufel tanzen.
„Ragald hat es mir erklärt“, begann sie. „Er sagt, wir haben lange nichts vom König gehört, weil er kaum noch Macht hatte. Die Barone und Grafen und Herzöge bekämpften sich untereinander, und es gab keinen Feind, gegen den sie hätten zusammenhalten müssen.“
„Das ist ja wohl nichts Neues“, murmelte Mutter.
„Aber jetzt, wo die Jattar ein Land nach dem anderen verwüsten“, fuhr Gunid fort, „besinnen sie sich plötzlich wieder alle auf den König und wollen von ihm, dass er sie beschützt, dass er sie anführt …“
„Wenn sie einen König dafür haben“, murrte Wulf, „wozu brauchen sie dann Tirak?“
Ein erneuter Windstoß fuhr ins Feuer, und einige hektische Augenblicke lang waren sie damit beschäftigt, mit Decken auf die Funken einzuschlagen, die sich auf der Holzbank und dem Tisch niedergelassen hatten. Bis sie damit fertig waren, hatten sie den König, die fremden Krieger und die Feldarbeit vergessen.
Sie war sechzehn, er war vierzehn, als er sie zum ersten Mal bei einer Rangelei besiegte.
Ragald stand kurz vor seiner ersten längeren Reise. Die nächsten Jahre sollte er auf der Burg von Baron Havegard verbringen und die höfische Etikette erlernen. Natürlich hatte er nicht aufbrechen wollen, ohne sich vorher von Gunid zu verabschieden, und wie immer hatten sie sich am Schrein der Vesas getroffen, um sich anschließend in eine stille Ecke zu verkriechen.
Es war einer dieser Tage, an denen der Frühling so tat, als wäre er bereits der Sommer, und so hatten sie sich diesmal im Schatten einiger Bäume auf den Hügelhang gesetzt. Ragald hatte aus dem Keller der Burg einen Krug Rotwein herausgeschmuggelt, und Gunid versuchte vergeblich, herauszufinden, was er damit meinte, dass sie die „Blume“ des Weins genießen sollte. Aber der Trank schmeckte gut, und er machte den Kopf angenehm leicht.
Gunid lag im Gras und versuchte mit der einen Hand, den Zopf zu bändigen, den sie sich wie eine Krone um Stirn und Schläfen drapiert hatte und der sich immer wieder selbstständig machen wollte. Auf ihren anderen Arm hatte Ragald den Kopf gebettet und plauderte über das Leben, das ihn auf Burg Havegard erwartete. Er war gerade in dem Alter, in dem seine Stimme manchmal quietschend die Höhe wechselte, und so sprach er mal im hellen Ton des Jungen, mal mit einer hörbar tieferen Stimme, die fast schon nach der eines Erwachsenen klang. Heute trug er nur ein leinenes Hemd, grob gewebte Hosen und keine Schuhe. Die vergangenen Wochen der Waffenübungen im Freien hatten ihm die vornehme Blässe ausgetrieben und Gesicht, Arme und Beine gebräunt. Wäre nicht der Glanz seines schwarzen Lockenschopfes gewesen, man hätte ihn für einen einfachen Knecht halten können.
„Es heißt, der Baron habe sogar einen Hofzauberer“, erzählte Ragald in seinem hohen Ton, träge von der Hitze, und wedelte mit der Hand, um einen Schmetterling von seiner Nase zu verscheuchen. „Einen alten Mann, der die Zukunft aus den Sternen deutet und Karten zeichnet.“
„Was für Karten?“
„Landkarten.“ Er drehte den Kopf, und als sie ihn immer noch nur verständnislos anblickte, setzte er an: „Bilder davon, wie die Welt aus der Luft aussieht. So, als würde man sie von einem hohen Berg aus betrachten.“
„Von welchem?“
Ragald lachte, und seine Stimme wurde tief. „Von keinem richtigen Berg. Er zeichnet nur so, wie die Welt aussähe, wenn – He!“ Sie hatte ihn mit einem Finger in die Seite gepiekst und bedachte ihn mit einem gespielt bösen Blick. „Mach dich nicht über mich lustig!“
„Tu ich doch gar nicht“, kiekste er weiter, und ehe er sich versah, hatte sie ihn von ihrem Arm geschubst und fing an, ihn zu kitzeln. „Es gehört sich nicht für einen Edelmann, sich über eine arme Hörige lustig zu machen, hörst du?“
Für einen kurzen Augenblick wand er sich gackernd unter ihren Fingern, dann hatte er plötzlich ihr Handgelenk umfasst und drückte sie mit der anderen Hand von sich weg. Der Zopf fiel ihr von der Stirn, und sie schlenkerte den Kopf, um ihn sich aus dem Gesicht zu werfen. Im Nu fingen sie wieder an zu raufen, wie sie es schon eine Ewigkeit nicht mehr getan hatten, und stachelten einander mit Neckereien zwischen den Atemzügen weiter an.
Es war wie früher und zugleich völlig anders. Seine Kraft überraschte sie, und in jeder seiner Bewegungen machte sich bemerkbar, dass er in letzter Zeit kaum noch etwas anderes tat, als sich im Kampf zu üben. Wo sie ihm früher an Schnelligkeit voraus gewesen war, kam er ihr nun mit knappen, gezielten Bewegungen mühelos zuvor. Ihr letzter Vorteil schien darin zu bestehen, dass er von seiner neuen Überlegenheit genauso überrumpelt schien wie sie. Dennoch war er bald über ihr, drückte ihr beide Arme zu Boden und grinste sie an. „Ergibst du dich?“ Seine Stimme klang tief und männlich.
„Niemals, mein Kleiner!“, lachte sie und strampelte und stemmte die Beine gegen den Boden in dem Bemühen, ihn abzuwerfen. Umsonst. Er wechselte den Griff, und selbst mit einer Hand war er noch stark genug, ihre beiden Hände zu halten, während er mit der anderen über ihre Seite fuhr und ihr das Kitzeln heimzahlte. „Hör auf!“, quietschte sie. „Hör auf! Ich gebe auf! Du hast gewonnen! Geh runter von mir! Ich krieg’ keine Luft! Ich krieg’ keine Luft!“ Immer noch kichernd und japsend, den Blick von Lachtränen verschleiert, sah sie ihm in die Augen, deren Blau ihr einen endlosen Moment lang viel zu nahe war. Auf ihrer Brust lag noch ein anderes Gewicht als bloß sein Körper. Warm spürte sie seinen Atem auf der Wange, sie sah sein Lächeln, in dem noch etwas anderes zu liegen schien als der Triumph, sie besiegt zu haben, und ein seltsamer Schauder rann ihr durch alle Glieder.
Dann ließ er sie los, richtete sich mit einem Ruck und einem hellen Jauchzen auf, und die Welt fiel dahin zurück, wo sie hingehörte.
Zwischen ihren Begegnungen vergingen nun oft Monate. Gunids Tage waren ausgefüllt mit der Arbeit auf dem Hof, mit dem geselligen Leben im Dorf und mit den Aufmerksamkeiten von Jarugal, dem ältesten Sohn des Holzfällers, der scheinbar ernsteres im Sinn hatte als ein paar schöne Stunden im Stroh.
Lirin meinte dazu nur schnippisch, Gunid könne froh sein, dass sie noch einen von denen abbekommen hatte, die nicht in den Krieg gezogen waren. Die Felder hatten sich inzwischen spürbar geleert, und dass nun auch weniger Mäuler zu stopfen waren, wog den Verlust an zupackenden Händen kaum auf. Dennoch fand Gunid Lirins Bemerkung überflüssig. Niemand brauchte ihr zu sagen, dass sie froh sein konnte: Sie genoss die Zeit mit Jarugal, dessen bodenständiges Wesen selbst von ihrem Temperament nicht aus der Ruhe zu bringen war.
Doch zu den seltenen Gelegenheiten, bei denen sie nichts zu tun und niemanden um sich hatte, vermisste sie Ragald und die Jagdausflüge mit ihm und Lif. Um so größer war ihre Freude, wenn er für einige Tage nach Hause kam und sich stets mindestens einen dieser Tage Zeit für sie nahm.
Jarugal hielt sich nicht damit zurück, ihr ruhig, aber bestimmt zu sagen, wie wenig ihm diese Treffen gefielen. Keine Beteuerung ihrerseits, dass sie und „ihr Kleiner“ nur Freunde waren, und kein Spott über seine Eifersucht konnte an diesen Tagen seinen Groll besänftigen. Jarugal wurde erst wieder zugänglicher, sobald sich der Sohn des Ritters und sein Gefolge gen Havegard entfernt hatten und Gunid nach ein paar Tagen aufhörte, von ihm zu reden.
Sie war neunzehn, er war siebzehn, als ihr auffiel, dass er kein Knabe mehr war.
3
Wieder stand hoher Besuch ins Haus, und wieder hatte Ritter Adolar einen Großteil des Dorfes zur Fron eingezogen. So sehr die Dorfbewohner über die Mehrarbeit murrten, so dankbar waren sie zugleich für das Schauspiel, das der Adel ihnen bieten würde. Das vergangene Jahr hatte dem Dorf viel abverlangt. Viele der gesunden, kräftigen Männer waren bereits ins Heer eingezogen, und schon von einigen war die Nachricht eingetroffen, dass sie nicht zurückkehren würden. Allen diesen Opfern zum Trotz, so hieß es, rückten die Jattar stetig nach Norden vor, und eines der Heerlager, in denen König Halrik seine Truppen zu ihrer Abwehr sammelte, befand sich kaum eine Handvoll Tagesmärsche weit im Westen. Gerüchte von plündernden Banden machten im Dorf die Runde, und auch von bösen Geistern war die Rede, die die Jattar ins Land eingeschleppt hatten und die nun des Nachts durch die Wälder streiften.
In diesen Tagen war das Volk über jede Ablenkung froh, und eine bessere Ablenkung als ein prächtiges Fest des Adels mit Tanz und Turnier konnte sich niemand denken. Edelleute aus allen umliegenden Ländereien kamen zusammen, um dem Ereignis beizuwohnen, wenn Ragald aus der Baronie Havegard zurückkam und seine Braut heimführte.
Diesmal würde der Empfang im Freien stattfinden. Die Bäume rund um die Burg standen in voller Blüte und ließen selbst die farbenfrohen Wimpel und Pavillons bescheiden aussehen. Warme Winde aus dem Süden jagten ausgefranste Wolken vor sich her, sodass die Wiese unterhalb der Burg, auf der das Turnier stattfinden sollte, im raschen Wechsel in Sonnenlicht und Schatten getaucht wurde. Von den Fahnenmasten, von der Umzäunung des Kampfplatzes, von der halb aufgebauten Tribüne, überallher dröhnte Hämmern und Klopfen.
„Wulf!“, rief Gunid im Vorbeigehen. „Hör auf zu schäkern, und bring Sigoras endlich die Bretter!“ Ihr Kinn scheuerte über das Eimerjoch auf ihren Schultern, als sie mit dem Kopf zur Tribüne hinüberwies. Die junge Izra, eben noch mit Wulf ins Gespräch vertieft, errötete, nahm den Korb mit den Girlanden auf und hastete davon.
Mit grimmiger Miene kam Wulf auf Gunid zu und verstellte ihr den Weg. „Schwesterherz“, grollte er, „nur weil deine eigene Hochzeit geplatzt ist, musst du noch lange nicht allen anderen jeden Spaß verderben!“ Sie und Jarugal hatten ihre Verlobung gelöst, nachdem ihnen schon nach der Hälfte des rituellen Probejahres keine anderen Kosenamen mehr füreinander in den Sinn gekommen waren als „Klotz“ und „Biest“.
„Und du könntest dich ruhig bis zum Fest gedulden, bevor du Izra den Hof machst“, gab sie schnippisch zurück. „Oder hast du Angst, dass sie dir wegläuft?“
„Geduld! Das sagt die Richtige!“
Statt einer Antwort drehte sich Gunid, um ihren Weg fortzusetzen, und zwang ihn so, dem herumschwingenden Joch auszuweichen. Obgleich er schnell zurücksprang, streifte ihn der baumelnde Eimer am Knie. Seine Schimpftirade tönte hinter ihr her, als sie schmunzelnd den Hügel hinabstieg.
Auf halbem Weg kam ihr die lange, schlaksige Gestalt von Heglaf entgegen, hinter sich zwei Ochsen, die einen Karren voller Mehlsäcke durch das Gras zogen. Als er sie erblickte, weitete ein Strahlen sein langes Gesicht. Gunid verdrehte im Gegenzug die Augen. Der Müllergeselle war ein gefälliger Bursche mit seinen tiefdunklen Augen und seinem wuscheligen, dunkelbraunen Schopf, doch seit er – etwas verspätet – den Reiz der Frauen entdeckt hatte, stieg er allem hinterher, was einen Rock trug und nicht rechtzeitig flüchten konnte. Nach der Abfuhr, die ihm Bine jüngst erteilt hatte, war nunmehr Gunid zur „einzigen Frau, die ihn verstand“ nachgerückt, und seine Aufmerksamkeit wurde ihr langsam peinlich. „Gunid!“, rief er in einem forschen Ton, für den er zuvor tief Luft hatte holen müssen.
„Grüß dich, Heglaf“, erwiderte sie und schickte sich an, ihm auszuweichen, doch er hielt zielstrebig auf sie zu. „Wie geht es dir?“
„Viel zu tun“, gab sie zurück und schlug einen Bogen um seine Ochsen ein. Er streckte den Arm aus und stieß ihr bei dem unbeholfenen Versuch, sie aufzuhalten, beinahe das Joch von der Schulter. „Du hast mir immer noch nicht gesagt, ob du auf dem Fest mit mir tanzen willst.“
„Frag mich auf dem Fest nochmal“, seufzte sie und trat an ihm vorbei. Bald hatte sie den Reitweg am Fuß des Burghügels erreicht und folgte seinem Verlauf, vorbei am Schrein der Vesas und ein gutes Stück weiter, bis sie in den Waldweg einbog, der zum Bach hinunterführte.
Das Zwitschern und Schelten der Waldvögel begleitete sie, während sie sicheren Fußes den unebenen Pfad hinabstieg. Sie dachte an Wulf, an Jarugal, an Heglaf und daran, dass sie eine Zeit lang gern ihre Ruhe vor Männern hätte. Dann dachte sie an den Krieg, der schon so viele Männer verschlungen hatte, der stetig näherzurücken schien und den sie alle im Dorf so sehr zu verdrängen bemüht waren, dass er wie eine düstere Wolke allgegenwärtig war. Mit einem Ächzen hob sie sich am Ufer des Baches das Joch von den Schultern, ließ den ersten Eimer an seiner Schnur in das sonnenglitzernde Wasser hinab und suchte nach einem angenehmen Gedanken.
Der Wind trieb ihn an ihr Ohr, kaum dass sie die Schnüre wieder am Joch befestigt und sich auf den Rückweg begeben hatte. Weit entfernt ertönte ein Jagdhorn, fast sofort beantwortet von einer Fanfare oben auf der Burg, und erinnerte sie an den Anlass all der Arbeit, die sie sich machten. Ragald.
Sie musste lächeln, und unwillkürlich schritt sie schneller aus. Sie hatte oft an ihn gedacht, und die Aussicht, dass er seine Reisen beendet hatte, dass er nun wieder im Lehen bleiben und sie sich öfter treffen würden, stimmte sie froh. Das Horn musste seine Ankunft angekündigt haben. Wenn sie sich beeilte, würde sie ihn vielleicht noch einreiten sehen.
Sie war noch ein gutes Stück vom Waldrand entfernt, als sie oben auf dem Reitweg Bellen und das Klappern vieler Hufe vernahm. Noch mehr beeilte sie sich, aber als die Eimer ins Pendeln gerieten und ihr Inhalt in die Büsche zu schwappen drohte, setzte sie kurz entschlossen das Joch ab und lief ohne ihre Last das letzte Stück hinauf. Gerade rechtzeitig teilte sie die ersten Büsche, um zwischen den Bäumen die Reitgesellschaft an sich vorbeiziehen zu sehen.
Das erste, was sie erblickte, waren zwei Bewaffnete in Kettenhemden unter blauen Wappenröcken. Von der Lanze des einen flatterte ein blaues Banner mit einem silbernen Schwan, dem Wappen des Hauses Havegard. Jeder von ihnen saß auf einem leichtfüßigen Zelter und hatte an den Sattelknauf die Zügel eines bulligen Streitrosses gebunden, das hinterdrein trottete. Neben ihnen her führte ein Page ein Rudel edler Hunde über die Wiese, die kläffend an ihren Leinen zerrten. Hinter ihnen folgten zwei weitere berittene Waffenknechte, aus deren Pfeilköchern entspannte Langbögen ragten. Und hinter diesen wiederum ritten, prächtig gekleidet, Ragald und seine Braut.
Bei seinem Anblick erstarrte Gunid. Es war ihr, als sähe sie Ragald zum ersten Mal. Nie wäre ihr früher eingefallen, „ihren Kleinen“ als stattlich zu beschreiben, selbst dann nicht, als er sie bereits um einen halben Kopf überragte. Nie hätte sie seinen schlanken Wuchs als athletisch bezeichnet, nie waren ihr die wohlgeformten Waden aufgefallen, die er nun in den engen, schwarzen Reithosen zur Schau stellte, oder die kraftvollen Schultern, die das Auge selbst unter dem sich bauschenden, kobaltblauen Hemd erahnen konnte. Nie zuvor wäre ihr in den Sinn gekommen, sein glücklich lachendes Gesicht schön zu nennen.
Für einen Moment schloss sie überwältigt die Lider und schluckte ihren Herzschlag herab. Als sie die Augen wieder öffnete, wanderten sie unstet über den Rest seiner Gestalt, über das blaue Barett mit der Pfauenfeder auf seinen schwarzen Locken, über das aufgenähte Wappen auf seiner Brust – den goldenen Schild mit dem schwarzen Raben des Hauses Adolar –, über das Langschwert an seiner Seite, über die Hand, die er zur Seite erhoben hielt und in der die zarten Finger seiner Braut ruhten.
Sie erschien, als wäre sie aus purem Licht geschaffen. An ihrem zierlichen Leib floss ein weißes Kleid mit silberbestickten Säumen herab und wehte so anmutig hinter ihr her, als sei es eins mit dem Wind. Einer Wolke aus gesponnenem Gold gleich, floss ihr Haar unter einer weißen und silbernen Kappe hervor. Gerade wandte sie das feine, bleiche Gesicht mit einem glücklichen Lächeln dem Mann an ihrer Seite zu, der ihre Hand hielt.
Dann waren sie vorbei, und alles, was Gunid noch sah, waren die Rücken zweier Edelleute und ihre Pferde, sein sandfarbener Falbe mit dem dunklen Fleck auf der Hinterhand, Seite an Seite mit dem Apfelschimmel der Dame. Die Bewaffneten, die ihnen folgten, verdeckten gleich darauf auch diesen Anblick. Kaum noch nahm sie die Packtiere wahr, die danach an ihr vorübertrotteten, und die letzten berittenen Kämpfer der Nachhut. Irgendwo aus dem Zug heraus ertönte noch einmal über den Hufschlag hinweg das Jagdhorn, wieder beantwortet von der Fanfare auf der Burg. Im Wald, halb verborgen vom Unterholz, stand bebend und mit zugeschnürter Kehle Gunid, ballte die Fäuste, blickte den Reitern nach und kämpfte gegen das überwältigende Bedürfnis an, dem elfengleichen Geschöpf an Ragalds Seite die Augen auszukratzen.
„Wohl jeder Vater meint an einem solchen Tag, der glücklichste Mann seit Anbeginn der Zeit zu sein. Ich aber glaube aufrichtig, dass ich allen Grund dazu habe.“
Ritter Bernon Adolar bot einen Eindruck davon, welches Bild wohl sein Sohn nach einem halben Leben ständiger Kämpfe abgeben würde. Graue Strähnen durchwirkten seinen schwarzen Schopf, ein struppiger Vollbart verbarg mehr schlecht als recht einige Narben, und jede Gebärde, die seine Rede begleitete, schien mit einem kraftvollen Ruck einherzugehen. Wenngleich von eher schlanker Statur, besaß er doch einen Brustkorb, der das nachtblaue Wams schier sprengen wollte. Wenn er, so wie jetzt, vor dem Herzen die Faust ballte, fiel es nicht schwer, sich vorzustellen, dass er darin gerade eine Walnuss knackte. Von den vielen Gelegenheiten, bei denen seine Stimme Schlachtenlärm hatte übertönen müssen, war sie rau geworden, doch auch volltönend und laut.
„Jawohl, aus mir spricht durchaus der Stolz eines Adligen, der die Verbindung seines Hauses mit einem der vornehmsten dieses Landes verkündet. Noch viel mehr aber“ – mit diesen Worten ließ er den Blick über das Geviert der Festtafel wandern – „spricht aus mir der Stolz des Vaters, der die Verlobung seines Sohnes mit einer Dame erleben darf, deren edle Abstammung von ihren Tugenden und ihrem Liebreiz noch übertroffen wird!“ Mit ausholender Gebärde deutete er auf das Geschöpf aus Weiß und Silber, das bescheiden die Augen niederschlug. Von den Herrschaften von Stand an der Tafel, aber auch von den umstehenden Gemeinen und Hörigen ertönten Jubel und Hochrufe.
Gunid ließ das Hackmesser auf die Schweinelende auf ihrem Brett niedersausen und presste grimmig die Lippen aufeinander.
„So lasst uns denn trinken“, rief der Ritter und erhob seinen Kelch. Der Wind griff nach seinem Haar, ließ die bunten Wimpel über seinem Kopf flattern und trieb den Schatten einer Wolke über den Festplatz. „Auf das Bündnis zwischen den Häusern Havegard und Adolar, noch mehr aber auf das Glück zweier junger Leute: auf Witlinde Havegard und auf meinen Sohn, Ragald Adolar! Ich bin gewiss“ – er sah nach oben – „dass in diesem Moment auch die Seele meiner Gemahlin Yville glücklich und stolz aus den Nebeln der Göttin auf ihren Sohn herablächelt. Möge Vesas diese Verbindung segnen!“
Von den Bänken erhob sich die farbenfrohe Schar der Edelleute in Samt, Seide und feinstem Leinen. Wieder erschollen Hochrufe, Kelche wurden dem Himmel entgegengereckt, und das einfache Volk klatschte stürmisch Beifall. Gunid lüpfte das Hackbrett an und schob mit dem Messer die abgeteilten Schnitzel auf eine Platte. Wulf, der den Grillrost im Auge behielt, versetzte ihr einen Rempler. „Bist du toll geworden?“ zischte er. „Du kannst doch nicht in diesem Moment weiter Fleisch hacken!“





























