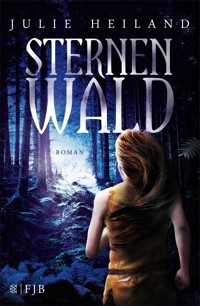14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Bannwald-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ich hasse den Wald. Ich hasse ihn aus tiefstem Herzen. Er tut so, als wäre er mein Zuhause. Aber das ist er nicht. Er ist mein Gefängnis. Sie können nicht töten – als Anhänger der weißen Magie erschaffen sie nur. Seit Generationen lebt der friedliche Stamm der Leonen gefangen im Wald, gewaltsam unterdrückt vom Stamm der mörderischen Tauren. Als die 17-jährige Robin auf den jungen Tauren Emilian trifft, ist sie sich sicher, dass er sie töten wird. Doch Robin gelingt es zu fliehen – scheinbar. Erst später wird ihr bewusst: er hat sie laufen lassen. Warum? Als Robin dann ein Reh mit der bloßen Kraft ihrer Gedanken tötet, ist sie zutiefst erschüttert. Was ist mit ihr? Robin trägt ein Geheimnis in sich, und es gibt nur einen, der davon weiß – ihr größter Feind. Wie es dazu gekommen ist? Wie es immer zu so etwas kommt. Die Starken wittern die Macht und bezwingen die Schwachen. Wir, der Stamm der Leonen, sind Anhänger der weißen Magie. Die Magie der Natur. Wir heilen, wir erschaffen, wir tun Gutes. Die anderen, der Stamm der Tauren, haben sich der schwarzen Magie verschworen. Sie herrschen kaltblütig, sie vernichten, sie töten. Auch uns. Aber das werde ich nicht länger zulassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Ähnliche
Julie Heiland
Bannwald
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Jagd
Ich hasse den Wald. Ich hasse ihn aus tiefstem Herzen. Er tut so, als wäre er mein Zuhause. Aber das ist er nicht. Er ist mein Gefängnis. Ein Ort ständiger Angst, in den kein einziger Lichtstrahl fällt. Dabei hätte ich ihn gerne als Zuhause. Seine saftig grünen Bäume, die weiche, dunkelgrüne Moosschicht über der Erde und die verspielten Wurzeln, die so vielen Tieren Unterschlupf bieten. Ein Kunstwerk, das ich hassen muss.
Natürlich kann er nichts dafür, dass wir gefangen gehalten werden. Wir sind Gefangene der Tauren. Wir, meine Familie. Der Stamm der Leonen. Vordergründig sind wir frei. Wir leben in einer kleinen Siedlung mitten im Wald.
Die Regeln hier sind einfach. Bereits als Kind werden sie einem von den Ältesten so oft eingetrichtert, dass man sie im Schlaf herunterbeten kann. Ohne deren Sinn wirklich zu verstehen. Dann wächst man heran und begreift irgendwann, was diese Regeln tatsächlich für einen bedeuten.
Regel Nummer eins: Wir, der Stamm der Leonen, sind immer minderwertig. Wir haben keine Rechte und schulden unseren Herrschern, dem Stamm der Tauren, bedingungslosen Gehorsam.
Wie es dazu gekommen ist? Wie es immer zu so etwas kommt. Die Starken wittern die Macht und bezwingen die Schwachen. Wir, der Stamm der Leonen, sind Anhänger der weißen Magie. Die Magie der Natur. Wir heilen, wir erschaffen, wir tun Gutes. Unsere Kraft ist nicht stark, wir sind keine großen Zauberer. Aber wir sind die Guten. Die anderen, der Stamm der Tauren, haben sich der schwarzen Magie verschworen. Sie herrschen kaltblütig, sie vernichten, sie töten. Einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns zu fügen.
Regel Nummer zwei: Am Ende einer jeden Woche sind wir verpflichtet, Abgaben zu leisten. Und das, wo wir doch selbst kaum das Nötigste zum Überleben haben. Gemüse, Beeren, Kräuter. Manchmal auch ein junges Mädchen, das sie sich zur Hure machen.
Regel Nummer drei: Wir dürfen unser Gebiet niemals verlassen. Gerade einmal zur Schule oder in die Stadt, um zu arbeiten. Doch das auch nur zu vorgegebenen Zeiten. Überschreiten wir die Grenze ohne Erlaubnis, droht uns die Todesstrafe.
Die Tage, an denen wir zum Arbeiten und Lernen in die Stadt dürfen, werden von den Tauren willkürlich bestimmt. Meistens jedoch einmal in der Woche. Natürlich gehört die Schule den Tauren. Lernen kann man dort also nur, wie minderwertig wir und wie herrschaftlich sie sind. An einem weiteren Tag im Monat dürfen wir zudem noch für wenige Stunden in die Stadt, um lebensnotwendige Dinge zu besorgen. Dann gibt es noch zwei Abende für die jungen Leute, damit diese ausgehen und in einer Bar etwas trinken können. Dieses zweifelhafte Angebot wird jedoch kaum in Anspruch genommen. Denn die Stadt wird gänzlich von den Tauren beherrscht. Selbst die Menschen, die darin leben, werden von ihnen dominiert und merken es nicht einmal. An jeder Ecke trifft man auf Tauren. Sie demonstrieren ihre Macht, jagen einen wie der Fuchs den Hasen. Zwar dürfen sie uns dort nichts tun, aber mein Opa starb an Herzversagen. Mitten in der Stadt. In einer engen Seitengasse. Weiß der Himmel, was sie dort mit ihm angestellt haben.
Wir sind ihnen ausgeliefert. Die Liste der Regeln geht noch weiter, ungefähr fünfzig sind es. Deswegen hasse ich diesen Wald. Ich will fort von hier. Raus, einfach woandershin. Aber dafür muss ich über die Grenze, und spätestens dort würden sie mich töten. Ich weiß ja nicht einmal, was dahinter kommt. Ich kenne nur unser Gebiet und die Stadt. Mehr dürfen meine Augen nicht sehen. Ein Gefängnis.
Über meinem Kopf bewegt sich etwas. Blätter rascheln. Ganz langsam ziehe ich mein Wurfmesser aus der Gürtelscheide. Ich habe immer drei Messer dabei, ein besonders scharfes, ein leichtes und das Wurfmesser. Es ist perfekt geformt und liegt anders in der Hand als die beiden anderen Waffen. Perfekt ausbalanciert, der Schwerpunkt in der Mitte, spitzer. Mein Körper spannt sich, ich hole aus und schleudere das Messer durch die Luft. Im nächsten Moment fällt schon der leblose Körper einer Wildtaube vor meine Füße. In ihrer Brust steckt mein Messer, sauber gezielt, so dass man es herausziehen kann, ohne den halben Körper der Taube zu zerfetzen.
»Robin?! Was machst du denn? Wo bist du?«
Laurin. Wir wurden von unserem Stammesvater losgeschickt, um Beeren für die wöchentliche Abgabe zu sammeln. Laurin sammelt, ich reagiere meinen Frust ab. Seit Stunden stapfe ich ziellos durch den Wald, müde und erschöpft, dennoch mit jedem Sinn darauf bedacht, nicht die Grenze zu überschreiten. Ich atme tief ein, rieche die nasse Erde und den würzigen Duft der Kräuter. Die Süße der Blüten und das bittere Harz. Schnell hebe ich die Taube auf, ziehe das Messer aus ihrer Brust und verstaue es wieder an meinem Gürtel. Das Tier hänge ich mit einem Haken an meine Hose, wo es bei jedem Schritt baumelt. Meine Füße, eingepackt in robuste Lederstiefel, federn über das weiche Moosbett. Jeden Zweig kenne ich hier, jedes Blatt, jede Wurzel. Ich laufe schneller, damit Laurin mich nicht entdeckt. Soll er doch alleine Beeren sammeln. Er ist ohnehin viel zu nett, viel zu lieb. Wenn wir am Abend zurück in unsere Siedlung kommen, wird er ganz selbstverständlich behaupten, dass ich die ganze Zeit an seiner Seite war. Vermutlich sogar noch, dass ich den größeren Teil Beeren gesammelt habe.
»Robin! Jetzt mache ich mir langsam Sorgen …«
Ich laufe noch schneller. Die Taube schlägt im Takt meiner Schritte gegen mein Bein. Auf einmal knackt etwas. Die Zweige eines Busches rascheln. Alles geht viel zu schnell.
Ein Eber prescht zwischen den Ästen hervor, die gebogenen Eckzähne wie zwei Klingen gegen mich erhoben. Fast schon hat er mich erreicht, als es mir endlich gelingt, mich aus der Schockstarre zu lösen. Die hohen, grunzenden Laute sind so dicht hinter mir, dass ich beinahe schon den heißen Atem des Tieres auf meinem Rücken spüre. Für seinen ungelenken Körper ist er verdammt schnell.
Ich springe über Wurzeln, federe vor umgefallenen Baumstämmen ab und springe ohne zu straucheln darüber. Weiche in letzter Sekunde Bäumen und Ästen aus, ohne auch nur einen einzigen Kratzer davonzutragen. Alles in mir ist nur darauf ausgerichtet, das hier zu überleben. Ich kalkuliere meine Möglichkeiten. Von den Messern an meinem Gürtel kommt nur das scharfe für den Zweikampf in Frage. Ich bin schnell – aber nicht schnell genug, um es aus meinem Gürtel zu ziehen, stehen zu bleiben und es dem Tier in seinen wuchtigen Körper zu rammen, ohne dabei selbst verletzt zu werden.
»Robin! Rooobin! Was ist los?« Wieder Laurin.
Bleib weg!, flehe ich ihn in Gedanken an. Er kann nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun, geschweige denn ein größeres Tier töten. Wie sollte er es dann mit einem Eber aufnehmen?
Wieder ein wuterfülltes Quieken, diesmal weiter weg. Ich springe erneut über einen Baumstamm, entdecke die Felswand vor mir. Mit wenigen Zügen hangle ich mich die grauen Steine empor, reiße mir dabei meine Hände auf und schürfe meine Knie blutig. Hier hinauf kann mir der Eber so schnell nicht folgen.
Ich ziehe mich die restlichen Meter hinauf, bis ich wieder eben stehe. Mein Herz rast, das Blut schießt durch meinen überhitzten Körper. So wütend bin ich auf mich selbst, dass ich nicht aufgepasst habe! Meine Gedanken haben mich unaufmerksam gemacht. Ich hätte den Eber früher bemerken müssen. Dann hätte ich mich hinter einem Busch versteckt, in Ruhe mein Wurfmesser gezückt und es in seinen borstigen Körper geschmettert.
Jetzt bin ich aufmerksam. So aufmerksam, dass ich die Veränderung merke. Es ist ruhig in diesem Waldstück. Verdammt ruhig. Kein einziger Vogel singt. Nicht einmal die Blätter rascheln im Wind. Das Licht, das sonst so wundervoll zwischen dem dichten Baumdach hindurchbricht, ist verschwunden. Es ist dunkel hier. Fast so, als wäre es Nacht. Gänsehaut überzieht meine Arme. Ich weiß, wo ich bin, oder besser gesagt, ich ahne es. Im verbotenen Bereich. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich laufen muss, um von hier wieder fortzukommen. In unser Gebiet. Dorthin, wo ich sicher bin.
Mein Atem geht so schnell, dass mir schwindelig wird. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt doch den Eber bevorzugen. Die Stille überreizt meine Nerven endgültig. Das hier ist nicht natürlich. Selbst den Wald haben sie ihrer Macht unterworfen.
Ich weiß nicht, wie sie es tun werden. Ob sie mich gleich töten oder mich erst gefangen nehmen. Mich erhängen oder mir die Kehle aufschlitzen. Mein Stamm wird nichts davon mitbekommen. Sie werden nur merken, dass ich nicht mehr nach Hause komme.
Reiß dich zusammen!, ermahne ich mich. Vielleicht haben sie noch gar nicht gemerkt, dass ich die Grenze überschritten habe. Wie auch? Ich atme einmal tief ein, drehe mich um meine eigene Achse. Keine Ahnung, wo ich mich im Wald befinde. Ich könnte in die Richtung zurücklaufen, aus der ich gekommen bin, und runterklettern. Aber dort laufe ich Gefahr, dem Eber ein zweites Mal zu begegnen. Dafür fehlen mir die Kraft und die Konzentration. Eine andere Richtung einzuschlagen ist aber noch gefährlicher. Am Ende lande ich direkt in ihrer Siedlung.
Meine Beine sind schwer wie Blei, meine Muskeln zittern vor Anstrengung. Wie zur Hölle soll ich so einen klaren Kopf behalten?
Ein Ast knackt. Nicht ich habe das verursacht, denn ich stehe ganz still. Ein Quieken, das ich inzwischen nur zu gut kenne. Diesmal reagiere ich nicht. Meine Füße wollen sich nicht vom Boden lösen, sind wie festgewachsen. Ich stehe einfach nur da und sehe, wie der Eber auf mich zustürmt. Er muss einen Weg nach hier oben gefunden haben.
Ich spüre bereits, wie er seine Zähne in mein Fleisch gräbt. Ich sehe mich schon fallen. Ich sehe meinen Stamm, wie sie alle weinen und denken, dass ich von den Tauren getötet worden bin. Niemand wird auch nur ansatzweise daran zweifeln, dass sie es gewesen sind. Dabei werde ich Opfer eines Ebers. Was für ein erbärmlicher Tod!
Ich schließe meine Augen. Der Eber stößt ein hohes, kreischendes Quieken aus. Unnatürlich. Dann ist es still. Nichts rührt sich. Mein Körper ist unversehrt.
Ich blinzle, frage mich schon, ob ich gestorben bin. Aber ich stehe im Wald. Ich zwinge mich, meine Augen zu öffnen. Gegen meinen Willen. Vor mir eine dunkle Gestalt. Jetzt ist es also so weit. Sie haben mich gefunden.
Er ist erstaunlich jung. Vielleicht gerade ein Jahr älter als ich. Markante Wangenknochen, schmale Lippen. Schwarzes, kurzes Haar. Schicken sie jetzt also schon den Nachwuchs zum Töten, denke ich verächtlich.
»Was machst du hier?«, herrscht er mich an. Seine Haut ist braungebrannt.
»Spazieren gehen. Oder wonach sieht’s denn aus?«, gebe ich eiskalt zurück.
»Du weißt, was ich jetzt machen muss, oder?«
Die Distanz zwischen uns ist viel zu gering. Ich kann seinen warmen Atem auf meiner Haut spüren. Dennoch bleibe ich mit gestrafften Schultern stehen. Keine Schwäche zeigen.
»Mich töten«, entgegne ich schlicht und schaue ihm dabei direkt in die Augen. Grün. Ein tiefes Grün. Gnadenlos.
»Ja. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.«
Ein Windhauch fährt durch den Wald und bringt die Blätter der Bäume zum Rascheln. Eine Haarsträhne löst sich aus meinem locker geflochtenen Zopf und wird mir ins Gesicht geweht. Irrwitzigerweise fällt mir in diesem Moment auf, dass ich die Wildtaube verloren habe.
»Macht dir das Spaß?«, frage ich. Solange ich rede, bin ich nicht nervös.
»Was? Das Töten?«
Ich schweige, nicke nicht einmal.
Es dauert eine Weile, bis er schließlich antwortet. »Ja. Schon.«
Einzelne Sonnenstrahlen dringen durch das dichte Blätterdach, werden gebrochen und teilen sich in zarte Bahnen auf. Strahlen sein Gesicht von der Seite an, das schwarze Achselshirt und die trainierten Arme. In Anbetracht dieser Muskeln sind die Männer unseres Stammes alle Mädchen.
Er verzieht seinen Mund zu einem Grinsen. Weiße, blitzende Zähne. Ich schüttle fassungslos meinen Kopf. Er will mich einschüchtern, mit mir spielen. Aber das lasse ich nicht zu. Meine Lederstiefel quietschen auf dem nassen Moos, als ich mich umdrehe und betont gelassen davonmarschiere. Vorbei an dem toten Eber. Kein einziges Anzeichen einer Wunde. Weit aufgerissene Augen, ansonsten ein unversehrter Körper. Ein kalter Schauer rinnt mir den Rücken hinab. Mal eben ein Leben ausgelöscht. Ohne die kleinste Anstrengung.
»Wohin wollen wir denn?« Er überholt mich mit wenigen Schritten, lehnt sich lässig vor mir an einen Baumstamm, ein Bein angewinkelt.
Seine übertrieben selbstsichere Art macht mich wütend. Wenn ich wütend bin, werde ich unvorsichtig. Ich atme tief ein, laufe an ihm vorbei. Flüchtig prüfe ich meine Chancen, entkommen zu können. Zu meiner Linken befindet sich die Felswand, die ich vorhin hochgeklettert bin. Zu meiner Rechten ebener Wald. Wenn ich mich für diese Richtung entscheide, renne ich mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch nur in das Wespennest. Also bleibt nur die Felswand. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es, ihn abzuhängen. Mein Körper ist kleiner, nicht so schwer. Wendiger.
»Du redest nicht gern, was?«
Ich bleibe abrupt stehen, drehe mich zu ihm um. Meine Hand auf dem Haken an meinem Hosenbund. Wenn er mich jetzt angreift, ramme ich ihm den Haken ins Gesicht. Am besten in ein Auge. An meine Messer werde ich nicht kommen. Dafür sind seine Reaktionen sicher zu schnell.
»Ich rede nicht gern mit jemandem, der mich töten will.«
Er verzieht seinen Mund zu einem amüsierten Grinsen. »Ach, sei doch nicht so streng mit mir!«
Er macht sich lustig über mich! Nur mit viel Selbstbeherrschung kann ich mich zurückhalten, ihn nicht anzugreifen. Das wäre mein sicherer Tod. Meine Augen suchen unauffällig nach der Stelle, wo der Abstieg am leichtesten ist. Ein paar Meter vor mir sind besonders viele Vorsprünge in der Felswand. Dort lässt es sich gut klettern. Die Wand fällt zwar weiter unten ziemlich steil ab, aber ich könnte rutschen. So wie es mir Almaras beigebracht hat …
»Vergiss es. Genau an dieser Stelle ist ein weiterer Auslöser. Wenn du da drüberläufst, kommen noch ein paar meiner Freunde. Wenn überhaupt, dann dort.« Er zeigt auf ein ziemlich steiles Stück Felswand. Mir würde nur übrig bleiben zu springen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, komme ich einigermaßen auf, ohne mir alles zu brechen, und kann rennen. Ich bin sicher schneller als er. Oder auch nicht. Die Tauren sind anders. Maschinen. Darauf aus zu töten.
»Ich gebe nicht kampflos auf«, keife ich ihn an.
Sein Blick wird ernster, verliert jedoch nicht an Spott. »Das habe ich auch nicht erwartet.«
Ein Käuzchen ruft. Für ein paar Sekunden ist er abgelenkt. Meine Chance. Ich schieße an ihm vorbei, meine Füße fliegen über den dunkelgrünen Boden. Kommen auf, federn wieder ab. Schritte hinter mir, viel zu dicht. Keine Möglichkeit auszuweichen. Dann der Abgrund. Ohne nachzudenken, hebe ich ab, verliere den Boden unter den Füßen. Ich fliege. Wie Blitze tauchen Almaras’ Ratschläge in meinem Kopf auf. Wenn du fällst, dann zieh deinen Körper zusammen. Werd eine Kugel, roll dich so am Boden ab. Zu spät. Ich pralle auf. Mein Arm knackt. Meine Brust fühlt sich an, als würde sie zerreißen. Das Moos ist nicht weich wie sonst immer. Ein Brett, das meine Knochen in tausend Splitter geschlagen hat.
Er landet geschickt neben mir. Elegant. Ich will mich aufrappeln. Meine Rippen sind bohrende Messer. Er schlingt einen Arm um mich, presst mich zurück auf den Boden. Dunkelgrüne Augen. Nur eine Handbreit ist er von mir entfernt. Er keucht. Ganz unversehrt ist er also auch nicht. Sein warmer Atem streicht über meinen Hals. Ich warte darauf, dass er mir mit einer einzigen Bewegung das Genick bricht. Wie ein vor Angst erstarrtes Kaninchen liege ich unter ihm. Sein Gewicht wiegt schwer auf meinem schmerzenden Körper.
Er sieht mich an. Ein Blick, der das Blut in meinen Adern gefrieren lässt. Dann geschieht es. Sein Arm lockert sich. Für ein paar Sekunden nur.
Ich nutze die Chance, versetze ihm einen Tritt in den Bauch, beiße in seinen Arm. Er lässt ganz von mir ab. Ich richte mich auf, renne. Renne um mein Leben. Keine Schritte hinter mir. Erst als ich mir ganz sicher bin, dass ich unser Gebiet erreicht habe, werde ich langsamer. Ich keuche. Mein Körper ist ein einziger Schmerz.
Ich drehe mich um. Niemand.
Ich bin ihm entkommen.
Feuer
»Mein Gott, Kind! Wo warst du denn so lange?«
Donia stürzt auf mich zu, ihre beiden Arme ausgebreitet wie Flügel, bereit zum Abheben. Sie reißt mich an sich und drückt mich so fest, dass mir die Luft wegbleibt. Mein Arm pocht vor Schmerz. Ich versinke fast ganz in ihrem weichen, runden Körper, den sie immer versucht, mit engen Kleidern zusammenzuschnüren.
Ich winde mich aus ihrer Umarmung, zwinge mich zu lächeln. Auch wenn meine Beine immer noch zittern wie bei einem Erdbeben. »Ich hab mich unter einen Baum gelegt und bin eingeschlafen«, lüge ich und fühle mich nicht einmal schlecht dabei. Immer noch besser als die Wahrheit.
Jetzt kommt auch Laurin aus einem der Lehmhäuser herbeigeeilt. Seine schulterlangen, hellbraunen Haare wehen hinter ihm her, so schnell läuft er. Zwei Kinder folgen ihm, Minna und Flora. Die Töchter von Marla, die nun auch aus ihrem Haus kommt und sich an die Wand lehnt. Die Arme vor der Brust verschränkt, verschmitztes Grinsen. Sie weiß nur zu gut, dass ich lüge.
Die zwei Mädchen erreichen mich noch vor Laurin. Beide schlingen sie ihre Arme um meine Hüfte. Flora, die noch so klein ist und sich noch um nichts Sorgen zu machen braucht. Minna, die inzwischen schon mehr an Jungs und diesem ganzen Mädchenkram interessiert ist, als ich es jemals war. Meine zwei kleinen Schwestern, die ich niemals hatte.
»Wo warst du denn?« Flora schaut mich mit weit aufgerissenen Augen von unten an. »Alle hier haben sich Sorgen gemacht.«
Ich streiche über ihr weiches Haar. »Tut mir leid. Ich war unten am Fluss und habe mich da in den Schatten gelegt.«
Jetzt lächelt sie zufrieden, so dass ihre Zahnlücke zum Vorschein kommt, in die sie sich so gerne ganze Maiskörner oder Erbsen schiebt. »Warum hast du mich nicht mitgenommen?«
»Weil sie eigentlich mit mir Beeren sammeln sollte«, kommt mir Laurin zuvor. Er legt mir freundschaftlich seine Hand auf die Schulter. Durch meinen Arm fährt ein stechender Schmerz. Ich zucke zusammen.
»O nein, o nein, o nein! Verdammter Mist!«, flucht Donia auf einmal. »Der Fisch!«
Ein verbrannter Geruch liegt in der Luft. Die zwei Mädchen fangen augenblicklich an zu kichern, als Donia an ihnen vorbeistürmt, direkt auf das Kochhaus zu.
»Ich würde mal sagen, das Essen ist fertig«, scherzt Laurin und legt jetzt seinen Arm um meine Schultern. Er ist ein ganzes Stück größer als ich und ziemlich schlaksig gebaut. Mein bester Freund.
Er zieht mich enger an sich, so dass seine Lippen direkt an meinem Ohr sind. »Das mit dem Fluss und dem Schatten kannst du den anderen erzählen.«
Er küsst mich auf mein Haar. Als würde er mir damit all meine Last nehmen wollen, öffnet er seitlich an meiner Hüfte den Verschluss meines Messergürtels und hängt ihn sich selbst über die Schulter. Dann löst er sich von mir und geht gemeinsam mit den beiden Mädchen Donia nach. Für einen kurzen Augenblick scheint es, als hätten mich alle schon wieder vergessen.
Ich versuche ruhig zu atmen, doch es gelingt mir immer noch nicht wirklich. Fast hätte ich all das hier verloren. Es nie wiedergesehen. All die Mitglieder unseres Stammes, meine übergroße Familie, die sich auf dem Platz tummelt wie in einem Ameisennest. Die schlichten kleinen Lehmhäuser mit den Dächern aus getrocknetem Schilf. Jede Familie hat ihr eigenes Lehmhaus. Sobald ich achtzehn bin, bekomme ich eines zugeteilt – für mich ganz alleine. Diesen Tag erwarte ich sehnlichst. Aber es dauert noch eine ganze Weile. Leider.
Das Kochhaus, aus dessen Schornstein und Eingang nun grauer Dampf quillt. Jeder darf es benutzen. Ein Gebäude, mit mehreren Kochstellen. Doch meistens zaubert Donia gleich etwas für den gesamten Stamm. Also für über hundert Leute. Das meiste wird bei uns mit Feuer gemacht. So etwas wie Strom gibt es bei uns nicht.
Ähnlich ist es mit dem Waschhaus. Ein großes Haus mit mehreren Duschen und Waschbecken. Ein Bereich für Frauen, der andere für Männer. So modern sind wir schon. Ansonsten ist alles wie im Mittelalter. Das Wasser kommt aus Tanks, die von den Männern täglich am Fluss aufgefüllt werden. Die meisten Häuser sind nur mit dem Notwendigsten eingerichtet. Bett, Tisch, ein paar Schränke. Für unsere Versammlungen haben wir ein eigenes Haus, das jedoch höchstens zweimal im Jahr richtig genutzt wird. Das meiste wird abends am Feuer diskutiert. Thema Nummer eins: die Abgaben. Thema Nummer zwei: wie wir die nächste Zeit überleben können. Danach, wenn es schon dunkel ist, die kleinen Kinder im Bett sind und der Großteil der Männer sich dem Beerenwein hingibt, kommen die Gespräche auf das, was wir nie sehen werden. Darauf, was es in dieser Welt wohl alles gibt. Wir träumen einfach ins Blaue hinein, erzählen den anderen von unseren Vorstellungen. Fragen uns gegenseitig, ob es überall Wald gibt oder vielleicht auch ganz andere Regionen, ohne einen einzigen Baum. Wohin der Fluss führen mag, der durch unser Gebiet fließt. Ob es nur uns Sternenwesen und die Menschen gibt oder vielleicht sogar noch ganz andere Geschöpfe. Ich habe nicht einmal eine vage Vorstellung davon, wie groß die Welt wohl sein mag. Wir wissen von der Existenz anderer Sternenstämme, die über die ganze Welt verteilt sein müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll.
»Kommst du, Robin?«, ruft mir Laurin zu. »Wir sollen Donia beim Essenraustragen helfen.«
»Gleich«, antworte ich. Erst muss ich einen Abstecher zu unserer Heilerin machen.
Es stellt sich heraus, dass zu meinem Glück nichts gebrochen ist. Nur geprellt. Mit ein wenig Magie ist alles wieder so wie vorher. Ich muss nicht einmal eine Behandlung mit irgendwelchen Kräuterpasten oder Wurzeltränken über mich ergehen lassen.
Langsam schlendere ich auf das Kochhaus zu. Das helle Blau des Himmels weicht allmählich einem Dunkelblau, vermischt mit einem golden schimmernden Rot. Sonnenuntergang. Unsere Siedlung ist mitten auf einer Lichtung gebaut. Wenn das Wetter schön ist, dann ist es traumhaft, den Himmel betrachten zu können. Wenn es regnet, dann vermissen wir alle das schützende Dach des Waldes.
Laurin drückt mir eine Schüssel mit Rübensalat in die Hand und nickt in Richtung Feuerstelle. Immer noch betrachten mich seine nussbraunen Augen mit übertriebener Aufmerksamkeit. Als würde ich jeden Moment wieder fortlaufen.
Die Feuerstelle ist umgeben von vier langen, schmalen Tischen, die zusammen ein großes Quadrat bilden. In ihrer Mitte lodert bereits ein Feuer, aus dem leise die wärmenden Flammen züngeln. Um den Platz herum stehen ausgehöhlte Baumstämme, in denen ebenfalls kleine Feuer knistern. Feuer, allein aus Gedankenkraft geschaffen.
Das ist unsere Magie. Wir arbeiten mit der Natur, bringen sie in Einklang, nutzen sie für uns. Die schöne Magie.
Ich stelle die Schüssel auf einen der Tische. Nach und nach kommen alle Leonen aus ihren Häusern, versammeln sich um das Feuer, reden lautstark miteinander. Vereinzelt klopft mir jemand auf den Rücken oder ruft mir etwas zu. Die Leute mögen mich, hier mag man jeden. Aber wirklich beliebt bin ich hier nicht. Ich gelte als verschlossen, wenig gesprächig, stur.
Ich trotte zurück in Richtung Kochhaus, doch Marla fängt mich schon nach wenigen Schritten ab. »Robin!«, ruft sie mich zu sich herüber. An ihrer Stimme kann ich erkennen, dass sie mit irgendetwas gar nicht zufrieden ist. Marla, meine Ersatzmutter.
»Ich kann dir das erklären …«, setze ich bereits an, doch sie winkt mit der Hand ab.
»Ich will, um ehrlich zu sein, gar nicht wissen, was du tatsächlich gemacht hast. Ich will nur, dass du vorsichtig bist. Deine Mutter hat …«
»Jaja«, unterbreche ich sie. »Meine Mutter hat dir vor ihrem Tod das Versprechen abgenommen, dass du mich hütest wie deinen Augapfel. Ich weiß.«
Diesen Vortrag musste ich mir schon Tausende Male anhören. Schon, als ich noch in dem Alter war, in dem ich nur auf Bäume geklettert bin. Meine Mutter scheint wirklich große Angst um mich gehabt zu haben.
Ich habe sie nie kennenlernen dürfen. Kurz nachdem ich geboren worden bin, haben sie mir meine Mutter genommen. Getötet. Einfach so. Die Tauren. Marla ist die beste Freundin meiner Mutter gewesen. Sie hat sich damals meiner angenommen, mich zu ihrer dritten Tochter gemacht.
»Ich will nur, dass du vorsichtig bist«, verteidigt sie sich.
»Wo ist Almaras?«, lenke ich ab. Almaras, mein Ersatzvater, Marlas Ehemann und Anführer unseres Stammes.
»Er musste fort. Die Tauren waren unzufrieden mit unseren letzten Abgaben.«
Wie jedes Mal muss Marla um das Leben ihres Mannes fürchten. Nie kann man sagen, ob Almaras zurückkommen wird. Wenn die Tauren gnädig sind, dann schon. Wenn sie Lust zu töten haben, dann nicht. Wir sind wie Ungeziefer, das sie mit dem Fuß zertreten.
Ich nicke. »Hast du Hunger?«, frage ich sie.
Sie schüttelt den Kopf, dass ihre Haare hin und her fliegen. »Nicht wirklich.«
»Ich auch nicht. Aber ich werde mich trotzdem mal dazugesellen.«
Das Essen ist eine reine Folter für mich. Die Kleinen hängen an mir wie zwei Äffchen, Laurin lässt mich keine Sekunde aus den Augen. Almaras taucht nicht auf. Nicht einmal, als sich die Ersten bereits aufmachen, um sich schlafen zu legen.
Die Nacht ist wie ein Geschenk. Als nur noch das warme Feuer und die wenigen Glühwürmchen, die durch die Luft sausen, Licht spenden, mache auch ich mich auf. Kühle Luft, die mich umfängt. Ein perfekter schwarzer Himmel, geschmückt mit Tausenden von Sternen. Das silbern schillernde, plattgetretene Gras unter meinen Füßen ist noch nass vom Regen heute Morgen. Ich bin froh, endlich aus meiner engen, schwarzen Stoffhose schlüpfen zu dürfen und meine Stiefel in die Ecke werfen zu können.
Da Marla und Almaras als meine Ersatzeltern gelten, wohne ich bei ihnen. Eigentlich ist es viel zu eng für uns fünf, zumal die zwei Mädchen sich mit ihrem Hab und Gut im ganzen Haus ausbreiten. Doch so sehen es die Stammesregeln nun einmal vor. Erst wenn ich volljährig bin, steht mir ein eigenes Haus zu.
Auch jetzt habe ich es geschafft, mich abzuseilen. Hinter dem Haus habe ich mir zwischen zwei Tannen eine Hängematte befestigt, von der aus ich direkt den Himmel betrachten kann. Mein Rückzugsort, wenn mir alles zu viel wird. Fast jede Nacht verbringe ich dort, wenn es nicht gerade regnet.
Ich lasse mich in die Hängematte fallen, schaukle müde vor mich hin. In ungefähr einer Stunde ist das Waschhaus leer, dann werde ich mich duschen. Den Schmutz und die Angst abwaschen.
»Wusste ich doch, dass du hier bist.«
Ich habe Laurin gar nicht gehört, so sehr war ich in meine Gedanken versunken. Ich richte mich auf, betrachte seine dunkle Gestalt in der Nacht. Er lehnt an der Hauswand, ein Bein angewinkelt, das andere fest in den Boden gestemmt. Wie der Taurer heute. Nur, dass Laurin dabei viel harmloser aussieht.
»Willst du mir erzählen, was passiert ist?«, fragt er, obwohl er vermutlich bereits weiß, dass ich das nicht tun werde.
Ich lasse mich wieder in meine Hängematte zurückfallen und suche die Himmelswesen, die Almaras mir alle als Kind gezeigt hat. Den großen Bären, den fliegenden Fisch, den Löwen. Suche meine Mutter. »Nein. Nicht wirklich.«
»Dachte ich mir schon«, sagt Laurin. Er klingt nicht beleidigt, vielleicht etwas enttäuscht.
Er vertraut sich mir immer an, erzählt mir jedes noch so kleine Detail aus seinem Leben. Ich schweige immer alles aus. In der Ferne stimmt ein Uhu sein nächtliches Lied an. Aus dem Waschhaus dringt das ausgelassene Gelächter der Frauen. Zu meinem Glück muss ich nicht mit dabei sein.
Ich wende Laurin mein Gesicht zu, betrachte die dunkle Gestalt, die an der Hauswand lehnt. »Ich mag es nicht, wenn du so im Dunkeln stehst.«
Er lacht. »Hast du Angst vor mir?«
»Wie könnte ich? Du bist der Einzige, vor dem ich keine Angst habe. Du bist mein Freund! Ich mag es einfach nur lieber, wenn ich dein Gesicht sehen kann.«
Er gibt einen tiefen Seufzer von sich, ehe er seine Hand ausstreckt und leise vor sich hin murmelt. Beschwörungsformeln, die jeder von uns Leonen im Herzen trägt. Sie sind immer da, bei Schritt und Tritt. Man muss nicht über sie nachdenken, oft weiß man nicht einmal genau, was man da sagt oder tut. Man tut es einfach, weil die Natur es einem einflüstert. Sie schickt ihre Kraft durch den Boden, durch die Wurzeln, durch die Luft, durch ihren Geruch und die Geräusche, die hier im Wald sind. Man kann sie spüren.
Langsam erscheint auf Laurins Handfläche ein tanzendes Licht. Unruhig hüpft es hin und her. Es glimmt bläulich, und das kugelförmige Leuchten franst am Rand aus wie gelber Nebel.
»Bist du nervös?«, necke ich ihn und weiß, dass ich damit genau ins Schwarze treffe.
»Das ist gar nicht so einfach!«, verteidigt er sich. »Dir fällt das nun mal viel leichter.«
Er löst sich von der Wand und lässt sich neben meiner Hängematte im Schneidersitz auf dem Boden nieder. Die Lichtkugel schwankt nun so stark, dass sie ihm fast aus den Händen rollt. Drinnen im Haus geht nun ebenfalls das Licht an. Eine strahlende, goldene, selbstsichere Kugel, die bis nach draußen scheint.
»Auch gut.« Laurin zuckt mit den Schultern, und das Licht verschwindet von seiner Handfläche. Die Röte auf seinen Wangen ist nicht zu übersehen.
Eine Weile lang schweigen wir. Drinnen streitet Minna mit Marla. Anscheinend will das pubertierende Etwas noch mit einem Jungen unseres Stammes ein bisschen durch den Wald streifen. Ich muss schon fast lachen, so irrwitzig ist die Situation!
»Nicht weit. Nur ein bisschen«, verteidigt sich Minna mit quiekend hoher Stimme. Sie ist kurz davor zu weinen. »Titus meint, dass da irgendwo ein Dachsbau ist, den er mir gerne zeigen will!«
Titus. Er wohnt am anderen Ende unserer Siedlung. Vielleicht der hübscheste junge Mann unseres Stammes, aber definitiv zu alt für Minna. Mit seinen neunzehn Jahren wohnt er schon alleine. Er hat bereits mit so ziemlich jedem jungen Mädchen geflirtet. Mit allen, außer mit mir, nachdem ich ihm einmal als Kind fast die Nase gebrochen hätte.
Das Problem ist nur, dass Minna für ihr junges Alter die falschen Signale setzt. Sie ist vierzehn, hat aber den Körper einer Achtzehnjährigen. Wallendes, blondes Haar. Weiche Kurven. Doppelt so viel Oberweite wie ich, und sie trägt Kleider mit tiefem Ausschnitt und bunten Farben, die das Ganze noch unterstreichen.
»Keine Diskussion! Du wirst dich nicht mit diesem jungen Mann treffen! Ich glaube sowieso, dass ich mit ihm einmal ein Wörtchen reden sollte! Was denkt der denn überhaupt, wie alt du bist?!«
Wenn Minna jetzt mit einer Tür knallen könnte, würde sie es tun. Aber so etwas gibt es bei uns Leonen leider nicht. Stattdessen fegt sie eine Tasse oder eine Tonschale vom Tisch, die klirrend auf dem Boden zerbricht. Dann kehrt Ruhe ein.
Ein Glühwürmchen saust vor meiner Nasenspitze durch die Luft, schwirrt an Laurins Kopf vorbei und verschwindet über dem Strohdach unseres Hauses.
Laurin pfeift erstaunt durch die Zähne. »Eigenwilliges Ding. Von wem Minna das wohl hat?«
Ich gehe nicht darauf ein. Etwas anderes spukt in meinem Kopf herum. »Glaubst du, Almaras wird auch dieses Mal zurückkehren?«
Laurin schweigt lange, ehe er antwortet. »Ich weiß nicht. Das, was ich weiß, ist, dass wir alle Abgaben rechtzeitig bei ihnen abgeliefert haben. Was die Tauren machen, ist reine Willkür. Du kennst sie. Wenn sie ihn umbringen wollen, dann bringen sie ihn um. Was ich aber nicht annehme. Denn sie wissen, dass Almaras ein guter Anführer ist. Er hält uns alle ruhig und kriegt es hin, dass wir uns halbwegs mit unserer Situation abfinden. Sie wären dumm, ihn umzubringen.«
Laurin hat recht. Ich begnüge mich mit seiner Antwort und entscheide mich dafür, die Nacht einfach abzuwarten. Im Waschhaus sind die Geräusche nun endgültig verstummt. Zeit, mich bettfertig zu machen. Oder eher hängemattenfertig.
»Marla mag es nicht, wenn wir so spät noch Besuch haben. Du solltest jetzt gehen«, schwindle ich. Ich muss allein sein.
Laurin weiß zwar, dass Marla ihn mag und er sogar spät in der Nacht noch hier aufkreuzen könnte, aber er sagt nichts. Er kennt mich. Er erhebt sich von seinem Platz am Boden und streicht mir liebevoll über die Wange. »Gute Nacht, mein kleines Löwenherz.«
In dieser Nacht mache ich kein Auge zu. Ich könnte einen Marathon laufen, so wach bin ich. Immer wieder tauchen diese grünen Augen vor mir auf. Ich bin entkommen!, hallt es durch meinen Kopf. Ich habe ihn abgehängt!
Mein Herz rast wie wild. Dieses komische Gefühl in meinem Bauch sagt mir jedoch, dass ich unrecht habe.
Ich bin nicht entkommen.
Er hat mich laufenlassen.
Schwarz
Er sieht aus dem Fenster. Die Dämmerung setzt bereits ein. Er liebt die Dämmerung. Das Rot. Als würde der Himmel bluten. Sein Kopf schmerzt. Immer dieses Pochen! Als wäre sein Herz in den Kopf gefahren und würde dort nun pulsieren.
Welches Herz?, denkt er und muss lächeln. Hinter ihm steht sein treuer Berater. Das weiß er. Doch er ignoriert ihn. Es gibt Probleme. Und Probleme hasst er. Das, was er liebt, ist Kontrolle. Und Blut.
Im Raum ist es warm. Stickig. Sein schwarzer Mantel liegt viel zu schwer auf seinen Schultern. Sein Körper schwitzt unter dem schwarzen Leder seiner Hose und dem dunkelroten Hemd. Schwarz und Rot. Das sind seine Farben.
»Wie sollen wir weiter verfahren?«, fragt Vincente.
Langsam dreht er sich um. Betrachtet seinen Berater wie eine lästige Fliege. So lächerlich steht er da! Die Hände unsicher vor dem Bauch verschränkt, starr wie eine Statue, den Rücken krumm. Eine dürre Gestalt. Ein Frettchengesicht.
»Soll ich raten, wovon du sprichst, oder willst du es mir einfach sagen?«, antwortet er und genießt die Welle der Unsicherheit, die Vincente augenblicklich erfasst.
»Ich spreche von Almaras, mein Herr. Gegegedenkt Ihr ihn zu tttöten oder wwwollt Ihr ihn am Leben lassen?«
Zur Hölle! Jetzt stammelt er auch noch! Nur leider ist Vincente ein guter, umsichtiger Berater. Wenn nicht, würden sich schon längst die Würmer durch seinen leblosen Körper fressen.
»Wir zeigen ihnen nur, wo sich der Anfang befindet. Das Ende können sie sich dann selber denken.« Er lächelt, genießt seine Macht.
Die Kerze auf dem rustikalen Holztisch flackert, als er sich wieder zum Fenster wendet. Alles hier ist dunkel. Die steinige Felswand, in die sein Hauptsitz gebaut ist. Die Möbel schwarz lackiert oder aus dunklem Holz. Selbst die Fenster sind aus dunkelblauem Glas.
Er muss nicht einmal seine Hand bewegen, um die Kerze zu löschen. Nun brennt nur noch das Licht in dem schweren Käfig aus dunklem Eisen, der von der Decke baumelt und als Lampe dient. So fühlt er sich wohl.
»Mein Herr, wie lange wird es noch dauern?«
Soll er ihn nicht doch einfach umbringen? Es gibt genügend andere, die alles dafür geben würden, sein Berater zu sein. Aber Vincente ist gut. »Mich stört dieses Ratespiel. Wovon sprichst du?«
»Verzeiht, mein Herr. Von ihr.«
»Es passiert, wenn sie dafür reif ist.«
Er betrachtet die Kette um seinen Hals, lässt sie durch seine Finger gleiten. Den golden schimmernden Stein. Purer Bernstein. Allein eine Haarsträhne darin.
»Und was gedenkt Ihr dann zu tun?«
Jetzt lacht er. Ein wahrhaft fröhliches Lachen. »Ihr alles zu nehmen, das ihr etwas bedeutet. Und sie dann mit offenen Armen empfangen.«
Macht
Das einzige Licht spenden nun die Sterne. Selbst die Glühwürmchen haben sich dem Schlaf hingegeben. Flora murmelt im Traum, ich kann sie bis hierher hören. Der Wald ist nachts so friedlich. Ewig könnte ich hier liegen und einfach nur in den Himmel starren.
Ein Ast knackt. Leises Rascheln, wie wenn Leder aneinandergerieben wird. Kommen sie nun doch, um mich zu holen? Um die offene Rechnung zu begleichen? Mitten in der Nacht? Schritte auf der weichen Wiese unserer Siedlung. Ruhige, müde Schritte. Jemand atmet schwer, räuspert sich.
Mein Herzschlag wird langsamer. Mein Atem beruhigt sich. Die Schritte halten direkt vor unserem Haus. Ich springe aus meiner Hängematte und stürze um das Lehmgebäude herum. Dort steht er, in fast vollkommener Dunkelheit. Allein seine linke Gesichtshälfte wird schwach von dem spärlichen Licht der Sterne angestrahlt.
»Almaras!«, hauche ich und schlinge meine Arme um ihn.
Er taumelt, lacht dabei jedoch leise und streicht mir väterlich über mein Haar. »Du bist noch wach?«
»Kein Auge habe ich zugemacht! Wo warst du nur so lange?«
Drinnen im Haus geht das Licht an. Kurz darauf eilt Marla heraus, um ihren schlanken Körper nur einen kurzen Morgenmantel aus Wolle geschlungen. »Almaras«, flüstert sie.
Almaras dreht sich ihr entgegen. Das Licht strahlt sein Gesicht an, erhellt die Seite, die eben noch im Schatten lag. Ich keuche. Beiße meine Zähne zusammen, um nicht zu wimmern wie ein kleines Kind.
Eine leere Höhle ist nun dort, wo bisher sein rechtes Auge war. Sie haben es ihm herausgerissen. Einfach so. Um uns ihre Macht zu beweisen. Traurig sieht er uns mit seinem blauen Auge an. Darin spiegeln sich all der Schmerz und die Folter, die er die letzten Tage durchstehen musste.
»Was haben sie dir angetan?«, haucht Marla. Sie presst sich eine Hand vor den Mund, um das Zittern ihrer Lippen zu verbergen. Es ist kalt geworden. Eiskalt.
»Ich bin vermutlich noch ganz gut weggekommen. Sie wollten ihre Macht demonstrieren. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Ich bin dankbar dafür, dass ich wieder hier sein darf. Bei euch.«
Er legt eine Hand auf meine Schulter, die andere auf Marlas, die sich sofort an ihn schmiegt und an seiner Brust zu weinen anfängt. Ihr Körper schüttelt sich vor innerer Verzweiflung. Jetzt wünsche ich mir, dass Laurin bei mir wäre. Er würde die richtigen Worte finden, um mich zu trösten. Mich zu beschwichtigen. Mich zu beruhigen, damit ich nicht meine Messer schnappe und vor lauter Hass die Siedlung der Tauren stürme.
»Mama?« Eines der Mädchen ruft nach Marla. Vermutlich ist es Flora. Minna ist bereits aus dem Alter raus, sich nachts an ihre Mutter zu kuscheln.
Erschrocken blickt Marla erst ihren Mann, dann mich an. Ihre Augen sind tränengefüllt, ihre Wangen von nassen Bahnen überzogen.
»Ich kümmere mich darum«, sage ich und nicke den beiden zu.
»Danke«, flüstert Almaras. »Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, was wir der Kleinen sagen können. Sie würde die Wahrheit nicht verkraften.«
Als ich in das Haus schlüpfe, sitzt Flora kerzengerade in ihrem Bett, das Kissen vor den Bauch gepresst und die blonden Haare zerzaust wie nach einem Sturm. »Mir hat noch niemand eine Gutenachtgeschichte vorgelesen.«
»Und das fällt dir mitten in der Nacht ein?« Ich stupse sie mit meinem Zeigefinger auf die Nase und setze mich neben sie auf die Bettkante.
Sie nickt ganz aufgebracht. Ich lese ihr fast eine ganze Stunde lang vor, bis sie endlich eingeschlafen ist. Marla und Almaras sitzen auf der kleinen Holzbank vor unserem Haus und reden leise miteinander. Der Morgen naht bereits. Die ersten Vögel zwitschern, die Dunkelheit weicht langsam zurück.
Wie selbstverständlich schleiche ich mich zu Laurins Haus. Seit seinem achtzehnten Geburtstag vor vier Wochen hat er das Glück, alleine wohnen zu dürfen. Er erschrickt nicht einmal, als sich unangekündigt jemand neben ihn in sein Bett legt. Er kennt es schon so, dass ich mich manchmal, wenn mir alles zu viel wird, zu ihm schleiche. Ohne zu zögern, rollt er sich auf die andere Seite und schlingt seinen Arm um meinen Bauch.
Es dauert nicht lange, und ich bin eingeschlafen.
Am nächsten Morgen ist Laurin schon nicht mehr in seinem Haus, als ich aufwache. Es liegt eine merkwürdige Stimmung über der Siedlung. Die Nachricht hat sich also bereits herumgesprochen. Almaras, der geliebte Anführer der Leonen, wurde von den Tauren verunstaltet. Ein Zeichen ihrer Macht. Ein Zeichen unserer Schwäche. Nur kurz kann ich einen Blick auf Almaras werfen, wie er auf dem großen Platz mit ein paar Männern zusammensteht und diskutiert. Seine blonden, langen Haare fallen bis zur Mitte seines Rückens herab. Beim Reden streicht er sich über seinen Dreitagebart. Sein rechtes Auge hat er unter einem schwarzen Tuch versteckt.
Ich halte das nicht mehr aus und verlasse, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, unsere Siedlung. Meine Füße bringen mich wie selbstverständlich zum Fluss. Der Boden vibriert ganz leise unter meinen Schritten. Die Art des Waldes, mir zu sagen, dass es bald regnen wird. Der Himmel ist mit grauen Wolken bedeckt. Finster ist es hier, selbst am Fluss. Ich lehne mich gegen eine alte Trauerweide, lasse mich an ihrem Stamm hinuntergleiten, betrachte das vorbeirauschende Wasser. Ein Kunstwerk der Natur. Alles um mich herum so saftig grün. Die großen Steine moosbewachsen, so dass sie sich kaum vom Boden abheben. Verspielte Wurzeln, alte Baumstämme, dichter unberührter Wald. Nester von Wasservögeln und Staudämme von Bibern. Das Wasser bricht sich an den großen Steinen, die im Flussbett liegen, bildet kleine Strudel und winzige Wasserfälle. Es fließt so schnell, dass es nicht klar ist, sondern schaumig weiß.
Ich weiß nicht, wie lange ich hier so sitze und einfach nur schaue. Eine Ewigkeit. Währenddessen ruft Laurin immer wieder meinen Namen, doch er kann mich nicht finden. Die langen, herabhängenden Äste der Trauerweide sind wie ein schützender Vorhang.
Als ich in die Siedlung zurückkehre, wartet Minna schon sehnsüchtig auf mich. Ungeduldig sitzt sie auf der Bank vor unserem Haus, zupft an ihrem blonden gewellten Haar herum. Es ist nichts los in unserer Siedlung. Nur ein paar Frauen hängen an den von Tanne zu Tanne gespannten Seilen ihre Wäsche auf, die bei diesem Wetter ohnehin heute nicht mehr trocknen wird. Die Männer sind im Wald, schlagen Holz für Feuer oder reparieren den Staudamm am oberen Teil des Flusses, der uns als Badestelle dient.
»Da bist du ja endlich!«, ruft Minna, als sie mich entdeckt. »Ich muss dich etwas fragen.«
Misstrauisch ziehe ich eine Augenbraue hoch. Wenn Minna schon so anfängt, will ich es meistens gar nicht hören.
»Heute ist doch Ausgehtag …«, setzt sie an.
Ja. Der Tag, an dem die Tauren uns gestatten, abends in die Stadt auszugehen. Uns in eine Bar zu setzen und etwas zu trinken, ohne dass wir damit rechnen müssen, in der nächsten Sekunde umgebracht zu werden.
»Nein, Minna! Wirklich nicht! Alles andere sofort, aber nicht in die Stadt!«
»Mensch, du bist eine Spielverderberin! Ich durfte noch nie in die Stadt! Marla lässt mich nicht ohne dich gehen, und ich würde doch so gerne! Einfach nur in einer Bar sitzen und etwas trinken! Von mir aus nur eine Cola oder ein Wasser, ist mir egal! Aber einfach mal was anderes sehen!«
Mist! Ich kann ihr den Gefallen nicht abschlagen. Für sie muss es schrecklich sein, ihren Vater so zu sehen. Sie weiß, was wirklich passiert ist. Nicht so wie Flora, die glaubt, dass ihr Vater mit einem Wolf gekämpft hat.
Ich schnaufe laut aus, schließe meine Augen. »Gut. Aber nur für eine Stunde. Und du bleibst an meiner Seite, als wärest du festgekettet! Verstanden?«
Sie legt ihre Hand auf ihr Herz, strafft den Rücken und versucht vergeblich, das breite Grinsen zu unterdrücken. »Hoch und heilig.«
»Weiß Marla überhaupt schon davon?«
Sie weiß noch nichts davon. Aber sie ist mit ihren Gedanken ganz woanders und erlaubt uns tatsächlich, abends in die Stadt zu gehen.
Als die Dämmerung einsetzt, beginnt für mich die Tortur. Ich lehne mich neben Minna an das Waschbecken im Waschhaus und beobachte sie beim Schminken. Ein Waschbecken, bestehend aus einem ausgehöhlten Baumstamm. So lang, dass mindestens zehn Leute nebeneinanderstehen können. Sorgsam zieht Minna die Mascara, die ich ihr bei meinem letzten Besuch in der Stadt kaufen musste, durch ihre hellen Wimpern. Sie hat eines ihrer besten Kleider ausgewählt. Ein rosafarbenes, tailliert und von Marla mit Stickereien verziert. Viel Kleidung besitzen wir nicht. Jeder hat vielleicht eine oder zwei Hosen und genauso viele T-Shirts. Bei Minna sind es Kleider.
»Wen erwartest du denn in der Stadt zu treffen?«, frage ich vorsichtig und verschränke meine Arme vor der Brust. »Titus?«
Auf einen Schlag laufen ihre Wangen rot an. »Überhaupt nicht!«
Ich verkneife mir ein Lachen und schaue zu, wie sie die Wimperntusche wieder in ihrem Beutel verstaut und einmal probehalber mit den Wimpern klimpert.
Eine alte Frau stürmt ins Waschhaus. Salomé, unsere Heilkundige. Sie war es, die mir gestern meinen Arm geheilt hat und mir versprechen musste, niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen. Im ersten Moment ist sie verwirrt, jemanden um diese Zeit hier vorzufinden. Um sieben Uhr abends waschen sich hier höchstens mal die kleinen Kinder, um dann früh ins Bett zu verschwinden. Sie hastet auf die Toiletten zu, verschwindet in einer Kabine und stößt einen erleichterten Seufzer aus.
Minna und ich können uns kaum zurückhalten, Minna noch weniger als ich. Sie presst ihre geballte Faust vor den Mund und wischt sich mit der anderen Hand eine Lachträne aus dem Augenwinkel.
»Was gibt’s da zu lachen?«, brüllt Salomé aus der Kabine. Ohnehin ist sie bekannt für ihre eher ruppige Art. »Ich hab was Falsches gegessen. Na und? Kann vorkommen.«
Ich presse den Zeigefinger auf meinen Mund, um Minna zu bedeuten, dass wir uns besser etwas zusammenreißen sollten. »Du siehst hübsch aus«, sage ich, um von Salomé abzulenken. »Titus wird Augen machen.«
»Ich weiß doch gar nicht, ob er da ist. Möchtest du dich nicht auch ein bisschen schminken?«, fragt Minna hoffnungsvoll.
Ich halte nicht viel von Make-up. Das weiß sie. Ich bevorzuge es schlicht. Jeans oder bequeme Stoffhosen, manchmal auch meine Wildlederhose. Dazu ein weißes Tanktop. Höchstens noch die Kette, die mir Laurin einmal geschenkt hat. Ein dunkelbraunes Lederband mit einem aus Holz geschnitzten Herzen daran. Die meiste Kleidung nähen wir uns selbst. Wir nutzen jedes alte Laken und jedes Stück Stoff, um daraus ein Hemd oder eine Hose anzufertigen. Meine Wildlederhose stammt noch von meinem Großvater. Marla hat sie mir ein wenig gekürzt und enger gemacht. Ganz selten kaufen wir etwas zum Anziehen in der Stadt. Nur, wenn einmal genug Geld in der Gemeinschaftskasse und der letzte Fetzen Stoff verbraucht ist.
Ich betrachte mich im Spiegel. »Muss das sein?«
Die Toilettentür geht auf, und Salomé kommt aus der Kabine heraus. Ihr faltiges Gesicht wirkt nun um einiges entspannter.