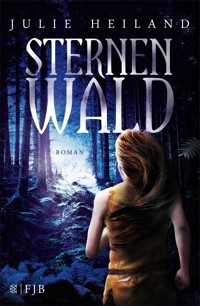14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die ungestillte Sehnsucht nach Liebe macht sie unsterblich. Aber alles, was sie will, ist endlich zu lieben. "Zweihundert Jahre habe ich die Liebe gesucht, wollte sie mehr als alles andere – nie hat sie sich meiner erbarmt. Ich habe noch nie geliebt. Wurde noch nie geliebt." Pearl ist eine Suchende. Ihre Sehnsucht nach Liebe ist so groß, dass sie selbst im Tod keine Ruhe gefunden hat und zur Unsterblichkeit verdammt ist. Sie hat nur eine Möglichkeit, erlöst zu werden: sie muss die wahre, aufrichtige Liebe erfahren. Aber der, den sie endlich lieben kann, stellt sich als ihr größter Feind heraus. Wird er ihre Gefühle erwidern und sie befreien oder wird er ihr Schicksal auf ewig besiegeln? Unendlich romantisch und absolut spannend – der neue phantastische Roman von Julie Heiland!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Ähnliche
Julie Heiland
Pearl – Liebe macht sterblich
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine über alles geliebte Familie
Für all die Suchenden
Du bist der Liebe schon zum Raube
Und bist dir kaum des Worts bewußt.
Theodor Storm,
Du willst es nicht in Worten sagen
1
»Ich liebe dich«, formen meine Lippen stumm. »Ich liebe dich …«
Jedes noch so kleine Detail des Toilettenvorraums, in dem ich mich verbarrikadiert habe, ist typisch venezianisch kitschig. Ein vergoldeter Wasserhahn in Form eines Schwans mit ausgebreiteten Flügeln. Üppige Sträuße aus weißen Rosen zu beiden Seiten der marmornen Ablage. Weiche Frotteehandtücher, aufgestapelt in einer goldenen Halterung.
Seit fünf Minuten prüfe ich anhand des Bildes, das mir der ovale Spiegel mit den goldenen Rahmenverzierungen präsentiert, wie mein Mund diese drei Worte sagt. Ich. Liebe. Dich.
John – mein Date –, der draußen auf der Terrasse des Nobelrestaurants auf mich wartet, ist ein Mann, den eine Frau sich nur wünschen kann. Er ist charmant, klug und aufmerksam. Hat ein schönes Lächeln, dunkelblonde, dicke Haare. Graue Augen, die hervorragend zu seinem dunkelblauen Anzug passen. Sein Drei-Tage-Bart lässt sein Gesicht männlich wirken. Er lebt in Kalifornien, studiert dort Wirtschaftspsychologie und arbeitet nebenbei vier Tage die Woche in einem großen Immobilienbüro.
Ich horche tief in mich hinein. Wenn ich mich konzentriere, spüre ich ein warmes Kribbeln in meinem Bauch. Fühlt sich so die Liebe an? Ja!, schreit mein Bauch hoffnungsvoll. Nein, antwortet mein Kopf trocken. Dieses warme Kribbeln hast du lediglich dem Ramazotti zu verdanken, den du nach der Schokoladenmousse noch unbedingt trinken musstest.
Ich stütze mich auf den Waschbeckenrand. Die Klinke wird heruntergedrückt, schon das dritte Mal innerhalb der fünf Minuten. Doch ich habe vorsorglich die Tür abgeschlossen. Nur noch ein paar Sekunden …, ein paar Sekunden lang brauche ich noch meine Ruhe. Ich kann John lieben. Das weiß ich. Er bringt mich zum Lachen. Ich misstraue ihm nicht. Mehr noch: Ich glaube, ich könnte ihm sogar vertrauen.
»Ich liebe dich, John. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich«, murmele ich, diesmal etwas lauter.
Mein Körper leistet Widerstand. Ich bekomme kaum noch Luft. Spüre, wie sich ein leichter Schweißfilm auf meinem Rücken bildet. Mein Mund wird ganz trocken. Das ist die Nervosität!, beruhige ich mich selbst in Gedanken. Du bist nervös, weil John dir gefällt.
»Are you alright?«, fragt eine hohe Frauenstimme durch die Tür hindurch. Vermutlich eine viel zu reiche Amerikanerin, die es sich leisten kann, mit ihrem Mann in diesem überteuerten Restaurant direkt am Canal Grande zu speisen. Die in einem der versnobten Hotels logiert, einen persönlichen, englischsprachigen Reisebegleiter gebucht hat und später ihren Freundinnen erzählen wird, sie habe das wahre Venedig kennengelernt.
»Yes, thank you.« Ich straffe die Schultern, nehme Haltung an.
Vor etwa einer Woche habe ich John in einer Bar in der Calle Vallaresso kennengelernt. Seitdem haben wir jeden Tag zusammen verbracht. Haben die Sehenswürdigkeiten der Stadt besucht. Haben am Lido den Sonnenuntergang betrachtet. Sind mit einem gemieteten Motorboot übers Meer geflitzt. Wenn John mir jetzt noch sagt, dass er mich liebt, ist alles perfekt.
Und wenn ich seine Liebe erwidere.
Zweihundert Jahre lang habe ich die Liebe gesucht, wollte sie mehr als alles andere – nie hat sie sich meiner erbarmt. Ich habe noch nie geliebt. Wurde noch nie geliebt. Nicht mal meine Mutter konnte mich ertragen. Sie hat mich als Säugling im Wald zurückgelassen, in der Hoffnung, dass ich von wilden Tieren gefressen werde. Alles in meinem Dasein ist auf die Liebe ausgerichtet, und dennoch weiß ich so gut wie nichts über sie. Weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Kann es nur ahnen. Mir in meiner Phantasie ausmalen.
Ich werfe einen letzten Blick in den Spiegel. Tiefdunkle, fast schwarze Augen blicken mir entgegen. Schwarzes Haar, das mir bis zum Kinn reicht. Ein Pony wie mit dem Lineal gezogen. Mein Gesicht wirkt hart. Gezeichnet von all dem Leid, das ich ertragen musste. Man sagt, Männer mögen Frauen mit einer positiven und liebenswerten Ausstrahlung. Aber alles, was ich ausstrahle, ist, dass ich in zweihundert Jahren nie wirklich glücklich war.
Ich bin eine Suchende.
Suchende sind Menschen, die gestorben sind, ohne jemals Liebe erfahren zu haben. Deren Sehnsucht nach Wärme, Geborgenheit und Liebe aber so groß gewesen ist, dass ihr Herz nach dem Tod keinen Frieden gefunden hat.
Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, als ich gestorben bin – oder eben nicht gestorben bin. Schätzungsweise war ich achtzehn. Obwohl ich inzwischen über zweihundert Jahre alt bin, habe ich noch immer den Körper des Mädchens, das ich damals war. Die Leiterin des Waisenhauses, in dem ich vor meinem Tod aufwuchs, war ein abgrundtief böses Miststück. Selbst wenn ich nichts falsch gemacht hatte, zerrte sie mich vors Haus und drückte meinen Kopf in ein Fass, gefüllt mit eisigem Wasser. Lange. Bis ich glaubte zu ertrinken. Erst dann ließ sie mich auftauchen und zischte: »Das hast du nun davon.« Die anderen Kinder bewarfen mich mit Steinen oder legten Schlangen unter meine Bettdecke. So wie ich, hatten auch sie noch nie etwas Gutes erlebt. Wie also hätten sie mich nicht quälen und verletzen sollen? Ich wehrte mich nie.
Eines Tages, als ich von der Leiterin ins Dorf geschickt worden war, um dort Briefe aufzugeben, warf ich die Kuverts einfach in die Büsche, steckte das Geld ein und lief. Lief, bis es stockdunkel war. Lief weiter bis zum nächsten Tag, die nächsten Tage hindurch. Immer weiter. Zunächst schmeckte meine Flucht nach Freiheit und Abenteuer. Aber dann hatte ich das wenige Geld ausgegeben und schrecklichen Hunger. Bis heute lässt mich die Erinnerung an meinen Tod nicht los. Erlebe ich meine letzten Stunden wieder und wieder.
Abwechselnd überkommen mich Schüttelfrost und Fieber. Das hat mir den Hunger vertrieben. Vom Brot, das ich gestohlen habe, ist eh nur noch ein faustgroßes Stück übrig. Und das ist schon ganz grün vom Schimmel.
Mein Körper und mein Kopf arbeiten nicht mehr zusammen. Mein Kopf sagt, dass ich von hier weg muss. Mein Körper aber hört nicht hin, konzentriert sich auf das siedend heiße Blut in meinen Adern. Auf meine Muskeln, die bei der kleinsten Bewegung schmerzen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin, aber ich muss weiterziehen, immer weiter, damit sie mich nicht finden, weg von hier, weit weg von dem Waisenhaus, in dem sie mich mit einem Gürtel geschlagen haben, bis meine Haut aufgeplatzt ist.
Ich lecke über meine rauen Lippen. Schmecke Blut. An einem Holzbalken ziehe ich mich auf die Beine. Beiße die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien. Vor einer Woche erwischte mich eine Bauersfrau dabei, wie ich etwas von der Milch trank, die in großen Kannen in einer Ecke des Stalls stand. Ich versuchte zu fliehen. Übersah das hervorstehende Brett am Boden. Stolperte, und eine Sekunde später grub sich die Spitze einer Mistgabel in meinen Oberschenkel. Ich konnte nur entkommen, weil es mir gelang, der Bauersfrau die Mistgabel aus der Hand zu treten.
Das Brennen in meinem Bein ist so heftig, dass mir ein paar Sekunden lang schwarz vor Augen wird. Trotzdem schaffe ich es irgendwie, ein paar Schritte zu laufen.
Jede Nacht sieht der Mond mir dabei zu, wie ich langsam zugrunde gehe. Auch heute hängt er inmitten dieses sternenlosen Himmels. Ich höre ihn lachen. Vielleicht bin auch ich es, die lacht. Alles geht ineinander über. Ich sehe verschwommen. Höre verschwommen. Nehme meinen eigenen Herzschlag nur noch dumpf wahr. Aber solange mein Herz schlägt, bin ich am Leben.
Das Gras neben dem Unterstand ist so hoch, dass es mir bis zur Hüfte reicht. Meine zu weite Hose und mein zerrissenes Hemd saugen die Feuchtigkeit auf. Offenbar hat es erst vor kurzem geregnet. Bereits nach wenigen Schritten beginnen erst meine Knie, dann mein ganzer Körper zu zittern.
Gott kann das nicht zulassen, ist alles, was ich denken kann. Er kann nicht zulassen, dass ich einfach so sterbe. Ich habe nie etwas Böses getan, ich habe verdient zu leben. Ich möchte so gerne leben …
Aber Gott lässt es zu. Meine Beine geben nach. Ich breche zusammen. Stürze zu Boden. Versuche, wieder aufzustehen. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht … Bin so schwach.
Es beginnt wieder zu regnen. Ich bin allein. So allein wie kein anderer auf dieser Welt. Es gibt niemand, der meine Hand hält. Niemand, der um mich weint. Niemand, der meinen Tod überhaupt bemerken wird.
Mein Herz hört auf zu schlagen.
Ich sterbe.
Aber ich bin nicht gestorben. Kurz bevor die Sonne aufging, setzte mein Herz wieder ein. Es fing einfach an zu schlagen, als wäre nichts passiert. Es schlug und schlug und schlägt und schlägt. Unaufhörlich. Ewig.
Die Sehnsucht nach der mir verwehrten Liebe hat es angetrieben. Und eben diese Sehnsucht ist es, die einen Suchenden ans Leben kettet. Es gibt für ihn nur eine Möglichkeit, den Fluch der Unsterblichkeit zu durchbrechen: Er muss die wahre Liebe erfahren. Eine bedingungslose, schicksalhafte Liebe. Wird diese einem Suchenden zuteil, so wird er wieder zum Menschen. Und so hoffen wir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde darauf, dem Menschen zu begegnen, der diese unglaublichen Gefühle für uns empfindet und in uns entfacht. Der uns rettet.
Ich spritze mir kaltes Wasser auf die Wangen. Um wieder Farbe ins Gesicht zu bekommen, trage ich etwas Rouge auf. Das Lächeln, das ich mir aufzwinge, strengt meine Mundwinkel an. Meine Lippen glänzen kirschrot. Laden ein, sie zu küssen. Ganz leicht zittern meine Hände.
Ich entschuldige mich bei der Amerikanerin, als ich aus dem Vorraum der Toilette trete. John sitzt auf der Terrasse des Restaurants, nimmt einen Schluck Rotwein und wirft einen Blick auf seine Rolex. Als er mich näher kommen sieht, springt er von seinem Stuhl auf, um mir den meinen zurechtzurücken. Ein wahrer Gentleman.
»Ich hatte schon Angst, dass du mir davongelaufen bist«, lacht er.
»Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Aber ich wollte mich für dich noch hübsch machen.«
»Noch hübscher? Das geht doch wohl kaum.«
Ich spüre seinen Atem an meinem Hals. Rieche den Duft seiner Herzensaura.
Wir Suchenden sehnen uns so sehr nach Liebe, dass wir Herzen riechen können. Wir nehmen, wenn man so will, die Geschichten wahr, die sie erzählen. Jede Aura duftet individuell. Johns riecht beispielsweise leicht süßlich. Ein angenehmer Duft, der darauf schließen lässt, dass ihm nur Gutes widerfahren ist. Da wir Suchenden meist nur Leid kennen, sind unsere Herzensauren finster und kalt. Wie tiefe, dunkle Keller.
»Möchtest du noch einen Espresso?«, fragt John. Seine Hand berührt ganz leicht meinen Oberarm.
»Nein, danke, keinen Espresso für mich. Was hältst du davon, noch ein bisschen am Wasser entlangzuspazieren?«
Ich setze mich, ziehe unauffällig den Ausschnitt meines roten, enganliegenden Kleides ein wenig höher, um die Narbe auf meinem Brustbein zu verdecken. Meine zum Kleid passenden, silbernen Sandaletten sind schlicht, dennoch sexy.
»Das klingt sehr gut.« John winkt dem Ober, lässt mich dabei nicht eine Sekunde aus den Augen. Er zahlt, gibt ein großzügiges Trinkgeld.
Zunächst spazieren wir die Riva degli Schiavoni entlang, die von Touristen am meisten bewanderte Promenade am Canal Grande. John nimmt meine Hand und drückt sie zärtlich. Mir gefällt der Gedanke, dass andere Spaziergänger uns für Verliebte halten. Sind wir das denn nicht auch? Bestimmt ist dieses Prickeln, das mich erfüllt, das, was man Schmetterlinge im Bauch nennt.
Manchmal denke ich, dass Venedig schon fast zu romantisch ist, vor allem nachts. Trotz der Touristenschwärme, die, ausgerüstet mit Reiseführern und Fotoapparaten, tagtäglich den Markusplatz bevölkern, entbehrt die Stadt jeglicher Hektik. Motorboote schaukeln wie Kinderwiegen auf dem Wasser. Gondeln gleiten langsam die Kanäle entlang, gelenkt von leise singenden Gondolieri in weiß-blau gestreiften Hemden. Die sich dicht aneinanderdrängenden, im Wasser eingebetteten Häuser werden vom Schein der Laternen und Barkassen in ein sanftes Licht getaucht. Die leicht gekräuselte Wasseroberfläche reflektiert dieses Licht und lässt die Touristen glauben, sie säßen an einem Fluss aus purem Gold.
Ich weiß, dass das alles wunderschön ist. Aber diese Schönheit Venedigs … Sie berührt mich einfach nicht. Ich sehe sie, aber ich kann sie nicht fühlen. Weil mir etwas fehlt. Etwas, das mein Herz für diese Magie öffnet.
John ist so sehr damit beschäftigt, mir von seiner bevorstehenden Asienreise zu erzählen, dass er nicht merkt, wie ich ihn vom Zentrum fortlotse. Wie die Gassen, die ich auswähle, immer enger werden. Immer dunkler. Ich will allein mit ihm sein. Ungestört. Vielleicht, wenn es nur noch ihn und mich gibt, werde ich meine Gefühle für ihn deutlicher spüren …
Jetzt bleibt John lachend stehen. »Wo sind wir hier eigentlich?«
Es fällt mir schwer, meine Stimme verführerisch klingen zu lassen. Es erscheint mir falsch. Lächerlich. »Ich dachte, ich bringe uns an einen Ort, wo wir ungestört sein können.«
Wir sind in einem der stilleren Sestieri der Lagunenstadt, dem sogenannten Cannaregio. Hierhin verirren sich nur wenige Touristen, vor allem nicht um diese Uhrzeit. Die Gasse ist nur ein schmaler Spalt zwischen zwei Häusern, so dass John gezwungen ist, hinter mir zu gehen. Meine Fingerspitzen fahren über den roten, mit Graffiti besprühten Tuffstein der Gebäude. Die Berührung erdet mich ein wenig. Ich bin so nervös, dass mir schon leicht übel ist. Was, wenn John nicht der Richtige ist? Wenn ich mich wieder täusche? Wenn ich diesen Teufelskreis nie verlassen werde …
Am Ende der Gasse stütze ich mich auf einen filigranen Zaun aus schwarzem Eisen. Atme tief die frische Nachtluft tief ein, um mich zu beruhigen.
John merkt mir nicht an, wie aufgewühlt ich innerlich bin. »Es kommt mir vor, als würde ich dich schon seit Jahren kennen. Es ist, als hätte ich in dir eine Seelenverwandte gefunden.« Er lehnt mit dem Rücken an der Hausfassade. Seine Augen haben dieses verräterische Funkeln. Romantische Gefühle lassen Augen derart erstrahlen.
Langsam, ganz langsam drehe ich mich zu ihm um. Er fährt sich durchs Haar, weiß nicht wohin mit seinen Händen. »Pearl …«, haucht er.
John denkt, ich sei eine Kunststudentin aus Mailand. Bei meinen Recherchen in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram habe ich nämlich erfahren, dass er sich sehr für Bildhauerei interessiert und Mailand seine Lieblingsstadt ist. Ich schätze, es ist normal, ein wenig zu schummeln, wenn man jemanden kennenlernt, der einem gefällt. Jeder tut das. Man gibt sich sportlicher, belesener, glücklicher … Und mal ehrlich: Was hätte ich ihm auch sonst erzählen sollen? Dass ich über zweihundert Jahre alt bin und meine Zeit meistens auf den Dächern Venedigs totschlage? Ziemlich wahrscheinlich würde er mich für einen Freak halten – zu Recht. Aber ich mag es, der Sonne beim Aufgehen zuzusehen und auf ein und derselben Stelle zu warten, bis sie wieder verschwunden ist. Und das, ohne mich vom Fleck zu rühren. Wenn man so lange wie ich auf der Welt ist, spielt Zeit kaum noch eine Rolle.
Blut färbt das Nagelbett meines Daumens rot. Unbewusst habe ich wieder ein Stück Haut abgezupft. Eine Angewohnheit, die ich wohl niemals ablegen werde.
Johns Blick gleitet an mir hinab und wieder hinauf. Zögerlich mache ich noch einen Schritt auf ihn zu. Sehe ihn fest an. Sein Mund öffnet sich, als wolle er etwas sagen, doch schließlich lächelt er nur. Ein wunderschönes Lächeln, das ausdrückt, wie glücklich er in diesem Moment ist.
»Es war Schicksal, dass wir uns begegnet sind«, flüstere ich.
Es ist die Hoffnung, die aus mir spricht. Die Hoffnung auf eine schicksalhafte Liebe. Auf eine Liebe, die mich von meinem ewigen Leben erlöst.
Zu meinem Erstaunen wendet sich John ab. »Das ist mein letzter Abend hier in Venedig …«, sagt er.
Ich suche in mir so etwas wie Traurigkeit. Oder zumindest Bedauern darüber, dass John abreisen wird. Es muss mich doch traurig machen, dass er Venedig verlassen wird. Oder etwa nicht? Ich sehe mein Spiegelbild auf der glatten Wasseroberfläche hinter dem Eisenzaun. Es ist, als würde es sagen: Mach dir keine Hoffnung, Pearl. Du wirst diesem ewigen Teufelskreis nicht entkommen. Auch John ist nicht der Richtige. So wie Tom vor einem Monat nicht der Richtige war oder Maurice oder Patrick …
Das stimmt nicht!, widerspreche ich meiner inneren Stimme in Gedanken. John ist anders. Ich mag ihn wirklich. Er könnte mein Erlöser sein …
»In weniger als zwölf Stunden kehre ich wieder in die USA zurück«, fährt John fort.
»Dann lass uns keine Sekunde verschwenden.«
Ich kann es in seinen Augen sehen. Gleich wird er es sagen.
»Pearl, ich liebe dich.« Er atmet schwer aus, als wäre eine zentnerschwere Last von seiner Seele gefallen.
Seine wunderschönen Worte freuen mich aufrichtig. Worte, die der erste Schritt von dreien sind. John hat mir gesagt, dass er mich liebt. Jetzt bin ich an der Reihe.
»Auch ich habe mich in dich verliebt«, sage ich. Zu schnell, zu hastig. Man könnte meinen, dass ich es einfach nur hinter mich bringen will. Aber das stimmt nicht. Ich bin nur so verdammt nervös …
Jetzt fehlt noch der letzte Schritt: Der Kuss. Erst durch einen Kuss werde ich die Gewissheit haben, ob John wirklich mein Seelenverwandter ist. Ob er der Mensch ist, mit dem ich die wahre Liebe erfahre. Der mich erlösen kann. So, wie der Prinz Dornröschen mit einem Kuss aus ihrem Schlaf erweckt, könnte mich John durch einen Kuss wieder zu einem richtigen Menschen machen.
Metaphorisch ausgedrückt, sieht das folgendermaßen aus: Unsere gegenseitigen Liebesgeständnisse sind wie die beiden Flügel eines Tores. Und der Kuss vermag dieses Tor zu öffnen. Dahinter liegt entweder das unvorstellbare, erlösende Glück der wahren Liebe oder erneute Enttäuschung. Enttäuschung, die ich nicht mehr verkraften kann. Nicht noch einmal …
Die Sache hat aber einen Haken: einen verhängnisvollen Haken. Ist John nicht mein Seelenpartner, dann beraube ich ihn durch den Kuss seiner Liebe. Dann wird er nie wieder dieses Gefühl empfinden. Er wird sich daran erinnern, er wird es vermissen. Aber sein Herz wird nur noch die reine Funktion ausführen, Blut durch seinen Körper zu pumpen. Manche Menschen werden depressiv, nachdem ein Suchender ihnen die Fähigkeit zu lieben genommen hat. Es kann sogar so weit führen, dass sie sich in den Tod stürzen, weil sie im Leben keinen Sinn mehr sehen. Deshalb können wir Suchenden grausame Wesen sein. Aber niemals, nicht mal ansatzweise geliebt worden zu sein, ist ebenso grausam. Ewig erfüllt zu sein von einer gewaltigen und schmerzhaften Sehnsucht ist kaum zu ertragen.
Auf eine bittere Weise war ich erleichtert, als ich starb. Die Augen wieder aufzuschlagen und noch immer von dieser Sehnsucht gequält zu werden, war das Schlimmste, was mir widerfahren konnte.
John berührt zart mein Gesicht. »Pearl …«
Tu es, Pearl. Jetzt!
Aber was, wenn ich mich täusche? Wenn ich mir meine Gefühle nur einbilde?
Schwachsinn. Du warst die letzten Tage so von ihm erfüllt!
Oder, wenn John mich zwar sehr mag, aber nicht liebt? Er kennt mich doch kaum … Auch dann würde ich ihn seiner Fähigkeit zu lieben berauben.
Ich versuche, meine Gefühle zu verstehen. Versuche, auf meine zweihundert Jahre lange Lebenserfahrung zurückzugreifen. Doch das Problem ist – ich habe keine Ahnung von der Liebe. Ich weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Ich bin nervös, und da ist dieses Prickeln in meinem Bauch und diese Wärme, wenn ich John ansehe … Aber reicht das?
Jetzt tu es doch einfach!
Ich denke: Bitte lass es die wahre Liebe sein! Bitte lass dieses Dasein ein Ende finden! Mach, dass ich ein richtiger Mensch werde.
Ich lasse meine Finger seinen Arm hinaufwandern, halte mich am Kragen seines weißen Hemdes fest. Ziehe ihn an mich.
Unsere Lippen treffen sich. Nicht. »Nein …«
»Was?«
Ich schiebe John von mir fort. »Es geht nicht. Entschuldige …«
»Was ist denn los?«
»Ich glaube … ich befürchte, ich mag dich sehr, aber … aber womöglich nicht genug.«
»Was? Was redest du denn da? Du hast doch gerade noch gesagt, dass du mich liebst!« Jegliches Funkeln ist nun aus Johns Augen verschwunden, sein Blick ist traurig.
»Es tut mir leid.«
»Pearl, hey, du bist nur nervös. Aber das bin ich auch. Wir beide …«
»Du verstehst nicht …«
»Doch, das tue ich. Wirklich.«
Gerade, als ich ihm sagen will, dass ich gehen muss, fragt er: »Gehört der da zu dir?«
Zunächst verstehe ich seine Frage nicht. Dann sehe ich, was er meint. Am anderen Ende der Gasse steht eine Gestalt mit grauem Kapuzenpullover. Die nächtliche Brise trägt den Duft ihrer Herzensaura herüber. Eine Herzensaura, die gleichzeitig so warm ist wie Sonnenstrahlen und so scharf wie Chili.
»Gibt es ein Problem?«, rufe ich der Gestalt zu.
Schweigen. Zähne blitzen in der Dunkelheit auf, nur von einer Straßenlaterne schwach erleuchtet. Die Gestalt grinst. Jetzt erkenne ich, dass es ein Mann ist. Sehe noch, wie er ein Handy zückt, bevor er sich in Bewegung setzt, um die nächste Ecke biegt und verschwunden ist. In diesem Moment weiß ich, dass ich ein Problem habe. Sie haben mich entdeckt.
Die Jäger.
2
Während ich meine Bankkarte aus meinem Geldbeutel krame, denke ich darüber nach, von hier wegzuziehen. Zu viele Erinnerungen, die mich in dieser Stadt nachts wachhalten. Ich stecke die Karte in den Schlitz des Zigarettenautomaten. Zwei offensichtlich frisch Verliebte spazieren hinter meinem Rücken vorbei. Ich wähle Marlboro. Beobachte aus dem Augenwinkel, wie die beiden um die Ecke der Gasse verschwinden. Höre den Typen lachen: »Wo sind wir hier eigentlich?«
»Ich dachte mir, ich bringe uns an einen Ort, wo wir ungestört sein können«, antwortet sie.
Mein Jäger-Instinkt schlägt Alarm. Ich werde aufmerksam. Kann es sein, dass …? Kurz höre ich nicht, was die beiden sagen, denn der Automat spuckt die Packung Zigaretten aus. Ich stecke sie in meine Jacke. Tue so, als würde ich nach etwas im meinen Taschen suchen. Lausche.
»In weniger als zwölf Stunden kehre ich wieder in die USA zurück«, sagt der Typ.
»Dann lass uns keine Sekunde verschwenden.«
Scheiße. Kann sein, dass ich mich täusche. Dass sie gar keine Suchende ist. Es soll ja Frauen geben, die so rangehen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass da was faul ist.
Das Problem ist nur, dass ich erst vor zwei Monaten nachts ein Pärchen in einer schummrigen Gasse auseinandergerissen habe, weil ich die Frau schützen wollte. Weil ich dachte, dass der Typ, mit dem sie zusammen war, ein Suchender wäre. Tja. Fehlanzeige. Einen ordentlichen Kinnhaken habe ich kassiert und wurde als geisteskrank bezeichnet. Außerdem hat die Frau mir gedroht, die Bullen zu rufen, wenn ich nicht sofort verschwinde. Na, vielen Dank. Ich wollte sie nur davor bewahren, ihr restliches Leben in Depressionen zu verbringen. Aber wie hätte ich das den beiden erklären sollen? Hätte ich sagen sollen, dass es Suchende auf dieser Welt gibt, die Menschen mit einem Kuss ihrer Fähigkeit zu lieben berauben?
Die meisten beraubten Menschen verlieren jegliche Motivation. Werden depressiv. Manche stürzen sich sogar vor den Zug oder schneiden sich die Pulsadern auf, weil sie’s einfach nicht mehr aushalten. Tja, hätte ich das den beiden erklärt, wäre ich schnurstracks in der Klapse gelandet.
Ich schleiche ans Ende der Gasse. Werfe einen Blick um die Ecke.
»Pearl, ich liebe dich«, sagt er.
»Auch ich habe mich in dich verliebt«, entgegnet sie.
Scheiße. Ich bin hin- und hergerissen …
Meine Finger tasten in der Innentasche meiner Jacke nach der Spritze. Das Mittel darin wird ihre Muskeln lähmen. Ich habe immer eine volle Spritze dabei.
Kurz bevor die beiden sich küssen, macht sie einen Rückzieher. Also doch keine Suchende?
Ich trete aus meinem Versteck. Gebe mich zu erkennen.
»Gibt es ein Problem?«, ruft das Mädchen mir zu.
Obwohl es dunkel ist, sehe ich es an ihren Augen. Kein normaler Mensch hat einen solchen Blick. Einen solch erfahrenen, wissenden und müden Blick. Ich bin mir ganz sicher: Sie ist eine Suchende. Aber wäre sie eine von den Bösen, dann hätte sie den Typen geküsst und ihm sein Leben versaut.
Ich könnte sie trotzdem beseitigen. Eine Suchende weniger schadet der Welt ganz bestimmt nicht. Es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis sie böse wird … Außerdem lebt sie bestimmt nicht allein in dieser Stadt.
Nein. Erst beobachten. So lautet die Regel.
Aber es kann auch nicht schaden, ein paar Informationen aus ihr herauszuholen.
Ich bin froh, dass ich endlich wieder eine Mission habe. Ich zücke mein Handy, tauche im Schatten des Gebäudes ab und warte darauf, dass ich mich an ihre Fersen heften kann.
3
Vielleicht wäre das mit John die große Liebe gewesen. Vielleicht liebt er mich tatsächlich, vielleicht liebe ich ihn auch. Vielleicht habe ich gerade die Chance meines Lebens vertan. Aber vielleicht auch nicht, und dann hätte ich ihm durch einen Kuss das Schönste und Erfüllendste seines Lebens genommen. Und hätte mich zu einem bösen Wesen gemacht. Hätte den Jägern das Recht gegeben, mich auszuschalten.
Ein paar meiner Spezies, die bösen Suchenden, genießen es regelrecht, den Menschen ihre Liebe zu stehlen, denn sie verschafft ein kurzzeitiges Hochgefühl. Die Sehnsucht, die uns umtreibt, ist wie ein in der Brust brennendes Feuer. Die gestohlene Liebe eines Menschen löscht dieses Feuer wenigstens für ein paar Stunden. Alles wird dann leichter. Das Gehen. Das Atmen. Das Sein.
Es ist die Hoffnungslosigkeit, die uns Suchende böse werden lässt. Wenn wir nicht mehr daran glauben, die wahre Liebe zu erfahren. Auch ich zweifle so langsam daran. Ich bin schon so verdammt lange auf dieser Welt … Ich meine, weshalb sollte ich noch Hoffnung haben? Weshalb?
Die Welt von den bösen Suchenden zu befreien, haben sich die Jäger zur Aufgabe gemacht. Wenn sie einen erwischen, injizieren sie ihm ein Gift. Diese rote Flüssigkeit lähmt seine Muskeln – sterben können Suchende ja nicht. Wenn der Suchende nicht mal mehr seinen kleinen Finger bewegen kann, verfrachten die Jäger ihn in einen Sarg und begraben ihn bei vollem Bewusstsein. Das ist so schrecklich, dass allein der Gedanke daran mir einen kalten Schauer den Rücken hinunterjagt.
Die Jäger wissen aus einem ganz bestimmten Grund von unserer Existenz und davon, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, erlöst zu werden: Sie selbst waren einst Suchende. Aber sie zählen zu den wenigen Glücklichen, die der wahren Liebe begegnet und dem Fluch des ewigen Lebens entkommen sind. Ich bin wütend auf die Jäger, weil sie es geschafft haben, erlöst zu werden. Nein, das stimmt nicht, ich bin nicht wütend. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich froh, Wut zu empfinden. Aber ich bin nur abgrundtief traurig. Und das ist viel schlimmer. Denn wer Wut empfindet, ist bereit zu kämpfen. Aber wer nur noch Trauer verspürt, hat aufgegeben.
Habe ich schon aufgegeben?
Nervös sauge ich das Blut von meinem Daumen. Versuche mir einzureden, dass die Gestalt am Ende der Gasse, die plötzlich aufgetaucht und ebenso plötzlich wieder verschwunden ist, doch nur ein verirrter Tourist gewesen ist. Aber es klappt nicht, ich weiß es besser: Es war ein Jäger. Und er wird mich nicht mehr aus den Augen lassen.
Das Beste wird sein, so schnell wie möglich dorthin zurückzukehren, wo es nur so von Touristen wimmelt. Eilig verabschiede ich mich von John. Dann haste ich entlang einer Reihe verrosteter Wandleuchten, die die bunten Haustüren erhellen.
Mein Handy vibriert. Lenkt meine Aufmerksamkeit auf ein Foto, das Damien mir per WhatsApp geschickt hat: auf dem nichts als die Ecke eines dunkelroten Ledersofas, davor mehrere Flaschen Champagner, schwarze Damenpumps und zwei venezianische Masken zu erkennen sind.
Es gibt verschiedene Arten, mit dem ewigen Leben umzugehen. Viele meiner Spezies schlagen ihre Zeit mit rauschenden Partys tot, die erst in den frühen Morgenstunden enden. Damien ist dafür ein Paradebeispiel.
Auch ich habe das eine Zeitlang getan. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen, musste mich der Wahrheit stellen. Und die lautet: Ich bin allein und einsam. Zwar habe ich Damien und Alexa, meine »Familie«. Beide Suchende – zwei Gleichgesinnte. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass wir nur zusammenleben, um uns die Einsamkeit etwas erträglicher zu machen.
Der scharfe Geruch von Chili verfolgt mich. Als ich mich umdrehe, ist die Gasse jedoch wie ausgestorben. Ich steuere auf einen weiteren Zweig des Kanals zu. Renne die flachen Treppenstufen der Brücke hinauf und wieder hinab, immer zwei Stufen auf einmal. Die an Eisenringen festgebundenen Motorboote liegen vollkommen ruhig auf dem spiegelglatten Wasser, das durch das nervös flimmernde Licht einer Laterne grünlich schimmert.
Eng an den bröckeligen Putz der Wand gedrückt, schleiche ich um die nächste Ecke. Konzentriere mich auf jedes noch so leise Geräusch. Ich kann nahezu lautlose Schritte hinter mir hören.
Ich beginne zu rennen. Eine Gruppe Jugendlicher kommt mir entgegen, steuert mit ausgelassenem Gelächter direkt auf mich zu. Ich könnte mich unter sie mischen, doch die Jungs und Mädchen bleiben unter einem Balkon stehen und rufen nach einem weiteren Freund. Der Geruch von Chili ist inzwischen so stark, so als würde er an meiner eigenen Haut haften.
Eine weitere Brücke, eine weitere Gasse. Dann höre ich auf einmal das vertraute Stimmengewirr und Durcheinander vieler Geräusche, das die großen Plätze hier gerne erfüllt. Ich folge dem bunten Gemurmel und entdecke, dass zu meinem Glück auf dem Campo Santa Maria Formosa heute Nachtmarkt ist. Es wimmelt nur so von Touristen, die viel zu viel für venezianische Masken, italienische Gewürze und Kleidung bezahlen. In der Hoffnung, mich unsichtbar zu machen, tauche ich im Gedränge ab. Fast stoße ich mit einem Händler zusammen, der gerade dabei ist, seine Wassermelonen zu drapieren. Ich weiche zur Seite aus, streife mit dem Oberschenkel die Holzkiste, in der die Orangen zu einer Pyramide aufgestapelt sind. Die oberste Frucht fällt herunter, bringt eine zweite Orange ins Rollen, die wiederum den Rest des Turms einstürzen lässt.
»Porca miseria!«, flucht der Händler, während er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. »Signorina, haben Sie denn keine Augen im Kopf?«
»Scusi!«
Noch ehe die Gruppe chinesischer Touristen überhaupt begreift, woher der plötzliche Tumult kommt, habe ich mich schon in den versteckten Hinterhof der Calle Cafetier geschlichen. Die Leute, die sich an der angrenzenden Gasse vorbeischieben, bemerken nicht, wie ich auf den Müllcontainer im Hof klettere. Trotz meiner Sandaletten und meines engen Kleides gelingt es mir, von dort aus den mit Blumen überladenen Balkon des ersten Stockwerks zu erklimmen. Ich schwinge die Beine über das Geländer, lasse meinen Blick prüfend über den Hinterhof gleiten. Nichts, was auf einen Verfolger hinweist. Habe ich mir alles doch nur eingebildet?
Mit einem festen Tritt stoße ich die morsche Balkontür zur Wohnung auf.
»Aiuto! Hilfe!«, schreit eine alte, zahnlose Frau um die achtzig.
Sie versucht mit zittrigen Armen, sich aus ihrem abgewetzten Polsterstuhl zu heben. Scheitert. Eine getigerte Katze springt von ihrem Schoß, flüchtet vor dem plötzlichen Lärm. Es tut mir leid, die Frau so erschreckt zu haben – aber ich habe keine Zeit, sie zu beruhigen.
Sie schreit noch immer, als ich ihre Wohnung durchquert und die Tür hinter mir zugezogen habe. Ich haste die Treppenstufen hinab, warte im Erdgeschoss noch wenige Minuten, ehe ich hinaus in die kühle Nachtluft trete.
Blick nach links, Blick nach rechts. Die Luft scheint rein zu sein. Erstaunt stelle ich fest, dass es noch immer Gassen gibt, durch die ich in den drei Jahren, die ich in Venedig lebe, nie gelaufen bin.
Ich wähle Damiens Nummer und halte mir das iPhone ans Ohr.
»Ja?«, meldet er sich mit rauer Stimme.
»Damien, ich wurde verfolgt. Von einem Jäger.«
»Was?! Scheiße … Wo bist du jetzt?«
»In der Nähe vom Campo Santa Maria Formosa. Ich versuche, irgendwie zum Canal Grande …«
Ich bringe den Satz nicht zu Ende. In derselben Sekunde, in der ich den scharfen Chiliduft wahrnehme, legt sich eine Hand auf meine Schulter. Im nächsten Moment durchzuckt ein heftiger Stromschlag meinen Körper. Meine Muskeln verkrampfen. Dann geben meine Beine nach. Ich schlage auf den Boden auf.
»Ich habe sie«, höre ich eine tiefe Männerstimme sagen, vermutlich in ein Handy hinein. »Komm schnell. Gasse Corte dei Orbi. Jaja, ich weiß. Ich warte.«
Ich keuche. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Mann sein Handy in eine der Gesäßtaschen seiner Jeans steckt. Stattdessen holt er aus der Innenseite seiner schwarzen Jacke eine Spritze hervor. Eine Spritze, die meine Muskeln lähmen wird. Die rote Flüssigkeit darin schillert im Licht der Straßenlaterne.
Er kniet sich neben mich. Ich kann in seine Augen sehen. »Erzähl mal, Nummer fünf: Wie viele Suchende gibt’s in Venedig?«
Nummer fünf. Ich bin nicht mehr als eine Nummer …
»Nur mich«, lüge ich. Ich versuche meine Hand zu heben, doch sie gehorcht mir nicht.
»Schwachsinn! Das glaube ich dir nicht.« Er setzt die Spritze an meinen Hals an. Ich kann spüren, wie die Nadel meine Haut durchsticht. »Denk lieber noch mal über deine Antwort nach. Ich mag es nämlich nicht, wenn man versucht, mich zum Narren zu halten.«
Furchbare Angst überkommt mich. Mein Dasein wird jetzt noch schrecklicher werden. Tief unter der Erde. In einer Holzkiste. Mit dem Gefühl, zu ersticken und dann eben doch nicht zu ersticken. Vollkommen allein. Für immer. »Ich habe doch gar nichts gemacht … Ich bin eine von den Guten!«, bringe ich hervor.
»Ich weiß, dass du den Typen nicht beraubt hast. Aber das heißt noch lange nicht, dass du eine Gute bist. Vielleicht habe ich dich auch nur gestört.«
»Nein … Ich … ich hatte Angst, dass ich mich täusche. Dass meine Gefühle für ihn nicht ausreichen …«
»Ach ja? Das würde ich an deiner Stelle auch behaupten. Aber wenn du jetzt schön ruhig bleibst und mir die Wahrheit sagst, dann passiert dir nichts. Vorerst zumindest. Wie alt bist du?«
»Zweihundert.«
»Ziemlich alt, nicht wahr? Da verliert man doch sicher langsam die Hoffnung … Und jetzt sag schon, wie viele Suchende treiben sich hier herum? Wenn du mich noch mal für dumm verkaufst, verliere ich die Geduld.«
Tränen treten in meine Augen. Niemals würde ich Alexa und Damien verraten. Niemals.
Meine Tränen lassen den Jäger innehalten. Die Härte, die eben noch sein Gesicht wie eine Maske wirken ließ, weicht etwas Zerbrechlichem. Mir fällt auf, dass er zwei unterschiedliche Augenfarben hat: Sein linkes Auge ist braun, sein rechtes grün.
»Scheiße«, flucht er leise. Schüttelt den Kopf. »Ich weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt, ein Suchender zu sein. Dieser ständige Schmerz, dieses abartige Hoffen … Aber selbst wenn man erlöst wird, ist es nicht besser … Im Gegenteil. Glaub mir.«
In diesem Moment lässt der Schock des Stromschlags nach. Meine verkrampften Muskeln lockern sich. Mein Überlebensinstinkt setzt ein. Noch in derselben Sekunde hole ich mit dem Fuß aus, treffe den Jäger an der Schläfe.
Wenige Atemzüge später bin ich schon am Ende der Gasse, reiße meinen Körper nach links herum. Renne weiter. Ich habe nicht viel Zeit, denn er hat bereits Hilfe angefordert.
Erschrockene Touristen springen zur Seite, als ich den schmalen Weg zwischen den Gebäuden und dem Wasser entlangsprinte. Straße. Brücke. Straße. Brücke. Wenn ich mich jetzt verlaufe, in einer Sackgasse lande, bin ich verloren.
Dann erhebt sich die Rialtobrücke vor mir. Ich wage zu hoffen, dass sie mich retten wird. Restaurantgäste glotzen mir nach. Ich stürme an den geschlossenen Souvenirläden vorbei, die weißen Stufen der Brücke hinauf. Bleibe im nächsten Moment wie vom Blitz getroffen stehen. Eine dunkle Gestalt erwartet mich bereits am anderen Ende. Ich wirble herum. Mein Verfolger erreicht die Treppenstufen. Jetzt sitze ich in der Falle.
Nein, eine Möglichkeit gibt es noch. Passanten schreien auf, zeigen auf mich, als ich über das von der Witterung schwarz verfärbte Geländer der Brücke klettere. Ich stoße mich ab. Fliege. Schlage im nächsten Moment schon auf dem Wasser auf. Von einer Sekunde auf die andere sind das Brummen der Motorboote und das Stimmendurcheinander wie ausgelöscht.
Meine Arme und Beine strampeln wie wild, ich habe die Orientierung verloren. Weiß nicht, wo oben und unten ist. Sehe nur Hunderte kleine Bläschen um mich herumtanzen.
Dann durchbreche ich die Wasseroberfläche. Ringe nach Luft.
Auf einmal blendet mich ein gleißend helles Licht. Ich habe nie verstanden, weshalb Tiere erstarren, wenn ein Auto auf sie zurast. Weshalb sie nicht um ihr Leben rennen. Jetzt verstehe ich es.
Es passiert so viel so schnell, dass mein Hirn nicht hinterherkommt. Ein Motorboot rauscht direkt auf mich zu. Ich bin nicht fähig, mich zu rühren.
4
Ich bin mir sicher, dass mich das Sportboot erwischen wird. Doch das hohe Jaulen des Motors bricht unerwartet ab. Das Boot gleitet die letzten zehn Meter auf mich zu, bis es schließlich fast punktgenau neben mir hält. Jemand greift unter meine Achseln, zieht mich ein Stück weit aus dem Wasser.
»Cazzo, Pearl!«, sagt eine mir vertraute Stimme.
Damien. Mit seiner Hilfe schaffe ich es ins Boot hinein. Keine Sekunde später ist er wieder am Lenkrad und drückt den Gashebel nach hinten. Das Boot gewinnt an Fahrt. Wir jagen unter der Rialtobrücke hindurch, folgen der Biegung des Kanals und sind im nächsten Moment außerhalb des Blickfelds der Jäger.
Damien macht die Scheinwerfer des Bootes aus, so dass uns nur noch das Licht der Palazzi und Straßenlaternen den Weg weist.
»Das war ja mal knapp«, sagt er atemlos, den konzentrierten Blick weiterhin nach vorne gerichtet. »Wie geht’s dir?«
Ich kauere auf dem weißen Ledersitz, die Beine angezogen. Meine nasse Kleidung klebt auf meiner Haut. »Passt schon …«
Ihm ist anzusehen, wie gerne er mich trösten, umarmen, wie gerne er mich jetzt küssen würde. Aber es ist wichtiger, dass wir hier wegkommen. Und zwar schnell.
Damien fährt zunächst aus der Stadt hinaus, für den Fall, dass die Jäger uns verfolgen. Wie immer trägt er ein blütenweißes Poloshirt, das ihn in Kombination mit der beigen Jeans und den dunkelbraunen Lederschuhen wie den perfekten Schwiegersohn aussehen lässt. Äußerlich könnten wir nicht unterschiedlicher sein: Damien ist blass, blond und hat ein Gesicht, das den Anschein erweckt, er hätte nur Gutes in den vielen Jahren auf dieser Welt erlebt. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie jemand, der schon so viele Jahre auf dieser Welt ausharrt, eine so große Unbeschwertheit an den Tag legen kann.
»Unter dem Rücksitz liegt eine Decke. Dir ist sicher eiskalt«, sagt Damien.
»Danke, aber wir sind ja gleich zu Hause.«
»Wie hat dieser Jäger dich denn entdeckt? Hast du dich in letzter Zeit irgendwie beobachtet gefühlt?«
»Nein. Er stand heute Nacht auf einmal vor mir, als ich John fast geküsst hätte.«
»Du hast John also nicht geküsst?«
»Lass uns das Thema wechseln, Damien. Bitte.«
»Klar, tut mir leid.« Er streckt die Hand aus, und ich ergreife sie.
Venedig ist für Suchende ein Ort irgendwo zwischen Paradies und Hölle: Paradies deshalb, weil es tatsächlich die Stadt der Liebe ist. Und Hölle, weil genau das es zu einer Hölle macht. Überall trifft man auf verliebte Pärchen, die sich küssen, an den Händen halten und sich glücklich anstrahlen. Es tut weh, tagtäglich mitansehen zu müssen, wie scheinbar jeder Mensch auf dieser Welt geliebt wird – nur ich nicht. Nur meine Familie nicht: Damien und Alexa.
Zudem unterscheidet sich die Stadt trotz ihrer rund sechzigtausend Einwohner im historischen Kern kaum von einem Dorf. Die hier Ansässigen kennen das Leben ihrer Nachbarn besser als ihr eigenes und tauschen auf dem Rialtomarkt stets die neuesten Gerüchte aus. Was bedeutet, dass es Damien, Alexa und mich erhebliche Anstrengung kostet, wie eine normale und glückliche Familie wahrgenommen zu werden.
Da wir, wie die meisten Suchenden, mit den Menschen Qual und Leid verbinden, halten wir uns auch so gut es geht von ihnen fern. Ich beispielsweise muss nur die Narbe auf meinem Brustbein ansehen und weiß, wie abscheulich Menschen sein können. Dennoch suchen wir auch immer wieder ihre Nähe, denn wir hoffen, dass uns irgendwann derjenige begegnet, von dem wir glauben, dass er uns erlösen könnte. Aber eigentlich haben wir nur Kontakt zu den Menschen, wenn es unbedingt sein muss. Wenn wir in der Bäckerei einkaufen, der Postbote ein Paket vorbeibringt oder wir unsere Zeit in Bars oder Cafés vertrödeln.
Damien und Alexa sind alles, was ich habe. Dasselbe traurige Schicksal zu teilen verbindet uns auf eine besondere Weise. Aber die beiden können nicht die Lücke füllen, die in meinem Herzen klafft.
Manchmal, wenn in der Stadt zufälligerweise direkt neben mir ein junger, hübscher Kerl läuft, gebe ich mir Mühe, genau seine Geschwindigkeit zu halten und auf seiner Höhe zu bleiben. Dann stelle ich mir vor, dass wir ein Paar sind. Male mir aus, wie wir gemeinsam auf dem Weg in unsere schicke Wohnung sind, wo er für mich kocht und wir gemeinsam vor laufendem Fernseher auf dem Sofa einschlafen. Man könnte also sagen, dass ich ein totaler Freak bin.
»Damien?«, sage ich.
»Was denn?«
»Danke.«
Er schenkt mir ein schiefes Lächeln. »Stets zu Diensten.«
»Im Ernst. Die Vorstellung, die Jäger würden gerade irgendwo ein Loch für mich in den Erdboden graben, in dem ich jahrhundertelang vor mich hin vegetieren muss …« Ein eiskalter Schauer jagt mir den Rücken hinab.
»Nicht, solange ich auf dich aufpasse.«
Die Mahagonispitze des Bootes schwenkt in einen schmalen Wasserweg von Dorsoduro ein, dem Sestiere, in dem wir leben. Meine Kleidung ist inzwischen vom Fahrtwind fast getrocknet. Leise schippern wir die Kanäle entlang, bis wir wieder am Canal Grande herauskommen, direkt an der Anlegestelle unseres Palazzos.
Gemeinsam leben Damien, Alexa und ich in einem der schönsten Palazzi Venedigs mit Blick auf den Canal Grande. Ein byzantinisches Gebäude, das mit seinen weißen Arkaden aus istrischem Marmor, den Spitzbögen und den aufwendigen Rahmenverzierungen der Fenster beliebtes Fotoobjekt vieler Touristen ist. Ein spanischer Millionär hat Alexa vor drei Jahren den Palazzo vererbt. Unser restliches Vermögen ist ein Mix aus klug angelegten Aktien und wertvollen Geschenken von Verehrern, die wir veräußern.
Das Gitter unserer Garage fährt hoch, um sich kurz darauf hinter uns zu schließen. Damien stellt den Motor ab, springt mit dem Tau an Land und bindet das Boot an dem dafür vorgesehenen Eisenring fest.
»Bitte erzähl Alexa nichts von meinen Verfolgern«, sage ich. »Wir sollten sie nicht unnötig beunruhigen.«
Damien lässt das Tau fallen. »Unnötig beunruhigen? Die Jäger sind in der Stadt! Das ist keine unnötige Beunruhigung!«
Jetzt reicht er mir die Hand, um mir die vom Wasser glitschigen Steinstufen hinaufzuhelfen.
Ich nehme seine Hilfe an. »Willst du schon wieder umziehen?«, frage ich.
Eine rhetorische Frage. Allein in den letzten zwanzig Jahren haben wir viermal die Stadt gewechselt, wenn auch nur das Gerücht kursierte, ein Jäger sei in der Nähe.
»Aber was, wenn Alexa nachts ausgeht und …«
»Alexa und ausgehen?«, entgegne ich.
Seine Kiefermuskulatur tritt deutlich hervor. Er nickt einmal, um mir zu bedeuten, dass er dichthalten wird. Wir sind ein Team.
»Wie viele Jäger waren es denn eigentlich?«, fragt er, während er den Schlüsselbund aus der Hosentasche zieht, um das Eisentor aufzuschließen.
»Zwei.«
»Würdest du sie wiedererkennen?«
»Einen schon. Vor allem seine Herzensaura. Den Anderen habe ich überhaupt nicht gesehen. Es ging alles so schnell.«
Wir durchqueren die prächtige Eingangshalle, die den Eindruck erweckt, eine Königsfamilie wohne hier: Säulen aus Marmor, die die hohe Decke stützen. Ein riesiger Kronleuchter aus Muranoglas. Rosen in hohen Vasen verströmen einen betörenden Duft. Wie in jedem typisch venezianischen Palazzo befinden sich im Erdgeschoss zu beiden Seiten der Eingangshalle Büro- und Abstellräume.
»Wir müssen jetzt auf jeden Fall verdammt vorsichtig sein«, sagt Damien. »Vor allem du, denn ich schätze mal, die zwei werden die Stadt nach dir durchsuchen.«
»Verdammt«, fluche ich. Kicke einen von Damiens Flipflops, die er immer in der Gegend herumliegen lässt, aus dem Weg. »Drei Jahre lang war es perfekt in Venedig. Was wollen die Jäger plötzlich hier?«
Er zuckt mit den Schultern, als läge die Antwort auf der Hand. »Es war zu erwarten, dass sie irgendwann hierher kommen. Alles in dieser Stadt trieft nur so vor Romantik, da ist es doch klar, dass sich hier Suchende herumtreiben. Um ehrlich zu sein, wundert es mich, dass die Jäger nicht schon viel früher aufgetaucht sind.«
Ich folge Damien die elegant geschwungene Steintreppe hinauf, deren Stufen mit rotem Teppich ausgelegt sind. In einem venezianischen Palazzo ist es üblich, seine Gäste im Piano nobile, dem ersten Stockwerk, zu empfangen, weshalb dieses meist ziemlich beeindruckend ist. In unserem Fall ist beeindruckend stark untertrieben.
Der Saal, den Damien und ich nun durchqueren, lädt dazu ein, glamouröse Bälle zu feiern – was wir jedoch nie tun. Der Absatz meiner Sandaletten schlägt auf den mit rosa-grauen Mosaiken verzierten Steinboden, das Geräusch hallt im weitläufigen Raum wider. Die von beigen Samtvorhängen gerahmten Fenster reichen vom Boden bis knapp unter die Decke. Tagsüber ist der Saal von Sonnenlicht durchflutet. Nachts erhellen ihn zwei goldene Kronleuchter. Die Decke erzählt von griechischen Mythen, die sich auch in den halbnackten Marmorskulpturen wiederfinden – wir kommen an Apoll, Aphrodite, Zeus und Hades vorbei, als wir eine weitere Treppe ins zweite Obergeschoss hinaufgehen, wo sich unsere privaten Räumlichkeiten befinden.
»Jemand zu Hause?«, rufe ich.
»In der Quadreria«, antwortet eine weiche und tiefe Frauenstimme.
Die Quadreria – ein Raum voll mit Porträts der Adeligen, die früher einmal alle in diesen Räumen gelebt haben – ist das Herzstück des Palazzos. Dort finden wir Alexa, an den Rahmen des weitgeöffneten, spitzbogenförmigen Fensters gelehnt. Auf nahezu magische Weise fällt das Mondlicht auf Alexa, so als hätte sich der silberne Schein verflüssigt und ihre Kleidung, ihr Haar und ihre Haut getränkt. Obwohl das Knarzen der Holzdielen unsere Ankunft ankündigt, dreht Alexa sich nicht zu uns um.
Als ich sie vor etwa hundertfünfzig Jahren kennenlernte, beeindruckte mich Alexa mit ihrer positiven Ausstrahlung, der man sich nur schwer entziehen konnte. Sie ging gerne aus. Genoss es, längere Reisen zu unternehmen. Jetzt ist davon nichts mehr zu spüren. Wie kalter Schweiß dringt ihre rasende Sehnsucht nach Liebe aus ihren Poren. Wenn man in ihrer Nähe ist, färbt sich die Welt grau.
Zigarettenrauch steigt vor ihr auf, wird von der nächtlichen Sommerbrise nach draußen gezogen. Ihr nachthimmelblaues Kleid, das in der Taille gerafft ist, passt sich perfekt ihrer großen, schlanken Figur an und betont ihre blasse Haut, die sich kaum von der weißen Wand abhebt. Jeden Tag fasst sie ihre langen Haare zu einem strengen Dutt zusammen und schlüpft in diese halsbrecherischen Pumps.
Ich kann nur ahnen, wie alt sie war, als sie starb. Die meisten Suchenden sprechen nicht gerne über ihren Tod oder ihr früheres Leben. Alles, was ich über Alexa weiß, ist, dass sie heute etwa zweihundertfünfzig Jahre alt ist. Dass sie an einer Krankheit gestorben ist. Und vor ihrem Tod eine Phase durchgemacht hat, die sie die dunkle Zeit nennt.
»Hier steckst du«, weise ich Alexa auf unsere Anwesenheit hin.
Sie wendet uns ihr Profil zu, doch ihr Blick gleitet zu Boden. »Die Nacht war so schön. Ich wollte sie mir ein wenig ansehen.«
Die Nacht ist heute wirklich wunderschön. Der Himmel erinnert an schwarzen Samt, der mit silbern funkelnden Steinen besetzt ist. Als Damien das Licht anknipst, ist die Magie des Moments von einer Sekunde auf die andere verflogen.
»Wie war euer Abend?« Schatten legt sich auf Alexas Augenpartie, als sie sich nun ganz zu uns dreht. Ladylike steckt ihre Zigarette in einer eleganten Spitze, wie man sie sonst nur aus Filmen wie Frühstück bei Tiffany kennt.
»Nichts Besonderes«, lügt Damien mir zuliebe.
Alexa nimmt einen tiefen Zug. Hält den Rauch lange in der Lunge, um ihn dann so langsam wie möglich auszustoßen. »Mein Abend war grauenhaft. Emmanuel, mein Erwählter, war zunächst wirklich vielversprechend. Er ist attraktiv und gebildet, aber dann hat er den ganzen Abend nur von sich gesprochen. Von seiner Kindheit, von seinen Hobbys, seinen Sportwettkämpfen … Schrecklich! Reine Zeitverschwendung!«
Ich ringe nach den richtigen Worten. Aber Tröstendes und Aufmunterndes wie »Das tut mir leid« oder »Kopf hoch« sind bei uns schon so was von abgenutzt. Und sie bringen nichts. Sie nehmen einem nicht die Last von den Schultern. Lassen einen nur weiter allein zurück.
Gerade, als ich Alexa von meinen Abend erzählen, sie damit trösten will, dass auch ich wieder einmal gescheitert bin, fährt sie fort: »Ich habe es dann recht schnell beendet, indem ich zu ihm ›Ich liebe dich‹ gesagt und ihn dazu gebracht habe, dasselbe zu mir zu sagen. Dann habe ich ihn geküsst.«