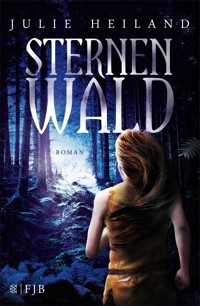
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Bannwald-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach "Bannwald" und "Blutwald" jetzt "Sternenwald", der dritte Teil der phantastischen Trilogie mit Robin und Emilian von Erfolgsautorin Julie Heiland. Das spannende Finale der phantastischen Saga um Macht und Liebe in einer gnadenlosen Welt. "Du brauchst einen Plan. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Nur so hast du eine Chance!" Robin ist entschlossen, die die sie liebt zu retten. Doch wenn du dafür dein Leben geben musst – was wirst du tun? "Gib auf, Robin. Du entkommst mir nicht." Immer noch hört Robin Birkaras' leises Flüstern und Emilians Schreie. Doch auch wenn Robin nichts anderes will, als Emilian sofort aus der Gewalt ihres Vaters zu befreien, weiß sie, dass sie es nicht alleine schaffen kann und Hilfe braucht. Wer wird an ihrer Seite sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Ähnliche
Julie Heiland
Sternenwald
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine über alles geliebte Familie
Fremder
Emilians Schreie hallen in meinem Kopf wie ein Echo.
Schmerz.
Birkaras’ Flüstern sitzt in meinen Knochen. Gib auf, Robin. Du entkommst mir nicht.
Eiseskälte legt sich um meinen erstarrten Körper. Vor mir erhebt sich der nachtschwarze Wald, hinter mir liegt eine Wiese. Eine atemberaubend große Wiese. Diese Wiese ist meine Freiheit.
Emilian. Sie haben Emilian.
Die Nacht kämpft gegen die ersten Sonnenstrahlen an. Grau verschwommene Unendlichkeit über meinem Kopf. Ich fühle mich so klein, so hilflos wie noch nie zuvor in meinem Leben. Schwarze Schatten zeichnen sich zwischen den Tannen ab. Die Tauren lauern wie hungrige Wölfe in der Finsternis des Waldes und hoffen darauf, dass ich ihre Beute sein werde. Sie rufen meinen Namen.
Meine Beine geben nach. Kraftlos sinke ich zu Boden. Meine Finger suchen etwas, woran ich mich festhalten kann, doch sie finden nur zartes Gras. Ich zittere am ganzen Körper. Was, wenn ich doch zurückstürme und sie alle so schnell ich kann töte? Aber es sind zu viele …
»Robin …«, flüstert der Wind. Vielleicht einer der lauernden Tauren im Wald, vielleicht Birkaras. Ich weiß es nicht, ich weiß gar nichts mehr.
Meine Schläfen pochen. Alles um mich herum dreht sich. Zunächst ganz langsam, dann immer schneller und schneller, bis die Konturen verschwimmen und ich nur noch das dunkle Grün des Waldes und das langsam heller werdende Blau des Himmels unterscheiden kann.
Ich höre meinen Herzschlag.
Einen Schlag.
Noch ein Schlag.
Nichts mehr.
Lange Zeit ist es still in meiner Brust.
Ich muss tot sein, denke ich.
Doch dann ist da wieder ein kaum spürbarer Schlag meines Herzens. Luft füllt meine Lunge. Ich atme tief ein. Ich lebe. Aber ich weiß nicht, ob Emilian lebt. Ob sein Herz noch schlägt. Wohin sie ihn bringen. Was sie mit ihm machen.
Ich krieche weiter vom Wald fort, kann meiner Feigheit nicht so nahe sein. Als die ersten goldenen Strahlen durch das Dach des Waldes brechen, verschwinden die Bestien. Gemächlich erhebt sich die Sonne über den Wipfeln der Tannen. Immer hat mich ihr helles Auftauchen irgendwie berührt. Jetzt schäme ich mich dafür, dass sie so freundlich über mir scheint, wo doch gerade meine Welt in Dunkelheit versinkt.
Schon wieder setzt mein Herz aus. Ich weiß nicht, was mit meinem Körper passiert. Ich weiß nur, dass er sich fremd anfühlt. Krank. Emilians Beobachtung kommt mir in den Sinn: Ich werde immer schwächer, während Birkaras von Tag zu Tag an Kraft gewinnt. Was, wenn tatsächlich ein Zusammenhang besteht? Oder zerbreche ich an all dem Leid um mich herum? Weil ich es nicht mehr ertragen kann?
Wolken ziehen über mir vorbei. Vögel kreisen in der Luft, Bienen fliegen summend zwischen den Blüten hin und her. Ich fühle das Gras unter mir. Betrachte das helle Grün. Die bunten Blumen.
Ich bin frei.
Aber mein Gefühl sagt mir etwas anderes. Ich will meine Lungen füllen. Einatmen. Mein Leben spüren. Doch es ist, als lägen Steine auf meiner Brust. Als wäre ich bei lebendigem Leib begraben.
Langsam versuche ich mich aufzurichten. Stütze mich mit den Händen ab, knicke erneut ein. Versuche es wieder. Denke an das, was mich antreibt. Mein Leben mit Emilian. Freiheit. Aber ohne ihn fühlt sich das hier falsch an.
Wie Blitze zucken Erinnerungsfetzen durch meinen Kopf. Unsere Flucht. Die Tauren hinter uns. Birkaras, so nah … Seine Mordlust. Im nächsten Moment war er einfach fort. Nur eine Einbildung. Nur in meinem Kopf. Doch es hat sich so echt angefühlt …
Mein Stamm wartet in einer Höhle darauf, dass ich ihn rette. Aber alleine kann ich ihn nicht erlösen … Nicht ohne Emilian.
Ich schaffe es, mich auf die Beine zu ziehen. Bleibe stehen. Zwinge mich klarzusehen. Den Wald. Meinen Feind. Mein jahrelanges Gefängnis. Mein Zuhause. Sein tiefes Grün erinnert mich an Emilians Augen. Vor Schmerz zieht sich mein Herz zusammen.
Ich renne einfach los. Renne zurück zu ihm, auch wenn es mich mein Leben kostet. Als ich die Grenze übertrete, fühlt es sich an, als würde ich ausgepeitscht. Die Zweige der Tannen schlagen auf mich ein, verhaken sich in meinem Hemd, reißen es auf. Die Dunkelheit des Waldes macht mich orientierungslos.
Ich stolpere, verliere das Gleichgewicht und falle auf die Knie. Der Hang ist so steil, dass ich ausrutsche, ein Stück hinabschlittere, als wäre es eine Fläche aus purem Eis. Meine Wildlederhose reißt an den Knien auf, im nächsten Moment pralle ich mit der Schulter gegen etwas Hartes. So fest, dass ich für einen kurzen Moment völlig benommen bin.
Stille. Dunkelheit.
Nur eine Krähe ruft ihre Artgenossen. Neben mir rollen immer noch Steine und Tannenzapfen den Hang hinunter. Ich blinzle. Nehme meine Umgebung wieder wahr. Der Stamm einer Tanne hat mich aufgefangen. Dort liege ich nun. Ein Schatten meiner selbst. Kraftlos. Hilflos. Nicht mehr die Robin, die ich einmal gewesen bin.
Ich huste. Klopfe mir auf die Brust, die sich anfühlt, als wucherten dort Dornenranken, die sich langsam durch meinen Körper bohren. Diese Stille macht mich verrückt. Kein einziges Geräusch hallt durch die Nacht. Die Tauren sind verschwunden und haben Emilian mitgenommen. Hier irgendwo muss es gewesen sein, nur wenige Meter vom Ziel entfernt. Hätte er es bis über die Grenze des Waldes geschafft, hätten die Tauren ihm nichts mehr antun können.
Aber er hat es nicht geschafft …
Ich lehne meine Stirn an den Baumstamm. Bleibe dort liegen, als wollte ich einschlafen und nie wieder aufwachen. Ich schließe meine Augen. Ein fremder Geruch mischt sich unter die würzigen Düfte des Waldes. Ich muss nicht lange überlegen, was es für ein Geruch ist. Blut. Ich öffne die Augen wieder und betaste mein Gesicht. Ob ich mich im Sturz verletzt habe. Doch ich kann keine Wunde fühlen.
Als ich auf meine Fingerspitzen sehe, beginnt sich die Welt um mich herum zu drehen. Sie sind dunkelrot. Aber ich spüre kein Brennen an meinem Körper. Da ist nichts. Gar nichts. Unversehrte Haut. Und dennoch ist meine Stirn voller Blut.
Es ist nicht mein Blut.
Als hätte ich einen Stromschlag bekommen, rücke ich von dem Stamm ab. Nur fort. Weit weg von hier. Aber mein Blick bleibt starr auf die Rinde der Tanne gerichtet. Sie ist rot. Mit Blut getränkt.
Emilians Blut.
Es ist schon fast getrocknet. Ich versuche verzweifelt, es mit dem Ärmel meines Hemdes aus meinem Gesicht zu wischen. Damit ich es nicht mehr sehen, nicht mehr riechen muss. Alles ist rot. Auch der Boden. Blätter, Wurzeln, Steine.
Ich schüttele den Kopf. Will nicht glauben, was ich da sehe. Ich stemme mich hoch. Renne einfach los. Ohne nachzudenken. Dorthin, wo sich die Mörder versammeln und auf ihren Erfolg anstoßen. Zurück in die Siedlung der Tauren. Zurück zu Emilian.
Diesmal stolpere ich nicht. Ich springe über alle Fallen des Waldes, haste an den Tannen vorbei, bringe den Hang sicher hinter mich. Renne und renne, verliere jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Emilian gehört zu mir wie die Wurzeln zu einem Baum. Es kann nicht sein, dass er tot ist.
Einen kurzen Moment lang bleibe ich stehen, um mich zu orientieren. Ja, hier muss es sein. Irgendwo in diesem Teil des Waldes habe ich Emilian das letzte Mal bewusst angesehen. Ihm in die Augen geschaut.
Hysterisches Lachen. Noch sind sie fern, aber sie wissen scheinbar, dass ich mich zurück auf taurisches Gebiet gewagt habe.
Ich will weiterlaufen, doch in diesem Augenblick nehme ich die Anwesenheit einer anderen Person wahr. Nicht weit von mir. Hier irgendwo versteckt sie sich in der Finsternis des Waldes.
Vollkommene Stille. Nur der harte Schlag meines Herzens lässt das Blut in meinen Ohren wie Trommelschläge dröhnen. Ich sehe mich um. Doch da ist niemand. Werde ich verrückt? Meine Verbindung zur Natur ist lange nicht mehr so gut wie sie einmal war. Vielleicht täusche ich mich. Oder es ist ein Taurer, der geblieben ist, um darauf zu warten, dass ich zurückkomme. Natürlich ist es so. Es muss so sein. Die Tauren wollen töten. Sie können nicht verlieren.
Mein Herz schlägt schneller, immer schneller, wie das unruhige Prasseln des Regens an einem stürmischen Tag. Ich presse meine Hand auf die Brust und versuche es zu beruhigen. Ich muss all meine Gedanken sammeln. Brauche sie klar und deutlich. Nicht so, als würde in meinem Kopf ein Tornado wüten. Ich muss herausfinden, wo sich die Person befindet, damit ich ihr nicht direkt in die Arme laufe. Verzweifelt versuche ich, meine Energie in den Boden zu schicken. Doch sie dringt nicht durch. Verschwindet irgendwo. Versickert in der Erde. Löst sich einfach in der Luft auf.
Ich darf keine Zeit verlieren. Sprinte wieder los. Einfach weiter, egal wer hier auf mich wartet. Ich bin stark. Ich kann töten. Wenn derjenige es darauf anlegt, dann werden dies seine letzten Sekunden sein.
Es ist das erste Mal, dass ich nicht bei diesen Gedanken erschrecke. Ich weiß, dass ich töten werde, sollte mich jemand angreifen. Vielleicht tue ich es sogar gerne. Aus purer Rache, weil sie mir Emilian genommen haben.
In diesem Moment reißt mich etwas zurück. Jemand packt mich am Arm und hält mich fest. Wirbelt mich herum, so dass ich ihm gegenüberstehe. Flüchtig sehe ich die starken Schultern eines Mannes. Ein Taurer. Ich mache mich darauf gefasst, dass der Wunsch zu töten mich jeden Augenblick überkommen wird. Der Fremde stößt mich um, und ich stürze zu Boden. Versuche wegzukriechen, doch er kniet sich neben mich. Presst die Hände auf meine Brust. Nur leicht. Ich könnte mühelos entkommen.
Aber ich halte inne. Noch nie habe ich diesen Mann gesehen. Er ist zweifellos ein Taurer, so stark wie er ist. Doch sein Gesicht verrät mir, dass er mir nichts tun wird. Die Art und Weise, wie er mich mit seinen warmen Augen ansieht, gibt mir diese Gewissheit.
»Verschwinde von hier! Die Auslöser haben längst ihr Signal gesendet. Sie wissen, dass du wieder da bist. Du musst hier weg!« Er sieht mich ein paar Sekunden lang durchdringend an. Scheinbar wartet er auf eine Antwort. »Hast du verstanden?«
»Wer bist du?«, entgegne ich verwundert.
Er rollt mit den Augen. Dann packt er mich einfach an meiner Hand und zieht mich auf die Beine. »Ich hätte dich für intelligenter gehalten, Robin. Jetzt beweis mir, dass dir dein Leben nicht gänzlich egal ist und verschwinde!«
Wankend stehe ich vor ihm. Ich klopfe den Dreck von meinem Hemd, lasse ihn dabei jedoch keine Sekunde lang aus den Augen. »Wieso sollte ich dir trauen? Du bist doch einer von ihnen.«
»Ich gehöre nur mir selbst«, antwortet er bestimmt. »Die Wiese kennst du ja schon. Lauf weiter. Immer geradeaus und du kommt in die Siedlung der Aries. Es ist nicht allzu weit.«
Ich mustere ihn. Auch, wenn ich glaube, dass er mir nichts antun wird, ist er nur schwer einzuschätzen. Die braunen Haare, diese perfekte Tolle über seiner Stirn, so als würde er jeden Morgen Stunden damit verbringen, sie zu formen, passen nicht in das Bild eines unerschütterlichen Kämpfers für die Gerechtigkeit. Er ist ein Schönling. Ein Blender. Vor solchen Leuten muss man sich in Acht nehmen.
»Was ist mit dir?«, frage ich. Vielleicht kann ich ja so wenigstens irgendetwas von diesem Fremden erfahren. Einen Hinweis bekommen, mit wem ich es hier zu tun habe.
Jetzt grölen die Tauren wieder meinen Namen. Wie Gespenster huschen einzelne Fetzen hasserfüllter Wörter durch den noch finsteren Wald. Sie nähern sich.
»Mach dir um mich keine Sorgen. Und jetzt los! Wenn du jetzt nicht verschwindest, dann war alles umsonst!« Er schubst mich den Hang ein Stück hinauf.
»Niemals. Ich lasse Emilian nicht im Stich.«
Ich rechne damit, dass er versuchen wird, mich festzuhalten. Deshalb weiche ich zur Seite aus, als er seine Hand nach mir ausstreckt. Mannshohes Dornengestrüpp versperrt mir den Weg, weshalb ich kurz innehalte. Der Fremde reagiert erstaunlich schnell. Diesmal bekommt er mich am Handgelenk zu fassen. Ich versuche mich ihm zu entwinden. Trete sogar nach ihm, doch sein Griff ist fest. Als er mich zusätzlich noch an der Schulter packt, bin ich gezwungen, aufzugeben.
»Wenn du jetzt in die Siedlung der Tauren marschierst, dann töten sie Emilian, und dich nehmen sie gefangen. Oder sie töten dich auch, weil Birkaras inzwischen verstanden hat, dass du eine Bedrohung für ihn bist. Verstehst du denn nicht? Du brauchst einen Plan. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Nur so hast du eine Chance!«
Mir wird klar, dass er recht hat. Dass er mir vielleicht gerade das Leben rettet. Er, den ich nicht kenne. Der dritte Taurer in meinem Leben, der mich laufen lässt. In diesem Moment wird mir bewusst, dass ich ihm vertraue. Vermutlich ist es die Stärke in seinen Augen, die mich so fühlen lässt. Ich verharre noch ein paar Sekunden und präge mir sein schmales, schönes Gesicht ein. Dann nicke ich. Sein Griff lockert sich, bis er seine Hände schließlich ganz von mir löst. Vorsichtig mache ich ein paar Schritte rückwärts, ehe ich wieder renne. Diesmal mit klarem Kopf. So schnell mich meine Füße tragen sprinte ich den Hang hinauf. Ein einziges Ziel vor Augen. Die Siedlung der Aries.
Kurz bevor ich die Grenze erreiche, drehe ich mich noch einmal um. Doch der Wald ist wieder nur Wald, kein störendes Lebewesen darin. Von Ferne dringen Grölen, Gelächter und schlechter Gesang zu mir herüber. Offensichtlich haben die Tauren heute keine große Lust mehr zu jagen. Vielleicht sind sie noch zu sehr davon berauscht, Emilian gefangen zu haben.
Der fremde, ungewöhnliche Taurer hingegen ist einfach verschwunden. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Doch ich habe das Gefühl, dass ich ihn wiedersehen werde.
Geisel
Er steht mitten auf dem großen Platz und wartet. Das schwache Licht des allmählich verblassenden Monds scheint ihm auf die knochigen Schultern. Er atmet die kühle Luft ein, saugt sie in sich auf. Er spürt, wie sie in seinen Lungen brennt. Sie gibt ihm Kraft. Er genießt den Moment, den Moment der vollen Kontrolle. Er fühlt sich so gesund wie schon lange nicht mehr.
Einige Tauren kehren vom See zurück. Sie wirken niedergeschlagen. Zögern, als sie ihn erblicken. Wagen es scheinbar kaum, ihm unter die Augen zu treten – sie haben sie nicht gefunden.
Natürlich haben sie das nicht. Weil sie dort nicht waren. Täuschen wollten Robin und Emilian ihn. Um zu fliehen. Selbst Melvin, der ihm stets treu ergeben war, haben sie in ihren Plan einbezogen.
Aber man täuscht ihn nicht.
Er gibt den Tauren mit der Hand ein Zeichen, dass sie verschwinden sollen. Er will nicht mit ihnen reden. Sie würden mit ihren plumpen Worten nur diesen vollkommenen Moment zerstören.
Gier wallt in seinem Magen. Sein ganzer Körper ist von zuckersüßer Vorfreude durchdrungen. Er schließt die Augen, spürt die neugewonnene Macht in sich. Ja – er, Birkaras, ist ein wahrer Herrscher. Ein Herrscher, der in die Geschichte eingehen wird. Schlau. Stark. Er hat Ideen, die die Welt verändern. Ohne Zweifel wird er in dieser Nacht seinen Triumph erleben. Er lässt seinen Blick über den Platz schweifen.
Hoffentlich tun die Tauren seiner Tochter nichts an. Denn sie haben eigentlich immer Lust zu töten. Und manchmal ist diese Lust so stark, dass sie ihr nicht wiederstehen können. Sie sind einfach zu heißblütig, zu impulsiv.
Auch er würde gerne mal wieder ein Leben auslöschen. Wenn man tötet, dann löst sich etwas in der Seele. Wie eine Fessel, die die Brust zuschnürt und mit einem Mal abfällt. Zwar hält dieses befreiende Gefühl nur für ein paar Augenblicke an, doch man will es immer wieder haben. Wieder und wieder. Es ist eine Sucht.
Von ihm aus können die Tauren Emilian töten. Am besten noch dort im Wald, weit von der Siedlung entfernt. Dann muss sich niemand um seine Leiche kümmern.
Jetzt tritt eine Gruppe Tauren aus dem Wald, kommt direkt auf ihn zu. Es ist so, wie er es erwartet hat. Sie haben Emilian. Zwei Taurer halten ihn an seinen Armen. Schleifen ihn über den Boden. Sein Kopf ist gesenkt, dennoch kann er sehen, dass Emilians Gesicht voller Blut ist. Wahrscheinlich ist er tot.
Kurz wünscht er sich, er hätte es selbst getan. Emilian mit seinen bloßen Gedanken zu Tode gequält, jegliches Leben aus ihm herausgepresst. Jetzt, wo sein Körper die Krankheit überlistet hat und er nicht ständig Schwächeanfälle fürchten muss, könnte er wieder nach Herzenslust töten.
Als hätte Emilian seine dunklen Gedanken gehört, hustet er. Spuckt Blut auf den Boden. Wehrt sich, will sich aufrichten. Doch einer der Taurer schlägt sofort mit der Faust auf seinen Hinterkopf, dass er wieder in sich zusammensackt. Sie müssen ihn übel zugerichtet haben, wenn sein ehemals stärkster Taurer so schwach ist.
Sein Blick gleitet weiter, sucht eine ganz bestimmte Person. Doch schon bald ist offensichtlich, dass sie nicht da ist.
Seine Tochter. Robin.
Sie hat es tatsächlich geschafft zu entkommen. Er holt tief Luft, zieht die Augen zu Schlitzen, leckt sich über die Lippen. Das Fehlen seiner Tochter trübt seine Stimmung. Gerade war alles noch so schön, geradezu perfekt. Er schaut noch einmal genauer, geht sogar ein paar Schritte auf die Gruppe zu. Aber er entdeckt Robin nicht.
Es wird nicht mehr lange dauern, bis es hell wird. Er sollte langsam von hier verschwinden und sich in sein Gemach zurückziehen, damit er diesen grässlichen Sonnenaufgang nicht sehen muss. Ganz zart zeichnet sich dort schon ein hellgelber Streif ab. Sonnenstrahlen. Wie er sie hasst.
»Das waren keine Diener, die flüchten wollten«, stellt jemand unnötigerweise fest.
Serbio, einer seiner stärksten Tauren. In etwa so alt wie Emilian, aber leider nur halb so intelligent.
»Diese Verräter haben nur so getan als ob, um sich heimlich aus dem Staub zu machen.« Serbio spuckt voller Verachtung auf den Boden. Direkt neben Emilian.
Denkt er etwa, er, Birkaras, sei dumm? Hätte die Sache nicht schon längst durchschaut? Für diese törichte Erklärung sollte er ihn eine Nacht in den Kerker werfen lassen! Um sich zu beruhigen, atmet er tief die kalte Nachtluft ein. Die Erkenntnis, dass er nicht das bekommen hat, was er wollte, bringt sein Blut in Wallung.
»Wo ist Robin?«, fragt er.
»Sie ist uns entwischt.«
Sie hat es tatsächlich geschafft. Er wundert sich nicht. Sie ist so willensstark, so entschlossen.
»Ist sie verletzt?«
Serbio schüttelt den Kopf. »Ich denke nicht.«
Er nickt. Die Taurer lassen den bewusstlosen Emilian zu Boden fallen, wo er wie ein Stein liegen bleibt. Ein Anblick, der seine Stimmung ein wenig bessert.
»Was sollen wir mit Emilian machen?«, fragt Serbio und kratzt sich am Kopf.
Auch die anderen Taurer sehen ihren Herrscher ratlos an. Die Tauren denken in erster Linie mit ihren Muskeln, deshalb brauchen sie auch einen fähigen Anführer. Zum Glück haben sie ihn, Birkaras. »Schafft ihn fort. Am besten in den Kerker. Zu Melvin, dem Verräter.«
Ein überraschtes Raunen geht durch die Gruppe. Sie wissen ja noch nicht, dass auch Melvin versucht hat, ihn zu täuschen.
Melvin war es, der behauptet hat, zwei Diener seien entwischt – irgendwo in der Nähe des Sees –, damit Emilian und Robin in die entgegengesetzte Richtung der Siedlung fliehen konnten. Für seine Tochter hat Melvin den Helden gespielt. Entzückend. Vermutlich hat sie das Gleiche an sich, was auch ihre Mutter hatte. Isa umgab eine Art Zauber, der ihn angezogen hatte wie ein Magnet.
»Wir könnten Emilian töten«, schlägt Serbio vor und lacht. Die anderen Taurer stimmen in sein Lachen ein.
Das Gelb am Himmel zeichnet sich immer deutlicher ab. Er sollte sich beeilen, wenn er vor Sonnenaufgang in seinem dunklen Gemach sein will. »Von mir aus. Macht, was ihr wollt.«
Er dreht sich um, will gehen. Doch dann kommt ihm ein anderer Gedanke. Seine Tochter wird nur in die Siedlung der Tauren zurückkehren, wenn Emilian noch am Leben ist. Emilian ist der Köder. Warum also sollte er ihn nicht nutzen?
Er dreht sich wieder um. Die Taurer sind bereits dabei zu klären, wer von ihnen Emilian töten darf. Kein einziger zeigt Mitleid. Nichts von der alten Freundschaft ist noch übrig. Sie alle haben Emilian gemocht, sogar zu ihm aufgesehen. Jetzt verachten sie ihn. Er weiß das zu schätzen.
»Oder nein«, verbessert er sich, fährt mit dem Zeigefinger über sein Kinn. Spürt seinen nachwachsenden Bart. »Eines ist sicher: Meine Tochter wird zurückkommen, um Emilian zu befreien. Bereiten wir ihr doch einen schönen Empfang.«
Er lacht. So laut und boshaft, dass die Taurer nicht widerstehen können, mit ihm zu lachen. Sie verstehen nicht, aber sie spüren die Grausamkeit, die in der Luft liegt.
O ja. Emilian wird sich noch wünschen, dass sie ihn einfach getötet hätten.
Freiheit
Mit aller Macht schiebt sich die Sonne über den Horizont empor. Breitet ihre Strahlen aus. Ihr Licht blendet mich. Brennt in meinen Pupillen.
Wieder stehe ich auf dieser mir endlos erscheinenden Wiese. Wieder ohne Emilian.
Der Fremde hat recht – ich brauche Hilfe, wenn ich Emilian retten will. Ich kenne die Aries nur vom Sehen. Nur vom Sternenball. Sie sind ruhige Wesen, meistens mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht.
Ich nicke, als wollte ich mich selbst davon überzeugen. Denke an meine Familie, die in einer Höhle kauert, darauf wartet, dass ich sie befreie. Die Höhle, in der ich Emilian wiedergetroffen habe, nachdem unser Angriff auf die Tauren in der Huldigungsnacht gescheitert war. In der er mir alles erklärt hat. In der ich ihm verziehen habe. Und in der er mir gesagt hat, dass er mich liebt.
Vorsichtig mache ich einen Schritt nach vorne, dann noch einen. Schritte in die Freiheit. Ich kann gehen, wohin ich will. Mein Kopf ist so klar wie schon lange nicht mehr. Hier gibt es keine Fallen, die mich aufhalten. Keine Grenzen, die mir meine Freiheit nehmen. Wenn ich wollte, könnte ich die Welt kennenlernen und endlich zu leben beginnen.
Ich breite meine Arme aus, fühle den Wind an meinem Körper. Spüre, wie er unter mein Hemd fährt und meine Haut streichelt. Ich nehme all die Gerüche um mich herum wahr. Gerüche, die mir vertraut sind und andere, die mir völlig fremd scheinen. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die wärmenden Sonnenstrahlen. Jetzt verschwimmt die Schönheit der Natur nicht mehr in einer schmerzenden, gelben Welle.
Ein Marienkäfer landet auf meiner Nasenspitze. Ich schiebe ihn auf meinen Zeigefinger, hauche ihn sanft an. Er breitet seine Flügel aus und hebt ab.
Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich schlucke, kämpfe innerlich dagegen an. Ich darf jetzt nicht weinen. Nicht schwach werden. Nicht jetzt.
Ich muss mich konzentrieren, mich irgendwie ablenken. Ich schließe die Augen, um die Energie der Sonne in all meinen Zellen zu speichern. Keine Grenzen.
In diesem Moment wird mir bewusst, dass ich jetzt endlich genauso frei bin wie ein Marienkäfer. Ich kann nicht fliegen, aber ich kann rennen, wohin ich will. Also renne ich los. Renne so schnell ich kann, die Arme ausgebreitet wie Schwingen. Ich spüre das Gras, nehme wahr, wie es gegen meine Beine schlägt. Vom Tau auf den Halmen werden meine Knöchel nass. Ich fühle mich so lebendig wie noch nie zuvor. Ich renne durch verblühten Löwenzahn, verteile seine grauen Pollen überall in der Luft. Wie Ballerinas tanzen sie in Richtung Himmel. Ich laufe immer weiter, schmecke die Luft, nehme sie in mir auf, als wäre sie das Köstlichste, was ich je gekostet hätte. Ich springe, als könnte ich fliegen. So wie der Marienkäfer oder die Vögel, die im Schwarm über meinen Kopf ziehen.
Aber Emilian ist nicht bei mir.
Ich darf nicht weinen. Nicht schwach sein. Nicht jetzt. Doch meine Wangen sind nass.
Ich bleibe stehen. Hole tief Luft. Wische die Tränen mit den Ärmeln meines schmutzigen Hemdes fort. Meine Knie, meine Arme, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Muss weiterlaufen.
Als ich doch das Ende der Wiese erreiche und an einen Wald komme, fühle ich Vertrautheit. Im Wald kenne ich mich aus, hier kann ich mich verstecken, mit den Bäumen eins werden. Es ist ein freundlicher Wald. Saftig grüne Bäume, deren Stämme mit feinblättrigem Moos überzogen sind. Zarter Farn, der büschelweise den Boden bedeckt. Dicke Wurzeln, die vielen Tieren ein Zuhause bieten. Die Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch das dichte Laubdach hindurch, lassen die Blätter funkeln.
Immer geradeaus. Das waren die Worte des fremden Taurers. Ich streiche mit den Händen über die Rinde der Bäume. Atme tief den harzigen Geruch des Waldes ein, den Duft all der blühenden Pflanzen. Im Busch neben mir raschelt es. Ein Fuchs schiebt seinen Kopf zwischen den Zweigen hervor, hält einen Augenblick lang inne, sieht mich misstrauisch an. Dann kreuzt er meinen Weg. Ihm folgt sein Nachwuchs, drei kleine Fuchswelpen. Tollpatschig, wie sonst nur Laurin geht, wenn er zu viel Beerenwein getrunken hat, tapsen sie über das Moos. Sie folgen brav ihrer Mutter und verschwinden irgendwann aus meinem Sichtfeld.
Es schmerzt, an Laurin zu denken. Nicht zu wissen, wie es ihm geht. Wie es meinem Stamm geht. Meiner Familie.
Schon bald wird der Waldboden steiler. Kurz darauf höre ich die ersten Stimmen. Mein Herz pocht so heftig, dass ich ein paar Sekunden lang Atemnot habe. Ich weiß nicht, warum ich so nervös bin. Die Aries sind gut, sie wollen mir nichts Böses.
Ich lege die Hand um den Vorsprung eines großen Felsbrockens, ziehe mich hoch. Die Stimmen werden lauter. Ich höre Musik und Kinderlachen. Rieche den Duft von gebratenem Fett. Mein Magen knurrt. Er will dem Essen entgegen, doch mein Kopf und die Angst in meinem Bauch halten mich zurück.
Dann ertaste ich eine ebene Fläche. Gerade, als ich mich hinaufwuchten will, ergreift jemand meine Hand und zieht mich mit einem Ruck nach oben. Erst weiß ich nicht, wie mir geschieht. Wie ein Fisch, der an Land gespült wurde, liege ich hilflos auf dem Boden. Ich sehe zwei nackte Füße. Männerfüße. Mein Blick wandert weiter, sieht zwei Beine in bequemen Stoffhosen.
Ich entziehe dem Mann meine Hand. Drehe mich auf den Rücken. Der Ariesmann – zumindest vermute ich, dass es ein Ariesmann ist – hat seine Stirn misstrauisch in Falten gelegt, doch seine warmen Augen lächeln mich an. Ich spüre, dass er mir nichts Böses will.
»Wen haben wir denn hier?«, fragt er so laut, dass ihn alle aus seinem Stamm gut hören können. Seine Stimme ist fest und sympathisch.
Als ich nicht antworte, lacht der Ariesmann. Er fährt mit den Fingern durch sein langes, ungekämmtes Haar. Hellrot ist es und ebenso lang, wie das von Almaras war. Überhaupt erinnert mich dieser Mann schmerzhaft an Almaras. Und das, obwohl mein Adoptivvater nicht so breite Schultern hatte und ihm sein Bart nicht bis zur Brust reichte.
Es ist seine Art. Sein freundliches und weises Lächeln. Seine starken, entschiedenen Bewegungen, von denen jede einzelne davon zeugt, dass er ein selbstsicherer und kluger Mann ist. Wie er amüsiert die Augenbrauen hochzieht.
»Geht es dir gut?«, erkundigt er sich, beugt sich zu mir herunter.
»Ja«, antworte ich knapp.
Umständlich richte ich mich auf. Der Ariesmann ergreift ein zweites Mal meine Hand und zieht mich auf die Beine. Er mustert mich eine Weile. Mein mit Dreck verkrustetes Hemd, meine wirren Haare, die Schrammen in meinem Gesicht.
»Wo kommst du her?«, fragt er schließlich ganz sanft, als wäre ich ein scheues Tier.
Inzwischen haben die Mitglieder seines Stammes einen Kreis um uns herum gebildet. Sie rücken immer näher. Ich kann ihre Neugier regelrecht fühlen. Sie mustern mich. Wollen wissen, wer ich bin, was mich zu ihnen führt. Bestimmt fragen sie sich, was mir widerfahren sein muss, um so mitgenommen auszusehen.
»Ich bin die Anführerin vom Stamm der Leonen.«
Mehrere Aries lachen leise hinter vorgehaltener Hand. Ich hätte mir denken können, dass sie mir das nicht glauben. Der rothaarige Mann vor mir bleibt vollkommen ruhig.
»Ich bin Elvor«, stellt er sich vor. Sein erwartungsvoller Blick sagt mir, dass er meinen Namen erfahren möchte. Doch ich schweige. Noch kann ich kein Vertrauen fassen.
Ich werfe einen Blick in die Runde. Sehe die freundlichen Gesichter und die Kleidung, die, obwohl sie grob ist, dennoch um ein Vielfaches besser ist als die meines Stammes. »Wo ist euer Anführer?«
Elvor macht einen Schritt auf mich zu. Sein Lächeln ist verschwunden. »Es ist dir also wirklich ernst.«
Eine Frau bahnt sich einen Weg durch die Menge der starrenden Aries und legt Elvor eine Hand auf die Schulter. Ihr Gesicht ist rund wie ein Kürbis, ebenso ihr Bauch. Ich erwische mich dabei, wie ich ein paar Sekunden lang auf die Wölbung starre. Meine Gedanken schweifen ab zu Marla – zu dem Tag, an dem ihr ungeborenes Kind, mein Bruder, starb.
Die Stimme der Frau holt mich zurück. »Hast du Hunger?« Sie löst sich von Elvor, wendet sich mir zu. »Wir dürften noch etwas vom Frühstück übrig haben.«
Mein Magen knurrt demonstrativ.
Elvor nickt mir aufmunternd zu. »Wenn du willst, dann kannst du erst mal etwas essen und dann bringen wir dich zu unserer Anführerin. Einverstanden?«
Anführerin? Ich bin mir sicher, mich verhört zu haben. Am liebsten würde ich jetzt gleich den Anführer der Aries sprechen, aber ich brauche Kraft, um klar denken zu können. »Einverstanden.«
Elvor legt einen Arm um meine Schultern. Vorsichtig führt er mich durch die Menge. Ich mag ihn. Auch, wenn wir noch nicht wirklich viel miteinander gesprochen haben, ist er mir irgendwie vertraut.
Mein Blick bleibt fasziniert an jedem kleinsten Gegenstand in der Siedlung hängen. Die Aries wohnen in Zelten aus robustem Leder und schützenden Plastikplanen. Sie sind so groß, dass in manchen ganze Familien unterkommen können. Kunstvoll verziert mit Symbolen und Schriftzügen in allerlei Farben. Zeichen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Von fern höre ich Musik: fröhliche Klänge einer Gitarre. Kinder laufen an mir vorbei, beachten mich nicht mal, so sehr sind sie in ihr Spiel vertieft. Der Boden ist ausgelegt mit schmalen Holzstücken und kleinen Steinen. Ideal, falls es mal regnet.
Es fällt mir schwer zu schätzen, wie viele Aries hier leben. Die Zelte sind scheinbar wahllos verteilt. Die meisten stehen im Rund um den großen Platz, über den ich jetzt mit Elvor laufe. Doch als ich meinen Blick zum Wald schweifen lasse, fällt mir auf, dass auch dort zwischen den Bäumen noch einige Zelte stehen.
In der Mitte der Siedlung sind lange Tische zusammengestellt, um beim Essen möglichst nah zusammenzusitzen. Einfache Hocker stehen um die Feuerstelle herum. Es geht zu wie auf einem Marktplatz. Eine Gruppe Frauen mit Körben voller Wäsche vor den Bäuchen spaziert an uns vorbei und unterhält sich aufgeregt. Männer ziehen Karren mit Gemüse hinter sich hier. Ein Anblick, der in meinem Magen schmerzhaftes Ziehen hervorruft.
Etwas abseits sitzt ein Junge mit einer Gitarre in der Hand und spielt gedankenversunken ein Lied. Vor seinen Füßen liegt eine Mütze. Darin liegen ein paar Münzen. Ein Mann läuft an ihm vorbei, bleibt stehen und schüttelt amüsiert den Kopf. Er tätschelt dem Jungen liebevoll das Haar und lässt ein paar Münzen in die Mütze fallen. Münzen, für die wir Leonen eine Woche lang in der Stadt schuften müssten.
»Setz dich. Ich besorge dir etwas zu essen.« Elvor zwinkert mir zu, dann geht er und lässt mich alleine.
Ich setze mich auf eine der Bänke. Dorthin, von wo ich am besten die ganze Siedlung überblicken kann. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, von allen angestarrt zu werden, als hätte ich drei Köpfe oder regenbogenfarbige Haut. Doch es beachtet mich niemand. Nur ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter Hand in Hand an mir vorbeiläuft und verwundert mit dem Finger auf mich zeigt, scheint mich wahrzunehmen.
Mein Herz zieht sich bei seinem Anblick schmerzhaft zusammen. Das Mädchen erinnert mich an Flora. Diese freche Art, die blitzenden Augen, das verträumte Lächeln.
»Wer ist das?«, fragt das Mädchen und zieht am Rock seiner Mutter.
Die Mutter wirft einen Blick zu mir herüber und lächelt entschuldigend. »Weiß ich nicht, mein Schatz. Aber wir müssen uns beeilen, sonst sind die Honigtörtchen alle aufgegessen.«
Bei dem Wort Honigtörtchen knurrt mein Magen so laut, dass es weithin zu hören ist. Elvor taucht wieder neben mir auf und stellt einen Teller mit in Öl eingelegten Tomaten, Käse und zwei verschiedenen Brotsorten neben mir ab. Ich starre auf den Teller und kann es kaum glauben. Wie köstlich alles aussieht. Tausendmal lieber möchte ich das hier essen als all die teuren Delikatessen der Tauren.
»Irgendwas nicht in Ordnung?« Elvor sieht mich erstaunt an. »Möchtest du lieber etwas anderes?«
Hastig schüttele ich den Kopf. »Nein, das ist perfekt«, antworte ich schnell, nehme mir eine Brotscheibe.
Elvor setzt sich neben mich und lehnt sich mit dem Rücken gegen den Tisch. Ich beiße in das noch warme Brot, kaue hastig, schlucke. Sofort muss ich husten.
»Nicht so schnell.« Elvor klopft mir auf den Rücken. Sein Mund formt sich zu einem verschmitzten Grinsen. Dabei ist sein Blick eindringlich. Ich sehe ihm an, dass er über mich nachdenkt. »Und du bist also eine Leonin?«, beginnt er, mich auszufragen.
Ich nicke, während ich mir ein Stück Käse in den Mund schiebe. »Anführerin.«
»Anführerin, entschuldige.« Er räuspert sich. »Möchtest du mir jetzt deinen Namen verraten?«
Ich überlege, zucke schließlich mit den Schultern. Von Elvor geht keine Gefahr aus. »Robin.«
»Robin.« Er nickt, als würde ihm einiges klarwerden. Dann streicht er sich gedankenversunken über den Bart. »Ich dachte immer, dass ein Mann der Anführer der Leonen sei? Zumindest war das noch auf dem letzten Sternenball der Fall.«
Ich kaue. Schlucke. Breche mir ein weiteres Stück Brot ab. Atme ein, atme aus. Für ein paar Sekunden droht die Welle aus Wut, Hoffnungslosigkeit und Angst mich mit sich zu reißen. Doch ich fange mich.
»Gestorben«, murmle ich, schiebe mir das Brot in den Mund.
»Das tut mir leid.« Elvor wischt die Krümel neben meinem Teller auf den Boden, fragt nicht weiter nach. »Wie alt bist du eigentlich?«, schneidet er ein anderes Thema an. »Ich meine, für eine Anführerin bist du ja noch ganz schön jung.«
Einen kurzen Moment lang muss ich überlegen. Dann wird mir bewusst, dass ich meinen eigenen Geburtstag vergessen habe. So groß ist das Leid, dass ich selbst an die schönen Dinge nicht mehr denke.
»Achtzehn«, antworte ich, während ich mich den eingelegten Tomaten widme.
»Dann müsst ihr Leonen ja ganz schön aufgeschlossen sein, wenn ihr eine so junge Anführerin habt«, stellt Elvor fest. Er grüßt mit einem stummen Nicken eine junge Frau, die ein Tablett voller Brote an uns vorbeiträgt.
Ich antworte nicht, esse stur weiter. Elvor nimmt mein Schweigen als Anlass, ebenfalls nichts mehr zu sagen. Vielleicht weil er denkt, dass ich nicht mit ihm sprechen will. Doch in Wahrheit bin ich sprachlos, weil mir in diesem Moment bewusstwird, wie wenig die anderen Sternenstämme über uns Leonen wissen. Sie haben keine Ahnung von unserer Gefangenschaft.
Als ich fertig gegessen habe, stehe ich sofort auf. Ich will keine Sekunde verlieren. »Bringst du mich nun zu eurem Anführer?«
Elvor kratzt sich am Kopf. Seine roten Haare fallen ihm ins Gesicht. Er streicht sie zurück. Wieder mustert er mich auf eine Weise, als wisse er nicht, was er von mir halten soll. »Bei deiner Entschlossenheit könnte ich fast glauben, dass du die Anführerin der Leonen bist.«
Er lächelt, doch das Lächeln verschwindet schnell wieder aus seinem Gesicht. »Ich bin gespannt, was sie zu deiner Geschichte sagen wird.«
Seelenblick
Wir schieben uns durch die Menge, laufen bis ans Ende der Siedlung, hin zu einer kleinen Erhöhung, die aus einer Anhäufung riesiger flacher Steine besteht. Auf einem dieser Steine, der so groß ist wie der zentrale Platz der Leonen, steht ein weiteres Zelt. Es ist größer als die anderen Unterkünfte und hat die Form eines Hauses. Zudem ist es mit zahlreichen Laternen und Tüchern prächtig geschmückt. Das Zelt des Anführers. Von hier kann er seine Siedlung gut überblicken.
Elvor steigt vor mir die in den Stein gehauenen Treppenstufen hinauf. Ich folge ihm schweigend. Oben angekommen schlägt er die Glocke an, die an einem bunten Band vor dem Eingang des Zelts hängt. Spätestens jetzt weiß man von unserer Ankunft. Zwei dicke Ledertücher schirmen das Innere des Zeltes ab. Auch diese sind kunstvoll verziert mit Schriftzeichen und Symbolen. Ich rätsle, was die Zeichen wohl zu bedeuten haben.
»Kommt herein«, bittet uns eine freundliche Stimme.
Ich habe eine tiefe Männerstimme erwartet. Habe mir den Anführer als robusten Mann vorgestellt, ebenso stark wie Elvor. Doch diese Stimme gehört einer Frau. Also habe ich mich eben doch nicht verhört.
Elvor schiebt eines der Ledertücher zur Seite. Mit der freien Hand macht er eine Bewegung, mit der er mir bedeutet, dass ich vorgehen soll. Ich danke ihm mit einem Nicken. Betrete das Zelt. Innen ist es unerwartet dunkel. Allein das Licht zahlreicher Kerzen erhellt die Unterkunft der Anführerin. Kerzen, die in Schalen aus buntem Glas stehen und das Leder der Zeltwände in alle möglichen Farben tauchen. Rote, gelbe, grüne und blaue Tücher sind von einer Seite des Zelts zur anderen gespannt oder hängen scheinbar wahllos von der Decke herab. Mehrere große Kommoden reihen sich aneinander. Die Schalen darauf sind angefüllt mit Nüssen, Kräutern oder getrockneten Früchten. Ein herber Geruch liegt in der Luft. Weihrauch oder Kräuterdampf, der in der Nase juckt.
»Trau dich nur«, sagt die fremde Stimme.
Eine zarte Gestalt taucht hinter der Wand aus bunten Tüchern auf, schiebt sie zur Seite. Sie mustert mich. Blut schießt mir in die Wangen. Ich schäme mich. Meine Klamotten sind zerrissen und dreckig, meine Haare zerzaust, mein Gesicht zerkratzt. Sie hingegen wirkt so würdevoll und stark, obwohl sie nicht sonderlich groß ist. Ihre hellblonden Haare reichen ihr gerade mal bis kurz über die Schultern und sind so akkurat geschnitten, als hätte jemand mit dem Lineal nachgemessen. Wie Marla trägt sie einen Pony, jedoch tanzt bei ihr keine einzige Strähne aus der Reihe.
Noch nie habe ich so viel Schmuck gesehen: Sie trägt goldene Ringe und bunte, geflochtene Bänder an den nackten Füßen. Mehrere schwere Ketten zieren ihren zarten Hals, die teils von einem breiten Tuch verdeckt werden. An ihren Ohren baumeln apfelgroße Kreolen. Das alles sind Schmuckstücke, für die Minna ein Jahr lang freiwillig den Abwasch machen würde, nur um sie einen Tag lang tragen zu dürfen.
Die weite Hose der Anführerin glänzt rot. Ihr Hemd ist schlicht und weiß, im Gegensatz zu der grünen, ebenfalls glänzenden Weste, die sie darüber trägt. Auf ihrer Stirn scheinen dieselben Zeichen gemalt zu sein, wie ich sie zuvor draußen auf den Zeltwänden entdeckt habe. Selbst um ihre Augen schwingen sich zarte Ornamente in tiefem Rot und glänzendem Gold.
Sie nähert sich mir langsam. Barfuß läuft sie direkt auf eine Holzschale mit einer dampfenden Flüssigkeit zu, die mitten im Zelt auf dem Boden steht. Sie blickt mich unverwandt an. Wenn sie nicht gleich stehen bleibt oder endlich zu Boden sieht, wird sie gegen die Schale stoßen und sich die Füße verbrennen. Ich will sie warnen, doch sie hebt ihren Fuß und steigt darüber hinweg, als würde sie jeden Zentimeter ihres Zeltes auswendig kennen.
»Sei gegrüßt«, sagt sie, als sie vor mir steht. Sie ist mir viel zu nah. So nah, dass unsere Gesichter nicht mal die Länge eines Zeigefingers trennt.
»Seid ebenso gegrüßt«, antworte ich und versuche so unauffällig wie möglich einen Schritt zurück zu machen.
Sie folgt mir auf der Stelle. Keine Sekunde lässt sie davon ab, mir in die Augen zu blicken. Als ob sie mich hypnotisieren will. Ich versuche ihren Blick zu halten, nicht nachzugeben.
Jemand räuspert sich hinter mir. Elvor. Ich atme vor Erleichterung aus. Er ist also immer noch da.
»Ich werde dann wieder gehen«, sagt er, jetzt aber mit seiner tiefen, beruhigenden Stimme. Kurz darauf höre ich, wie die ledernen Tücher am Eingang gegeneinanderschlagen.
Meine Hände beginnen zu schwitzen. Noch immer lässt mich die Anführerin nicht aus den Augen. Das Verlangen zu schlafen überkommt mich. Von einer Sekunde auf die andere bin ich unendlich müde.
Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, bis die Anführerin endlich einen Schritt zurück macht und ihren bohrenden Blick von mir löst. Mit einem Mal fühle ich mich, als könnte ich wieder frei atmen. Die Müdigkeit ist verflogen.
»Wie ist dein Name?«, tastet sie sich mit weicher Stimme vor.
»Robin.« Ich versuche wenigstens annähernd so viel Kraft in meine Stimme zu legen, wie sie es tut. »Anführerin vom Stamm der Leonen.«
Sie verzieht keine Miene. Kein amüsiertes Lächeln, wie ich es erwartet habe. »Dann folge mir, Robin, Anführerin vom Stamm der Leonen.«
Sie dreht sich um und verschwindet hinter den Tüchern. Ich folge ihr und stehe vor großen, bunten Kissen, die rings um einen flachen Tisch auf dem Boden liegen.
»Setz dich, Robin.« Sie weist mit einer eleganten Bewegung auf ein Kissen, dann auf den Tisch. »Bedien dich, wenn du Hunger hast.«
Erst jetzt nehme ich die Schalen mit all den Köstlichkeiten darin wahr. Früchte, die ich noch nie gesehen habe. Ich setze mich auf das buntbestickte Kissen. Warte ab.
Die Anführerin der Aries lässt sich mir gegenüber im Schneidersitz nieder, wobei sie die Hände auf die angewinkelten Knie legt. Wieder mustert sie mich, diesmal mit schiefgelegtem Kopf. »Was führt dich zu uns?«
Ich bin nicht besonders gut darin zu reden. Deshalb fällt es mir schwer, einen Anfang zu finden. »Ich bin geflohen«, beginne ich meine Geschichte.
Die Anführerin zieht die Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht, wie ich diese Geste deuten soll. Erstaunen, Verwunderung, Unglaube?
»Eigentlich bin ich eine Leonin«, fahre ich fort, »doch Birkaras, der Anführer der Tauren, hat mich gezwungen, bei ihm zu leben.«
»Wie kann er dich zwingen?«, fragt mich die Anführerin, nimmt sich eine der Früchte. Sie klingt unbeeindruckt, fast ein wenig gelangweilt. Als müsse sie mir erklären, warum im Sommer die Sonne scheint und im Winter Schnee fällt. Sie beißt in die violette Frucht, betrachtet eingehend das blutrote Fruchtfleisch.
»Weil die Tauren unsere Kraft geraubt haben. Sie unterdrücken uns und wir können uns nicht wehren. Sie sind um ein Vielfaches stärker als wir.«
Die Anführerin beißt wieder ein Stück von der Frucht ab. Kaut. Schluckt. Ihr Gesichtsausdruck verändert sich, wird härter. »Du bist nicht schwach. Das hat mir deine Seele verraten.«
Mein Herzschlag beschleunigt sich. Sie glaubt mir nicht. »Ich bin eine halbe Taurin. Meine Mutter hatte ein Verhältnis mit Birkaras. Doch als der damalige Anführer der Tauren dahinterkam, ließ er meine Mutter töten.«
Mir wird bewusst, wie unwahrscheinlich meine Geschichte klingt. Vermutlich würde ich mir auch nicht glauben, wenn ich es nicht besser wüsste. Schon allein die Vorstellung, dass ich die Anführerin eines Stammes sein könnte, muss ihr lächerlich erscheinen.
Dennoch rede ich weiter. Ich berichte ihr von den Abgaben. Von all den Leonenleben, die die Tauren auf dem Gewissen haben. Von unserem Versuch, uns in der Huldigungsnacht zu befreien. Ich erzähle ihr davon, dass die Tauren meinen Ziehvater getötet haben. Davon, wie Birkaras mich gezwungen hat, in der Siedlung der Tauren zu leben und wie Emilian und ich geflüchtet sind. Und schließlich, wie Emilian auf einmal nicht mehr bei mir war.
Die ganze Zeit über hört mir die Anführerin aufmerksam zu. Als ich ende, schweigt sie minutenlang. Schließt die Augen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Reaktion von ihr. Die Zeit vergeht quälend langsam.
Als sie die Augen wieder öffnet, ist ihr Blick vollkommen leer. »Ich muss mich nun hinlegen. Wir sehen uns beim Abendessen. Ich würde mich freuen, wenn du an meiner Seite sitzen würdest.«
Dann steht sie auf und neigt den Kopf zur Verabschiedung. Kurz bevor sie hinter einer weiteren Wand aus bunten Tüchern verschwindet, dreht sie sich noch einmal flüchtig zu mir um. »Mein Name ist Oxana. Elvor wird dir ein Zelt herrichten, in dem du dich ausruhen kannst. Schlaf ein wenig, du bist erschöpft.« Dann fallen die schweren Tücher hinter ihr zu.
Mehrere Atemzüge lang sitze ich einfach nur da. Starre geradeaus. Kann nicht fassen, dass sie einfach so gegangen ist. Dass sie meine Hoffnung, hier Hilfe zu finden, einfach so zerstört hat.
Als ich das Zelt verlasse, beginnt eine Ader an meiner Schläfe heftig zu pochen. Ich spüre, wie das Blut schwallartig durch meinen Kopf gepumpt wird, als hätte sich in meinem Körper ein Staudamm gelöst.
Auf einmal dreht sich alles um mich herum. Die ebene Fläche unter den großen Steinen scheint unendlich weit weg zu sein. Ich erkenne die Treppenstufen nicht mehr, nehme nur noch schemenhafte Umrisse wahr. Die riesigen Steine, der Wald, das Zelt lösen sich auf, werden zu einer einzigen grauen Masse. Alles dreht sich immer schneller und schneller. Und dann wird alles von einem Wirbelsturm mitgerissen.
Ich spüre, wie ich mit meinem Kopf auf etwas Hartem aufschlage. Eine warme Flüssigkeit läuft mir über die Stirn, über meine Augen und verfängt sich in meinen Wimpern.
Dann ist alles schwarz.
Hilflos
Wie Sand, der langsam in ein Gefäß rieselt, kehrt meine Erinnerung ganz allmählich zurück. Bildfetzen tauchen vor meinem inneren Auge auf. Ich kann sehen, wie ich zu Boden gestürzt bin. Wie Elvor mich gefunden, mich vorsichtig auf eine Pritsche gelegt hat.
Jeder einzelne Schlag meines Herzens dröhnt in meinem Kopf. Es ist, als würde mein Gehirn vom Schmerz zerquetscht. Ich wage es nicht, meine Augen zu öffnen. Streiche nur vorsichtig mit den Händen über die weiche Decke, auf der ich liege. Ein seltsamer Geruch kitzelt mich in der Nase. Bitter und würzig. So, als hätte jemand Pfeffer und noch etwas, das ich nicht ausmachen kann, in die Luft gesprüht. Meine Lider flattern.
»Da ist sie ja wieder«, höre ich jemanden sagen. Eine tiefe klangvolle Männerstimme. Elvor.
»Besonders lang hat sie nicht geschlafen«, erklingt eine zweite Stimme. Die einer Frau. Jung, freundlich und klar. Die Anführerin.
Vorsichtig öffne ich die Augen. Die beiden beugen sich über mich, jeder von einer Seite, dass sich ihre Haarscheitel fast berühren.
»Wie geht es dir?«, fragt mich Oxana. »Elvor hat dich vor meinem Zelt gefunden. Du warst bewusstlos.«
Das Licht der roten Kerzen auf der Kommode brennt in meinen Pupillen. Ich fahre mir über die Stirn. Lasse die Augen über die wenigen Möbel im Zelt schweifen. Ein Schemel. Eine Kommode. Das Bett, in dem ich liege. Ein seltsames Gefäß hängt von der Decke herab und schwingt sanft über meinem Kopf hin und her. Eine Art silberner Topf, der oben geschlossen ist, dafür jedoch seitlich Löcher hat. Dämpfe steigen daraus empor. Vermutlich kommt daher der herbe Geruch.
Oxana folgt meinem Blick. »Das sorgt dafür, dass es dir wieder bessergeht. Du warst sehr schwach.«
Ich versuche mich aufzurichten. Scheitere. »Warum bin ich ohnmächtig geworden?«
Oxana zuckt mit den Schultern. »Ich kann dir das nicht erklären. Aber ich glaube, du selbst weißt ganz genau weshalb.«
Ich weiche ihrem Blick aus. »Dankt eurer Heilerin von mir.« Meine Stimme ist rau.
»Unsere Heilerin steht vor dir«, lacht Elvor. Nickt in Oxanas Richtung.
Die Anführerin lächelt. Streicht mir über die Wange, als wäre ich ein kleines Kind. Ihre Berührung fühlt sich gut an. Vertraut, obwohl ich diese Frau überhaupt nicht kenne. »Eigentlich sind wir ja alle Heiler.«
»Aber du bist die Beste«, fügt Elvor hinzu.
Oxana legt den Kopf schief. »Sonst wäre ich wohl nicht eure Anführerin, nicht wahr?«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Lasse es zu, dass Elvor mich am Rücken stützt, als ich ein zweites Mal versuche, mich aufzurichten. Nur langsam lässt das Brennen in meiner Brust nach. »Ihr könnt alle heilen?«
Jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit von beiden. Sie starren mich an. Ich schäme mich. Meine absolute Ahnungslosigkeit scheint ihnen die Sprache verschlagen zu haben.
»Wusstest du das nicht?«, fragt mich Oxana schließlich.
Ich schüttele den Kopf. Jeder Fetzen meiner langsam wiederkehrenden Erinnerung mahnt mich, dass ich mich gar nicht ausruhen dürfte. Die Zeit drängt. Ich liege hier – wohlig gebettet auf weichen Decken –, habe vielleicht sogar mehrere Stunden geschlafen, während sich mein Stamm voller Angst in einer Höhle versteckt. Darauf hofft, dass ich ihn rette. Vermutlich durchkämmen die Tauren bereits den Leonenwald. Suchen nach meinen Leuten. Lechzen nach Rache.





























