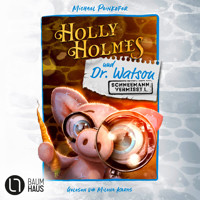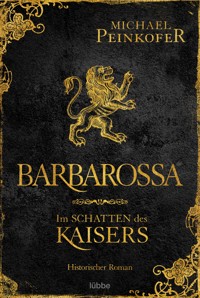
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitlebens steht er im Schatten des Kaisers: der Findelknabe Arndt von Cappenberg, später Diener und Leibwächter des legendären Herrschers. Er begleitet Barbarossa im Kampf um das Königtum und im Krieg gegen Mailand. Er folgt ihm auf den Kreuzügen, und sogar als Arndt sich unsterblich in Beatrix verliebt, die zukünftige Frau Barbarossas, hält er ihm die Treue, innerlich zerrissen zwischen Loyalität und Leidenschaft, Hass und Liebe. Im Schatten des Kaisers beobachtete er, wie dessen Entscheidungen Wohlstand und Frieden bringen, aber auch Trauer und Leid. Und so muss er am Ende eine Entscheidung treffen - eine Entscheidung, die nicht nur ihn betrifft, sondern das Schicksal eines ganzen Reichs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Zeitlebens steht er im Schatten des Kaisers: der Findelknabe Arndt von Cappenberg, später Diener und Leibwächter des legendären Herrschers. Er begleitet Barbarossa im Kampf um das Königtum und im Krieg gegen Mailand. Er folgt ihm auf den Kreuzügen, und sogar als Arndt sich unsterblich in Beatrix verliebt, die zukünftige Frau Barbarossas, hält er ihm die Treue, innerlich zerrissen zwischen Loyalität und Leidenschaft, Hass und Liebe. Im Schatten des Kaisers beobachtete er, wie dessen Entscheidungen Wohlstand und Frieden bringen, aber auch Trauer und Leid. Und so muss er am Ende eine Entscheidung treffen – eine Entscheidung, die nicht nur ihn betrifft, sondern das Schicksal eines ganzen Reichs.
ÜBER DEN AUTOR
Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen« und der Abenteuerreihe um Sarah Kincaid, deren abschließender vierter Band mit »Das Licht von Shambala« vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
MICHAELPEINKOFER
Barbarossa –Im Schattendes Kaisers
HISTORISCHER ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln
Copyright © 2022 by Michael Peinkofer
Originalausgabe 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © kosmofish/shutterstock; © Eroshka/shutterstock; © Phatthanit/shutterstock; © vectorkat/shutterstock; © LadyMary/shutterstock; © Ton Photographer 7824/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2106-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für meinen Vater,
der dieses Buch so gerne noch gelesen hätte
Der alte Barbarossa,
der Kaiser Friederich,
im unterird’schen Schlosse
hält er verzaubert sich.
Er ist niemals gestorben;
er lebt darin noch jetzt.
Er hat im Schloß verborgen
zum Schlaf sich hingesetzt.
Er hat hinabgenommen
des Reiches Herrlichkeit
und wird einst wiederkommen
mit ihr zu seiner Zeit.
Friedrich Rückert (1817)
HANDELNDE PERSONEN
Friedrich, genannt Barbarossa
Kaiser des römischen Reiches
Adalbert von Haigerloch
ein junger Ritter
Adela von Vohburg
erste Gemahlin Barbarossas
Arndt von Cappenberg
der Schatten des Kaisers
Arnold II.
Erzbischof von Köln
Arnulf von Weißenburg
Ritter, staufischer Gefolgsmann
Beatrix von Burgund
zweite Gemahlin Barbarossas
Berthold IV.
Herzog von Zähringen
Bertolf von Urach
Bannerträger des Reiches
Bruno von Chiaravalle
Abt des Zisterzienserordens
Chrétien von Troyes
ein französischer Dichter und Sänger
Christian von Buch
kaiserlicher Legat, Erzbischof von Mainz
Dazio
Waffenknecht aus Siena
Dietho von Ravensburg
ein Ritter
Dietrich von Flandern
Graf, Schwager des Kaisers
Dietrich von der Lausitz
Markgraf des Reiches
Dietrich von Sylva Benedicta
ein Kartäusermönch
Eberhard
Bischof von Bamberg
Friedrich II.
Herzog von Schwaben, Vater Barbarossas
Friedrich V. von Schwaben
Herzog, erstgeborener Sohn Barbarossas
Garzabano
ein italienischer Ritter
Gautier von Arras
ein französischer Sänger
Gebhard von Henneberg
Bischof von Würzburg
Gottfried von Viterbo
Kapellan des Kaisers
Gottfried von Wiesenbach
Ritter, Teilnehmer am 3. Kreuzzug
Gunther
Hofkaplan und Erzieher der Kaisersöhne
Guido von Biandrate
Graf des Reiches
Guido von San Callisto
Kardinal, päpstlicher Legat
Hartmann von Siebeneich
kaiserlicher Ritter
Heinrich
Sohn des Kaisers, erster in der Thronfolge
Heinrich der Löwe
Herzog von Sachsen und Bayern
Heinrich Jasomirgott
Herzog von Österreich
Heinrich von Kalden
Marschall des Kaisers
Hillin
Erzbischof von Trier
Humbert III.
Graf von Savoyen
Imad ad-Din Zengi
Atabeg von Mossul
Konrad
Pfalzgraf bei Rhein, Stiefbruder Barbarossas
Konrad
drittältester Sohn des Kaisers, später Friedrich von Schwaben
Konrad III.
römisch-deutscher König, Onkel Barbarossas
Konrad von Lützelhardt
Graf, Getreuer des Kaisers
Kuno
Gelehrter, Leibarzt des Kaisers
Lothar III.
Kaiser und König, Vorgänger Konrads III.
Ludwig von Helfenstein
Ritter, Teilnehmer am 3. Kreuzzug
Ludwig II.
Landgraf von Thüringen
Manuel I. Komnenos
Kaiser von Byzanz
Maria Komnena
seine Nichte, kaiserliche Prinzessin
Marchese
ein Erfinder von Kriegsmaschinen
Nicolaios
ein byzantinischer Hofbeamter
Nikolaus
Bischof von Cambrai
Nur ad-Din
Atabeg von Aleppo
Oberto von Dovara
Bischof von Cremona
Obizo Malaspina
Markgraf in Italien
Octaviano
Kardinal, später Papst Viktor IV.
Otto von Cappenberg
Mönch, Taufpate Barbarossas
Otto von Wittelsbach
Graf, Vertrauter Barbarossas
Philipp von Heinsberg
Kanzler, später Erzbischof von Köln
Rainald von Dassel
Kanzler, später Erzbischof von Köln
Rolando Bandinelli
Kardinal, später Papst Alexander III.
Sebastiano Ziani
Doge von Venedig
Sven von Dänemark
Cousin Barbarossas
Vincenzo
Kaufmann, Konsul in Mailand
Welf VI.
Herzog, Onkel Barbarossas
Wendelin
Bruder des Prämonstratenserordens
Wichmann von Seeburg
Erzbischof von Magdeburg
Wiebald von Stablo
Benediktinerabt, Berater des Kaisers
Wilhelm III. von Burgund
Onkel von Beatrix
Wilhelm von Montferrat
Markgraf, Onkel des Kaisers
Wladyslaw II.
polnischer Herzog, Schwager des Kaisers
Yussuf Salah ad-Din
Sultan von Ägypten und Syrien
PROLOG
Heerlager am Fluss Saleph, KleinarmenienNacht des 10. Juni 1190
Die Zeit schien stillzustehen.
Es war, als hätte der Allmächtige selbst die Tiere verstummen lassen und den Lüften verboten, sich zu regen.
Schweigen hatte sich über das Lager gebreitet, so steinern wie die karge Landschaft, die es umgab, und so endgültig wie der Tod auf Erden selbst. Die Banner über den Zelten hingen träge herab, da war kein Wind mehr, der sie bewegt hätte. Und sogar der einstmals reißende Fluss schien jetzt zäh und langsam dahinzuziehen, nachdem er sein Mordwerk verrichtet hatte.
Der Kaiser war tot.
Friedrich von den Staufern, Kaiser und König, dem sie seines roten Haares wegen den Namen Rotbart gegeben hatten, weilte nicht mehr unter den Lebenden. Und es war, als hätte mit dem Ableben des Herrschers auch jeder Mut und alle Hoffnung das Heer der Kreuzfahrer verlassen.
Strapazen lagen hinter uns, die jeder Beschreibung spotteten, Hunger und Entbehrung. Sengende Hitze und brennender Durst hatten uns ebenso zugesetzt wie die Seldschuken, die uns immer wieder überfallen hatten, eine Taktik gezielter Nadelstiche, die früher oder später jeden Kämpfer ermüden musste. Doch selbst in dieser scheinbar aussichtslosen Lage war es dem Herrscher gelungen, die Seinen stets mit frischem Mut und neuer Kraft zu erfüllen und bei Iconium zum Triumph über die Heiden zu führen. Noch keinen Mond lag dies zurück – doch schien es, als wären seither Ewigkeiten verstrichen.
Friedrich war nicht mehr unter uns.
Das Licht des Abendlands war erloschen, und drückende Trauer hatte sich über uns alle gelegt, die wir dem Kaiser ins Heilige Land gefolgt waren: Von den zehn Bischöfen und dreißig Grafen und ihren Bannerträgern und Rittern bis hinab zum Fußvolk und dem gemeinsten Knecht. Und nun, als sich der Tag dem Ende neigte, als die Sonne im Westen blutrot versank und die Felsen und verkrüppelten Bäume in der kargen Landschaft lange Schatten warfen, gesellte sich dunkle Furcht zur Trauer der Männer. Eine Angst, die bereits als dumpfe Vorahnung ihre Herzen verfinstert und ihnen in kalten Wüstennächten den Schlaf geraubt hatte und die nun mehr und mehr zur Gewissheit wurde – dass dieses ganze Unternehmen, dieser Heereszug zur Ehre des Allmächtigen und seiner himmlischen Scharen, nicht unter günstigen Sternen stand und von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen war, vom ersten Tage an, seit der Kaiser vor drei Jahren auf dem Hoftag Jesu Christi das Kreuz genommen und feierlich gelobt hatte, das Heilige Land von den Heiden zu befreien.
Auch ich konnte mich dem nicht entziehen.
Furcht war mein Begleiter gewesen, seit wir Regensburg vor mehr als einem Jahr verlassen hatten und gen Osten aufgebrochen waren: zunächst auf Schiffen den großen Fluss hinab bis Alba Graeca, hinein in das Östliche Imperium, durch die Wälder und über die Pässe der Bulgaren nach Adrianopel. Versorgungsnot und ständige Überfälle hatten uns bis dahin bereits zugesetzt, und nur dem eisernen Willen und der Führungskraft des Kaisers war es zu verdanken gewesen, dass wir zum Osterfest den Hellespont erreichten und ihn auf byzantinischen Schiffen überquerten. In Anatolien freilich stießen wir erneut auf Widerstand. Heidnische Türkenstämme und kriegerische Seldschuken setzten uns zu, deren Hauptstadt Iconion wir mit Gottes Hilfe und unter großen Opfern eroberten – und nun, da wir mit dem Königreich von Kleinarmenien endlich wieder befreundetes, christliches Gebiet erreichen sollten und uns nur noch der Lauf des Saleph von den rettenden Mauern von Seleukia trennte, war unser geliebter Herrscher eines ebenso jähen wie unerwarteten Todes gestorben.
Es gab solche im Lager, die sich an die Heilige Schrift erinnert fühlten und an Moses, dem es nicht vergönnt gewesen war, das Land der Verheißung zu betreten; aber auch andere, die von dunklen Vorzeichen sprachen und von drohendem Untergang. Und alle stellten sie dieselben Fragen: Was genau war an der Furt geschehen? Wie hatte es zu dem furchtbaren Unglück kommen können, das nun womöglich Tod und Verderben über uns alle bringen würde?
Und wenn mich die Erfahrung meines langen Lebens eines gelehrt hatte, dann, dass vor allem die Mächtigen es nicht ertrugen, wenn solche Fragen ohne Antwort blieben …
Als die Wachen kamen, hielt ich mich vor dem Zelt des Kaisers auf. Hell erleuchtet stand es inmitten des Heerlagers, und obgleich es kein Prunkzelt war wie das, welches Heinrich von England dem Kaiser einst zum Geschenk gemacht hatte, war es doch größer als alle anderen und mit purpurfarbenem Stoff ausgeschlagen, der Farbe des Herrschers. Von hellem Fackelschein erfüllt, leuchtete es in roter Glut und beschien die Gesichter jener, die sich eingefunden hatten, um ihrem König und Kaiser die letzte Ehre zu erweisen, seiner zu gedenken und für seine unsterbliche Seele zu beten. Aus dem Inneren des Zeltes drangen leise lateinische Worte – Litaneien der Prämonstratenser-Mönche, die die Wallfahrt begleiteten und sich um den aufgebahrten Leichnam des Herrschers versammelt hatten. Auch wenn die meisten, die hier draußen ausharrten, kein Wort davon verstanden, legte sich der monotone Gesang wie Balsam um ihre Seelen, gab ihnen Trost und Hoffnung inmitten der Trauer … anders als mir.
Am Boden kniend, bemerkte ich den Schatten, der auf mich fiel. Ich blickte auf und sah im Zwielicht zwei Waffenknechte. Auf ihren zerschlissenen Röcken, die vor Schweiß und Dreck ebenso standen wie vom Blut erschlagener Feinde, prangte neben dem Kreuz der Pilger das Wappen des schwäbischen Herzogs.
»Folge uns«, sagte einer der beiden mit einem Tonfall, der keinen Widerspruch zuließ.
Warum hätte ich mich auch wehren sollen? Ich hatte damit gerechnet und war bereit, die verlangte Auskunft zu geben. Ein leises Stöhnen entfuhr mir, als ich mich auf die Beine raffte. Das rechte Knie machte noch immer Schwierigkeiten, seit der seldschukische Pfeil mich getroffen hatte. Ein Splitter der Pfeilspitze steckte noch in der Wunde, die sich immer wieder öffnete – und nach dem heutigen Tag bezweifelte ich, dass sie sich jemals wieder schließen würde.
Einer der Posten bot mir den Arm als Stütze, und ich nahm dankbar an. Gemessenen Schrittes führten sie mich zu einem Zelt, das nicht weit entfernt von dem des Herrschers stand, jedoch kleiner und schlichter gehalten war. Das Banner über dem Eingang kennzeichnete es als die Unterkunft des Kaisersohnes Friedrich, der den Titel des Herzogs von Schwaben trug und seinen Vater auf der Pilgerfahrt begleitet hatte – nicht unbedingt freiwillig, aber davon sprach inzwischen niemand mehr. Denn in den verlustreichen Kämpfen hatte sich der junge Herzog mehr als nur hervorgetan, und es galt schon jetzt als sicher, dass er anstelle seines Vaters die Führung des Kreuzfahrerheeres übernehmen würde.
Auch wenn das Zelt weniger prächtig anzusehen war als das des Kaisers, war es dennoch geräumiger als alles, worin gewöhnliche Edelmänner nächtigten. Zwei große Kammern umfasste es, von denen die größere auch als Versammlungsort diente. Dort hinein führte man mich.
Die vier Ritter, die dort bereits warteten, kannte ich. Auch ihre Waffenröcke waren schmutzig, die Gesichtszüge ausgemergelt von der Entbehrung und gezeichnet von den Schrecken des zurückliegenden Tages. Es waren nicht die Höchsten und Nobelsten, die im Heer der Kreuzfahrer ritten, gleichwohl waren sie enge Vertraute des Herzogs: Hermann, Bischof von Münster, der sich im Verlauf der Wallfahrt als kühner Anführer erwiesen hatte; des Kaisers Marschall Heinrich von Kalden sowie die Ritter Gottfried von Wiesenbach und Ludwig von Helfenstein, dem nachgesagt wurde, dass zuweilen himmlische Mächte zu ihm sprachen – wie am Tag vor dem Triumph von Iconion, als er in einer Vision gesehen haben wollte, dass der Heilige Georg selbst dem Heer der Kreuzfahrer vorausritt und es zum Sieg über die Heiden führte.
Die Ereignisse des zu Ende gehenden Tages freilich hatte auch er nicht kommen sehen …
Ich beugte das Haupt, um den hohen Herren Respekt zu erweisen. Ihre ratlosen Gesichter verrieten, dass auch sie nicht wussten, warum sie zu dieser späten Stunde an diesen Ort bestellt worden waren, noch dazu, wo nebenan Andacht für den verstorbenen Kaiser gehalten wurde. Kein Wort wurde gesprochen, und mir kam es vor, als würde die Hitze des Tages, die noch drückend unter dem Zeltdach hing, mit der Stille zu zäher, giftiger Schlacke verschmelzen.
In diesem Moment trat der junge Herzog aus der angrenzenden Kammer. Seine bartlosen Gesichtszüge, die eine gewisse, jedoch nicht frappante Ähnlichkeit zu seinem Vater aufwiesen, wirkten müde und ausgezehrt, in Strähnen hängendes blondes Haar umrahmte sie. In Friedrichs blauen Augen jedoch brannte ein Feuer, das verriet, dass sich die anfängliche Trauer um seinen Vater inzwischen in blanken Zorn verwandelt hatte.
Und Zorn pflegte stets nach einem Schuldigen zu rufen …
»Nehmt Platz, ihr Herren«, wies er die vier Rittern an und deutete auf die Hocker, die in der Kammer aufgestellt waren, auf einem Teppich, wie die Türken ihn woben, ein Beutestück aus vorangegangenen Kämpfen. Die Herren leisteten der Aufforderung Folge, auch Friedrich selbst nahm Platz, während ich weiter stehen blieb. Es kam mir nicht zu, mich ohne Aufforderung zu setzen, auch nicht nach all den Jahren.
Mit loderndem Blick sah Friedrich reihum. Sein Waffenrock ließ die Spuren zurückliegender Kämpfe erkennen; auf der Brust trug er den Löwen der schwäbischen Herzöge, auf der Schulter das Kreuz der Kämpfer Christi, so wie auch ich und alle anderen im Raum es trugen und wie es auch der Kaiser getragen hatte.
»Meine Freunde«, wandte sich Friedrich an die Anwesenden, »ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Dies ist keine offizielle Beratung. Noch nicht einmal eine Anhörung. Kein Schreiber wird anwesend sein, um der Nachwelt davon zu berichten – euch jedoch bitte ich, um der Wahrheit willen mit mir auszuharren.«
»Um der Wahrheit willen?« Hermann von Münster hob die buschigen Brauen. »Verzeih, wenn ich widerspreche, aber solltest du in diesem Augenblick nicht bei deinem toten Vater weilen? Der heiligen Messe beiwohnen, die Bischof Gottfried lesen wird?«
In einer Geste, die mich an seinen Vater erinnerte, schüttelte Friedrich unwillig das Haupt. »Mein Vater hat zu Lebzeiten alles getan, um ins Reich des Allmächtigen aufgenommen zu werden. Er ist ein frommer Mann gewesen, erbarmungslos gegen die Heiden und barmherzig gegen die Armen. Die letzte Entscheidung, die er als unser Herrscher getroffen hat, bestand darin, meinem Bruder Heinrich die Krone zu übertragen und sich selbst nach dem Heiligen Land zu begeben, um dort seine christlichste Pflicht zu erfüllen. Ich werde«, fügte er schnaubend hinzu, »das Beten denen überlassen, die sich darauf verstehen und stattdessen gemeinsam mit euch Gewissheit suchen.«
»Dann stimmt es also?«, erkundigte sich Heinrich von Kalden. Der kaiserliche Marschall war dafür bekannt, keinem Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Die Narbe, die quer über seine rechte Wange verlief, legte davon beredtes Zeugnis ab. »Im Lager machen Gerüchte die Runde …«
Statt zu antworten, winkte Friedrich einen Diener heran. Auf seiner Schulter trug der Mann einen Kriegssattel, den wir alle sofort erkannten: Es war der Sattel, der unseren Herrscher in die Kämpfe und Schlachten der letzten Wochen getragen hatte. Für den Sattel eines Kaisers war er vergleichsweise schmucklos, Friedrich Rotbart war kein Freund großer Verweichlichung gewesen. Die Nähte waren brüchig von der Sonne, das Leder glattgewetzt vom häufigen Benutzen. Von Sätteln wie diesem aus hatte der Kaiser sein Leben lang regiert, hatte er Huldigungen empfangen und Kriege geführt. Bis zuletzt …
Der junge Herzog erhob sich, nahm dem Diener den Sattel ab und hielt ihn so, dass alle das mit einer Borte versehene Gurtzeug sehen konnten. Man brauchte kein Sattler zu sein, um zu erkennen, dass etwas damit nicht stimmte. Der Bauchgurt war offenbar gebrochen, knapp unterhalb der Schnalle. Und die Glätte des Bruchs machte klar, dass jemand nachgeholfen hatte …
»Der Gurt ist angeschnitten worden!«, zischte von Kalden.
»Da musste er ja reißen«, folgerte Gottfried.
»Die dabei waren«, entgegnete Friedrich mit einem Seitenblick auf mich, »berichten übereinstimmend, dass Vater von großer Ungeduld erfüllt war, und wer ihn kannte, dem fällt es nicht schwer, dies zu glauben. Seleukia war bereits in Sichtweite, und er war nicht gewillt, sich von den Wassern eines Flusses aufhalten zu lassen, und wären sie noch so reißend. Also trieb er sein Ross in die Fluten, um dem Heer vorauszureiten – kurz darauf fiel er vom Pferd und ertrank, obwohl wir alle hier wissen, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters ein Meister im Sattel war.«
»Nun kennen wir den Grund für den Sturz«, sagte von Helfenstein. »Jetzt ergibt alles Sinn …«
»Es war feiges Mordwerk«, flüsterte Ludwig.
Wieder trat Schweigen ein. Das hässliche Wort war ausgesprochen, wie beißender Odem hing es in der schwülen Luft. Ein Ritter nach dem anderen nahm das Sattelzeug näher in Augenschein, überzeugte sich, dass der ungeheure Verdacht berechtigt war. Ihre Mienen verfinsterten sich, Fäuste wurden geballt und Racheeide geschworen.
»Die Sarazenen waren es«, meinte Gottfried überzeugt. Er musste es wissen, war er doch einige Zeit ihr Gefangener gewesen und unlängst nur mit Mühe entkommen. »Den Heiden ist nicht zu trauen, das haben sie mehr als einmal bewiesen!«
»Und wie sollten sie an meinen Vater herangekommen sein?«, fragte der junge Herzog dagegen. »Er war zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlbewacht. Nein, meine Freunde.« Friedrich schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, was meinem Vater zum Verhängnis wurde, war nicht nur feiger Mord, sondern auch Verrat.«
»Du meinst … einer von uns ist es gewesen?«, fragte Hermann kopfschüttelnd. »Das mag ich kaum glauben.«
»Ich ebenso wenig. Aber nur einer der Unseren konnte an die Ausrüstung meines Vaters gelangen. Und nur einer der Unseren kannte seinen unbeugsamen Willen und sein Ungestüm.«
»Dann lassen wir das Lager durchsuchen.« Von Kalden rammte die Faust in seine halb geöffnete Hand.
»Wonach?«, konterte Friedrich mit einer Weisheit jenseits seiner Jahre. »Nach Mordlust? Falschheit? Niedertracht?«
»Bei den Stallknechten fangen wir an«, beharrte der Thüringer und erntete dafür allseitiges Nicken. »Spätestens, wenn wir sie einer peinlichen Befragung unterziehen …«
»… werden sie uns alles erzählen, was wir hören wollen, und am Ende werden wir der Wahrheit kein Stück näher sein«, fiel Friedrich ihm kopfschüttelnd ins Wort. »Nein, meine Freunde. Außerdem will ich nicht nur die Hand, die den Mord ausführte – ich will den Kopf, der die feige Tat ersann.«
»Aber wer könnte so etwas tun?«, fragte Bischof Hermann in ehrlicher Bestürzung. »Wer seine unsterbliche Seele mit einer solchen Untat zu ewiger Verdammnis verurteilen?«
Friedrich nickte. Er schien über diese Frage bereits nachgedacht und eine Antwort gefunden zu haben. »Mein Vater hat mich gelehrt, dass es notwendig ist, seine Feinde stets genau zu kennen«, erwiderte er und nickte mir zu. »Tritt vor, Arndt.«
Ich kam der Aufforderung nach, so gut es eben ging. Genau wie der Kaiser, der von uns gegangen war, näherte auch ich mich dem siebzigsten Lebensjahr. Und obwohl es dem Allmächtigen bislang gefallen hatte, mich vor der Schwäche des Alters zu bewahren, hatten die Dürre Kilikiens und der Pfeil des Seldschuken mich auf schmerzhafte Weise gelehrt, dass ich nicht mehr der Jungspund von einst war. Humpelnd trat ich in die Mitte des Zeltes, wobei Gambeson und Kettenhemd schwer an mir zu zerren schienen, aber vielleicht kam es mir auch nur so vor. Alles schien schwerer zu sein, seit Rotbart nicht mehr da war, um meine Last zu teilen. Und ich die seine mit ihm …
»Du meine Güte«, stieß Marschall von Kalden hervor, als würde er mich jetzt erst wirklich wahrnehmen. »Heinrich, warum hast du diesen Greis zu unserem Treffen bestellt? Er vermag ja kaum noch aufrecht zu stehen!«
»Dieser Greis«, stellte der junge Herzog mich ohne Zögern vor, »ist Ritter Arndt von Cappenberg. Möglicherweise ist euch sein Name niemals untergekommen, aber ihr habt ihn oft gesehen, und stets in unmittelbarer Nähe meines Vaters. Arndt ist sein Diener gewesen, sein persönlicher Leibwächter, sein Leben lang – und das mit derartiger Hingabe, dass manche von caesaris opacitas sprechen …«
»… dem Schatten des Kaisers«, übersetzte Helfenstein.
»Herr Arndt hat Vater besser gekannt als irgendjemand sonst. Beide sind gleich alt, am selben Tag geboren, und wie der erwähnte Schatten hat er ihn sein Leben lang begleitet, lautlos und treu und ohne ein Wort der Klage.«
Ich widersprach nicht, senkte jedoch den Blick. Was das Letztgenannte betraf, war ich mir nicht so sicher.
»Er wird uns Auskunft geben«, schloss Friedrich seine Beschreibung meiner Person und Tätigkeit.
»Worüber?«, fragte Hermann.
»Über alles«, entgegnete Friedrich achselzuckend. »Das Gift, das meinen Vater getötet hat, ist in der Vergangenheit gewachsen, und ich verlange alles darüber zu erfahren, von Anfang an. Welche Freunde hat mein Vater gehabt und welche Feinde? Was sind seine Stärken gewesen, was seine Schwächen? Was seine geheimen Leidenschaften? Heute Nacht werden wir seiner auf unsere Art gedenken, indem wir uns an all das erinnern – Herr Arndt wird uns berichten.«
»Kann er denn reden?«, erkundigte sich Gottfried mit herablassendem Augenaufschlag. »Offen gestanden wusste ich nicht einmal, dass er ein Ritter ist – noch kann ich mich entsinnen, ihn jemals sprechen gehört zu haben.«
»Das haben Schatten so an sich«, erwiderte ich.
»Hört, hört.« Ein flüchtiges Lächeln huschte über Bischof Hermanns Züge. »Das verspricht interessant zu werden.«
»Herr Arndt wird uns berichten«, wiederholte Herzog Friedrich und wies mir einen Platz auf dem letzten noch freien Schemel an, »und wir werden seinem Bericht lauschen. Wir werden meinen Vater durch seine Augen sehen und erfahren, wer er gewesen ist – und vielleicht finden wir auf diese Weise auch denjenigen, der ihn feige ermordet hat.«
»Mit Verlaub, hoher Herr«, wandte ich leise ein. »Wollt Ihr das alles wirklich hören? Es könnte Euch missfallen …«
»Ich will die Wahrheit«, stellte Friedrich klar, und sein Blick machte deutlich, dass er keinen Widerspruch dulden würde. »Die reine Wahrheit, verstehst du das?«
»Junger Herr«, entgegnete ich, »in meinem Alter ist die Wahrheit alles, was mir geblieben ist. Ihr werdet nichts anderes von mir zu hören bekommen.«
»Gut.« Friedrich nickte, und seine blauen Augen sahen mich auffordernd an, genauso wie die seines Vaters mich oft angesehen hatten. »So beginne deinen Bericht, Schatten! Sage uns, wer unser Kaiser gewesen ist und wer seine Feinde waren – auf dass wir die Schlange finden, die er an seiner Brust genährt hat bis zum tödlichen Biss …«
Indicium I
ADOLESCENTES
1
Prämonstratenserstift CappenbergHerbst 1129
Trotz all der Jahrzehnte, die verstrichen sind, erinnere ich mich noch genau an meine erste Begegnung mit dem Mann, der später einmal Herzog, danach dann König und schließlich unser aller Kaiser werden sollte.
Meine ersten Lebensjahre hatte ich in der Obhut meiner Mutter verbracht, einer zarten jungen Frau, von der mir kaum mehr als ihr Lächeln in Erinnerung geblieben ist. Sie starb im bitterkalten Winter des Jahres 1127, als die Vorräte eines kargen Herbstes bereits zu Sancta Barbara zur Neige gingen und Eis und Schnee nicht enden wollten. In meinem ganzen Leben habe ich nur einen weiteren Winter erlebt, der ähnlich düster und dunkel war wie dieser. Dass mir der frühe Tod durch Kälte und Hunger erspart blieb, habe ich Mönchen der Prämonstratenser zu verdanken, die mich noch in jenem Winter zu sich nahmen. Damals hielt ich das für glückliche Fügung, für ein Wunder, das der Allmächtige an mir gewirkt hatte – heute weiß ich, dass dabei Mächte ihre Hand im Spiel hatten, von denen ich, der siebenjährige Knabe, noch nichts ahnte.
Die Mönche brachten mich, abgemagert und halb erfroren, wie ich war, in ihr Kloster nach Cappenberg, das erst wenige Jahre zuvor gegründet worden war, durch eine Stiftung der jungen Grafen von Cappenberg, der Herren Gottfried und Otto. Um für die Zerstörung des Gotteshauses von Münster zu sühnen, das durch ihr Zutun in Flammen aufgegangen war, hatten die beiden Brüder nicht nur ihrem weltlichen Besitz entsagt und das Armutsgelübde abgelegt, sondern die Burg und den Besitz ihrer Familie dazu eingesetzt, gleich mehrere Klöster zu gründen. Und Otto von Cappenberg war es auch, der mich unter seine Fittiche nahm. Wann er jenen Plan gefasst hatte, von dem ich ein Teil sein sollte, vermag ich nicht zu beurteilen, doch hätte es keinen Unterscheid gemacht, hätte ich schon früher davon erfahren. Denn fortan brauchte ich keinen Hunger mehr zu leiden. Ich bekam zu essen, bis ich satt war, und Kleidung, die mich wärmte, und war fortan von schützenden Mauern umgeben. Die Mönche waren gut zu mir; auf Bruder Ottos Geheiß lehrten sie mich Lesen und Schreiben und weihten mich ein in die Geheimnisse der Heiligen Schrift. Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich den Trost einer Gemeinschaft, und ich verlebte glückliche Tage … dass all dies einem Zweck diente und einer festen Bestimmung, erfuhr ich erst später.
An einem Frühlingstag des Jahres 1129 rief mich Bruder Otto zu sich. Ich nahm an, dass er sich über den Stand meiner Kenntnisse informieren wollte, indem er mich wie so oft einer kleinen Prüfung unterzog. Aber an diesem Tag war es anders. Am frühen Morgen waren Reiter im Kloster eingetroffen, gepanzerte Kämpen auf riesigen Pferden. Es kam öfter vor, dass Reisende im Kloster Halt machten oder bei Einbruch der Nacht um Obdach ersuchten; doch selbst ich, der halbwüchsige Knabe, konnte sehen, dass diese Leute keine gewöhnlichen Reisenden waren. Ihre Rösser, ihre Kleider, ihre Rüstungen – all das deutete darauf hin, dass hoher Besuch nach Cappenberg gekommen war.
Mein Verdacht bestätigte sich, als ich den Kapitelsaal des Klosters betrat. Nicht nur Bruder Otto fand ich dort, wie zu festlichen Anlässen in Mönchsrobe und Chorhemd gekleidet, sondern auch zwei Ritter, die auf ihren Röcken die Löwen der Staufer trugen – ich konnte nicht ahnen, welche gewichtige Rolle dieses Zeichen noch in meinem Leben spielen würde.
Und auch ein Knabe war dabei.
Es kam nicht oft vor, dass Kinder im Kloster weilten, meist kamen sie nur bis an die Pforte, um dort um Essensreste zu betteln. Aber dieser Junge, das konnte ich auf den ersten Blick erkennen, gehörte nicht zu denen, die es nötig hatten, ihr Auskommen auf Knien zu erflehen.
Sein Wuchs war aufrecht, seine Haltung stolz; sein Körperbau war kräftig, nicht unähnlich dem meinen. Aber anders als ich schien er die Kraft seiner Arme durch regelmäßige Übung zu trainieren. Seine Gesichtszüge waren blass und ebenmäßig. Sein Gebiss, das zu sehen war, weil er lächelte, war weiß und lückenlos. Es war kein hochmütiges Lachen, wie ich es bei anderen Gelegenheiten auf den Gesichtern hochwohlgeborener Sprösslinge gesehen hatte, sondern es lag eine offene, ehrliche Freundlichkeit darin. Obwohl er noch ein Knabe war, wirkte sein Kinn energisch und entschlossen, und etwas lag im Blick seiner blauen Augen, das mich beeindruckte und das ich später noch oft darin gesehen habe, eine unerklärliche Zuversicht, ein tiefes Vertrauen auf die eigene Herkunft, die vom Herrn verliehenen Fähigkeiten und ein günstiges Schicksal – und auch gewisse Ungeduld. Das mit Abstand hervorstechendste Merkmal jedoch war das fast bis zur Schulter reichende rote Haar, das sein Gesicht umrahmte.
Ich war in respektvollem Abstand vor dem Jungen und seinen beiden Begleitern stehen geblieben. Wir mochten im selben Alter sein und womöglich manches gemeinsam haben, und doch trennten uns Welten.
»Arndt«, ergriff Bruder Otto das Wort und winkte mich näher heran, »ich möchte, dass du Friedrich kennenlernst, mein geliebtes Patenkind.«
Ich war sieben Jahre alt und wusste nicht viel von solchen Dingen – im Gegenteil konnte ich froh sein, überhaupt getauft worden zu sein und mich an den Namen zu erinnern, den meine Mutter mir gegeben hatte. Umso mehr beeindruckte mich, dass mein väterlicher Freund und Mentor, dem ich so viel verdankte, sich dazu bekannte, der Taufpate dieses Jungen zu sein, und das mit großem Stolz. Erst viel später erfuhr ich, dass dies auf die Verwandtschaft zwischen den Grafen zu Cappenberg und der Familie dieses Jungen zurückging.
Ich nickte und trat zögernd ein wenig näher. Das Gesicht des Knaben blieb freundlich. Er zog sogar die Nase kraus, und in seinem Augenwinkel zuckte es, als wollte er mich jeden Moment fragen, ob wir Fangen oder Verstecken spielen wollten. Der Blick seiner erwachsenen Begleiter jedoch verfinsterte sich mit jedem Schritt, den ich mich näherte.
»Und Ihr seid sicher, dass …?«, fragte der eine.
»Es ist der Wille des Herrn«, erklärte Bruder Otto überzeugt, während seine Blicke zwischen uns Knaben hin und her glitten. »So unterschiedlich und doch einander gleich«, sagte er. »Im selben Jahr geboren, im selben Mond, womöglich zur selben Stunde – der Herr tut solches nicht von ungefähr. In Rätseln wie diesen pflegt uns der Allmächtige seinen Willen zu offenbaren, davon bin ich überzeugt.«
»Aber ist es wirklich der Wille des Allmächtigen, der spricht?«, wandte der anderer Ritter ein. »Oder vielmehr der Eure, Cappenberg?«
Bislang hatte Bruder Otto seine verschränkten Arme in den weiten Ärmeln des Chorhemdes verborgen. Jetzt breitete er sie in einer schicksalsergebenen Geste aus. »Genau wie mein Bruder habe ich sowohl dem Titel als auch dem Besitz meiner Familie entsagt. Beides hat für mich keine Bedeutung mehr, mein Weg ist der des Herrn. Doch indem ich das Amt des Paten für diesen Knaben übernahm, gelobte ich auch, ihn vor Gefahr zu schützen. Wenn dieser Junge, in dessen Adern Blut von Staufern und Welfen fließt, einst tatsächlich sein wird, was ich gesehen habe und mir inständig erhoffe, so wird er jemanden brauchen, der ihm treu ergeben zur Seite steht.«
»So jemanden hat er bereits«, versicherte der Ritter, die Hand am Griff seines Schwertes. »Bis zum Tod.«
»Daran zweifle ich nicht – doch könnt Ihr nicht immer bei ihm sein. Schon aufgrund Eures Alters werdet Ihr eher vor dem Schöpfer stehen als dieser Knabe. Und wer wird dann an seiner Seite sein, habt Ihr daran je gedacht? Dieser Junge dort wird nicht nur ein specialis custos sein, ein Leibwächter, der ihn beschützt, sondern er wird auch mit ihm zusammen altern und mit Gottes Hilfe stets bei ihm verweilen, treu wie ein Schatten – selbst dann, wenn Ihr und ich längst den Weg alles Sterblichen gegangen sind.«
Ich verstand nicht wirklich, was mein Mentor damit sagen wollte, aber der Ritter widersprach nicht mehr. Und auch der Junge selbst, von dem so geheimnisvoll gesprochen wurde, sagte nichts. Ich wurde wieder fortgeschickt, wobei ich das Gefühl hatte, dass mich die Blicke der fremden Besucher verfolgten, selbst dann noch, als ich den Kapitelsaal längst wieder verlassen hatte. Was weiter gesprochen wurde, weiß ich nicht. Aber ich merkte, wie sich meine Ausbildung veränderte.
Die Mönche waren fortan strenger mit mir, und die Lektionen, die sie mir erteilten, wurden länger. Bruder Otto persönlich unternahm es, mich in den Grundzügen der lateinischen Sprache zu unterweisen, und zum ersten Mal wurde auch körperliche Ertüchtigung in meine Ausbildung einbezogen. All das ließ ich geschehen und stellte keine Fragen. Ich hatte keinen Grund, den Mönchen zu misstrauen, und nahm an, dass all diese Lektionen letztlich dazu dienten, mich zu einem der Ihren zu machen. Die Aussicht gefiel mir, denn ich hatte Freude am Lesen und an Büchern, und meine freie Zeit, obschon spärlich bemessen, verbrachte ich oft im scriptorium, wo ich den Mönchen bei der Abschrift und Vervielfältigung alter Schriften zusah. Ich hegte die Hoffnung, mich ihnen eines Tages anschließen zu können – nicht ahnend, was andere, höhere Mächte für mich beschlossen hatten.
Eines Tages – ich mochte neun oder zehn Winter alt gewesen sein – bat ein Mann im Kloster um Zuflucht. Es war eine stürmische Herbstnacht, und den Geboten von Gastfreundschaft und Nächstenliebe folgend, gewährten die Mönche von Cappenberg ihm Obdach. Wie sich zeigte, war der Fremde ein walisischer Sänger, der sich für das Mahl und das Dach über dem Kopf bedankte, indem er uns etwas vortrug.
Während der Regen auf die Dächer peitschte und der Wind um die Mauern der Klosterburg heulte, saß ich am flackernden Kaminfeuer und lauschte dem Sänger, der in einer schlichten Melodie und mit einfachen Worten die Geschichte eines Königs namens Artus besang, der vor langer Zeit in Britannien herrschte.
Es war keine Kindergeschichte, doch ich habe die Worte, die der Waliser in akzentbeladenem Deutsch vortrug, nie vergessen. Irgendetwas daran berührte mich und drang tief in mein Herz.
Erst Jahre später erkannte ich den Grund dafür.
2
Klosterstift CappenbergMärz 1134
Den rothaarigen Knaben sah ich erst fünf Jahre später wieder. Über die Zeit hatte ich ihn beinahe vergessen, so eifrig hatte ich mich den Studien gewidmet. Inzwischen hatte ich Lesen und Schreiben gelernt und Kenntnisse in der lateinischen Sprache erworben, die es mir ermöglichten, in der Heiligen Schrift zu lesen. Auch lauschte ich den Ausführungen gelehrter Mönche über Glaubensfragen, so wie ich ihnen an den Lippen hing, wenn sie Geschichten aus alter Zeit erzählten, die sie uralten Schriften entnommen hatten: von Kriegen, die vor undenklichen Jahren auf Erden tobten, von wagemutigen Reisen und hölzernen Pferden und von heidnischen Göttern, die auf Erden wirkten, ehe der Glaube an den Allmächtigen sie vertrieb.
Meine körperliche Ertüchtigung war darüber ein wenig zu kurz gekommen, ganz anders als beim roten Friedrich. Als wir einander zum zweiten Mal begegneten, zählten wir beide zwölf Lenze und standen vor dem Eintritt ins Mannesalter. Der junge Staufer jedoch – so hieß, wie ich inzwischen erfahren hatte, sein Adelsgeschlecht – erweckte den Eindruck, mir mindestens zwei Winter voraus zu sein. Er war ungewöhnlich groß für sein Alter, und seine Körperkraft hatte Sinn und Richtung bekommen. Er hatte dieselbe Haltung, die ich oft bei gepanzerten Reitern gesehen hatte, die Haltung eines Kämpfers; das leichte Kettenhemd, das er trug, unterstrich diesen Eindruck noch. Sein Haar trug er nun kurz geschnitten, aber noch immer war es so rot wie die Sonne, wenn sie abends versinkt.
Ob die Ritter, die ihn begleiteten, dieselben waren wie beim letzten Besuch, vermochte ich nicht zu sagen. Doch ihre Blicke waren ähnlich abschätzig, und der Argwohn war ihnen deutlich anzumerken. Bruder Otto setzte sich wie immer für mich ein: Er verteidigte meine Ausbildung, versicherte jedoch, mich nach dem Umgang mit Tinte und Feder künftig auch den mit dem Schwert lehren zu wollen. Für einen Jungen, der nichts als ein friedfertiger Mönch werden und sein Leben in den Dienst von Glauben und Wahrheit stellen wollte, kam das einer Drohung gleich, und ich hoffte, dass daraus so bald nichts werden würde. Doch der einstige Graf zu Cappenberg war nicht Ordensbruder geworden, weil er sich leicht von seinen Zielen abbringen ließ – und so fand ich mich bereits am nächsten Tag auf der Wiese am Fuß der Klosterburg wieder, in der linken Hand ein Schwert aus Holz und in der Rechten einen Schild, mit dem ich mich mehr recht als schlecht gegen die Schläge verteidigte, die der junge Friedrich auf mich niedergehen ließ. An Gegenwehr war erst gar nicht zu denken.
Die Hiebe, die er mir versetzte, flogen mir um die Ohren, als würde um mich ein Gewitter toben. Die lederne Haube, die man mir zum Schutz auf den Kopf gesetzt hatte, leistete mir nur sehr unzureichende Dienste, ich bezog furchtbare Prügel unter den Augen meines Mentors und vor Friedrichs Begleitern, die sich ausschütten wollten vor Lachen. In meinem Inneren wuchs Widerstand, ja sogar Zorn auf den Knaben, der mir dies antat, der mich vor sich hertrieb wie ein verschrecktes Tier und mich demütigte. Ich mochte kein gelernter Kämpfer sein, aber ich hatte von jeher einen starken Arm besessen, dem der Dienst an der Feder zumindest nicht geschadet hatte. Und so umklammerte ich den Griff des Schwertes fester und wartete auf eine Gelegenheit.
Der Schild, den ich zum Schutz immer höher genommen hatte, löste sich bereits in seine Bestandteile auf, während Friedrich auf ihn eindrosch. Doch da der junge Staufer darauf versessen war, mir meine Deckung zu nehmen, ließ er die seine außer Acht. Just in dem Augenblick, als mein Holzschild an meinem Arm zerfiel, holte ich zum Gegenschlag aus.
Oder vielmehr zum Gegentritt.
Mit voller Wucht traf ich das Schienbein meines Gegners, das wegen der noch kühlen Jahreszeit mit Hasenfell umwickelt, aber nicht gepanzert war. Ein überraschter Laut kam aus Friedrichs Kehle, schmerzvoll verdrehte er die Augen. Und statt mir den letzten entscheidenden Streich zu versetzen, nahm er ihn selbst in Empfang.
Da ich nun beide Hände frei hatte, schlug ich auch beidhändig zu. Seinen Schild hatte Friedrich sinken lassen, ob vor Überraschung oder vor Schmerz, und so drang mein Hieb durch und erwischte ihn an der Schläfe. Eine Wunde platzte auf und Blut trat hervor, und der rote Friedrich fiel um wie ein Mehlsack vor dem refectorium.
Im Siegestaumel riss ich den Schwertarm hoch und empfand einen Anflug diebischer Freude – die allerdings nicht lange währte. Denn schon einen Herzschlag später waren Friedrichs Begleiter bei mir. Einer stieß mich zu Boden, und noch ehe ich begriff, was geschah, schwebte seine blanke Klinge vor meiner Kehle, bereit, sie zu durchschneiden.
»Haltet ein, ihr Herren!«
Bruder Otto stürzte atemlos heran. Gemeinsam mit dem anderen Ritter fiel er bei Friedrichs regloser Gestalt nieder und untersuchte ihn mit prüfendem Blick. »Dem jungen Herrn geht es gut, er wird gleich wieder zu sich kommen«, versicherte er. »Arndt hat in fairem Kampf gesiegt.«
»Fair war das wohl kaum!« Der Ritter, der mich bedrohte, bedachte mich mit finsterem Blick. »Was sollte der Sohn einer Stallmagd auch von den Regeln ritterlichen Zweikampfs wissen? Ich habe gleich gesagt, dass es an Irrsinn grenzt, ihm ein Schwert in die Hand zu geben, vom Frevel ganz zu schweigen!«
»Aber ist es nicht das, was Ihr erfahren wolltet?«, fragte Bruder Otto, der sich wieder aufrichtete und näher trat. »Ob Arndt sich im Kampf als ebenbürtig erweisen kann?«
»Ein Hund muss wissen, wer der Herr ist«, knurrte der Ritter. »Wenn sein Frevel ihn schon nicht das Leben kostet, dann doch zumindest die Hand, die den Sohn des Herzogs schlug.«
»Hier ist sie«, sagte der andere Ritter, der mein rechtes Handgelenk bereits ergriffen hatte und es so quetschte, dass ich das Holzschwert wimmernd fallen ließ.
»Nein, Ihr Herren, so hört doch …«, begann Bruder Otto von Neuem und klang beinahe flehend – doch die staufischen Ritter beachteten ihn nicht.
Mein Gesicht war heiß, mein Herz hämmerte, während meine Blicke zwischen den beiden Herren hin und her flogen. »Bitte nicht«, hauchte ich, doch weder konnte ich Nachsicht noch Mitleid in ihren harten, bärtigen Zügen erkennen. Mit panisch geweiteten Augen sah ich, wie der eine seine Klinge hob, um sie herabfahren zu lassen und mein Handgelenk zu durchtrennen. Ich hatte Verstümmelungen wie dieser beigewohnt und die Schreie der Bestraften gehört. Ich stellte mir den Schmerz vor und das Blut, musste daran denken, dass ich niemals wieder eine Feder würde halten können. Ich sah die Wut und die Entschlossenheit in den Augen des Ritters und wusste, dass selbst Bruder Otto die Mittel fehlten, um ihn aufzuhalten …
»Halt!«, rief in diesem Moment eine Stimme, die sehr viel jünger war als die meines Mentors, aber bereits voller Autorität. »Hört sofort auf damit!«
Friedrich war wieder zu sich gekommen. Mit einer Verwünschung auf den Lippen kam er auf die Beine und befühlte seine blutende Stirn. »Meiner Treu! Was ist das gewesen? Ist ein Baum auf mich gefallen?«
»I-ich bin das gewesen, Herr«, gestand ich leise, noch immer im Griff meiner Peiniger.
»Etwa damit?« Er deutete auf das Holzschwert, das herrenlos zu meinen Füßen lag.
Ich nickte.
»Aber er wird dafür bezahlen«, versicherte der Ritter mit der erhobenen Klinge.
»Was denn, Vetter?«, fragte Friedrich, während er grinsend seine blutbesudelte Hand betrachtete. »Bist du schwachen Verstandes, dass du jemanden, der so dreinschlagen kann, seiner Hand berauben willst? Hast du mal daran gedacht, wie nützlich er uns sein könnte, wenn es das nächste Mal gegen die Zähringer geht?«
»Ja … nun, nein«, gab der Ritter ein wenig verlegen zu – nachzudenken schien nicht unbedingt seine Sache zu sein. »Aber Cousin, Ihr müsst eingestehen …«
»Ich muss gar nichts«, stellte Friedrich klar, wischte energisch das Blut aus seinem Gesicht und trat auf mich zu. »Außer mich bei dir bedanken, Arndt«, sagte er.
»Was?«, fragte sein Vetter, und auch ich selbst glaubte, nicht recht zu hören. »Aber …«
»Du hast mir heute eine wichtige Lektion erteilt«, fuhr Friedrich fort, »und ich lerne sie lieber durch ein Schwert aus Holz als durch Zähringer Stahl.« Er nickte mir zu, und da war wieder dieses Lächeln, offen und ehrlich und trotz des furchtbaren Hiebes, den er eingesteckt hatte, voll unerschütterlicher Selbstsicherheit.
Der Cousin des jungen Herzogs zögerte noch einen Augenblick, dann endlich ließ er sein Schwert sinken und trat zurück. »Wenn Ihr es wünscht, Vetter.«
»Ich wünsche es, und mehr als das«, erklärte Friedrich, an Otto gewandt. »Ich verstehe jetzt Euren Gedanken, mein Pate, und die Vision, die Ihr verfolgt.«
»Das freut mich, Junge.« Bruder Otto nickte, wobei er die anderen beiden Staufer mit einem Seitenblick streifte. »Wenn deine Begleiter deine Meinung auch nicht zu teilen scheinen.«
»Das tut nichts zur Sache. Arndt ist Eure Gabe an mich und nicht an meine Vettern«, erwiderte Friedrich, und erneut hatte ich das Gefühl, meinen Ohren nicht recht trauen zu können.
Ich war eine Gabe? Ein Geschenk?
An den jungen Herzog?
»Er soll unterwiesen werden in den Regeln des ritterlichen Kampfes«, fuhr Friedrich fort. »Und ich möchte über seine Fortschritte auf dem Laufenden gehalten werden.«
»So soll es geschehen«, bestätigte mein Mentor und lächelte in väterlichem Wohlwollen. Meine Brust straffte sich, denn für einen Augenblick glaubte ich, dass sich dieser väterliche Stolz auf mich bezog – doch schon im nächsten Moment wurde mir klar, dass es sein Patensohn war, den der Cappenberger so ansah und mit dem er ein Geheimnis zu teilen schien. Ein Geheimnis, das mich betraf, meine Zukunft und das, was aus mir werden sollte.
Ich war plötzlich wütend und ertappte mich dabei, dass ich Eifersucht empfand, den Neid eines Zwölfjährigen, der seinen Vater niemals kennengelernt hatte und sich nach Anerkennung sehnte. Doch schon im nächsten Moment wurde mir klar, dass mir dieses Gefühl nicht zukam. Und dass es äußerst gefährlich sein würde, ihm nachzugeben, also verbarg ich es besser tief in meinem Inneren.
»Mein lieber Friedrich«, sagte Bruder Otto und legte seine Hände auf die breiten Schultern des jungen Staufers, der ihm an Körpergröße fast ebenbürtig war. »Die Wege des Herrn sind unergründlich, doch mir ist offenbar geworden, dass er Großes mit dir vorhat – deshalb hat er dir nicht nur Sinn und Verstand gegeben, sondern auch ein großes Herz, das aus deinen Worten und Taten spricht. Arndt wird es dir mit unverbrüchlicher Treue danken und dir ergeben dienen.«
»Was?«, platzte es aus mir heraus – schließlich war es das erste Mal, dass ich von solchen Dingen hörte. »Aber Herr«, wandte ich ein, »Ihr wisst, was ich mir erhoffe, mehr als alles andere! Ich möchte Mönch werden wie Ihr und mich dem Studium des Glaubens widmen, des Wissens und der Wahrheit …«
»Da hört Ihr es«, wandte Friedrichs Vetter spöttisch ein. »Dieser undankbare Bengel begreift noch nicht einmal, was ihm zuteilwerden soll.«
»Er ist noch zu jung, um zu wissen, was er will und was nicht«, entgegnete Bruder Otto mit gütigem Lächeln. Auch wenn er es mir gegenüber nie erwähnt hatte, schien er diesen Plan schon seit langer Zeit zu verfolgen – war es womöglich sogar der Grund dafür, dass mich die Mönche von Cappenberg zu sich genommen hatten?
»Er wird mehr als Friedrichs Diener sein und auch mehr als ein bloßer Wächter. Er wird ihn verstehen wie niemand sonst und ihm nicht nur mit dem Schwertarm zur Seite stehen, sondern auch mit Rat, wann immer er es wünscht, so lautlos und selbstverständlich wie ein Schatten.«
»Aber …«, hauchte ich noch einmal, beinahe flehend.
»Ich weiß, dass es nicht das ist, was du dir erhofft hast, mein guter Arndt«, wandte sich Bruder Otto mir zu, und sein Blick schien zu sagen, dass er sehr genau wusste, wovon er sprach, »aber dir ist dies Schicksal bestimmt so wie mir das meine, und wenn der Herr nach uns ruft, so können wir uns diesem Ruf nicht verweigern. Auch mein Bruder und ich konnten es nicht, trotz aller Anfeindungen, die wir dafür in Kauf nehmen mussten, trotz des Zorns, der uns aus unserer eigenen Familie entgegenschlug.« Er hob den Arm und deutete auf seinen Patensohn. »Auch Friedrich kann sich seiner Bestimmung nicht entziehen«, erklärte er dazu. »Es wird der Tag kommen, da man ihm große Macht und Verantwortung übertragen wird … nicht etwa, weil Menschen es so verfügen, sondern weil der Allmächtige selbst es so will. Ich werde dann womöglich nicht mehr da sein, um ihn zu unterstützen, aber du, mein guter Arndt, wirst es für mich tun, selbst dann noch, wenn ich längst aus dieser Welt geschieden bin. So ist der Wille Gottes – und wer sind wir, uns diesem Willen zu widersetzen?«
3
CappenbergAnfang Mai 1138
Jener Tag änderte alles.
Zwar blieb ich in Cappenberg, während Friedrich das Kloster schon am nächsten Morgen wieder verließ und es über die nächsten Jahre nur gelegentlich besuchte; jedoch führte ich fortan nicht mehr das Dasein eines Novizen, an dem ich so großen Gefallen gefunden hatte, sondern bekam zu meinen Pflichten als Laienbruder nun auch noch jene als Schildknappe verordnet. Der Tag war fortan dem Erlernen des Kriegshandwerks gewidmet, während die Studien in Literatur, in Geschichte und Philosophie nunmehr nachts und bei Kerzenschein erfolgten, bis meine Augen vom Lesen bei spärlichem Licht schmerzten.
Ich nehme an, dass Bruder Otto sein Versprechen erfüllte und dem jungen Herzog von meinen Fortschritten berichtete – und es gab Gutes zu berichten. Denn obwohl ich am Umgang mit Waffen wenig Gefallen fand, musste ich zu meinem Verdruss feststellen, dass ich dafür mehr Begabung besaß als für Feder und Wissenschaft. Die Waffenmeister, die ins Kloster kamen, um mich im Umgang mit Pfeil und Bogen zu trainieren sowie im Führen von Schwert und Lanze, zeigten sich überaus zufrieden; mit Leibesübungen kräftigten sie meine Beine, damit ich einen festen Stand hatte, und meine Arme, damit ich auch nach längerem Kampf nicht ermüdete; sie lehrten mich den Waffenstreit zu Fuß ebenso wie den zu Pferd, der eigentlich dem höheren Stand vorbehalten war. Doch der Zweck, dem meine Ausbildung diente, schien dies zu rechtfertigen.
Ich tat, was ich konnte, um Bruder Otto zufriedenzustellen und seine Anerkennung zu gewinnen, und so beflissen, wie ich mich zuvor dem Erlernen von lateinischer Schrift und Sprache gewidmet hatte, widmete ich mich jetzt den ritterlichen Tugenden – auch wenn ich insgeheim noch immer hoffte, dass mein Gönner irgendwann von seinem Plan ablassen und mir doch gestatten würde, als einfacher Klosterbruder zu leben.
Vergeblich, wie sich zeigte.
Von Friedrich hörte ich in diesen vier Jahren, die von Unruhen im Reich gekennzeichnet waren, nur selten; sein Onkel Konrad, der nach dem Tod Kaiser Heinrichs Ansprüche auf die Königskrone erhoben hatte, erhielt diese auch aufrecht, als die Reichsfürsten Lothar von Sachsen zum Nachfolger Heinrichs erwählten. Die Folge waren blutige Fehden, die sich Staufer und die mit Lothar verbündeten Adelshäuser von Welfen und Zähringern lieferten. Der zum Gegenkönig ausgerufene Konrad war schließlich zum Verzicht auf die Krone gezwungen worden, doch Lothars Tod im vergangenen Jahr hatte die Machtverhältnisse erneut grundlegend verändert. Und indem sie ihren noch immer vorhandenen Einfluss im Reich geltend machten, war es den Staufern gelungen, Konrad bei der Fürstenversammlung zu Koblenz zum neuen König wählen und in Aachen krönen zu lassen.
Erst im vorletzten Monat war dies geschehen, und der Groll darüber, dass er in der Herrschernachfolge übergangen worden war, saß tief beim mächtigen Welfenherzog Heinrich, der nicht von ungefähr den Beinamen »der Stolze« trug. Spätestens nach dem Reichstag zu Bamberg, den Konrad zum Pfingstfest einberufen hatte, um sich der Anerkennung durch die Mächtigen des Reiches zu versichern, würden neue Auseinandersetzungen aufflammen und das Reich in blutige Fehden stürzen.
Die Wochen zuvor, die uns wie die Ruhe vor dem drohenden Sturm erschienen, nutzte Friedrich zu einem weiteren Besuch in Cappenberg, diesmal für mehrere Tage; und wie ich zu meiner Verblüffung feststellen musste, war er nicht nur ins Klosterstift gekommen, um seinen Taufpaten zu besuchen und sich nach dem Stand meiner Ausbildung zu erkundigen; sondern auch noch aus einem anderen Grund, den er mir auf seine bisweilen schelmische Art offenbarte.
»Du bist zu beneiden, Arndt«, stellte er fest, als wir vom Übungsplatz in unsere Unterkünfte zurückkehrten – ich in die bescheidene Enge meiner Zelle, er in das gemütlich eingerichtete Gästequartier, das für ihn und seinen Vater, den Schwabenherzog Friedrich, hergerichtet worden war. Stundenlang hatten wir aufeinander eingeschlagen und den Kampf Mann gegen Mann geübt, und anders als damals war ich nun tatsächlich in der Lage, den Attacken des jungen Herzogs Einhalt zu gebieten, ohne ihm, auf höchst unritterliche Weise vor das Schienbein treten zu müssen; da warmer Mairegen niederging, waren wir beide durchnässt bis auf die Haut und sahen aus wie zwei Frischlinge, die sich im Schlamm gewälzt hatten.
»Zu beneiden? Warum?«, fragte ich. Wenn wir unter uns waren und niemand in der Nähe, der uns belauschte, so hatte ich die Scheu weitgehend abgelegt und unterhielt mich mit ihm, wie ich es auch mit anderen Gleichaltrigen getan hätte. Friedrich selbst hatte mich dazu ermutigt.
»Nun mach nicht so ein Schafsgesicht«, meinte er und grinste breit. »Du weißt doch genau, was ich meine – oder willst du mir erzählen, du hättest dich noch nie hinübergeschlichen?«
»Hinüber?« Ich wusste wirklich nicht, wovon er sprach.
»Dummkopf, zu den Weibern natürlich!«
Jetzt wurde es mir klar. Wie alle Prämonstratenser-Klöster zeichnete sich auch das Klosterstift zu Cappenberg dadurch aus, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Männerkonvents ein Frauenhaus befand, in dem fromme Christinnen nach den Ordensregeln lebten. Da ich von klein auf unter Mönchen gelebt hatte, hatte ich dieser Tatsache nie größere Bedeutung beigemessen, zumal ich mich ja selbst mit dem Gedanken getragen hatte, die Gelübde abzulegen (und es insgeheim noch immer tat). Friedrichs wölfisches Lächeln allerdings machte mir klar, dass er sich seine eigenen Gedanken zum Thema gemacht hatte – und dass sie nichts mit Frömmigkeit oder gar Keuschheit zu tun hatten …
»Die Nonnen von Cappenberg haben ihr Leben in den Dienst Jesu Christi gestellt«, erwiderte ich schnell und lauter, als ich beabsichtigt hatte. »Sie stehen unter dem Schutz des Allmächtigen und der heiligen Kirche, ich würde niemals …«
»Krieg dich wieder ein«, feixte Friedrich und hob dabei die Hände wie jemand, der ein in Unruhe geratenes Pferd beschwichtigt. »Ich habe gewiss nicht vor, die heiligen Frauen in ihrem Seelenfrieden zu stören«, versicherte er. Er war ein gut aussehender Bursche, selbst jetzt, da er vor Dreck starrte. Seine Schultern waren noch breiter geworden, und seine Postur wirkte noch eindrucksvoller; um sein Kinn spross jetzt ein Bart, der ebenso rot war wie das Haar auf seinem Kopf, und seine Augen blitzten vor Tatendrang. »Aber ich weiß auch, dass es dort auf der anderen Seite Laienschwestern gibt, die von ihren gestrengen Vätern dorthin entsandt wurden, um wichtige Tugenden des Lebens zu erlernen. Und dabei könnten wir beide ihnen heute Nacht behilflich sein.«
»Heute Nacht?« Vor Schreck blieb ich stehen und ließ die beiden Übungsschilde fallen, die ich getragen hatte. Klappernd landeten sie auf dem Boden.
Friedrich griff an den ledernen Beutel an seinem Gürtel und zog mit noch breiterem Grinsen einen eisernen Schlüssel daraus hervor. »Erkennst du den?«
Und ob ich ihn erkannte!
Es war der Schlüssel zu dem alten Kellergang, der den Männerkonvent und das Niederkloster der Frauen unterhalb der Burg miteinander verband, ursprünglich angelegt, um im Fall eines Überfalls die Flucht zur jeweils anderen Seite zu ermöglichen, sowie zur Vorratshaltung, aber gewiss nicht für die Zwecke, denen der junge Friedrich sie zuführen wollte …
»Woher hast du den?«, fragte ich verblüfft.
»Das brauchst du nicht zu wissen. Wichtig ist nur, dass du dich um Mitternacht im Keller einfindest, sodass wir beide einen Ausflug auf die andere Seite unternehmen können.«
»Wir beide?« Mir wurde heiß und kalt. In Gedanken begann ich bereits zu zählen, wie viele Verbote ich mit diesem Frevel wohl übertreten würde … »Das geht nicht, Herr«, widersprach ich und wurde plötzlich wieder förmlich.
»Warum nicht?«
»Weil es sich nicht geziemt, deshalb!«
Friedrich schnaubte nur. »Hat Otto dir je erzählt, was seinem Bruder Gottfried widerfuhr, als er sich für das klösterliche Leben entschied?«
»Nein«, musste ich zugeben.
»Gottfried war zu diesem Zeitpunkt mit Jutta verheiratet, der Tochter Graf Friedrichs von Arnsberg. Durch Heiratspolitik hatte der alte Graf gehofft, Macht und Besitz für seine Familie zu mehren und auf Generationen hinaus zu sichern – all diese hochtrabenden Pläne lösten sich in Wohlgefallen auf, als sich Gottfried entschied, den weltlichen Dingen zu entsagen und den Klostertod zu sterben. Und das, zumal auch Jutta sich auf Gottfrieds Drängen hin entschied, den Schleier zu nehmen und dem Frauenkonvent beizutreten. Nicht nur dass ihr Vater Gottfried mit wüsten Schmähungen überzog und ihn vor Gericht zerrte – er versuchte auch, Jutta gewaltsam aus den Klostermauern zu befreien.«
»Das … wusste ich nicht«, gab ich zu. Die Mönche hatten zwar hin und wieder etwas in dieser Richtung angedeutet. So unverblümt berichtet hatten sie es mir allerdings nicht.
»Bis zu Gottfrieds Tod lebte Jutta im Kloster. Die Ordensgelübde hat sie allerdings nie abgelegt und später einen anderen Mann geheiratet«, fuhr Friedrich fort, geschwätzig wie eine Magd am Brunnen. »Zugegeben, das ist eine Weile her. Aber nun stelle dir vor, wie viele Töchter aus gutem Hause dort noch in Klostermauern leben, von Gelübden gänzlich unberührt und von Langeweile gepeinigt!«
Ich gestehe, dass ich der Vorstellung für einen Moment nachgab – und einigermaßen über die Reaktion meiner Leibesmitte erschrak.
»Das … das ist keine gute Idee Herr … Friedrich«, würgte ich mühsam hervor.
»Wie auch immer – mein herzensguter Pate hat angeordnet, dass du mir immer zu folgen hast«, konterte dieser, »du musst also mitkommen, ob es dir gefällt oder nicht.«
Mein Mund klappte auf und zu wie bei einem Fisch, der auf dem Trockenen lag. Dann kam mir ein rettender Gedanke. »Außerdem nutzt der Schlüssel der einen Seite nichts«, merkte ich an, »wenn man nicht auch den der anderen …«
Friedrichs Grinsen ließ mich verstummen.
»Wie es der Zufall will, weiß ich aus zuverlässiger Quelle von zwei jungen Damen, die just das Gegenstück zu diesem Schlüssel hier besitzen und uns um Mitternacht auf der anderen Seite erwarten werden. Bereitwillig, wenn du verstehst.«
Ich verstand durchaus – aber mir war nicht klar, ob ich darüber in helle Verzückung oder in schiere Panik ausbrechen sollte. Friedrich sah meine Verlegenheit und deutete sie richtig.
»Einen Moment«, sagte er. »Soll das etwa bedeuten, dass du noch nie …?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Noch nicht einmal mit einer Stallmagd?«
»Dies ist ein Kloster, Herr.«
»Dann wird es höchste Zeit«, urteilte Friedrich unbarmherzig. »Bei Sonnenuntergang am Eingang zum Keller. Wasch dich und sorg dafür, dass du nicht stinkst wie ein Bulle. Und flechte einen Blumenkranz.«
»Wozu?«, fragte ich mit großen Augen.
»Wozu wohl?«, fragte Friedrich dagegen, während er die Tür zu seiner Kammer aufstieß und grinsend darin verschwand. »Um Maienzauber zu treiben natürlich!«
Ich weiß nicht, woran genau es lag – ob es die Ehrfurcht vor meinem jungen Herrn war oder ob seine Worte eine Begierde in mir geweckt hatten, die sich nicht mehr einfach leugnen ließ, jedenfalls fand ich mich um Mitternacht tatsächlich an der verabredeten Stelle ein. Ich hatte mich gewaschen und ein frisches Hemd angezogen und bildete mir ein, auch ordentlich zu riechen. Und in aller Hast hatte ich sogar einen Kranz aus Margeriten geflochten, auch wenn ich mir nicht recht erklären konnte, wofür er gut sein sollte.
Friedrich erwartete mich bereits.
Auch er hatte sich zurechtgemacht, auf den Blumenkranz allerdings verzichtet. Er war wohl der Ansicht, dass er keines Maienzaubers bedurfte, um beim weiblichen Geschlecht zu erreichen, wonach ihm der Sinn stand. Dafür hatte er zwei brennende Kerzen aus Talg dabei, von denen er eine an mich weiterreichte. Dann schlichen wir lautlos die Treppe zum Keller hinab. Das Herz schlug mir dabei bis zum Hals, und ein Teil von mir sehnte sich zurück in die Abgeschiedenheit meiner Zelle – während ein anderer nirgendwo anders sein wollte als hier und jetzt, bei meinem jungen Herzog, dessen Lebenslust geradezu ansteckend war. Wann immer sich bislang körperliches Verlangen bei mir geregt hatte, hatte ich durch Gebet und Askese versucht, mich auf andere Gedanken zu bringen, und bisher war mir das leidlich gelungen. Nun jedoch nicht mehr – und niemand anders als der rote Friedrich trug daran Schuld.
Wir bewegten uns so lautlos wie möglich, schließlich konnte es sein, dass der Cellerar oder einer seiner Helfer sich noch zu einer späten Bestandsaufnahme in den unteren Gewölben aufhielt. Doch wie es später noch so oft der Fall sein sollte, war Friedrich das Glück hold. Unbehelligt erreichten wir die Tür zum Tunnel, und er schloss sie auf. Was folgte, war der Gang durch einen ebenso kalten wie feuchten Stollen, der steil bergab durch Gestein und Erdreich getrieben worden war, kaum hoch genug, dass man aufrecht darin stehen konnte. Scharen von Ratten tummelten sich darin, die Reißaus nahmen, sobald der Lichtschein der Kerzen sie berührte.
Endlich erreichten wir die andere Seite. Friedrich klopfte an, und wir warteten mit pochenden Herzen. Im nächsten Moment wurde das Schloss von der anderen Seite geöffnet.
Die Tür schwang auf, und wir schlüpften durch den sich weitenden Spalt, lautlos und geschmeidig wie Füchse in einem Hühnerstall. Dunkelheit umgab uns, und ich leuchtete mit der Kerze umher, bis ihr Lichtschein eine Gestalt erfasste.
Ich war wie vom Donner gerührt.
Sie war älter als ich, wohl schon um die zwanzig Lenze, und in der Blüte ihrer jugendlichen Schönheit. Kastanienbraunes, zu dicken Strängen geflochtenes Haar umrahmte ihr zartes Gesicht, aus dem mich ein rehbraunes Augenpaar freundlich ansah. Sie lächelte, und ihr Mund war ein wenig geöffnet, sodass kleine weiße Zähne blitzten. Nie zuvor hatte ich etwas so Anmutiges gesehen. Wie eine Erscheinung stand sie vor mir in ihrem weißen Gewand, unter dem sich ein bebender Busen abzeichnete. Mein Herz schlug schneller, und meine Begierde erwachte unter ihrem einladenden Blick. Ich murmelte etwas Unverständliches und hielt ihr den Kranz hin, den ich geflochten hatte, um ihre Stirn damit zu krönen …



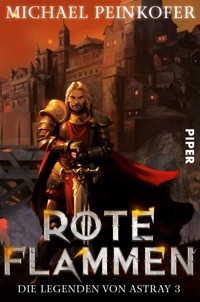
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)