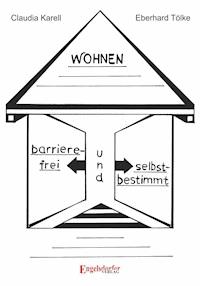
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer von Ihnen möchte nicht gern sein Leben barrierefrei und selbstbestimmt gestalten - möglicherweise trotz eines Handicaps? Ja, das ist möglich. Dieser Ratgeber enthält Anregungen und Tipps, wie Sie die Hindernisse in Ihrem persönlichen Alltag, die Sie noch am selbstbestimmten Leben (be-)hindern, aus dem Weg schaffen können. Holen Sie sich Hilfe durch Fachkräfte, wie Architekten, Pflegekräfte, Behörden und Vermieter. Das Einholen von weiteren Informationen zum barrierefreien Bauen wird sich für Sie lohnen! Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, besteht die zukünftige Aufgabe der Fachkräfte darin, Wohnungen so auszubauen, umzubauen oder neu zu bauen, dass diese für alle Menschen, uneingeschränkt barrierefrei zugänglich und nutzbar sind, egal ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Von grundlegender Bedeutung ist dabei der im Buch beschriebene gelingende Umgang mit Menschen mit Handicap, als Voraussetzung für ein gegenseitiges Geben und Nehmen zwischen Vermieter und (zukünftigem) Mieter. Denn barrierefreies Bauen als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Wohnen, führt zur positiven Lebenseinstellung und Lebensqualität jedes Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Unser Anliegen ist das Aufzeigen von baulichen Besonderheiten in Bezug auf verschiedene Erkrankungen und Handicapgruppen. Denn der Weg ist das Ziel...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Karell & Eberhard Tölke
Barrierefrei und selbstbestimmt Wohnen
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2016
Liste der Krankheiten/Personengruppen
Nummer
Krankheit
1
Alzheimer-Krankheit
2
Arm-(Hand)-Erkrankungen
3
Bein-Erkrankungen (Einsatz von Gehhilfen)
4
Blasen-Inkontinenz
5
Blindheit
6
Darm-Inkontinenz
7
Demenz
8
Gehörlosigkeit
9
Gleichgewichtsstörungen
10
Hausstaubmilben-Allergien
11
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzschrittmacher)
12
Hörsehbehinderung
13
Hüft- und Knie-Erkrankungen
14
Kinder
15
Kleinwuchs
16
Menschen mit Großwuchs
17
Multiple Sklerose
18
Pollen-Allergie
19
Progressive Muskeldystrophie
20
Rollatornutzer
21
Rollstuhlnutzer
22
(Schimmelpilz)-Allergien
23
Schlaganfall
24
Schwerhörigkeit
25
Sehbehinderung
26
Taubblindheit
27
Wirbelsäulen-Erkrankungen
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Liste der Krankheiten / Personengruppen
Impressum
Vorwort
1.Barrierefreiheit
1.1Übernahme des Begriffs „Barrierefreiheit“ durch die Bundesländer – Beispiel Thüringen
1.2Kernpunkte der Barrierefreiheit
1.3„10 Gebote der Barrierefreiheit“
1.4„Post-Fall-Syndrom“ als Ursache mangelhafter Barrierefreiheit
1.4.1Sturzursachen
1.4.2Personengruppen mit besonderem Sturzrisiko
1.4.3Maßnahmen zur Reduzierung von Stürzen
1.5Was bringt die Barrierefreiheit der Gesellschaft?
2.Behinderung
3.Mobilität – Definition
3.1Physisch-räumliche Mobilität
3.1.1Wer ist in seiner „physisch-räumlichen“ Mobilität eingeschränkt?
3.1.2Sind blinde Menschen in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt?
4. Wohnen
4.1 Selbstbestimmt Wohnen
4.2 Nachhaltiges Wohnen
4.3 Wohnung
4.3.1 Entwicklungsskizze des Wohnens
4.3.2 Wohnquartier
4.3.3 Hausrecht
4.3.4 Funktionen der Wohnung
4.3.5 Wohnbauformen
4.3.6 Wohnungseinteilung nach ihrem Alter
4.3.7 Wohnungsgröße
4.3.8 Kriterien für die Wahl einer Wohnung
5. Baukultur – die Verantwortung der Gesellschaft für die gebaute Umwelt
6. Barrierefreies Bauen
6.1 Gibt es einen Unterschied zwischen behindertengerechtem und barrierefreiem Bauen?
6.2 Spezifische Bauweisen oder barrierefreies Bauen?
6.3 Planungsebenen des barrierefreien Bauens
6.4 Behinderungsbedingter Mehrbedarf (BMB)
6.5 Unverhältnismäßiger Mehraufwand
7. Gesetzliche und normative Vorgaben zum barrierefreien Wohnen
7.1 Gesetzliche Bestimmungen zu den Belangen von Menschen mit Behinderung
7.1.1 Grundgesetz – GG
7.1.2 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze
7.1.3 Gleichstellungsgesetze der Bundesländer für Menschen mit Behinderung
7.1.4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
7.1.5 Sozialgesetzbuch IX
7.1.6 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13.12.2006 (Behindertenrechtskonvention – BRK) und sein Fakultativprotokoll vom 13.12.2006
7.1.7 Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung Behindertenrechtskonvention
7.1.8 Aktions- und Maßnahmepläne zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in den Bundesländern
7.2 Vorgaben und gesetzliche Bestimmungen zum Baurecht
7.2.1 Musterbauordnung
7.2.2 Landesbauordnungen
7.2.3 Musterliste der Technischen Baubestimmungen (MLTB)
7.2.4 Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB) der Bundesländer
7.3 Normen
7.3.1 Zielstellung der Normung
7.3.2 Wissenswertes über Normen
7.3.3 Aufbau einer Norm
7.3.4 Akronym – Kurzzeichen
7.3.5 Lesebeispiel für eine Norm
7.3.6 Normungs-Organisationen
7.3.7 Übersicht – Normen zum barrierefreien Bauen und Gestalten
8. Behinderungen, Erkrankungen und Personengruppen mit Wohnraumanpassungsbedarf
8.1 Was versteht man unter der Beratung zur barrierefreien Wohnraumanpassung?
8.1.1 Ziele der barrierefreien Wohnraumanpassung
8.1.2 Zu beratende Personengruppen und Beratungsgegenstände
8.2 Personengruppen mit Beeinträchtigungen
8.2.1 Schutzziele – allgemein
8.2.2 Allergien
8.2.3 Alterserkrankungen–Krankheiten im Alter
8.2.4 Alzheimer Krankheit
8.2.5 Arm-Erkrankungen
8.2.6 Bein-Erkrankungen
8.2.7 Blasen-Inkontinenz
8.2.8 Blindheit
8.2.9 Darm-Inkontinenz
8.2.10 Demenz
8.2.11 Gehörlosigkeit
8.2.12 Gleichgewichtsstörungen
8.2.13 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
8.2.14 Hüft- und Knie-Erkrankungen
8.2.15 Kleinwuchs – Mikrosomie
8.2.16 Multiple Sklerose (MS)
8.2.17 Progressive Muskeldystrophie (MD)
8.2.18 Schlaganfall
8.2.19 Schwerhörigkeit
8.2.20 Sehbehinderung
8.2.21 Taubblindheit / Hörsehbehinderung
8.2.22 Wirbelsäulen-Erkrankungen
9. Wohnraumanpassung und -ausstattung
9.1 Äußere Erschließung der Wohngebäude
9.1.1 Gehwege, Verkehrsflächen
9.1.2 Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderung
9.1.3 Treppen im Außenbereich
9.1.4 Rettungstreppen im Außenbereich
9.1.5 Müllbehälter und -plätze
9.2 Zu- und Eingangsbereiche der Wohngebäude
9.2.1 Visuelle und taktile Kennzeichnung
9.2.2 Eingangstüren
9.2.3 Bewegungsflächen
9.2.4 Rampen
9.2.5 Personenaufzüge zur äußeren Wohngebäudeerschließung
9.3 Innere Wohngebäudeerschließung
9.3.1 Informationsgestaltung zur Wohngebäudenutzung
9.3.2 Flure und Verkehrsflächen
9.3.3 Gemeinschaftsräume
9.3.4 Türen
9.3.5 Fenster
9.3.6 Treppen
9.3.7 Rampen
9.3.8 Personenaufzüge
9.3.9. Bewegungsflächen
9.3.10 Rollstuhlabstellplätze
9.3.11 Bauteile
9.4 Wohnung – Räume und Erschließung
9.4.1 Raumstruktur (Grundrisse)
9.4.2 Raumakustik
9.4.3 Raumklima
9.4.4 Unfall- und Verletzungsprävention
9.4.5 Eingangstür
9.4.6 Türen innerhalb der Wohnungen
9.4.7 Fenster
9.4.8 Treppen
9.5 Flure
9.6 Küchen
9.7 Schlafräume
9.8 Sanitärräume
9.9 Wohnräume
9.10 Balkon, Loggia, Terrasse
9.11 Abstellräume
9.12 Kellerräume
9.13 Ausstattung von Wohngebäuden und Wohnungen
9.13.1 Elektrosmog
9.13.2 AAL-Systeme
9.13.3 Bedienelemente
9.13.4 Beleuchtung
9.13.5 Bodenbeläge
9.13.6 Brand- und Rauchmelder
9.13.7 Briefkästen
9.13.8 Fernbedienungen
9.13.9 Feuerlöscher
9.13.10 Gardinen
9.13.11 Gegensprechanlagen (Wechselsprechanlagen)
9.13.12 Geschirr und Küchenhilfen
9.13.13 Handläufe
9.13.14 Hausnotrufsysteme
9.13.15 Hausnummern
9.13.16 Informationsaushänge
9.13.17 Kleiderhaken und – stangen
9.13.18 Klimaanlagen
9.13.19 Klingelanlagen
9.13.20 Lichtschalter
9.13.21 Möbel
9.13.22 Pflanzen
9.13.23 Schilder
9.13.24 Schriften
9.13.25 Stützgriffe
9.13.26 Telefon (Festnetz)
9.13.27 Türöffneranlagen
9.13.28 Türschwellen
9.13.29 Waschmaschine / Trockner
10. Umgangsformen
10.1 Umgang mit Sozialleistungsträgern
10.2 Umgang mit behinderten Menschen
10.2.1 Umgang mit autistischen Menschen
10.2.2 Umgang mit geistig behinderten Menschen (kognitive Beeinträchtigung)
10.2.3 Umgang mit schwerhörigen bzw. gehörlosen Menschen
10.2.4 Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen
10.2.5 Umgang mit hörsehbehinderten und taubblinden Menschen
11. Kommunikation
11.1 Leichte Sprache?
11.2 Lormen
11.3 Gebärdensprachen
11.4 Haptische Kommunikation
11.5 Daktylieren
11.6 Blindenschrift
11.7 Profilschrift
11.8 Relief
11.9 Basale Kommunikation
11.10 Unterstützte Kommunikation (UK)
Nachwort
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Begriffserklärungen
Literaturhinweise
Internetseitenangaben
DIN Normen
Fußnoten
Vorwort
Bei näherer Betrachtung stellen die Begriffe „barrierefrei“ und „selbstbestimmt“ – jeder für sich – zwei recht komplexe Themen dar.
Während „selbstbestimmt“ das persönliche Handeln eines Menschen zum Ausdruck bringt, beschreibt „barrierefrei“ das Verhältnis zwischen der Umweltgestaltung und den Menschen. Dabei schließen sie sich gegenseitig ein und sind untrennbar miteinander verbunden. Beide Faktoren entscheiden, unabhängig davon, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht, maßgeblich über unsere Lebensqualität.
Ein selbstbestimmtes Leben bringt für jeden Menschen das Recht zum Ausdruck, persönlich, ohne Einschränkungen, Bevormundungen oder Mobbing, in vollem Umfang über seine eigene Lebensführung selbst entscheiden zu können. Jeder Mensch hat das Recht seinen Wohnort selbst zu wählen. Er bestimmt, wie er wohnen möchte und mit wem er seine Wohnung teilt. Dies schließt für Menschen mit Handicap die Nutzung von Hilfsmitteln und Assistenzen ein.
Die „Barrierefreiheit“ ist mehr als nur ein modernes Schlagwort, was sich in aller Munde befindet. Viele Mitbürger glauben zu wissen, was Barrierefreiheit ist, wie sie aussieht und was getan werden muss um diese zu schaffen. Sie handeln im guten Glauben. Dies macht es dem Außenstehenden sehr schwierig, sich einen Überblick zu Angeboten und Dienstleistungen zu verschaffen, die den tatsächlichen Ansprüchen der gesetzlich definierten Barrierefreiheit gerecht werden. Auf eine gründliche Recherche sollte nicht verzichtet werden.
Die Barrierefreiheit und die Selbstbestimmung erstrecken sich auf alle Lebensbereiche. Kernpunkt bildet dabei jedoch das Wohnen als zentraler Ort für ein selbstbestimmtes Leben. Dabei stellen sie zugleich hohe Ansprüche an die Gesellschaft und an jeden Einzelnen. Alle Beteiligten müssen die Bereitschaft zu schmerzhaften Kompromissen aufbringen. Die zu tragende Last darf nicht nur auf den Schultern von Menschen mit Handicap ruhen. Hier sollte bedacht werden, dass die von ihnen geforderte Barrierefreiheit kein Luxus darstellt, sondern eine elementare Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben ist.
Dieser Leitfaden möchte sich tiefer mit diesen Themenkomplexen auseinandersetzen. Dabei sollen nicht nur Hintergründe und bestehende Zusammenhänge beleuchtet, sondern auch Tipps und Anregungen für ein barrierefreies und selbstbestimmtes Leben gegeben werden.
Er wendet sich an alle Interessenten, die ihr Leben barrierefrei und weitestgehend selbstbestimmt gestalten möchten. Dabei bietet er gleichzeitig Fachkräften, wie Architekten, Pflegekräften, Behörden und Vermietern, einen umfassenden Einblick in diese Themen. Neben Hinweisen zu den Rechtsgrundlagen zur Schaffung der Barrierefreiheit, wird auf das barrierefreie Bauen eingegangen und es werden Tipps zum Umgang und zur Kommunikation mit behinderten Menschen gegeben.
Dazu wurden zahlreiche bestehende Möglichkeiten für das barrierefreie Bauen zusammengetragen. Eine Bewertung dieser erfolgte nur im Hinblick auf die allgemeine Nutzungsmöglichkeit. Jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Diese Verantwortung möchten Ihnen die Autoren nicht abnehmen, da dies ein Teil des selbstbestimmten Lebens ist.
Eine abschließende Behandlung der Thematik zum barrierefreien und selbstbestimmten Wohnen kann mit diesem Leitfaden nicht erreicht werden. Die Komplexität des Themas, aber auch die stetige Fortschreibung rechtlicher Vorgaben und die rasche Weiterentwicklung von Produkten auf dem Gebiet der Barrierefreiheit, stehen diesem Anliegen im Weg. Daher ist es unser Ziel, Ihnen einen Einblick in diese Thematik zu geben und Sie zu ermutigen, sich weitere Informationen zum barrierefreien und selbstbestimmten Wohnen einzuholen. Die Mühe lohnt sich!
Die Autoren
Claudia Karell & Eberhard Tölke
1. Barrierefreiheit
In Ergänzung des Grundgesetzes (GG)1 hat der Bund für seinen Zuständigkeitsbereich, mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG)2 am 1. Mai 2002, die Begrifflichkeit „Barrierefreiheit“ rechtlich verbindlich eingeführt und definiert.3
Somit wurde eine verpflichtende Grundlage zur Schaffung der Barrierefreiheit in Deutschland gelegt.
Die dort im §4 definierte Barrierefreiheit gilt im gleichen Maße für alle Menschen mit Handicap. Eine differenzierte Barrierefreiheit für einzelne Handicapgruppen sieht der Gesetzgeber nicht vor.
Der Gesetzgeber trifft hier eine klare Abgrenzung zwischen „barrierefrei“ und „nicht barrierefrei“. Dies wird deutlich, indem er Begriffe wie barrierearm, teilweise barrierefrei, behindertenfreundlich, behindertengerecht usw. nicht formuliert und grundsätzlich nicht definiert.
Die nationalen und europäischen anzuwendenden Regelwerke (z. Bsp.: TSI PRM4, DIN5 usw.) sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. Bsp.: BGG, BRK usw.) kennen die Begrifflichkeiten wie „barrierearm“, „behindertengerecht“ oder ähnliche Begriffe nicht. Eine anderweitig verbindlich anzuwendende Definition der Begrifflichkeit „Barrierefreiheit“ ist nicht bekannt. Auf der Basis dieser Definition zur „Barrierefreiheit“ haben die Kernpunkte der Barrierefreiheit eine fundamentale Bedeutung.
Sie müssen das Denken und Handeln aller Akteure prägen.
Darüber hinaus sollen die 10 Gebote für die Barrierefreiheit, aufgestellt von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR6), Berücksichtigung finden.
1.1 Übernahme des Begriffs „Barrierefreiheit“ durch die Bundesländer – Beispiel Thüringen
Die Bundesländer haben die Definition der Begrifflichkeit „Barrierefreiheit“, in ihre Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ebenfalls aufgenommen. Dabei haben sie die Definition „Barrierefreiheit“ des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG) des Bundes weitestgehend übernommen.
Die Definition „Barrierefreiheit“ in den Gesetzen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung der Bundesländer gilt für ihren jeweiligen Zuständigkeits- bzw. Geltungsbereich (vgl. beispielsweise ThürGlG7 § 5 „Geltungsbereich“).
Beispiel:
Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen vom 16.Dezember 2005
§5 Barrierefreiheit
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
1.2 Kernpunkte der Barrierefreiheit
Was bedeutet Barrierefreiheit? Und was bewirkt sie?
Bauen und gestalten für ALLE
Übernahme sozialer Verantwortung
Bereitschaft zur flexiblen und dynamischen Planung
„Nicht mehr als nötig“ aber auch nicht „weniger als möglich“
Zukunftsorientierung ohne Insellösungen
selbständige Mobilität
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für ALLE
1.3 „10 Gebote der Barrierefreiheit“
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. sieht in der Realisierung der Barrierefreiheit nicht in erster Linie eine technische Herausforderung. Die Schaffung der Barrierefreiheit beginnt, ihres Erachtens, vielmehr mit der Bewusstseinsbildung einer entsprechenden Gestaltung des Lebensraumes, damit dieser auch für Menschen mit Handicap zugänglich und nutzbar ist.
Vor diesem Hintergrund hat die BAR-Arbeitsgruppe „Barrierefreie Umweltgestaltung“ die „10 Gebote der Barrierefreiheit“ zusammengestellt.
1. Gebot
Die Barrierefreiheit bildet die Grundlage der Umweltgestaltung für ALLE. Die Anforderungen, welche behinderte Menschen stellen müssen, benötigen die Aufmerksamkeit und das Engagement aller Mitbürger.
2. Gebot
Wir müssen uns bewusst machen, dass die Barrierefreiheit alle Lebensbereiche betrifft:
Information und Kommunikation
Bauen und Wohnen,
Mobilität und Verkehr,
Bildung und Kultur,
Arbeit, Erholung und Gesundheitswesen.
3. Gebot
Es ist zu berücksichtigen, dass die Barrierefreiheit für alle Menschen in gleichem Maße wichtig ist. Dies gilt insbesondere auch für Menschen mit motorischen, sensorischen oder mit kognitiven Handicaps.
4. Gebot
Das Ziel unseres Handelns ist daran auszurichten, dass die Nutzungsobjekte von ALLEN eigenständig
wahrnehmbar,
erreichbar,
begreifbar (verständlich),
erkennbar und
bedienbar sind.
5. Gebot
Bei der Planung sollte man sich von 5 Maximen leiten lassen:
der ergonomischen Gestaltung,
dem Zwei-Sinne-Prinzip,
der Verwendung visueller, akustischer und taktiler Kontraste,
dem Fuß-und-Roll-Prinzip sowie
der Anwendung leichter Sprache.
6. Gebot
Menschen mit Behinderung bzw. ihre Vertreter sind frühzeitig in alle Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit einzubinden. Dies verbessert die Chance sachgerechte Lösungen zu finden und erhöht gleichzeitig deren Akzeptanz.
7. Gebot
Es sollten die
Technischen Regelwerke,
die Erkenntnisse der Forschung und
die Erfahrungen der Praxis genutzt werden.
Barrierefreiheit braucht Qualität!
8. Gebot
Es ist die objektive und subjektive Sicherheit für ALLE herzustellen. Dabei sind vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen besonders wichtig.
Die Möglichkeit einer Selbstrettung im Notfall muss auch für Menschen mit Behinderung gegeben sein.
9. Gebot
Die Erfüllung des Nachholbedarfs ist systematisch anzugehen. Ziel muss es sein, mit der Barrierefreiheit eine größtmögliche Nutzung und damit eine Nachhaltigkeit für ALLE zu erreichen.
10. Gebot
Die Schaffung der Barrierefreiheit ist ein zukunftsorientiertes Handeln, da im Zuge des demographischen Wandels die Bedeutung der Barrierefreiheit deutlich zunehmen wird.
Die „10 Gebote der Barrierefreiheit“ sind im Internet sowie in einer Broschüre (in leichter Sprache) nachzulesen.8
1.4 „Post-Fall-Syndrom“ als Ursache mangelhafter Barrierefreiheit
Zahlreiche Barrieren, wie beispielsweise:
ungekennzeichnete Stufen – in Gebäuden und im öffentlichen Verkehrsraum (z. Bsp.: Unterführungen)
mangelhafte Beleuchtung – in Gebäuden und im öffentlichen Verkehrsraum (z. Bsp.: Gehwege)
ungekennzeichnete und zu niedrige Poller
ungenügende Baustellenabsicherungen mit „Flatterleinen“
führen bei Menschen mit Handicap zu Ängsten und Stürzen mit schmerzhaften Verletzungen sowie teilweise schwerwiegenden Folgen.
Insbesondere gestürzte Menschen mit Handicap und Senioren entwickeln häufig eine große Angst vor erneuten Stürzen.
Daraus kann sich eine Sturzphobie (= krankhafte Angst vor erneuten Stürzen), auch als Post-Fall-Syndrom bezeichnet, entwickeln.
Zur Vermeidung weiterer Stürze reduzieren sie ihre
➢ Aktivitäten bei der Verrichtung täglicher Tätigkeiten im Haushalt sowie
➢ ihre Teilnahme am Straßenverkehr.
In der Folge kommt es nicht nur selten zur sozialen Isolation, sondern insbesondere auch zum geistigen und körperlichen Abbau.
Der entstandene Bewegungs- und Trainingsmangel fördert das Sturzrisiko! Defizite führen unwillkürlich zu(r):
➢ Muskelschwäche
➢ unkoordinierten Bewegungsabläufen und
➢ Gleichgewichtsstörungen in Folge von herabgesetzter Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems.
Menschen mit diesen Beeinträchtigungen bewegen sich naturgemäß vorsichtiger und weniger elastisch. Die Angst vor Stürzen nimmt zu und sie schränken ihre körperliche Mobilität erneut ein.
Damit schließt sich der Kreis und der Prozess beginnt von Neuem. Am Ende steht der
durch die Gesellschaft
geschaffene Pflegefall!
1.4.1 Sturzursachen
Voraussetzung für eine erfolgreiche Sturzprävention ist die Kenntnis über die möglichen Sturzursachen.
Endogene Sturzursachen
Die endogenen Sturzursachen liegen in der Person selbst begründet. Zu diesen sind u.a. zu zählen:
plötzlich eintretende Erkrankungen, wie z. Bsp.: Schlaganfall, Herzinfarkt
Verwirrtheitszustände
Einschränkungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
Sehstörungen
Störungen der Balance
plötzlicher Bewusstseinsverlust
psychische Aspekte wie Depression und Angstzustände
Unkenntnis über Sturzgefahren
Exogene Sturzursachen
Diese liegen nicht in der Person, sondern in deren Umwelt begründet. Sie können resultieren aus:
Stolperfallen wie z. Bsp.: fehlende Stufenmarkierungen, umherliegende Kabel
zu lange Kleidung, die auf den Boden schleift
schlecht sitzendes Schuhwerk, welches in der Folge zu Gehunsicherheiten führt
mangelhafte Lichtverhältnisse: nicht ausreichend, blendend, spiegelnd (blank gebohnerte Bodenbeläge) und Schatten werfende Lichtverhältnisse
Veränderungen, wie z. Bsp. durch das Aufstellen weiterer Möbel im Zimmer
für Kinder kommen u.
a. auch Fensterbänke, Tische und Stühle in Frage, auf welche sie klettern können
1.4.2 Personengruppen mit besonderem Sturzrisiko
Zu diesen Personengruppen gehören insbesondere:
Personen über 70 Jahre
Personen mit reduziertem bzw. schlechtem Allgemeinzustand
Personen mit körperlicher Behinderung
inaktive sowie immobile Personen
1.4.3 Maßnahmen zur Reduzierung von Stürzen
Bei den nachstehenden Beispielen für die Maßnahmen zur Reduzierung von Stürzen handelt es sich um keine abschließende Auflistung.
Maßnahmen in Gebäuden und deren Freiflächen:
stufenlose Zugänge
gemeinsame Orientierungsgänge durch die Räumlichkeiten mit Hinweis auf Gefahrenstellen, wie z. Bsp.: Stufen, Podeste
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen
ausreichende, blend- und schattenfreie Beleuchtung, insbesondere für Gefahrenstellen, wie Treppen
taktile Kennzeichnung von Treppen
visuelle Stufenmarkierungen
in langen Fluren:
Maßnahmen im Wohnbereich:
Lichtschalter und Klingeln zum Ruf von Hilfspersonen stets im Greifbereich anordnen,
wichtig
:
keine Klingelschnur über Gehbereiche führen
Optimierung der Nachtbeleuchtung
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen
Veränderungen im Zimmer, z. Bsp. Aufstellen weiterer Möbel, sollten möglichst am Vormittag erfolgen (Bewohner kann sich somit bis zur Nacht besser darauf einstellen)
Maßnahmen für Sanitärbereiche:
Einsatz von rutschhemmenden Fußbodenbelägen und Matten z. Bsp. in Wanne und Dusche
ebene, bodenbündige Duschen
ausreichend nutzbare Festhaltemöglichkeiten
Maßnahmen beim Einsatz von Hilfsmitteln:
Anleitung im Umgang mit Gehhilfen (durch Physiotherapeut)
Einsatz von Hilfsmitteln, wie Stockhalter
Rollstühle, Rollatoren und Betten nach Nutzung stets mit Hilfe der Bremsen feststellen
Bereithaltung eines fahrbaren Lifters, der sich auch eignet um gestürzte Personen vom Boden aufheben zu können
Personenbezogene Maßnahmen:
Beobachtung der Reaktion auf verabreichte Medikamente
wenn erforderlich, rechtzeitige Schlafmittelverabreichung
Passform von Bekleidung und Schuhen prüfen und ggf. korrigieren
Einsatz rutschhemmender Schuhe für Begleiter und zu Begleitenden
Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen zur Verbesserung der Stand- und Schrittsicherheit durch die Anleitung eines Physiotherapeuten
regelmäßige Fußpflege zur Vermeidung schmerzhafter Druckstellen
Anpassung der Inkontinenzhilfsmittel
Im Bedarfsfall Aufstellen eines Alarm-/Vorsorgeplans
Dieser sollte mindestens folgendes enthalten:
konkrete Handlungsanweisungen
eine Photokopie anzuwendender Techniken für den Patiententransfer
Standort des Lifts
Verzeichnis zu alarmierender Personen und Institutionen
1.5 Was bringt die Barrierefreiheit der Gesellschaft?
Eine Attraktivitätsverbesserung für alle Bürger.
Animierung von Senioren und Menschen mit Handicaps zur Gesundheitserhaltung durch barrierefrei zugängliche Fitness- und Sportangebote wie z.B. Gymnastik, Schwimmen, Wandern, Kegeln etc.
Verstärkte Nutzung von Tourismus-, Freizeit- und Kulturangeboten.
Erhöhung der Lebensfreude für Senioren und Menschen mit Handicaps.
Die Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert das Konsumverhalten von Senioren und Menschen mit Handicaps.
Steigerung des ehrenamtlichen Engagements von Senioren und Menschen mit Handicaps in Verbänden der Selbsthilfe und sozialen Einrichtungen.
Verlängerte Erhaltung der Mobilität älterer Menschen bis ins hohe Lebensalter.
Verringerung der benötigten stationären Heim- und Pflegeplätze.
Aus diesen Fakten entwickelt sich eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Barrierefreiheit. Dieser Aspekt muss insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels betrachtet werden.
Insgesamt ist eine positive Auswirkung auf die Volkswirtschaft zu erwarten.
Daraus lässt sich beispielsweise für Wohnungsbauunternehmen ableiten:
➢ langzeitige Vermietung des Wohnungsbestandes
➢ Verringerung des Wohnungsleerstandes
➢ Verbesserung des Marktwertes der Wohnungen
2. Behinderung
Der Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG) zur Begrifflichkeit „Behinderung“ eine rechtlich verbindliche Definition9 formuliert.
Diese dort enthaltene Definition zur „Behinderung“ gilt bei der Anwendung des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ für alle Menschen mit Handicap im gleichen Maße.
Übernahme des Begriffs „Behinderung“ durch die Bundesländer
Die Bundesländer haben die Definition der Begrifflichkeit „Behinderung“ in ihre Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufgenommen. Dabei haben sie sich der Definition „Behinderung“ des „Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen“ (BGG) des Bundes angeschlossen und diese übernommen.
Die Definition „Behinderung“ in den Gesetzen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung der Bundesländer gilt für ihren jeweiligen Zuständigkeits- bzw. Geltungsbereich.
Beispiel:
Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen vom 16.Dezember 2005
§3 Behinderung
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“
Auffassung der BAGFW
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW10) sieht in Folge der in Deutschland rechtlich verbindlich eingeführten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (BRK11) eine Überprüfung des Behindertenbegriffs in der deutschen Gesetzgebung für erforderlich. Dies bezieht sich insbesondere auf den definierten Behindertenbegriff nach §2 SGB IX (vgl. Kapitel 7.1.5).
Die gegenwärtig in Deutschland angewandte Gliederung in körperliche, geistige und seelische Behinderung entspricht nicht dem neuen ganzheitlichen Verständnis vom Menschen der ICF.12 Gleiches gilt für die verwendeten Kriterien der für ein Lebensalter typischen Gesundheitseinschränkungen sowie eine vorliegende gesundheitliche Einschränkungsdauer von mindestens sechs Monaten.
Die gegenwärtig eingesetzten medizinisch-diagnostischen Verfahren zur Behinderungsfeststellung gilt es daher zu hinterfragen und weiter zu entwickeln.
3. Mobilität – Definition
Das Adjektiv „mobil“ bedeutet so viel wie „beweglich“ bzw. „nicht an einen festen Standort gebunden“. Es wurde erstmals im 18. Jahrhundert in der Militärsprache – aus dem Französischen „mobile“ (= beweglich, marschbereit) stammend – benutzt. Dabei handelt es sich um eine Wortbildung, die auf das lateinische Wort „mobilis“ zurückgeführt werden kann.
Die Bewertung von Prozessen mit Hilfe dieser „Beweglichkeit“ – Mobilität – wurde seither verallgemeinert. Entsprechend groß ist die Vielzahl von Facetten der Mobilität. So stellen für uns heute beispielsweise die Bezeichnungen
geistige Mobilität
räumliche Mobilität
persönliche Mobilität
physische Mobilität
Umzugsmobilität
Wochenendpendlermobilität
Tagespendlermobilität oder
berufliche Mobilität
schon längst keine Abstrakte mehr dar.
Im sich eingebürgerten Sprachgebrauch wird unter der Mobilität behinderter Menschen, deren Möglichkeiten einer individuellen „physisch-räumlichen“ Fortbewegung/(Mobilität), verstanden.
3.1 Physisch-räumliche Mobilität
Unter der physisch-räumlichen Mobilität versteht man die Bewegung von Gütern und Menschen. Sie findet auf vielfältigste Weise, wie z. Bsp.: auf der Straße, der Schiene, über dem Wasser oder in der Luft statt.
In der Privatsphäre von Menschen mit Handicap bildet die physischräumliche Mobilität eine wesentliche Voraussetzung für die selbstbestimmte Lebensqualität. Die physisch-räumliche Mobilität von Senioren und Menschen mit Handicap erfolgt häufig per
Fuß und
ÖPNV.13
Zur Unterstützung der physisch-räumlichen Mobilität werden je nach Schweregrad der Beeinträchtigung und Fähigkeiten, Mobilitätshilfen eingesetzt. Diese können u.a. sein:
Gehhilfen/Unterarmstützen
Blindenlangstock
Blindenführhund
Auto
Fahrrad
Rollator oder
Rollstuhl
Persönliche, wie auch äußere Faktoren nehmen einen wesentlichen Einfluss auf die „physisch-räumliche“ Mobilität. Sie entscheiden über deren Umgang und Qualität. Einflussfaktoren auf die „physisch-räumliche“ Mobilität können sein:
persönliche Einflussfaktoren
Kognitive Fähigkeiten
Wahrnehmbarkeit der Umwelt (visuell, akustisch, taktil)
Orientierungsfähigkeit
Fähigkeit im Umgang mit der Mobilitätshilfe
äußere Einflussfaktoren
Barrieren (z. Bsp. baulich, kommunikativ)
Bereitstellung von Mobilitätshilfen (z. Bsp. durch Krankenkassen)
finanzielle Ausstattung
soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration
3.1.1 Wer ist in seiner „physisch-räumlichen“ Mobilität eingeschränkt?
Zu den Personen, die in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt sind, werden nicht nur Senioren oder Menschen mit Handicap gezählt. Die Palette der Personengruppen reicht durch die gesamte Gesellschaft. Zu ihnen gehören u.a.:
Rollstuhlbenutzer
Personen mit Gebrechen der Gliedmaßen
Personen mit Gehproblemen
Personen mit Kindern
Personen mit schwerem oder sperrigem Gepäck
Senioren
Schwangere
sehbehinderte und blinde Menschen
hörbehinderte und gehörlose Personen
Personen mit beeinträchtigter Kommunikationsfähigkeit, d.
h. mit Schwierigkeiten beim Verständnis geschriebener und gesprochener Sprache
ausländische Mitbürger
Personen mit psychischen und geistigen Behinderungen
kleinwüchsige Menschen
Kinder
3.1.2 Sind blinde Menschen in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt?
Die Grundlagen für die Erfüllung einer barrierefreien Mobilität dürfen nicht nur auf motorische Behinderungen (Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer) beschränkt werden. Für eine eigenständige Mobilität ist die räumliche Orientierung – übrigens u.a. auch für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer – unabdingbare Voraussetzung. Diese kann jedoch durch den Verlust des Sehvermögens nicht im erforderlichen Maß erfolgen. Somit können sich blinde und sehbehinderte Menschen nicht ohne weiteres (ohne Hilfen, wie Blindenlangstock, Blindenführhund, akustische Informationen) selbständig fortbewegen und sind daher in ihrer Mobilität wesentlich eingeschränkt und behindert. Die sich daraus ergebenden notwendigen baulichen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Erleichterung der Mobilität blinder und sehbehinderter Menschen müssen in diesem Zusammenhang ebenfalls zu den Mobilitätsgrundlagen gerechnet werden.
Die Tatsache, dass Blindheit und Sehbehinderung eine Mobilitätsbehinderung darstellen, wird vom Gesetzgeber nicht nur anerkannt, sondern auch in vielfacher Weise Rechnung getragen. Nach dem Gesetz bekommen hochgradig sehbehinderte Personen im Schwerbehindertenausweis14 die Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) und B (Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen.) eingetragen. Hier wird also die hochgradige Sehbehinderung vom Gesetzgeber klar einer Gehbehinderung (und somit einer Mobilitätsbehinderung) gleichgesetzt. Bei blinden Personen wird das Merkzeichen G durch H (hilflos) ersetzt, wodurch der Gesetzgeber die Bedeutung der Blindheit als Behinderung der Mobilität sogar noch einmal erhöht hat.
„Die Bezeichnung „mobilitätseingeschränkte bzw. mobilitätsbehinderte Personen" schließt die große Gruppe der seh- und hörgeschädigten Personen ein. Dies ist insofern von Bedeutung, als fachgesetzliche Bestimmungen oder Festlegungen in Technischen Regelwerken, die die Berücksichtigung von Anforderungen mobilitätseingeschränkter Menschen beinhalten, damit auch die Berücksichtigung von Belangen sensorisch geschädigter Menschen vorgeben.“15
Fußnoten
1. Barrierefreiheit
GG – Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland – siehe Abkürzungsverzeichnis
BGG – Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen – siehe Abkürzungsverzeichnis
vgl. Kapitel 7.1.2 (Artikel 1 BGG §4)
TSI PRM – siehe Abkürzungsverzeichnis
DIN – Deutsche Industrie-Norm(en) – siehe Abkürzungsverzeichnis
BAR – Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation – siehe Abkürzungsverzeichnis
1.1 Übernahme des Begriffs „Barrierefreiheit“ durch die Bundesländer – Beispiel Thüringen
ThürGlG – Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen – siehe Abkürzungsverzeichnis
1.3 „10 Gebote der Barrierefreiheit“
vgl.: www.bar-frankfurt.de/2652.html
2. Behinderung
vgl. Kapitel 7.1.2 (Artikel 1 BGG §3)
BAGFW – Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege – siehe Abkürzungsverzeichnis
BRK – Behindertenrechtskonvention – siehe Abkürzungsverzeichnis
ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health – siehe Abkürzungsverzeichnis
3.1 Physisch-räumliche Mobilität
ÖPNV: Öffentlicher Personennahverkehr – siehe Abkürzungsverzeichnis
3.1.2 Sind blinde Menschen in ihrer physisch-räumlichen Mobilität eingeschränkt?
Schwerbehindertenausweis – siehe Worterklärungen
vgl.: direkt 64 Kap. 4.2





























