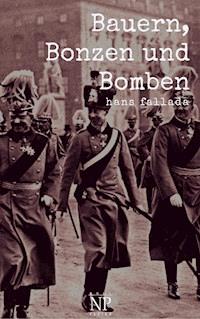
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hans Fallada bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit einer Besprechung von Kurt Tucholsky. In »Bauern, Bonzen und Bomben« verarbeitet Fallada die historischen Ereignisse um die schleswig-holsteinische Landvolkbewegung und deren Boykott der Stadt Neumünster, über die er 1929 selbst als Journalist berichtet hatte. Fallada verlegt die Handlung in eine fiktive pommersche Stadt namens Altholm. Die Bauernschaft geht auf die Barrikaden. Sie revoltieren gegen Zwangspfändungen. Bei einer Demonstration wird der Fahnenträger schwer verletzt. Daraufhin boykottiert die Bauernschaft die Stadt Altholm fast ein Jahr, was zu erheblichen wirtschaftlichen und politischen Problemen führt. Die Situation kulminiert in der persönlichen Auseinandersetzung zwischen dem deutschnationalen Redakteur Stuff und dem sozialdemokratischen Bürgermeister Gareis. »Es ist der Mief der Kleinstadt, jener Brodem aus Klatsch, Geldgier, Ehrgeiz und politischen Interessen.« [Tucholsky] Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 853
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Fallada
Bauern, Bonzen und Bomben
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Hans Fallada
Bauern, Bonzen und Bomben
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Rowohlt Verlag, Berlin, 1931 (565 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-35-2
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Besprechung von Kurt Tucholsky
Vorwort des Autors
VORSPIEL
Ein kleiner Zirkus namens Monte
ERSTES BUCH: Die Bauern
ERSTES KAPITEL – Eine Pfändung auf dem Lande
ZWEITES KAPITEL – Jagd nach einem Foto
DRITTES KAPITEL – Die erste Bombe
VIERTES KAPITEL – Ein Gewitter zieht sich zusammen
FÜNFTES KAPITEL – Der Blitz ist in der Wolke
SECHSTES KAPITEL – Das Gewitter bricht los
SIEBTES KAPITEL – Die Regierung greift durch
ZWEITES BUCH – Die Städter
ACHTES KAPITEL – Die Erfindung des Boykotts
NEUNTES KAPITEL – Der Boykott wird Wirklichkeit
ZEHNTES KAPITEL – Die Versöhnungskommission arbeitet
ELFTES KAPITEL – Die Städter kämpfen – aber gegeneinander
ZWÖLFTES KAPITEL – Es kracht zum zweiten Mal
DREIZEHNTES KAPITEL – Gareis der Sieger
DRITTES BUCH – Der Gerichtstag
VIERZEHNTES KAPITEL – Stuff verändert sich
FÜNFZEHNTES KAPITEL – Drei Tage Glück
SECHZEHNTES KAPITEL Tredups Ende
SIEBZEHNTES KAPITEL – Gareis in der Schlinge
ACHTZEHNTES KAPITEL – Zeugen und Sachverständiger
NEUNZEHNTES KAPITEL – Das Urteil
NACHSPIEL
Ganz wie beim Zirkus Monte
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Hans Fallada bei Null Papier
Jeder stirbt für sich allein
Der Trinker
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst
Ein Mann will nach oben
Kleiner Mann – was nun?
Der eiserne Gustav
Bauern, Bonzen und Bomben
Wolf unter Wölfen
Anton und Gerda
Der Alpdruck
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Besprechung von Kurt Tucholsky
Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, einen andern durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt – § 253 StGB
Ein politisches Lehrbuch der Fauna Germanica, wie man es sich nicht besser wünschen kann:
›Bauern, Bonzen und Bomben‹ von Hans Fallada (erschienen bei Ernst Rowohlt in Berlin). Bevor wir ins Thema steigen: das Buch hat ein gotteslästerlich schlechtes Satzbild. Wie sieht denn nur die Seite aus? Ich habe immer gelernt, der weiße Rand müsse sich nach der Innenseite des Buches hin verbreitern – dies Satzbild ist aber gar nicht schön. Rowohlt, Sie sind doch sonst nicht so? Jetzt gehts los.
Falladas Buch ist die beste Schilderung der deutschen Kleinstadt, die mir in den letzten Jahren bekannt geworden ist. Der Verfasser hat einen Bauernroman schreiben wollen – wohl anknüpfend an die Vorgänge in Neumünster in Holstein, wo Bauernführer im Sinne Klaus Heims und, unabhängig von ihm, die Nationalsozialisten die vorhandene Unzufriedenheit der Bauern benutzten, um gegen das, was sie die Republik nennen, vorzugehen. »Die Gestalten des Romans«, steht im Vorwort, »sind keine Fotografien, sie sind Versuche, Menschengesichter unter Verzicht auf billige Ähnlichkeit sichtbar zu machen. Bei der Wiedergabe der Atmosphäre, des Parteihaders, des Kampfes aller gegen alle ist höchste Naturtreue erstrebt. Meine kleine Stadt steht für tausend andere und für jede große auch.«
Die Bauern nun sind in diesem Roman eine dunkle, anonyme Masse – die paar Typen, die herausgegriffen werden, sind viel blasser als die Bewohner der kleinen Stadt Altholm; und von den wirtschaftlichen Gründen bäurischer Notlage wird so gut wie nichts gesagt. Einmal ist das heikle Thema, dass die Bauern vielleicht intensiver wirtschaften sollten, um sich gegen die ausländische Konkurrenz anders als mit Schutzzöllen zu behaupten, leise angeschlagen; kein Wort davon, dass die Verdienste, die der Bauernschaft durch die Inflation in den Schoß gefallen sind, sie damals für lange Zeit hätten schuldenfrei machen können, es war jene Zeit, wo die Ledersessel und die Klaviere in die Bauernhäuser transportiert wurden. Und wo stehn die Bauern heute ... also davon ist in dem Buch wenig zu spüren. Den Bauern gehts eben schlecht – und nun revoltieren sie.
Das tun sie auf eine recht merkwürdige Weise.
Die dem Altdeutschen entlehnten romantischen Formen des armen Konrad wirken wie aufgeklebt. »Bauern Pommerns, habt ihr darüber hinaus schuldig gefunden die ganze Stadt Altholm mit allem, was darin lebt, so sprecht: sie ist schuldig! – Ankläger, welche Strafe beantragst du gegen die Stadt Altholm?« Das ist tragische Oper, Film und neuruppiner Bilderbogen. Sicherlich wird auf diesen Things so gesprochen; es ist die gehobene Sprache von Ackerbürgern, die das Feierliche solcher Handlungen durch einen Stil bekunden, der leise Erinnerungen an die Bibel und an alte verschollene Zeiten aufweist, da der Bauer einmal wirklich revolutionär gewesen ist. Aber warum, warum das alles so ist – davon bekommen wir in diesem Buch wenig zu hören. Gut gesehn und gut geschildert ist das Dumpfe am Bauern, seine Schlauheit, seine ungeheure Aktivität im passiven Erdulden, woran sich jeder Gegner mit der Zeit totläuft ... aber der Bauer: der ist nicht in diesem Buch. Das hat kein Bauer geschrieben. Dieser Autor hat die Bauernbewegung schildern wollen, und unter der Hand ist ganz etwas andres herausgekommen: ein wundervoller Kleinstadtroman.
George Grosz, der du das Titelbild hättest zeichnen sollen, das lies du! Es ist dein Buch.
Die Technik ist simpel; es ist der brave, gute, alte Naturalismus, das Dichterische ist schwach, aber der Verfasser prätendiert auch gar nicht, ein großes Dichtwerk gegeben zu haben. Ein paar Stellen sind darin, an denen schlägt ein Herz. Nein, ein großes Kunstwerk ist das nicht. Aber es ist echt ... es ist so unheimlich echt, dass es einem graut.
Gezeigt wird das politische Leben einer kleinen Provinzstadt; ihre Intrigen und ihre Interessenten; ihre Stammtische und ihre Weiberkneipen; ihr Rathaus und ihre Polizeiwache ... es ist schmerzhaft echt. Das hat einer geschrieben, der diese Umwelt wie seine Tasche kennt, einer, der sich aber doch so viel Distanz dazu bewahrt hat, sie schildern zu können. Er hat genau die richtige Entfernung, deren ein Schriftsteller bedarf: nah, aber nicht zu nah. Es scheint mir ungemein bezeichnend, dass wir keinen solchen Arztroman haben; keinen solchen Börsianerroman; keinen solchen Großstadtroman: es ist, als hätten die Angehörigen dieser gehobenen Bürgerschichten keine Augen im Kopf, um das zu sehen, was rings um sie vorgeht. Es ist ihnen wohl zu selbstverständlich. Fallada hat gesehn.
Es ist eine Atmosphäre der ungewaschenen Füße. Es ist der Mief der Kleinstadt, jener Brodem aus Klatsch, Geldgier, Ehrgeiz und politischen Interessen; es ist jene Luft, wo die kleine Glocke an der Tür des Posamentierwarenladens scheppert und eine alte Jungfer nach vorn gestolpert kommt ... Augen tauchen hinter Fensterladen auf und sehen in den ›Spion‹ ... und wenn das nun noch ein Dichter geschrieben hätte, der nicht nur theoretisch im Vorwort sagt, dass dieses Altholm für tausend andre Städte stehe, sondern wenn er uns das nun auch noch im Buch selbst gezeigt hätte –: dann wäre dies ein Meisterwerk.
So ist es nur ein politisch hochinteressanter Roman geworden. Ich kann mir nicht denken, dass ich dieses Buch zu Ende gelesen hätte, wenn es etwa eine bretonische Kleinstadt schilderte; das kann für den Fremden nur ein Künstler wie Maupassant schmackhaft machen. Dieses Werk hier habe ich in zwei Nächten gefressen, weil es uns politisch angeht, nur deswegen. Beinah nur deswegen.
Im Gegensatz zu diesen dummen Büchern gegen die ›Bonzen‹, wo der Sozialdemokrat nichts als dick, dumm und gefräßig ist und die andern rein und herrlich; wo die Arbeiter abwechselnd als verhetzt und unschuldig oder als blöde Masse geschildert werden, und wo sich die ganze Wut nicht zu Worte gekommener Zahlabendmitglieder entlädt – im Gegensatz dazu sind hier Menschen gezeichnet, wie sie wirklich sind: nicht besonders bösartig, aber doch ziemlich übel, mutig aus Feigheit, klein, geduckt alle zusammen – und niemand ist in diesem Betrieb eigentlich recht glücklich.
Die Bauern demonstrieren in der Stadt mit der schwarzen Fahne gegen die zu hohen Steuern. Der Bürgermeister verbietet die Demonstration nicht, der Regierungspräsident will sie verboten haben; beides sind Sozialdemokraten. Der Regierungspräsident entsendet an die Grenze des städtischen Machtbereichs Schupo; sowie einen ›Vertrauensmann‹. Der Vertrauensmann bringt die städtische Polizei und die Bauern ein bißchen aufeinander; hier ist ausgezeichnet geschildert, wie so etwas verläuft: wie guter böser Wille, Tücke, Schlauheit und Gerissenheit des Beamten ineinander übergehn – Amtsmißbrauch? Das weisen Sie mal nach! Und wie sich dann vor allem die Ereignisse selbständig machen; wie es eben nicht mehr in der Macht der Menschen liegt, ihnen zu gebieten – das ›es‹ ist stärker als sie. Die Herren Führer stehen nachher als Opfer da – wie ist das gewesen? Ein Telefonanruf, die Ungeschicklichkeit eines Polizeiinspektors ... du lieber Gott, es sind lauter Kleinigkeiten, und zum Schluß ist es ernste Politik. Fallada hat das gut aufgebröselt; er begnügt sich an keiner Stelle mit diesen schrecklichen Rednerphrasen, wie wir sie sonst in jedem politischen Roman finden: er trennt das Gewebe auf und zeigt uns das Futter. Riecht nicht gut, diese Einlage.
Hießen alle diese Leute: Kowalski, Pruniczlawski, Krczynakowski und spielte dieser Roman in Polen –: die deutsche Rechtspresse würde ihn mit Freudengeheul begrüßen. Was? Diese Tücke! diese Falschheit – denn ein Grundzug geht durch das ganze Buch, und der ist wahr:
Fast alles, was hier geschieht, beruht auf Nötigung oder Erpressung.
Der Bürgermeister drückt auf die Zeitungsleute; die Zeitungsleute drücken auf das Rathaus; die Bauern auf die Kaufleute; jeder weiß etwas über wen, und jeder nutzt diese Kenntnis auf das raffinierteste aus. Nun wollen wir uns nicht vormachen, es käme solches nur in deutschen Kleinstädten vor; diese Leute sind immer noch Waisenknaben gegen die Franzosen, die aus Personalkenntnissen gradezu meisterhaft Kapital zu schlagen verstehn – die gute Hälfte ihrer Politik besteht aus solchen Dingen, und es ist sehr lustig, dass der Name ihrer einschlägigen Institution in wörtlicher Übersetzung »allgemeine Sicherheit« bedeutet. Also das ist überall so. Gestaltet ist es in diesem Buche meisterhaft.
Was vor allem auffällt, ist die Echtheit des Jargons. Das kann man nicht erfinden, das ist gehört. Und bis auf das letzte Komma richtig wiedergegeben: es gibt eine Echtheit, die sich sofort überträgt: man fühlt, dass die Leute so gesprochen haben und nicht anders.
Diese Aktschlüsse, wenn sie auseinandergehn, mit »Na, denn ... « und »Also nicht wahr, Herr Bürgermeister ... «; der schönste Gesprächsschluß ist auf der Seite 517 ... die grammophongetreue Wiedergabe dessen, was so in einer Konferenz gesprochen wird: wie da die Bürger aller Schattierungen eine Nummer reden, halb Stammtisch und halb Volksversammlung; wie sie unter Freunden sprechen und wie sie sprechen, wenn jemand dabei ist, gegen den sie etwas haben; wie sie schweinigeln ...
Ja, da lesen wir nun so viel über die Sittenverderbnis am Kurfürstendamm. Aber auf keinem berliner Kostümfest der Inflationsjahre kann es böser zugegangen sein als es heute noch in jeder Kleinstadt in gewissen Ecken zuzugehen pflegt, wenn die Ehemänner, fern von Muttern, in das Reich der Aktfotografien und der Weiberkneipen hinuntertauchen. Jeder hat was auf dem Kerbholz. »Ich sage bloß: Stettin ... « sagt einer zum Bürgermeister. Ich sage bloß: Altholm – und hierin steht dieses erfundene Altholm, das gar nicht erfunden sein kann, für jede Stadt. Dieses Laster ist unsagbar unappetitlich.
Wenn sie aber festgestellt haben, dass Betty, die Sau, heute keine Hosen trägt, dann reißen sie sich am nächsten Vormittag zusammen und werden ›dienstlich‹. Und das ist nun allerdings ganz und gar deutsch. »Ich komme dienstlich«, sagt einer zu einem Duzfreund. Und dann spielen sie sich eine Komödie vor: jeder weiß, dass der andre weiß, dass er weiß – sie grinsen aber nicht, sondern sie wechseln vorschriftsmäßig Rede und Gegenrede, damit sie nachher in den Bericht setzen und beschwören können: »Herr Stuff sagte mir, dass er von dem Verbleib des Inseratenzettels nichts wüßte. So wahr mir Gott helfe.«
O welsche Tücke, o polnische Niedertracht, o deutsche Dienstlichkeit.
Und eine Gerichtsverhandlung: wie da die unbequemen Zeugen zu Angeklagten werden; wie es gedreht wird; wie dieses ganze Theater gar nichts mehr mit Rechtspflege, dagegen alles mit Politik zu tun hat –: das ist ein Meisterstück forensischer Schilderung. Nur zu lang.
Und wenn man das alles gelesen hat, voller Spannung, Bewegung und ununterbrochen einander widerstreitender Gefühle: dann sieht man die immense Schuld jener Republik, die wir einmal gehabt haben und die heute zerbrochen ist an der Schlappheit, an der maßlosen Feigheit, an der Instinktlosigkeit ihres mittlern Bürgertums, zu dem in erster Linie die Panzerkreuzer bewilligenden Führer der Sozialdemokratie zu rechnen sind. Der Lebenswille der andern war stärker; und wer stärker ist, hat das Anrecht auf einen Sieg. Beklagt euch nicht.
Hier, in diese kleinen Städte, ist der demokratische, der republikanische Gedanke niemals eingezogen. Man hat – großer Sieg! – auf manchen Regierungsgebäuden Schwarz-Rot-Gold geflaggt; die Denkungsart der breiten Masse hat die Republik nie erfaßt. Nicht nur, weil sie maßlos ungeschickt, ewig zögernd und energielos zu Werke gegangen ist; nicht nur, weil sie 1918 und nach dem Kapp-Putsch, nach den feigen Mordtaten gegen Erzberger und Rathenau alles, aber auch alles versäumt hat – nein, weil der wirkliche Gehalt dieses Volkes, seine anonyme Energie, seine Liebe und sein Herz nicht auf solcher Seite sein können. Die Sozialdemokratie ist geistig nie auf ihre Aufgabe vorbereitet gewesen; diese hochmütigen Marxisten-Spießer hatten es alles schriftlich, ihre Theorien hatten sich selbständig gemacht, und in der Praxis war es gar nichts. Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig. Dass nun dieses richtige Grundgefühl heute von den Schreihälsen der Nazis mißbraucht wird, ist eine andre Sache.
Hier ist eine Blutschuld der nicht mehr bestehenden Republik. Aus keinem Buch wird das deutlicher als aus diesem, der Verfasser hat es uns vielleicht gar nicht zeigen wollen – die These springt aber dem Leser in die Augen. Was war hier zu machen –! Und was hat man alles nicht gemacht –! Zu spät, zu spät.
Ich empfehle diesen Roman jedem, der über Deutschland Bescheid wissen will. Wie weit ist das von dem Rapprochement-Geschwätz der braven Leute aus den großen Städten entfernt. Hier ist Deutschland – hier ist es.
Es wäre anzumerken, dass der Künstler in Fallada nur an einigen wenigen Stellen triumphiert. Manchmal sagt er kluge Sachen; wie sich zwei bei einer Unterredung vorsichtig abtasten: »Ein Anfang ist gemacht, ein günstiger Anfang. Die beiden Herren haben sich in ihren Antipathien getroffen, was meistens wichtiger ist, als dass die Sympathien übereinstimmen.« Und einmal steht da einer dieser Sätze, an denen das frühere Werk Gerhart Hauptmanns so reich ist. Einem Bauern geht alles, aber auch alles schief. »Welche sind, die haben kein Glück, sagt Banz und meint sich.«
Ja, das ist ein Buch! So ist die Stadt; so ist das Land, vor allem das niederdeutsche, und so ist die Politik. Man sieht hier einmal deutlich, wie eben diese Politik nicht allein in wirtschaftliche Erklärungen aufzulösen ist; wie sich diese Menschen umeinanderdrehen, sich bekämpfen und sich verbünden, sich anziehen und abstoßen, sich befehden und verbrüdern ... als seien sie von blinden und anonymen Leidenschaften getrieben, denen sie erst nachher, wenn alles vorbei ist, ein rationalistisches Etikett aufkleben; das Etikett zeigt den Flascheninhalt nicht richtig an. Sie drücken aufeinander und »lassen den andern hochgehn«; sie spielen einander die Komödie des Dienstlichen vor – und es sind arme Luder, alle miteinander. Und man bekommt einen kleinen Begriff davon, wie es wohl einem zumute sein mag, der in diesen mittlern und kleinen Städten auf republikanischem Posten steht. Fällt er wegen seiner Gesinnung? Natürlich. Fällt er durch seine Gesinnung? Nie. Sie »machen ihn kaputt«, wie der schöne Fachausdruck heißt, aber so: »Herr Schulrat P. hat gegen den § 18 der Bestimmung verstoßen, nach der er ... « Immer ist da so ein § 18, und immer funktioniert dieser Paragraph prompt, wenn sie ihn grade brauchen. Und niemals hilft die Republik ihren Leuten; sie wird so gehaßt und hat dabei gar nich veel tau seggn. Sie sieht sich das alles mit an ... sie läßt diese unsäglichen Richter machen, die die Hauptschuld an den blutigen Opfern der letzten Zeit tragen. Rechtsschutz gibt es nicht. Gleichheit vor dem Strafgesetz gibt es nicht. Kommunist sein bedeutet: Angeklagter sein, und wenn die Nazis ganze Kleinstädte terrorisieren, so bleibt der Landgerichtsrat milde und hackt auf den Belastungszeugen herum. Und wenn es gar nicht anders geht, wenn sonst nichts da ist, einen verhaßten Republikaner tot zu machen, dann hilft irgend ein § 18. Noch niemals aber ist ein Mitglied der herrschenden Rechtskaste über solch einen Paragraphen gestolpert, falls er sich nicht bei seiner Klasse mißliebig gemacht hat. Da gilt dann der Paragraph nicht. Man fällt nicht über seine Fehler. Man fällt immer über seine Feinde, die diese Fehler ausnutzen.
*
So einen Arztroman möchten wir lesen. So einen Journalistenroman. So einen berliner Roman. Dazu wäre allerdings der besondere Glücksfall nötig, dass ein schriftstellerisch begabter Mann in diesem Milieu lebt und es so genau kennt, wie Fallada das seinige.
Er hat es kaschiert. Seine Helden heißen nicht Knut, sondern Tunk. Wird diese Tarnkappe genügen? Begeistert wird die kleine Stadt von seiner Schilderung grade nicht sein – nicht davon, wie er sie entblößt; wie er aufzeigt, dass weit und breit keine Juden da sind, die man für alles verantwortlich machen könnte; weit und breit keine Kommunisten, die etwas bewirken. Fallada, sieh dich vor. Es gibt ein altes Grimmsches Märchen von der Gänsemagd, die eine Prinzessin war und die nun als Magd dienen muß. Den Kopf ihres treuen Rosses haben sie ans Stadttor genagelt, und jeden Morgen, wenn sie ihre Gänse da vorübertreiben muß, sieht sie es an und spricht:
»O Fallada – dass du hangest!«
Wenn sie dich kriegen, Hans Fallada, wenn sie dich kriegen: sieh dich vor, dass du nicht hangest! Es kann aber auch sein, dass sie in ihrer Dummheit glauben, du habest mit dem Buch den Sozis ordentlich eins auswischen wollen, und dann bekommst du einen Redakteurposten bei einem jener verängstigten Druckereibesitzer, die in Wahrheit die deutsche Presse repräsentieren.
Obgleich und weil du den besten deutschen Kleinstadtroman geschrieben hast.
Als Ignaz Wrobel, Die Weltbühne, 07.03.1931, Nr. 14, S. 496.
Vorwort des Autors
Dieses Buch ist ein Roman, also ein Werk der Fantasie. Wohl hat der Verfasser Ereignisse, die sich in einer bestimmten Gegend Deutschlands abspielten, benutzt, aber er hat sie, wie es der Gang der Handlung zu fordern schien, willkürlich verändert. Wie man aus den Steinen eines abgebrochenen Hauses ein neues bauen kann, das dem alten in nichts gleicht außer dem Material, so ist beim Bau dieses Werkes verfahren.
Die Gestalten des Romans sind keine Fotografien, sie sind Versuche, Menschengesichter unter Verzicht auf billige Ähnlichkeit sichtbar zu machen.
Bei der Wiedergabe der Atmosphäre, des Parteihaders, des Kampfes aller gegen alle, ist höchste Naturtreue erstrebt. Meine kleine Stadt steht für tausend andere und für jede große auch.
H. F.
VORSPIEL
Ein kleiner Zirkus namens Monte
1
Ein junger Mann stürmt den Burstah entlang. Während des Laufens schießt er wütende, schiefe Blicke nach den Schaufenstern der Läden, die in dieser Hauptstraße von Altholm1 dicht an dicht liegen.
Der junge Mann, um die fünfundzwanzig, verheiratet und nicht hässlich, trägt einen alten schwarzen Rockpaletot, blank gescheuert, einen breitkrempigen schwarzen Filz und schwarz umränderte Brille. Sein blasses Gesicht dazu – und er scheint ein Leichenbitter, würdig jeder »Pietät« und »Ruhe sanft«.
Wenn schon der Burstah der Broadway von Altholm ist, lang ist er nicht. Nach drei Minuten ist der junge Mann am letzten Haus, direkt am Bahnhofsplatz. Er spuckt kräftig aus und verschwindet nach dieser neuen Äußerung seiner Stinkwut im Hause der »Pommerschen Chronik für Altholm und Umgebung, Heimatblatt für alle Stände«.
Hinter der Barre der Expedition hockt eine gelangweilte Tippeuse,2 die das Manuskript eines Zeitungsromans wegstecken will. Sie bremst diese Bewegung ab, als sie sieht, es ist nur der Annoncenwerber Tredup.
Er schmeißt einen Papierfetzen auf den Tisch: »Da! Das ist alles. Geben Sie’s in die Setzerei. – Sind die anderen drinnen?«
»Wo sollen die denn sonst sein?« fragt die Schöne dagegen. »Wird das berechnet?«
»Natürlich wird das nicht berechnet. Haben Sie schon mal gesehen, dass ein Affe uns Anzeigen bezahlt hat?! Neun Mark kostet sie. War der Chef schon unten?«
»Der Chef erfindet schon wieder seit fünf.«
»Gott soll schützen! Und die Chefin? Dun?«
»Weiß nicht. Denke. Fritz hat ihr um acht eine Pulle Kognak holen müssen.«
»Dann ist ja alles in schönster Ordnung. – O Gott, was mich dieser Stall ankotzt! – Sind die drinnen?«
»Das haben Sie schon mal gefragt.«
»Haben Sie sich nicht, Klara, Klärchen, Klarissa. Ich hab Sie heute Nacht um halber eins aus der Grotte kommen sehen.«
»Wenn ich von meinem Gehalt leben sollte …«
»Weiß ich, weiß ich. Ob der Chef Geld hat?«
»Ausgeschlossen.«
»Und der Wenk, hat der was in der Kasse?«
»Ostseekino hat gestern Abend bezahlt.«
»Also hole ich mir Vorschuss. Drinnen ist er doch?«
»Ich glaube, Sie haben …«
»Das schon einmal gefragt. Mehr als eine Walze, bitte, meine Holde. Vergessen Sie nicht das Inserat.«
»Gott. Und wenn schon.«
fiktive pommersche Stadt <<<
Sekträterin <<<
2
Tredup zieht die Schiebetür zum Redaktionszimmer mit einem Ruck auf, geht durch und drückt sie sachte wieder zu. Der lange Geschäftsführer Wenk hockt in einem Sessel und pult an den Nägeln. Redakteur Stuff schmiert irgendeinen Mist.
Tredup feuert seine Mappe in ein Schrankfach, hängt Hut und Mantel beim Ofen auf und setzt sich an seinen Schreibtisch. Er zieht gleichgültig, als fühle er nicht die fragenden Blicke, einen Kartothekkasten hervor und beginnt Karten zu sortieren. Wenk hält mit Nägelschneiden inne, betrachtet sorgend die Klinge im Licht der Sonne, wischt sie an seinem Bürolüsterjackett ab, klappt das Messer zu und sieht Tredup an. Stuff schreibt weiter.
Es erfolgt nichts. Wenk nimmt ein Bein von der Sessellehne und fragt wohlwollend: »Na, Tredup?«
»Bitte, Herr Tredup!«
»Na, Herr Tredup?«
»Du kannst mich mal mit deinem ›na‹!«
Wenk wendet sich an Stuff. »Er hat nichts, Stuff, sage ich dir. Nichts hat er.«
Stuff glupscht unter seinem Klemmer auf Tredup, zieht seinen grau melierten Walrossbart durch die Zähne und bestätigt: »Natürlich hat er nichts.«
Tredup springt wütend auf. Der Kartothekkasten fliegt mit einem Knall auf die Erde. »Was heißt ›natürlich‹? Ich verbitte mir ›natürlich‹! In dreißig Geschäften bin ich gewesen! Kann ich die Leute notzüchtigen? Soll ich ihnen die Inserate aus der Nase ziehen? Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Ich bettele schon … Und so ein Schreibknecht sagt ›natürlich‹. Lächerlich!«
»Reg dich bloß nicht künstlich auf, Tredup. Was hat denn das für einen Sinn?«
»Natürlich rege ich mich auf über dein ›Natürlich‹. Geh du doch selber einmal los Annoncen sammeln. Diese Affen! Diese Krämer! Diese drehstierige Bande! ›Ich inseriere vorläufig nicht.‹ – ›Ich habe keine Meinung für Ihr Blatt.‹ – ›Besteht die Chronik überhaupt noch? Ich dachte, sie wäre längst eingegangen.‹ – ›Kommen Sie morgen wieder.‹ – Es ist zum Kotzen!«
Wenk murmelt aus seinem Sessel: »Ich traf heute früh den Maschinenmeister von den ›Nachrichten‹. Die kommen heute mit fünf Seiten Anzeigen raus.«
Stuff spuckt verächtlich. »Das Mistblatt. Kunststück. Wenn man fünfzehntausend Auflage hat.«
»Die haben ebenso gut fünfzehntausend, wie wir siebentausend haben wollen.«
»Bitte, wir haben eine notarielle Bescheinigung über siebentausend.«
»Du musst die Stelle mal radieren, wo das Datum steht. Die ist schon ganz schwarz vom Zuhalten mit deinem Daumen, all die drei Jahre, seit die Zahl mal richtig war.«
»Ich spucke auf die notarielle Bescheinigung. Aber den ›Nachrichten‹ wischt ich für mein Leben gern was aus.«
»Geht nicht. Der Chef will es nicht haben.«
»Natürlich, weil sich der Chef von den Fritzen Geld pumpt, müssen wir uns anstinken lassen.«
Wenk setzt den Bohrer neu an. »Also gar nichts hast du, Tredup?«
»Eine achtel Seite von Braun. Für neun Mark.«
Stuff stöhnt. »Neun Mark? Tiefer geht es nicht mehr.«
»Und sonst nichts?«
»Die Ausverkaufsanzeige vom verkrachten Uhrenschlosser hätt’ ich kriegen können, aber wir sollen Ware dafür abnehmen.«
»Bloß das nicht. Was mach ich mit Weckern? Ich steh doch nicht auf, wenn die Dinger klingeln.«
»Und der Zirkus Monte?«
Tredup bleibt im Auf-und-ab-Rennen stehen. »Ich hab dir doch gesagt, es ist nichts, Wenk. Nun lass gefälligst auch das Meckern sein.«
»Aber den Monte haben wir doch jedes Jahr gehabt! Bist du überhaupt dagewesen, Tredup?«
»Ich will dir was sagen, Wenk. Ich will dir in aller Ruhe und Freundschaft mal was sagen, Wenk. Wenn du noch einmal so was sagst von ›überhaupt dagewesen‹, dann klebe ich dir eine …«
»Aber wir haben ihn doch jedes Jahr gehabt, Tredup!«
»So, haben wir …? Und ich will dir was sagen, dann werden wir ihn dieses Jahr eben mal nicht haben. Und du kannst es mir sagen, und der Chef kann es mir sagen, und Stuff kann mir’s sagen: Ich gehe nicht wieder in diesen Scheißzirkus vorfragen.«
»Was war denn?«
»Was war? Mist war. Frechheit war. Zigeunerfrechheit, semitisches, widerliches Gehabe war. Vorgestern war die Voranzeige in den ›Nachrichten‹. Ich töffele hin, ganz auf den Jugendspielplatz. Der Zirkus war überhaupt noch nicht da.«
»Dann hat der Manager in den ›Nachrichten‹ die Anzeige aufgegeben.«
»Und bei uns ist er vorbeigelaufen. Eben. Gestern früh wieder hin. Die sind beim Aufbau. Wo ist der Manager? Über Land. Plakate in die Kuhdörfer kleben. Als ob die Bauern jetzt in Stimmung wären! Soll um eins wiederkommen. Um eins isst der Manager. Gut, ich warte eine Stunde. Der Manager, so ein verfluchter gelber Zigeuner, will mit seinem Chef reden. Ich soll um sechs wiederkommen. Ich bin um sechs da. Hat den Chef noch nicht sprechen können, soll heute früh wiederkommen.«
»Alle Achtung, immer nach dem Jugendspielplatz raus!«
»Das denke ich auch. Heute früh lerne ich den großkotzigen Chef kennen, diesen Herrn über anderthalb Affen, eine spätkranke Kracke und ein vermottetes Kamel. Hut in der Hand, Diener bis auf die Erde.
Und dieses Mistvieh, dieses Stinktier sagt, es lohnt sich ihm nicht, in der ›Chronik‹ zu inserieren! Kein Mensch lese unser Käseblättchen!«
»Was hast du ihm gesagt?«
»Am liebsten hätt’ ich ihm ein paar lackiert. Nun, ich dachte an meine Familie und habe Leine gezogen. Schließlich will meine Frau am Ersten auch ihr Wirtschaftsgeld haben.«
Stuff nimmt den Klemmer ab und fragt: »Hat er ›Käseblättchen‹ gesagt? Hat er wirklich ›Käseblättchen‹ gesagt?«
»So wahr ich hier stehe, Stuff!«
Und Wenk hetzt: »Das sollte ihm nicht so hingehen. Das wäre doch etwas für dich, Stuff. Du solltest ihn anmisten, nach Noten.«
»Tät ich. Tät ich. Aber der Chef will es doch nicht …«
»Das wäre mal eine schöne Gelegenheit, den Inserenten Angst zu machen. Kriegt einer was auf den Deckel, inserieren die anderen wieder ein Weilchen aus Angst.«
»Aber der Chef …«
»Ach was, der Chef! Wir gehen alle drei zu ihm hin und sagen, dass was geschehen muss.«
»Anmisten tät ich ihn brennend gerne«, murmelt Stuff.
»Halt!« schreit Tredup. »Ich weiß was. Du verlangst, dass du die Roten anmisten darfst, dann erlaubt er dir wenigstens den Monte.«
»Nicht übel«, nickt Stuff. »Ich weiß da gerade eine Geschichte mit dem Polizeimeister …«
»Na also, gehen wir ins Labor …«
»Jetzt gleich?«
»Na, natürlich gleich. Du musst doch die Eröffnungsvorstellung von gestern Abend runterreißen.«
»Also gehen wir zum Chef.«
3
In der Setzerei gab es einen Aufenthalt. Die beiden Linotypes waren verlassen, und die Maschinensetzer standen mit den Akzidenzsetzern und dem Metteur am Fenster. Sie starrten auf den Hof. Es war still im Raum, ein ungewohntes Atemanhalten.
Wenk fragte: »Ist jetzt Frühstück? Was gibt es?«
Ein wenig zögernd tat sich der Haufe am Fenster auseinander. Der Metteur, ehrliche Kümmernis im faltigen Gesicht, sagte: »Jetzt liegt sie draußen.«
Die drei gingen durch die Gasse Pausierender vor die Scheibe, taten einen Blick, auch ihnen verschlug es die Rede.
Es ist nur ein kleiner Hof, rings von Häusern umstanden, mit Fliesen belegt, einem spärlichen Grünfleck in der Mitte. Um sein schütteres Gras läuft ein Gitter, eines jener niedrigen gusseisernen Gitter, die nichts schützen. Fußfallen im Dunkel.
Aber jetzt war heller Tag, und sie war doch darüber gefallen. Sie lag dort auf dem Gras, wie sie hingestürzt, die schwarzen halblangen Röcke hatten sich verschoben, man sah unordentlich angezogene Strümpfe, schwarz gestrickt, weiße Wäsche.
»Sie wird über den Hof hinten zum Krüger gegangen sein, sich neuen Schnaps holen.«
»Der Fritz hat ihr um acht schon eine Pulle gebracht.«
»Sie ist ohne Besinnung.«
»Nein, sie weiß schon, sie will so liegen vor all den Fenstern.«
»Es ist, seit sich der Junge totgetrunken hat.«
Plötzlich sprechen alle auf einmal. Alle stehen sie und starren auf den schwarzen, hingestürzten Schatten.
Stuff schiebt die Schultern vor, drückt den Klemmer fest. »Das geht nicht. Komm, Tredup, wir holen sie.«
Wenk blickt den Fortgehenden nach. Er fragt besorgt: »Ob das richtig ist? Der Chef sieht das auch vom Labor.«
Der alte Metteur sagt giftig: »Seien Sie man sicher, Herr Wenk, wenn der seine Frau so sieht, dann sieht er sie nicht.«
Wenk geht den beiden nach. Er merkt auf dem Hof an allen Fenstern zurückfahrende Köpfe, die bei ihrer Neugierde nicht erwischt werden wollen.
Morgen ist es durch die ganze Stadt. Die Frau hat so viel Geld und suhlt sich im Dreck. Ich sollte ihr Geld haben …
So ist das Leben, denkt der Annoncenjäger. Na ja, der übliche Salat … Nicht der Sohn, der sich totsoff, hat ihr den Rest gegeben, aber dass es alle Leute wissen, dass er so umkam … So ’ne kleine Stadt.
»Kommen Sie, gnädige Frau. Setzen Sie sich auf.«
Es ist ein verwüstetes Gesicht – blutleer, graugelb, mit hängenden Falten – das verdrossen zur Sonne blinzelt. »Macht das Licht aus«, murrt sie. »Stuff, mach es aus. Noch ist Nacht.«
»Kommen Sie man, Frau Schabbelt. Wir trinken auf der Redaktion einen Grog, und ich erzähle Ihnen Witze.«
»O du Schwein«, sagt die Betrunkene, »glauben Sie, es ist mir um Witze?« Und plötzlich lebhaft: »Ja, erzähle Witze. Er hört sie immer gern. Ich darf an seinem Bett sitzen, er ist mir nicht mehr bös.«
Und plötzlich, im Aufstehen, im Gehen zwischen den beiden (Wenk folgt, schlenkert die Kognakflasche verächtlich zwischen den Fingern), plötzlich scheint sie in die Ferne zu horchen: »Keine Witze mehr, Herr Stuff. Ich weiß schon, Herbert ist tot. Aber auf Ihrem Sofa will ich liegen, wenn das Telefon geht und der Radiobericht kommt und die Zeitung läuft durch die Maschine. Es ist dann wie richtiges Leben.«
In der Setzerei ist ein hastiger, verlegener Arbeitsanfang. Niemand blickt hoch.
»Vergesst den Kognak nicht!« ruft plötzlich die Frau.
Auf dem Sofa bekommt sie noch ein Glas voll, und schon schläft sie mit offenem Munde, schlaffem Kiefer, besinnungslos.
»Wer bleibt bei ihr?« fragt Stuff. »Einer muss bleiben.«
»Wollt ihr jetzt noch zum Chef?«
»Wer so fragt, bleibt. Komm, Tredup.«
Sie gehen. Wenk sieht ihnen nach. Sieht auf die schlafende Frau, horcht nach der Expedition, fasst die Kognakflasche und gießt sich kräftig einen hinter die Binde.
4
Das Laboratorium ist kein modernes Labor aus Glas, mit Sauberkeit, Helle und Luft, es ist der Spelunkenwinkel eines tüterigen Erfinders, der in einem Wust von Geräten, Ideen, Schutt und Schmutz ertrinkt.
An einem Tisch mit säurezerfressenem Linoleum sitzt eine Art Gnom mit weißem Strubbelbart, ein fettes, kugeliges Geschöpf, eine Art rotlackierter Zwerg. Er hat die sehr gewölbten, hellblauen schwachen Augen gegen die Eintretenden gehoben. »Bin nicht zu sprechen. Macht euern Mist alleine.«
Stuff sagt: »Gerade anmisten möcht’ ich jemand, Herr Schabbelt. – Wenn Sie erlauben.«
Der Zwerg hebt eine Zinkplatte gegen das Licht, prüft sie sorgenvoll: »Die Autotypie kommt nicht.«
»Vielleicht ist der Raster zu fein, Herr Schabbelt?«
»Was verstehen Sie davon? Hinaus, habe ich gesagt! Was stinkt der Tredup hier herum? Raus! – Sieh da, zu fein. Dumm bist du nicht, Stuff. Das mag angehen. – Wen willst du anmisten?«
»Die Roten.«
»Nein. Fünfundfünfzig Prozent unserer Leser sind Arbeiter und kleine Beamte. Die Roten? Nie! Wenn wir auch rechts sind.«
»Es ist eine sehr gute Geschichte, Herr Schabbelt.«
»Erzähle sie, Stuff. Sieh, wo du Platz findest. Aber der Tredup muss raus. Er stinkt nach Akquisition.«
»Ich möchte schon gerne was andres tun«, murrt Tredup.
»Quatsch! Du tust es gern. Raus mit dir!«
»Wir brauchen ihn noch. Nachher zu der Geschichte.«
»Also stellen Sie sich dort ins Dunkel. Erzähle los, Stuff.«
»Sie kennen Kallene, den Polizeimeister? Natürlich. Nach der Revolution wurde er rot. SPD oder USPD, jedenfalls wurde er belohnt. Der dümmste aller Polizeidiener wurde Polizeimeister.«
»Weiß ich.«
»Und als er’s war, trat er aus der Partei aus, gab das Parteibuch zurück, wurde streng deutschnational, wie er vorher gewesen.«
»Und?«
»Na, der macht abends auf dem Rathaus Aufsicht über die Reinemachefrauen. Wenn die Büros leer sind, Herr Schabbelt!«
»Und?«
»Da sind so ein paar junge Weiber dabei, einfach Klasse. Man kann es sich ja denken, wenn sie so rutschen über den Boden, man bekommt da Einblicke …«
»Du kannst es dir jedenfalls denken, Stuff.«
»Na natürlich, nicht nur der Kallene kommt bei so was auf andere Ideen.«
»Mach’s kurz, Stuff. Wer hat ihn erwischt?«
»Der rote Bürgermeister!« schreit Stuff. »Der dicke Gareis. Auf seinem Schreibtisch haben sie’s gemacht.«
»Und?«
»Na, Herr Schabbelt! So eine Frage! Jetzt hat der Kallene wieder das Parteibuch.«
»Es ließe sich etwas daraus machen«, meint Schabbelt. »Aber nicht für uns. Etwa für die KPD. Tredup kann es weiterquatschen.«
»Herr Schabbelt!«
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Stuff. Sehen Sie, wie Sie sonst Ihre Spalten vollkriegen mit Lokalem.«
»Aber wenn wir nie stänkern dürfen! Das Blatt wird so doof. Man nennt uns schon ›Käseblättchen‹.«
»Wer?«
»Ist es nicht wahr, Tredup?«
Tredup tritt aus dem Schatten, ganz gallig: »Schmierblättchen. Stinkmakulatur. Hakenkreuzruh. Scheißhausklappe. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit.«
Stuff hebt seine Stimme: »Tante vom Kuhdorf. Der Langeweiler über alle Wände. Der Treppenfurz. Die Gakelei. Der Blinddarm. Der Maulwurf. Lies und schlaf.«
Tredup wieder: »Ich beeide es, Herr Schabbelt. Heute Morgen erst hat mir ein Inserent gesagt …«
Der Chef ist zu seinen Zinkplatten zurückgekehrt: »Wen wollt ihr also anstänkern?«
Beide: »Den Zirkus Monte.«
Und Schabbelt: »Meinetwegen. Dass die Nicht-Inserenten wieder einmal Angst kriegen. Und zur Belohnung wegen des zu feinen Rasters.«
»Schönen Dank, Herr Schabbelt.«
»Schon gut. Aber diese Woche lasst ihr mich nun gefälligst in Frieden. Ich habe keine Zeit.«
»Wir kommen schon nicht her. Guten Morgen.«
5
Stuff sitzt am Schreibtisch und sieht auf die immer noch schlafende Frau. Ihr Gesicht hat sich etwas gerötet, ihre eisgrauen Haarzotteln liegen um den Kopf, hängen in ihr Gesicht. Er denkt: Die Kognakflasche ist beinahe leer. Als ich den Wenk rausschickte, stank er nach Schnaps. Jetzt säuft er sogar der besoffenen Chefin den Schnaps weg. Ich werde es ihm stecken.
Wieder nach der Frau hin: Ich werde ihr einen Kaffee machen lassen, einen heißen Mokka, dass sie ihn trinkt, wenn sie aufwacht. Ich werde nach der Grete klingeln.
Er sieht auf den Klingelknopf neben der Tür, dann auf das weiße Papier vor sich auf dem Pult. Schließlich, was hilft ihr ein Mokka? Gar nichts.
Er dreht an den Knöpfen des Radios. Eine Stimme ertönt: »Achtung! Achtung! Achtung! Hier ist der sozialdemokratische Pressedienst! Achtung!«
Äh, scheiß! Werde ich meinen Riemen schreiben.
Er setzt an, denkt nach und schreibt dieses:
»Ein kleiner Zirkus namens Monte hat auf dem Jugendspielplatz sein Domizil aufgeschlagen und gab gestern Abend seine Eröffnungsvorstellung. Die Leistungen sind in keinem Punkte überragend und kommen nirgends über ein Mittelmaß hinaus. Nach den Darbietungen, die unsere Vaterstadt vor noch nicht langer Zeit im Zirkus Kreno und im Zirkus Stern bewundern durfte, sind die Nummern des Monte-Programms klägliches Surrogat, das allenfalls für Kindervorstellungen ausreicht.«
Er überliest noch einmal das Geschriebene. »Das wird es tun, denke ich.«
Er klingelt. Der Lehrling Fritz kommt. »Das soll gleich gesetzt werden. Und sag dem Metteur, er soll es als lokale Spitze bringen. Ich geh jetzt erst auf die Kriminalpolizei und dann aufs Schöffengericht. Wenn noch was ist, rufe ich an. Gut. – Halt, sage der Grete, sie soll der Frau Schabbelt einen Mokka machen.«
Der Junge geht ab. Stuff sieht auf die schlafende Frau, dann nach der Kognakbuddel. Er hebt die Buddel und trinkt den Rest aus. Er schüttelt sich.
Heute Abend werde ich mich besaufen. Heute Abend werde ich Amok laufen, denkt er. Mich betäuben, weg sein, vergessen. Das schweinischste Handwerk auf der Welt: Lokalredakteur sein in der Provinz.
Er sieht betrübt durch seine Klemmergläser und schiebt ab, zur Krimpo1 und zu den Schöffen.
Kriminalpolizei <<<
ERSTES BUCH: Die Bauern
ERSTES KAPITEL – Eine Pfändung auf dem Lande
6
Auf der Station Haselhorst steigen zwei Männer aus dem Personenzug, der von Altholm nach Stolpe fährt. Beide sind städtisch gekleidet, tragen aber über dem Arm Regenmäntel, in der Hand derbe Knotenstöcke. Der eine ist ein Vierziger und sieht verdrossen aus, der junge dürre Zwanziger blickt sich lebhaft nach allen Seiten um. Alles interessiert ihn.
Sie durchqueren Haselhorst auf der Dorfstraße. Überall schauen aus dem Grün die Dächer der Bauernhäuser, bald mit Stroh, bald mit Reet, bald mit Ziegeln, bald mit Zink gedeckt. Jeder Hof liegt für sich, wendet, meistens von Bäumen umstanden, nur die Schmalseite seines Wohnhauses der Landstraße zu.
Sie haben Haselhorst hinter sich und gehen nun unter Ebereschen auf der Chaussee nach Gramzow. In den Koppeln steht Vieh, schwarzbunt und rotbunt, sieht sich auch einmal, langsam weiterkäuend, nach den Wanderern um.
»Es ist schön, einmal aus dem Büro herauszukommen«, sagt der Junge.
»Das habe ich auch einmal gedacht«, widersetzt der Alte.
»Immer und ewig nur Zahlen, es ist nicht auszuhalten.«
»Zahlen sind bequemer als Menschen. Man weiß, was man von ihnen zu erwarten hat.«
»Meinen Sie denn wirklich, Herr Kalübbe, dass etwas passieren kann?«
»Reden Sie keinen Quatsch. Selbstverständlich passiert nichts.«
Der Junge fühlt nach der Gesäßtasche. »Jedenfalls habe ich meine Pistole parat.«
Der Ältere bleibt mit einem Ruck stehen, schüttelt wütend die Arme, sein Gesicht läuft blaurot an: »Sie Idiot, Sie! Sie gottgeschlagener Querkopf!«
Seine Wut steigert sich noch. Er wirft Mantel und Stock auf die Chaussee, seine Aktentasche, die er unterm Mantel trug, dazu.
»Da! Da haben Sie es! Machen Sie den Dreck alleine! So eine Hirnverbranntheit! Und solch ein Bulle …« Er kann nicht weiterreden.
Der Jüngere ist weiß geworden, aus Kränkung, Ärger, Schreck. Aber er kann sich beherrschen. »Ich bitte Sie, Herr Kalübbe, was habe ich gesagt, dass Sie derart erregt sind!«
»Wenn ich schon so etwas höre! Die Pistole parat! Wollen Sie unter die Bauern mit einer Pistole gehen? Ich habe Frau und drei Kinder.«
»Aber ich bin heute früh noch einmal vom Finanzrat über den Gebrauch der Waffe belehrt worden.«
Kalübbe ist ganz Verachtung. »Der! Sitzt hinter seinem Schreibtisch. Kennt nur Papier. Einen Tag sollte er hier draußen mit mir pfänden gehen, nach Poseritz oder Dülmen oder auch heute nach Gramzow … Er würde keine Belehrungen mehr erteilen!!«
Kalübbe grinst schadenfroh schon bei dem Gedanken, dass der Herr Finanzrat ihn bei seinen Pfändungsgängen begleiten könnte.
Plötzlich lacht er. »Da, ich werde Ihnen was zeigen.« Er holt aus der Gesäßtasche seine Pistole, richtet sie auf den Kollegen.
»Machen Sie keine Geschichten«, ruft der und springt zur Seite.
Kalübbe drückt los. »Sehen Sie: nichts! Gar nicht geladen. Das halte ich von dieser Art Schutz.«
Er steckt seine Pistole wieder ein. »Und nun geben Sie mir Ihre.« Er zieht den Lauf kräftig zurück, wirft Patrone auf Patrone aus. Der Junge sammelt sie schweigend auf. »Stecken Sie die Dinger in die Westentasche und geben Sie sie heute Abend dem Finanzrat zurück. Das ist meine Belehrung über den Waffengebrauch, Thiel.«
Thiel hat auch Stock und Mantel und Tasche schweigend aufgehoben und reicht alles dem Kollegen. Sie gehen weiter. Kalübbe sieht über die Wiesen, die von Hahnenfuß gelb, von Schaumkraut weißrosa sind. »Sehen Sie, Thiel, Sie müssen mir das nicht übelnehmen. Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. – Das ist recht. Alle, die ihr dort drinnen sitzt auf dem Finanzamt, ihr habt ja keine Ahnung, was das heißt, hier draußen Dienst tun.
Habe mich auch gefreut, als ich Vollstreckungsbeamter wurde. Nicht nur die Diäten und die Bewegungsgelder. Ich kann sie wahrhaftig brauchen, mit der Frau und den drei Kindern. Sondern draußen sein, hier, an einem Frühlingstag, und alles ist frisch und lebendig. Nicht so bloß Steine. Und man geht durch.
Und jetzt – jetzt ist man der schändlichste, schmählichste Dreck am Stecken des Staates.«
»Herr Kalübbe, Sie, der so gelobt werden!«
»Ja, die drinnen! Wenn ein Bauer zu euch kommt und wenn zehn Bauern zu euch kommen, so sind es Bauern in der Stadt. Und wenn sie wirklich einmal frech werden, wie ihr es nennt, so seid ihr viele. Und hinter der Barre. Und der Fernsprecher zur Polizei an der Wand.
Hier aber, wo wir jetzt gehen, da hat der Bauer gesessen vor hundert Jahren und vor tausend Jahren. Hier sind wir die Fremden. Und ich gehe mit meiner Aktentasche und mit meinen blauen Piepmatzmarken ganz allein zwischen ihnen herum. Und ich bin der Staat, und wenn es gut geht, nehme ich ihnen eine Ecke von ihrem Stolz und die Kuh aus dem Stall, und geht es schlimm an, dann mache ich sie heimatlos, wo sie seit tausend Jahren saßen.«
»Können sie denn wirklich nicht zahlen?«
»Manchmal können sie nicht, und manchmal wollen sie nicht. Und in letzter Zeit wollen sie überhaupt nicht. – Sehen Sie, Thiel, es sind immer reiche Bauern gewesen, sie haben immer aus dem vollen gelebt, und nun will es ihnen nicht eingehen, dass sie Fastenbrot essen müssen. Und dann sollen sie ja auch nicht richtig rationell wirtschaften …
Aber was verstehen wir davon? Es geht uns nichts an. Was gehen uns die Bauern an! Sie essen ihr Brot, und wir essen unseres. Aber was mich angeht, das ist, dass ich zwischen ihnen umhergehe wie ein unehrlicher Mensch, wie ein Scharfrichter aus dem Mittelalter, der geächtet war, wie ein Hurenmädchen mit dem Rädchen auf dem Arm, vor dem sie alle ausspucken, mit dem keiner an einem Tisch sitzen mag.«
»Halt! Einen Augenblick!« ruft Thiel und hält den Kollegen am Arm. Im Staub sitzt ein Schmetterling, ein braunbuntes Pfauenauge, mit zitternden Flügeln. Seine Fühler bewegen sich tastend in der Sonne, im Licht, in der Wärme.
Und Kalübbe zieht den Fuß zurück, der schon über dem Tier schwebte. Zieht ihn zurück und bleibt stehen, sieht hinab auf den beseelten farbigen Staub.
»Ja, auch das gibt es, Thiel«, sagt er erleichtert. »Weiß Gott, Sie haben recht. Auch das gibt es. Und manchmal wird der Fuß zurückgezogen. – Und nun bitte ich Sie nur um eines.«
»Ja?« fragt Thiel.
»Sie sind eben der Beherrschte gewesen und ich der Schreier. Mag angehen, dass sich heute noch einmal unsere Rolle ändert. Dann denken Sie daran, dass Sie jede Schmähung, jede Beleidigung ohne Widerspruch ertragen müssen, hören Sie, müssen. Dass ein guter Vollstreckungsbeamter keine Strafanträge wegen Beleidigung stellt, sondern vollstreckt. Dass Sie nie die Hand heben dürfen, selbst wenn ein anderer die Hand hebt. Es gibt immer zu viele Zeugen gegen Sie. Es gibt nur Zeugen gegen Sie. Wollen Sie daran denken? Wollen Sie mir das versprechen?«
Thiel hebt die Hand.
»Können Sie es auch halten?«
»Ja«, sagt Thiel.
»Dann also: Gehen wir dem Päplow in Gramzow seine beiden Ochsen versteigern.«
7
Die Uhr geht auf elf. Es ist immer noch Vormittag, und die beiden Finanzbeamten haben sich eben die Hand gegeben auf der Chaussee nach Gramzow.
Im Krug von Gramzow ist es drangvoll. Alle Tische sind besetzt. Die Bauern sitzen vor Bier und Grog, auch die Schnapsgläser fehlen nicht. Aber es ist fast still im Gastzimmer, kaum ein Wort wird laut. Es ist, als horchten alle nach hinten.
Hinten in der Wirtsstube sitzen auch Bauern, um den Tisch mit der Häkeldecke, unter dem Nussbaumregulator. Sieben Bauern sitzen dort, einer steht an der Tür, der achte. Im Sofa sitzt hinter seinem Grog ein Langer mit scharfgeschnittenem Gesicht voll unzähliger Falten, mit kalten Augen und schmalen Lippen. »Also«, spricht er und bleibt sitzen, »ihr, eingesessene Bauern von Gramzow, habt gehört, was der Bauer Päplow vorzubringen hat gegen den Entscheid des Finanzamtes in Altholm. Wer für ihn ist, hebe die Hand. Wer gegen den Bauern ist, lasse sie ungekränkt unten. Jeder tue, wie ihm dünkt, aber nur, wie ihm dünkt. – Stimmt ab.«
Sieben Hände erheben sich.
Der lange Bartlose steht aus dem Sofa auf. »Stoß die Tür auf, Päplow, zum Gastzimmer, dass alle hören. Ich verkünde den Beschluss der Bauern von Gramzow.«
Die Tür geht auf, und im gleichen Augenblick erheben sich die Bauern draußen. Der Lange fragt durchs Lokal zu einem weißbärtigen Bauern an der Außentür: »Sind die Wachen besetzt?«
»Sie sind besetzt, Vorsteher.«
Der Lange fragt nach der Tonbank mit dem kleinen wieselartigen Wirt: »Ist kein Weibervolk in der Nähe, Krüger?«
»Kein Weibervolk, Vorsteher.«
»So verkünde ich, der Gemeindevorsteher Reimers von Gramzow, den Beschluss der Bauernschaft, gefasst von ihren erwählten Vertretern:
Es liegt ein Entscheid des Finanzamts Altholm vom zweiten März vor gegen den Bauern Päplow, dass er zu zahlen hat an rückständiger Einkommensteuer aus dem Jahre 1928 vierhundertdreiundsechzig Mark.
Wir haben zu diesem Entscheid den Bauern Päplow gehört. Er hat geltend gemacht, dass dem Entscheid die Durchschnittsertragsberechnung für Höfe dieser Gegend zugrunde liegt. Dass dieser Durchschnittsertrag auf sein Anwesen aber keine Anwendung finden könne, weil er im Jahre 1928 außerordentliche Schädigungen erlitten hat. Zwei Pferde sind ihm eingegangen an Kolik. Eine Sterke ist beim Kalben verreckt. Seinen Vater, den Altenteiler, hat er ins Krankenhaus nach Altholm schaffen müssen und dort über ein Jahr erhalten.
Diese Gründe zum Steuernachlass sind dem Finanzamt bekanntgemacht, sowohl direkt, durch den Bauern Päplow, wie durch mich, den Gemeindevorsteher. Das Finanzamt hat die Veranlagung aufrechterhalten.
Wir Bauern von Gramzow erklären den Beschluss des Finanzamtes Altholm für null und nichtig, weil er einen Eingriff in die Substanz des Hofes bedeutet. Wir verweigern dem Finanzamt und seinem Auftraggeber, dem Staat, jede Mithilfe in dieser Sache, es geschehe uns Liebes oder Leides.
Die vor fünfzehn Tagen vorgenommene Pfändung zweier gut angegraster Ochsen des Bauern Päplow ist nichtig. Wer bei der heute angesetzten Versteigerung dieser Ochsen ein Gebot auf sie abgibt, soll von Stund an nicht mehr Glied der Bauernschaft sein. Geächtet soll er sein, niemand darf ihm Hilfe leisten, sei es in Nöten der Wirtschaft, des Leibes oder der Seele. In Acht soll er sein, in Gramzow, im Kreise Lohstedt, im Lande Pommern, im Staate Preußen, im ganzen Deutschen Reiche. Niemand darf zu ihm sprechen, niemand darf ihm die Tageszeit bieten. Unsere Kinder sollen nicht mit seinen Kindern sprechen, und unsere Frauen sollen nicht mit seiner Frau reden. Er lebe allein, er sterbe allein. Wer gegen einen von uns handelt, hat gegen uns alle gehandelt. Der ist heute schon tot.
Habt ihr alle gehört, Bauern von Gramzow?«
»Wir haben gehört, Vorsteher.«
»So handelt danach. Ich schließe die Bauernversammlung. Die Wachen sind zurückzuziehen.«
Die Tür zwischen Gast- und Wirtsstube geht wieder zu. Der Gemeindevorsteher Reimers setzt sich, wischt sich die Stirn ab und tut einen Zug vom kalt gewordenen Grog. Dann sieht er auf die Uhr. »Fünf Minuten bis elf. Es wird Zeit, dass du verschwindest, Päplow, sonst kann dir der Knecht vom Finanzamt das Protokoll vorlesen.«
»Ja, Reimers. Aber wie wird es, wenn sie die Ochsen forttreiben?«
»Sie werden die Ochsen nicht forttreiben, Päplow.«
»Wie willst du es hindern? Mit Gewalt?«
»Keine Gewalt. Nie Gewalt gegen diesen Staat und seinen Verwaltungsapparat. Ich weiß etwas anderes.«
»Wenn du etwas anderes weißt … Es müsste nur sicher sein. Ich brauche das Geld für die Ochsen.«
»Es ist sicher. Morgen wissen alle Bauern im Land, wie man in Gramzow mit dem Finanzamt fertig wird. Geh nur ruhig.«
Der Bauer Päplow geht durch die Hintertür über den Hof hinaus, verschwindet an einem Knick. Die sieben Bauern gehen in die volle Gaststube.
8
Vor den Fenstern der Wirtschaft entsteht Bewegung: Die beiden Beamten vom Finanzamt kommen. Jeder führt einen rotbunten Stier am Halfter.
Sie sind auf dem Hof von Päplow gewesen. Irgendein Knecht war da und hat sie in den Stall gelassen zu den gepfändeten Tieren. Kein Bauer war zu sehen, keine Bäuerin, niemand, der Auftrag gehabt hätte, die Pfandsumme zu erlegen. So haben sie die Tiere aufgehalftert und sind mit ihnen zum Krug gekommen, die angesetzte und bekanntgemachte Versteigerung abzuhalten.
Sie binden die Tiere ans Reek vor der Tür und treten in die Wirtschaft. Im Gastzimmer ist Gerede gewesen, halblauter Meinungsaustausch, auch ein Fluch vielleicht, als man die Männer sah mit den beiden Tieren. Nun ist es still. Aber dreißig, vierzig Bauern sehen stur auf die Beamten, sehen ihnen ins Gesicht und verziehen nicht das eigene.
»Ist hier vielleicht Herr Päplow aus Gramzow?« fragt Kalübbe in die Stille.
Die Bauern sehen auf ihn und den Jungen, keiner spricht.
»Herr Päplow hier?« fragt Kalübbe mit erhobener Stimme.
Keine Antwort.
Kalübbe geht durch den Mittelgang der Gaststube zur Tonbank hin. Unter all den feindlichen Blicken geht er gehemmt und unbeholfen. Einen Stock, der über einer Lehne hängt, stößt er um. Er fällt polternd hin. Kalübbe bückt sich danach, hebt ihn auf, hängt ihn über die Lehne, sagt: »Pardon.«
Der Bauer sieht ihn an, stur, dann zum Fenster hinaus, verzieht nicht das Gesicht.
Kalübbe sagt zum Krüger: »Ich soll hier eine Versteigerung abhalten, wie Sie wissen. Wollen Sie mir einen Tisch hersetzen lassen?«
Der Krüger murrt: »Hier ist kein Tisch und kein Raum für einen Tisch.«
»Sie wissen, dass Sie Platz zu machen haben.«
»Wie soll ich es machen, Herr? Wen soll ich fortschicken? Vielleicht machen Sie sich Platz, Herr?«
Kalübbe sagt mit Nachdruck: »Sie wissen …«
Und der wieselige Krüger eilfertig: »Ich weiß. Ich weiß. Aber geben Sie mir einen Rat. Kein Gesetz, verstehen Sie, einen brauchbaren Rat.«
Eine Stimme ruft befehlend durchs Lokal: »Setz einen Tisch vor die Tür.«
Plötzlich ist der kleine Krüger ganz Beweglichkeit, Höflichkeit: »Einen Tisch vor die Tür. Selbstverständlich. Die beste Idee. Man kann dann auch das Vieh sehen.«
Der Tisch wird nach draußen gebracht. Der Krüger trägt eigenhändig zwei Stühle herbei.
»Und nun zwei Glas Helles für uns, Krüger.«
Der Krüger bleibt stehen, sein Gesicht legt sich in Falten, Kummer ist darin. Er schielt zu den offenen Fenstern, hinter denen die Bauern sitzen. »Meine Herren, ich bitte Sie …«
»Zwei Glas Helles! Was soll das?«
Der Krüger hebt ganz schnell die Hände zu einer Bitte: »Meine Herren, verlangen Sie nicht von mir …«
Kalübbe sieht rasch zu Thiel hin, der das Gesicht über die Tischplatte gesenkt hält. »Sehen Sie, Thiel!« Und zum Krüger: »Sie müssen uns Bier ausschenken. Wenn Sie’s nicht tun und ich zeige Sie an, sind Sie die Konzession los.«
Und der Krüger vollendet im gleichen Ton: »Und wenn ich’s tue, bin ich meine Gäste los. So kaputt und so kaputt, Herr.«
Kalübbe und der Krüger sehen sich an, eine lange Zeit, scheint es.
»Also sagen Sie drinnen, dass die Auktion beginnt.«
Der Krüger macht eine halbe Verbeugung. »Solange es geht, soll der Mensch Mensch bleiben.«
Er geht. Der Beamte nimmt aus seiner Aktentasche Protokoll und Bedingungen, legt sie vor sich auf den Tisch. Thiel möchte gern, dass er ihn jetzt einmal ansähe, darum sagt er: »Ich habe eben an die Pistole gedacht. Ich glaube, ich lerne schon, dass Waffen nichts helfen.«
Kalübbe sagt trocken und blättert in seinem Protokoll: »Es ist noch nicht Abend. Wenn wir zu Hause sind, haben Sie mehr gelernt.«
Ein Schatten fällt auf den Tisch. Ein junger Mensch, schwarz gekleidet, eine schwarze Hornbrille auf der Nase, über der Schulter den Lederriemen eines Fotoapparates, tritt hutlüftend heran. »Gestatten Sie, meine Herren, mein Name ist Tredup, von der ›Chronik für Altholm‹. Ich war eben in Podejuch,1 den Kirchenneubau für unser Blatt zu fotografieren. Im Vorbeiradeln sehe ich, hier soll eine Auktion abgehalten werden.«
»Das Inserat stand auch in Ihrem Blatt.«
»Und das ist das gepfändete Vieh? – Man hört so viel von Schwierigkeiten bei Pfändungen. Hatten Sie welche?«
»Erlaubnis zu dienstlichen Auskünften erteilt Herr Finanzrat Berg.«
»Also Sie hatten keine Schwierigkeiten? Würden Sie etwas dagegen haben, wenn ich die Auktion fotografierte?«
Und Kalübbe barsch: »Stören Sie mich nicht länger. Ich habe keine Zeit für Ihr Geschwätz!«
Tredup zuckt überlegen die Achseln. »Wie Sie meinen. Jedenfalls werde ich fotografieren. – Jeder hat seine Art Brot, und besonders süß scheint Ihres auch nicht zu schmecken.«
Er geht auf die andere Seite der Dorfstraße und beginnt seinen Apparat fertigzumachen.
Kalübbe zuckt die Achseln: »Er hat ja im Grunde recht. Es ist sein Beruf, und es war albern von mir, ihn anzugrobsen. Aber ich habe eine Wut auf die von der ›Chronik‹. Das ist schon Revolverjournalismus, was die treiben. Haben Sie vor ein paar Tagen die Kritik über den Zirkus Monte gelesen?«
»Doch. Ja.«
»Die reine Erpressung. Dabei weiß ganz Altholm, dass kein Mensch von der ›Chronik‹ zur Vorstellung war. Der Besitzer wollte wegen Geschäftsschädigung klagen, aber das hat ja alles keinen Zweck bei denen. Der Schabbelt verdreht, die Frau versoffen, der Kerl, der das Blatt schreibt, der Stuff, kriegt auch so seine periodischen Touren … Und was da sonst so rumläuft …«
»Gott! Wer liest denn die ›Chronik‹? Ich lese die ›Nachrichten‹.«
»Soll mich wundern, was der Kerl über die Auktion zusammenschmiert. Mittlerweile scheint niemand zu kommen.«
Sie sehen nach den Fenstern der Gaststube. Soviel sie erkennen können, ist es leerer dort geworden, obwohl noch genug Bauern dasitzen.
»Gehen Sie noch einmal in die Tür und rufen Sie aus, dass die Auktion beginnt. Und dann sagen Sie dem Krüger, dass er zu mir kommen möchte.«
Thiel steht auf, geht in die Tür. Kalübbe hört ihn rufen, irgendjemand antwortet. Es entsteht Gelächter, dann gebietet eine scharfe Stimme Ruhe. Nach einer Weile kommt Thiel zurück.
»Was war da eben?« fragt Kalübbe gleichmütig.
»Der Krüger wird sofort kommen. – Ach ja, irgendein Witzbold rief mir zu: ›Jung, goh no Hus, dien Mudder will di waschen!‹ Aber ein Langer hieß ihn Maul halten.«
Der Krüger tritt an den Tisch: »Bitte, meine Herren?«
»Waren keine Viehhändler heute Morgen da?«
»Doch. Viehhändler waren da.«
»Wer?«
Der Krüger zögert: »Ich weiß nicht. Ich kenne sie nicht.«
»Natürlich kennen Sie sie nicht. Und die sind wieder fortgefahren?«
»Die sind wieder fortgefahren.«
»Danke. Das war alles.« Der Krüger geht, und Kalübbe sagt zu Thiel: »Nun rufe ich noch den Fleischer Storm an. Bei dem kaufe ich selbst mein Fleisch. Vielleicht, dass der die Courage hat und kauft das Vieh zur Taxe. Das ist halb geschenkt.«
»Und wenn nicht?«
»Gott, dann rufe ich den Finanzrat an. Mag der mal entscheiden, was geschehen soll.«
Thiel sitzt und schaut auf die besonnte Dorfstraße. Ein paar Hühner suchen in Pferdeäpfeln unverdautes Korn, über den nächsten Hofeingang streicht sacht mit aufrechtem Schwanz eine Katze. Es wäre ganz schön hier, denkt er. Es ist alles beieinander, aber es ist Unrat in der Luft. Dem Kerl von der »Chronik« scheint auch klargeworden, dass aus der Auktion nichts wird. Da streicht er ab. Hat den Apparat noch in der Hand, vielleicht hat er was Besseres gefunden zu fotografieren. – Muhe nicht, Ochs. Ich habe auch Durst und kriege nichts, obwohl hier Hof bei Hof Brunnen sind. – Kalübbe ist hübsch vergrätzt, aber er nimmt es zu tragisch. Bauern sind Bauern. Ein dickes Fell und seinen Dienst tun, nichts denken. Mittelalter und Scharfrichter – wo er das her hat? Er muss richtig darauf lesen. Ich habe meinen Skat und er seine Familie und wir beide Altholm, was brauchen wir da Bauern? Und hübsch ist es doch hier, wenn auch Unheil …
Er döst ein bisschen in der Mittagssonne vor sich hin. Die Ochsen werfen die Köpfe und wehren mit dem Schwanz die Fliegen.
Podjuchy, Stadtviertel von Stettin <<<
9
Kalübbe steht wieder am Tisch. »Geschlafen? Ja, es ist ganz, als könnte ein Gewitter kommen. Heut ist ein Tag, an dem die Milch zusammenläuft. – Also, der Fleischer Storm will nicht. Er hat Angst. Denkt, er bekommt landauf, landab kein Vieh mehr zu kaufen. Lass ihn. Wird meine Frau ihr Fleisch bei einem anderen Fleischer kaufen.«
»Und der Finanzrat?«
»Ja, der Finanzrat, der hohe Herr, der Herr Berg verstehen das natürlich nicht. Die Sache ist ihm einfach unverständlich. Aber jedenfalls soll heute einmal ein Exempel statuiert werden, und die Bauern nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wir sollen die Ochsen nach Haselhorst treiben und nach Stettin verladen. Vergnügen, was? Einen Waggon habe ich eben auch gleich bestellt. Also denke ich, wir machen los. Je eher wir dort sind, um so eher kriegen wir ein Glas Bier. Der Bahnhofswirt muss ausschenken.«
»Also denn los! Welchen nehmen Sie?«
»Lassen Sie mir den mit dem krummen Horn. Der ist zappelig. Und wenn er abhauen will, den Zaum nicht loslassen und feste mit dem Stock auf die Nase. Dann vergeht ihm schon das Rennen.«
Sie haben die Stricke vom Reek losgeknotet und machen sich an den Aufbruch. Die Tür von der Wirtschaft geht auf, und Bauer auf Bauer, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend treten aus der Gaststube. Sie stellen sich längs des Weges auf, wortlos stehen sie da, sehen den Abmarsch an.
Die beiden treiben die Dorfstraße entlang. Die Tiere gehen ruhig. Kalübbe wendet sich nach Thiel um und fragt: »Gemütlich, solch ein Spießrutenlaufen?«
»Wenn es denen Vergnügen macht!«
»Natürlich! – Was ist das?«
Das Dorf ist zu Ende. Die Straße hat einen scharfen Knick gemacht, und zwischen Ebereschen liegt die Chaussee nach Haselhorst vor ihnen. Auf beiden Seiten breite, wasserreiche Vorflutgräben, und vor ihnen, dreihundert Meter weiter, haben sie ein helldunkles Gewimmel, ein Hindernis.
»Was ist das?«
»Ich kann es nicht schlaukriegen. Bauen die eine Barriere?«
»Es sieht so hell aus. Und locker. Wie Stroh. Jedenfalls kümmern wir uns um nichts. Gehen gerade durch.«
»Und wenn wir nicht vorbeikommen? Die Gräben sind zu breit.«
»So warten wir. Es wird ja irgendein Wagen oder ein Auto kommen.«
Sie sind nahe, und nun ruft Thiel erleichtert aus: »Es ist nichts. Da hat einer ein Strohfuder umgeschmissen.«
»Ja. Es scheint so.«
Aber, als sie noch näher sind: »Da stimmt doch was nicht. Die laden nicht wieder auf. Die führen ja Wagen und Pferde fort!«
»Egal! Wir gehen durch. So ein Strohbund schmeißt man mit dem Fuß beiseite.«
Jetzt sind sie ganz nahe. Drei, vier Leute stehen dort beim Stroh, das quer über die Chaussee liegt. Einer bückt sich, und plötzlich züngelt es auf, hier, dort. Eine Flamme tanzt. Zehn. Hundert. Rauch, weißer dicker Qualm wallt empor.
Die Stiere werfen die Köpfe hoch, sperren sich breitbeinig. Reißen den Leib herum.
Und plötzlich wirft sich der Wind in die Flammen, sengende Glut schlägt ihnen entgegen, sie stehen ganz im Rauch …
»Los! Los! Zurück ins Dorf!« schreit Kalübbe und hämmert wild mit dem Knüppel auf die Nase seines Stiers. Dumpf dröhnt der Nasenknorpel.
Fast Seite an Seite, taumelnd, fallend, vom Strick wieder hochgerissen, rasen sie dem Dorf zu.
Dann, hundert Schritte weiter, geht das Vieh ruhiger. Atemlos ruft Kalübbe: »Diesmal muss ich einen Bericht schreiben, es hilft nichts.«
»Und was machen wir nun?«
»Nach Haselhorst lassen uns die nicht. Das ist zwecklos. Aber nun gerade! Wissen Sie was, jetzt spielen wir ihnen einen Streich und treiben über Nippmerow, Banz, Eggermühle nach Lohstedt.«
»Vierzehn Kilometer!«
»Und wenn! Wollen Sie die Stiere dem Päplow wieder in den Stall stellen?«
»Ausgeschlossen!«
»Also!«
Jetzt sind sie wieder am Krug. Dort stehen die Bauern, sehen ihnen entgegen.
»Die haben auf uns gewartet. Na, eure Stiere sollt ihr deswegen doch nicht haben. – Glatt und möglichst rasch vorbeitreiben.«
Alle Gesichter sehen auf sie. Es sind junge und alte, sehr weißblonde, mehlige, glatte und ganz zerfurchte mit grauen und schwarzen Bärten und mit der Lederhaut der Herbststürme und Winterregen. Als sie sich nähern, löst sich der Schwarm auf. Ein Teil tritt auf die andere Seite der Dorfstraße, und nun, als sie vorbei wollen, setzen sich alle in Bewegung, gehen stumm und dicht neben ihnen her, ein Geleit. Mit gesenkten und erhobenen Gesichtern, die nichts ansehen, Handstöcke in der Hand.
Das gibt noch etwas. Das geht nicht glatt, denkt Kalübbe. Wenn ich nur an den Thiel heran könnte, dass er nicht die Ruhe verliert.
Aber die Bauern gehen zu eng, und jetzt laufen die Stiere fast, sie riechen den Päplowschen Stall.
Doch Kalübbe passt auf. Im Augenblick, da sein Stier in die heimische Hoffahrt einbiegen will, gibt er ihm einen dröhnenden Schlag aufs rechte Horn, stößt gleich darauf die Stockspitze in die Weiche, und der Stier rast los, blindlings geradeaus, die Dorfstraße entlang.
Das ging gut, denkt Kalübbe laufend und wundert sich, dass die Bauern noch nicht nachgeben, weiter nebenhertraben. Aber da ist auch schon Thiel dicht neben ihm. Vom Rennen atemlos, flüstert er dem zu: »Kümmere dich um nichts, Thiel. Strick fest ums Handgelenk. Lass dir das Tier nicht klauen. Das gehört dem Staat, und das muss jetzt nach Lohstedt, koste es, was es wolle.«





























