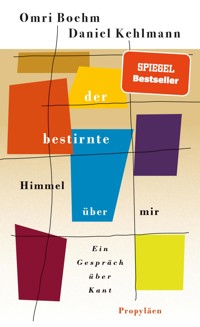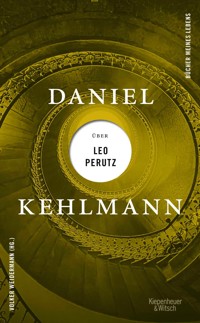Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2025
Zum 50. Geburtstag von Daniel Kehlmann: sein Debüt »Beerholms Vorstellung ergänzt um ein Nachwort des Autors«
Die Kraft der Zahlen und der Zauber der Karten, das Schleifen, Dublieren, Falschabzählen, Filieren, Palmieren – Arthur Beerholm, Zögling in einem Schweizer Internat, weiß früh um seine Begabung. Dennoch studiert er Theologie und landet erst über Umwege bei dem bewunderten Meister der Magie Jan van Rode. Mit seiner Hilfe beginnt Arthurs kometenhafter Aufstieg zum Zauberkünstler, zum weitum hofierten Publikumsliebling, der – auf der Höhe seines Ruhms – die Bühne unvermittelt wieder verlässt, weil ihm das Täuschen der Menschen nicht genügt.
Daniel Kehlmann war 22 Jahre alt, als 1997 Beerholms Vorstellung erschien. Rausch und Rationalität, Zauber und Wirklichkeit fügen sich darin zu einem frühen Meisterwerk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die Kraft der Zahlen und der Zauber der Karten, das Schleifen, Dublieren, Falschabzählen, Filieren, Palmieren — Arthur Beerholm, Zögling in einem Schweizer Internat, weiß früh um seine Begabung. Dennoch studiert er Theologie und landet erst über Umwege bei dem bewunderten Meister der Magie Jan van Rode. Mit seiner Hilfe beginnt Arthurs kometenhafter Aufstieg zum Zauberkünstler, zum weitum hofierten Publikumsliebling, der — auf der Höhe seines Ruhms — die Bühne unvermittelt wieder verlässt, weil ihm das Täuschen der Menschen nicht genügt.Daniel Kehlmann war 22 Jahre alt, als 1997 Beerholms Vorstellung erschien. Rausch und Rationalität, Zauber und Wirklichkeit fügen sich darin zu einem frühen Meisterwerk.
Daniel Kehlmann
Beerholms Vorstellung
Roman
Mit einem Nachwort des Autors
Paul Zsolnay Verlag
Solch ein Spiel verlangt Überlegung. Einem Taschenspieler zu glauben ist Abzeichen der Dummheit. Nicht anders aber der schlichte Unglaube, den er wohl zu nutzen und gegen dich zu kehren weiß. Darum merke dir: Ihm zu misstrauen, das ist die Weisheit der Toren. Jedoch selbst vor dem Misstrauen noch Vorsicht zu bewahren, das ist die Torheit der Weisen. Denn aus beidem erwächst Verwirrung. Welchen Weg du auch einschlagen willst: gewinnen wird der Taschenspieler.
Giovanni di Vincentio: Über die Kunst der Täuschung
Derowegen begreifet die Magie in sich die ganze Philosophiam, Physicam und Mathematicam, ferner die Kräfte des religiösen Glaubens.
Agrippa von Nettesheim: Von der Eitelkeit der Wissenschaften
Eins
Unsere seltsame Leidenschaft für erhöhte Standpunkte! Jede abgenützte Baukastenlandschaft wird passabel, wenn man sie von oben betrachtet. Sobald es einen Hügel gibt, drängen die Menschen hinauf. Verlangt jemand Eintrittsgeld, dann zahlen sie.
Deswegen gibt es Türme. Und an den Türmen Aussichtsterrassen. Und auf den Terrassen Tische und Stühle und Kaffee und belegte Brote und Kuchen zu überteuerten Preisen. Aber sie kommen. Man braucht sich nur umzuschauen: Alle Tische besetzt, Männer und Frauen, dicklich oder dürr, und dazwischen Kinder, viele, viel zu viele Kinder. Der Lärm! Aber man gewöhnt sich daran. Und sieh nur — wie nahe und dunkelblau der Himmel ist. Um die Sonne herum — nicht scharf hinsehen! — ins Weißliche und Unglaubhafte verfärbt. Darunter erstreckt sich die Stadt. Gemasert mit Straßen voller Autos, leuchtenden Ameisen. Da und dort schwingt sie sich zu glänzenden Türmen auf. Dazwischen Unmengen von Würfeln, matte und auch seltsam glitzernde. Aber damit kommt sie nicht weit. Schon der Horizont ist von hellgrünen Hügeln eingefasst; heute sieht man nicht sehr weit, es wird wohl regnen. Ich sollte mich beeilen.
Also fangen wir an. Wo? Am besten dort, wo alles anfängt. Und dann, Schritt für Schritt, an der Zeit entlang. Keine Erklärungen! Hätte ich die, wäre ich nicht hier, und wüsste ich etwas, würde ich nicht tun, was ich tun werde. Ich weiß noch nicht, wie lange das hier dauern wird, aber einmal, und bald, wird auch dies zu Ende sein. Also noch einmal: Fangen wir an.
Zunächst bloß Farben. Vor allem Orange, ein wässriges Grün, ein helles, sehr helles Blau. Und auf dem Grund ein reines, strahlendes Weiß. Sauberer als Neuschnee oder frische Vorhänge, eine gänzlich unirdische Farbe. Ich weiß: Man behauptet, dass Säuglinge farbenblind sind. Also gut; das mag stimmen! Die Farben sind wohl eine optische Täuschung meiner Erinnerung, oder auch eine Traumrückschau auf vergangene und kaum wirkliche Zustände vor dieser, vor jeder Existenz.
Und dann? Dann lange nichts. Welche weiblichen Wesen ließen sich dazu herab, mir mütterliche Attrappen zu sein, und in welchen weißen und desinfizierten Räumen? Ich weiß es nicht. In meinen frühen Erinnerungen findet sich keine Mutter, findet sich überhaupt kein menschliches Wesen. Alle Bilder auf den ersten verblassenden Seiten meines Gedächtnisses zeigen bloß mich, immer nur mich. Oder richtiger: Sie zeigen nicht einmal mich; aber alle Dinge sind überschattet von meiner Anwesenheit, blicken auf mich, sind durch mich, für mich. Das Gras, der Himmel, die freundliche, schattengefleckte Zimmerdecke. Als hätte es eine Zeit gegeben, in der ich der einzige Mensch auf der Welt war.
Da ist ein sonnenwarmes Frotteetuch, gelb in einer grünen, lichtduftenden Wiese. Sicher, da müssen Menschen in der Nähe sein, wer auch immer, aber sie sind nicht aufbewahrt. Nur das Tuch und der Rasen und die Luft. (Und noch heute betrachte ich die gut gewaschenen Tücher, die fette Hausfrauen in die Kamera der Fernsehwerbung halten, mit bestürzter Wehmut.) Dann wieder die Zimmerdecke, gelb auch sie, aber langsam färbt sie sich ins Graue. Ich liege in meinem Bett — der Kissenbezug zeigt einen verkrampft grinsenden rotnasigen Clown, den Kinder wohl mögen sollen, der mir aber unheimlich ist — und sehe zu, wie vor dem Fenster die Dunkelheit aus dem Himmel sickert. Aber ein dünner, länglicher Lichtstreifen in der Ritze der Tür spricht von Sicherheit, von Schutz. Natürlich, dieses Licht bedeutet die Anwesenheit anderer, aber mein Vertrauen scheint sich mehr auf das Licht selbst, seine Gegenwart und Macht, zu gründen. Das Licht — die Sonne. Der ungeheure brennende Ball; blickt man ihn an und schließt die Augen, glüht er in der Dunkelheit nach, und es dauert lange, bis die letzten kleinen Flammen ausgegangen sind. Ich muss ihn viel, viel zu viel, angestarrt haben. Er war immer da, und sei es nur in Gestalt eines Glimmens unter der Tür.
Dann ein Regenwurm, lang und rötlich, in brauner Erde unter farbigen, großen Blumen. Ich hebe ihn auf, betrachte ihn, wie er über meine Handfläche kriecht, und dann, mit seltsam mitleidlosem Interesse, nehme ich ihn an seinen Enden und reiße ihn entzwei. Ich lasse los, die beiden Hälften fallen auf die Erde und — kriechen weiter, zucken, winden sich, bewegen sich vorwärts, zwei selbständige Wesen, die einander nicht kennen und nichts miteinander zu tun haben. Ich fühle jetzt noch den Schreck, den kalten elektrischen Schlag und das Kribbeln auf meiner Haut wie von einer Reisegruppe hektischer Spinnen. Nicht ein Erschrecken vor dem Tod, im Gegenteil: vor dem Leben. Vor jenem niedrigen, sinnlosen Leben, das sich entzweispalten kann und wieder vereinen und teilen und das gliedlose Kreaturen aus Dreck formt. Vor dem Leben, wo es noch vielfältig ist und kriechend und krabbelnd und nahe am Boden im Feuchten und Schattigen. Vor dem Leben, wo es noch unberührt ist von Ordnung und Geist. Das Leben, und nicht der Tod, ist das Unvernünftigste; und nichts in der Welt ist erschreckender als reines, todloses Leben.
Es gibt noch andere Erinnerungen, aber sie widersprechen jeder Logik. Ich sehe mich verirrt in einem Wald, umringt von schwarzen, unendlich hohen Baumstämmen, und fühle mich laufen, laufen, stolpern, laufen, hinaus auf eine mondlichtgesprenkelte Wiese; wer verfolgt mich? Ich sehe mich fallen, immer wieder fallen, über Felskanten, Treppengeländer, in dunkle oder helle Abgründe; immer gibt irgendetwas nach und erweist sich als zerbrechlich, der feste Boden kippt und überlässt mich unerwartet der freien Luft, der sich unendlich schnell verkürzenden Tiefe, dem heranrasenden Erdboden. Dann wieder Insekten, dann wieder die Sonne, aber jetzt farbumlodert und unheimlich. All das kann sich nicht ereignet haben, zumindest nicht in dem Teil meines Lebens, der im Licht liegt und in der Vernunft. Er gehört auf die Nachtseite, zur Traumwelt, die mein Dasein und jedes Dasein umwuchert.
Und wann endete das alles? Zufällig weiß ich das genau. Ich saß auf dem Teppich und betrachtete einen jener pädagogischen Spielzeugkästen mit stern-, kreis-, drei- und viereckförmigen Löchern, durch die man geometrische Bausteine schieben kann. Die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, dass ein Stein nur durch jenes Loch wandern kann, das die gleichen Umrisse hat wie er selbst. Gut, ich nahm einen Kreis und versuchte, ihn in das Quadratloch zu stecken; es ging nicht; ich probierte das Dreieckloch; es ging nicht; ich probierte das Kreisloch … — es ging. Dann nahm ich ein Dreieck und sah den Baustein an und die Löcher und wieder den Baustein. Und auf einmal war alles anders. Ich sah, fühlte, wusste — jawohl, wusste, dass es eine Ordnung gab, die jedes bunte Ding auf seinen Platz, in seine Form wies, und dass irgendwo in einem unberührbaren Land ein Kreis lebte, ein Dreieck und ein Quadrat. Es mochte hier und dort und irgendwo und immerdar Kreise geben, es gab doch nur einen, einen einzigen, einen wahrhaften Kreis. So saß ich, ein zweijähriger Platoniker, auf dem Teppich und rieb mir die Augen. Eine lächelnde Holzfigur mit verformbaren Gliedern und ein dicker kleiner Plüschelefant lagen neben mir und starrten mich an, gierig nach Spielen. Aber danach war mir jetzt nicht. — Den Kasten habe ich danach nie wieder angerührt, natürlich nicht. Ich war hinter sein Geheimnis gekommen, jetzt war er langweilig. Er verschwand bald in einer Kiste in irgendeinem staubigen Keller. Doch ich verdanke ihm viel. Nicht, dass sich sofort etwas geändert hätte; aber heute glaube ich, dass ich damals, an diesem Nachmittag, zum Menschen geworden bin. Das, und nicht irgendein blutiger Moment voller Geschrei, Schmerzen und Scheußlichkeit war der Augenblick meiner Geburt.
Vor nicht ganz dreißig Jahren kam ich zur Welt, und zwar in einer mittelgroßen und mäßig hässlichen Stadt. (Unangenehm genug, aber sie hat mich kürzlich zum Ehrenbürger ernannt.) Ich kam zur Welt, um die Phrase zu wiederholen, als Sohn einer Mutter und keines Vaters.
Vor ein paar Jahren habe ich einige halbherzige Nachforschungen angestellt, aus Interesse, nicht aus innerem Bedürfnis, heftiger Seelenqual oder ähnlichem Unsinn. »Du musst«, sagten immer wieder Leute zu mir, »doch wissen wollen, woher du stammst!« Worauf ich nie etwas Besseres zu antworten hatte als: »Warum?« Nun, man behauptet, unsere Herkunft bestimme unser Leben. Ich halte das für dunkle Mystik, die versucht, den Menschen an die braune Erde zu fesseln, an sein Blut, an die Kolonie geselliger Zellen, die seinen armen Körper formt. Aber wie auch immer, hier ist, was ich herausfand:
Meine Mutter war sehr jung, viel jünger, als du jetzt bist. Ein Mädchen aus, wie man sagt, armen Verhältnissen. Ich wurde geboren, ich kam ungelegen, ich wurde freigegeben zur Adoption, alles unter Tragödien, die ich zum Glück verschlief, die freundliche Familie Beerholm nahm mich auf. Ich habe meine Mutter nie gesehen; ich hatte nie das Bedürfnis danach. Ich hätte zu ihr gehen können — ein Detektiv besorgte mir ihre Adresse —, und im Grunde könnte ich das immer noch. Aber wozu? Ich bin erwachsen, wir kennen uns nicht. Sie würde sich verpflichtet fühlen zu weinen, ich vielleicht auch, und eigentlich wäre es uns bloß furchtbar peinlich. Natürlich, ich könnte sie nach meinem Vater fragen … — Den nämlich gibt es nicht. Im Geburtsschein steht keiner, niemand weiß von einem, und auch der Detektiv erwies sich als unfähig, einen aufzutreiben. Wahrscheinlich würde meine Mutter mir sagen, wer es ist. Aber das Leben ist so geübt darin, seinen Überraschungen eine Wendung ins Enttäuschende zu geben; ich würde wohl einem senilen Eisenbahner, einem Gerichtsrat, einem glatzköpfigen Artilleriegeneral begegnen. — Nein, ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, keinen Vater zu haben. Und er gefällt mir. Er eröffnet einen traumhellen Raum von Möglichkeiten, den ich als Kind mit Helden, Königen und Astronauten bevölkerte. Und später sah ich ihn gerne leer. Es ist gut, von niemandem abzustammen.
Und wann erfuhr ich, dass sie mich adoptiert hatten? Früh, sehr früh. Da gab es keine späten Enthüllungen, kein Entsetzen, kein Zusammenbrechen von Illusionen. Ich wusste es eigentlich immer. Und es war mir egal.
Ella Beerholm, die ich wohl »Mama« nannte, als ich zu sprechen anfing, war eine breite Frau mit rundem, faltigem Gesicht und kurzgeschnittenen Haaren. Vor Zeiten, ich weiß es von Fotografien, war sie beinahe schön gewesen, doch als wir uns begegneten, stand sie in den Fünfzigern, und das war Vergangenheit. Meine Erinnerungen an sie sind die hellsten, wärmsten und ungetrübtesten, die ich besitze. Sie verschwand früh aus meinem Leben, aus dem Leben überhaupt, und damit endete die Zeit, in der alles in Ordnung war. Die Vögel am Himmel, die Leute auf der Straße, die Bäume am Horizont und der Regen am Nachmittag, all das war, überglänzt von ihrer Gegenwart, am rechten Platz. Es fällt mir schwer, Ella in Worte zu fassen; der Versuch, es zu tun, stellt mich vor die bestürzende Tatsache, dass nur noch wenig, entsetzlich wenig von ihr in meinem Gedächtnis ist. Ihre Augen natürlich, ihre Stimme. Und dann gleich ihr Pelzmantel, dick, wie geschaffen, um das Gesicht hineinzudrücken, und mit einem eigentümlichen Naphthalingeruch, dem Geruch der Sicherheit. In diesem Mantel holte sie mich täglich aus dem von Geschrei und Bösartigkeit dampfenden Raum des Kindergartens ab. Es war unsagbar schlimm, jeden Tag von neuem. Ein kleiner Kerl — damals schon erschien er mir klein — bewarf mich mit Schokoladekugeln, die er von daheim mitbrachte, wo sie eigens dafür von seiner Mama angefertigt wurden. Ein anderer saß auf dem Boden und aß Bausteine. Dutzende. Jeden Tag. Ich weiß nicht, wie er es überlebte. Ein Dritter versuchte, mit einer Stahlschaufel die Fenster einzuschlagen. Beaufsichtigt wurde das von einer überforderten, schreienden Neunzehnjährigen, die mir damals sehr alt und dumm vorkam. Es war die Hölle. Es war das äußerste Maß an Verwirrung, Willkür und Unsicherheit, und ich begriff nie, warum Ella mich täglich alldem überließ. Aber wie segensreich, wenn sie dann herabstieg und mich holte.
Einmal hatte ich die Masern, aber es ging vorbei. Muss ich erwähnen, dass Ella mich gesundpflegte, dass sie mir Rad fahren beibrachte, dass sie mich tröstete, als ich mir den Arm gebrochen hatte, und dass sie mir — aber damit genug! — vor dem Einschlafen Geschichten erzählte? Das Erzählen übrigens übernahm, nachdem sie diesen runden, meerblauen Stern verlassen hatte, ihr Mann. Ich war damals sieben Jahre alt.
Ellas plötzlicher Tod ereignete sich in einer Region, in der sich Schicksal, Irrsinn und Statistik auf das Unangenehmste berühren. Ella Beerholm, die Frau, die ich vermutlich einmal »Mama« genannt habe, wurde an einem freundlichen Frühlingstag vom Blitz erschlagen. Ich weiß, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass einem Menschen so etwas zustößt. (Was mich betrifft, so wäre es wahrscheinlicher, dass mich eine Pistolenkugel oder ein fallender Ziegelstein tötet, hätte ich nicht das Privileg, genau und jenseits aller Berechnung zu wissen, wann ich sterben werde und wie.) Ich weiß auch, dass jedes Jahr und überall eine gewisse Zahl von Leuten auf diese erhaben lächerliche Weise ums Leben kommt; der armen Ella Pech war es, dass sie grundlos und unverschuldet unter diese Menge fiel, die Mathematik ist blind. Das ist die Betrachtung aus dem kühlen Zahlenreich, und wie immer hat sie etwas Beruhigendes. Anders die theologische: Ella war ein friedlicher Mensch, nützlich und gut, des Herren Magd. Aber der Himmel wählte die drastischste, die effektvollste Methode, um ihr Herz zu verbrennen und ihr Gehirn zu durchlöchern, um sie aus der Welt zu bomben.
Es war wirklich ein schöner Tag, der Himmel war blau und stark gewölbt, gefleckt nur von ein paar schillernden Wolken. Vögel kreisten, Bienen summten, einige Bäume waren überschüttet mit Blüten. Ein fernes Grollen kündigte ein Gewitter an, Ella hörte es und ging in den Garten, um die dort trocknende Wäsche abzuhängen. Wäsche abhängen — gibt es etwas, das weniger geeignet wäre, um dabei zu sterben? Ella betrat die Wiese, machte einen Schritt, noch einen, eine Libelle schwirrte vorbei, noch einen. Dann blieb sie stehen, streckte die Hände aus und nahm ein frisch gewaschenes Handtuch von der Leine (vielleicht sogar das gelbe Handtuch, mein Handtuch, wer weiß; das Schicksal liebt sinnlose Symmetrien) — und in diesem Moment geschah es. Wissenschaftlich gesehen: Aus atmosphärischen Gründen gab es Potentialverschiebungen zwischen der Ladung hoher Luftschichten und der des tiefen braunen Erdbodens unter Ellas Füßen. Ein elektrisches Feld baute sich auf, eine körperlose Gegenwart von Kraft, von stummer Möglichkeit, ein Umschlagen von nichts in etwas, von Geist in Macht — unser ganzer Kosmos, so vermutet man, könnte solch einem Feld entsprungen sein. Vielleicht spürte sie es noch, als Bewegung in ihren Haaren, als Luftzug, der ihren Körper betastete, oder als ziehende Beklemmung in ihrem Inneren. Aber es war zu spät. Die Spannung nahm in wenigen Momenten um Ungeheures zu, die Sehnsucht zwischen Himmel und Erde wuchs ins Unermessliche, und dann konnte nichts mehr, auch nicht ein paar Kubikkilometer nichtleitender Luft und auch nicht Ellas armer Körper, den Energieüberschlag verhindern. Eine Säule reinen Lichtes entspross dem Boden, ein sich verästelnder Baum aus purer glühender Schönheit wuchs, streckte sich Hunderte Meter in die starre Luft, gefror für einen unendlich kurzen Moment, in dem die Engel den Atem anhielten und die Zeit vibrierte — und erlosch. Dann stürzten Tonnen von Luft in den dünnen Vakuumspalt, und der Donner rollte über die Erde, drückte ein Fenster ein, schüttelte einen Baum und brachte ein Kind zum Schreien. Dann war es still. Die Spannung war ausgeglichen, die Luft gereinigt. Eine Libelle flog erleichtert davon, ihr war jetzt besser. Ein warmer Frühlingsregen setzte ein, sanft und erfrischend, jene Art von Regen, nach der man sich sehnt im langen Winter. Und Ella lag auf der Wiese. Das Gras unter ihr war verdorrt wie nach langer Trockenheit. Einige ihrer Organe, so wurde später festgestellt, waren buchstäblich geschmolzen, und ein Teil ihres freundlichen Gesichtes hatte sich in Feuer aufgelöst.
Von da an waren Beerholm und ich allein. Ich nannte ihn ›Beerholm‹, mit einer gewissen respektvollen Ironie. ›Vater‹ wäre ja schlecht möglich gewesen, und ›Manfred‹ (er hieß Manfred) ist wirklich kein Name, mit dem man jemanden anreden kann. Er war damals schon über sechzig und nicht besonders geeignet, ein Kind aufzuziehen. Ein eleganter Herr mit weißen Haaren, dicken Tränensäcken und grauen Anzügen in der grauen Farbe seines Schnurrbartes. Ich bin nie daraufgekommen, was eigentlich sein Beruf war. Meist saß er an einem Schreibtisch, Unmengen von Papier vor sich, und blätterte und machte Notizen und murmelte vor sich hin. Dann gab er Anweisungen in einen Telefonhörer. Ich habe niemals erfahren, mit wem er sprach. Ich stellte mir vor, dass es irgendwo riesige Bürohäuser voller Menschen gab, die an langen Tischen saßen und nur auf seine Befehle warteten, um auszuschwärmen und große Dinge zu tun. Möglich, dass es sich tatsächlich so verhielt.
Ich war viel allein. Beerholm sah ich nur morgens und dann wieder am Nachmittag und am späten Abend, wenn er mir eine Gutenachtgeschichte erzählte. Ein Ritual, das uns beiden lästig war, aber keiner von uns wagte, den Vorschlag zu machen, es aufzugeben. Beerholm, der nicht den geringsten Anflug von Phantasie besaß, konsultierte täglich kurz ein oder zwei Märchenbücher aus seiner Bibliothek. Die aber kannte ich schon alle, und so bemerkte ich natürlich, dass er sich die Geschichten nicht ausdachte — und, schlimmer noch, auch er wusste, dass ich es bemerkte. Und so hörte ich wieder und wieder von der kleinen Meerjungfrau, vom Pferd Fallada (die schrecklichste Geschichte, die je einem Menschen eingefallen ist), von Peter Pan, von Merlin und Artus. Von Merlin, ja.
Vormittags war ich in der Schule, gegen eins kam ich heim und bekam von der Haushälterin — keine alte kinderliebende Frau, wie das Klischee es möchte, sondern eine junge hübsche, die mich nicht ausstehen konnte — ein aufgewärmtes Essen. Dann erledigte ich meine Aufgaben, schrieb kurze, angewiderte Aufsätze unter indiskrete Überschriften (»Mein schönstes Erlebnis«, »Mein bester Freund« — es braucht eine Menge von solchem Zeug, um Kinder an den Gebrauch von Phrasen zu gewöhnen) und löste mit leichter Hand einfache Rechnungen. Dann war ich frei. Es gab einen großen, gebüschreichen Garten; ich schlich durch das Gras und die Blumen, betrachtete kleine Tiere und den Himmel, freute und fürchtete mich, sprach mit dem backenbärtigen Gartenzwerg und stellte mir seltsame Dinge vor.
Eigenartig, wie diese Zeit von Angst überschattet war. Es gab einen braunen Fleck im Rasen; Beerholm ließ ihn beharken, vertikutieren, mit weißflockigem Dünger bestreuen — nichts half. Ich vermied diese Stelle, wich ihr aus, schlug Bögen um sie und starrte nachts durch die vor meinen Augen beschlagende Fensterscheibe auf sie hinunter. Aber das war nicht alles. Man sehnt sich oft zurück, in die Zeit, als man noch Phantasie hatte und spielen konnte und an Märchen und Götter glaubte — aber jenseits dieser Sentimentalitäten: Hat denn jeder die andere Seite vergessen? Den Schrecken, der in jedem schattigen Winkel wartet, die vielarmigen Gestalten, die aus der Ferne den Blick auf dich heften, das rein und unverstellt Böse, das im Keller darauf lauert, dass der Lichtschalter versagt? Die Welt um ein Kind ist noch nicht ganz festgefügt, an den Rändern fasert sie aus, es gibt noch Löcher darin und undichte Stellen und kleine Irrtümer im Gewebe. Nie wieder habe ich so intensiv das Grauen erlebt, das in der völligen Stille rauscht und in der Leere zwischen den Möbeln flimmert, wie in schlaflosen Kindernächten, wenn ich das Licht anknipste. Einmal, ich war acht oder neun Jahre alt, geriet mir die Geschichte von der bösen Frau in die Hände, die sich in eine Spinne verwandelt. In meinem ganzen Leben habe ich nicht mehr solche strahlend schrecklichen Alpträume, solche Exzesse der Angst durchlebt.
Dabei las ich sonst nicht sehr viel. Sicher, die Märchenbücher, dann die Sagen des klassischen Altertums in einer wertvollen Lederausgabe mit festen, goldumrahmten Seiten, Gotthelfs schreckliches Buch von der Spinne und einmal auch eine langatmige Lebensbeschreibung von Sir Francis Drake; ich weiß wirklich nicht, warum ich alle achthundert Seiten lang durchhielt. Es gab eine große Bibliothek im Haus, die Beerholms Großonkel einst zusammengetragen hatte, aber ich benutzte sie wenig. Ich war nie ein großer Leser, schon in der Grundschule war ich wenig interessiert in Deutsch und exzellent nur im Rechnen. Später las ich zum Vergnügen vor allem Bücher über die Traumreisen der theoretischen Physiker und aus beruflichen Gründen zuerst die klassischen Schriften der Theologie (des Aquinaten hundertbändigen Scharfsinn, Augustins klare Stimme, Brunos Häresien) und dann natürlich die Fachliteratur meiner neuen Profession: trockene Abhandlungen, deren wissenschaftliche Sprache Feuerwerke von Erstaunen, Wunder und Täuschung bereithält. Spinoza kenne ich vollständig, Pascal auch. Die Kritik der reinen Vernunft habe ich nie ganz bis ans Ende geschafft, auch Gödel bin ich nicht gewachsen. Beerholm hingegen sah ich nie etwas anderes lesen als die Wirtschaftsteile englischer Zeitungen. Er saß dann in einem uralten Plüschsessel, den Kopf schräg zur Schulter geneigt, die Augenbrauen hochgezogen, eine kaum merkliche Bewegung in den Lippen und träumerische Konzentration im Blick. —
In der Wüste, wo sie am heißesten ist, sind Tiere entstanden, die so sparsam mit ihrer Kraft sein müssen, dass sie sich nur bewegen, wenn es wirklich unvermeidlich ist, und auch dann nur langsam, ganz langsam. So ähnlich war Beerholm. Er sah nur auf, wenn es etwas zu sehen gab, griff nur nach etwas, wenn er es unbedingt brauchte, sprach nur, wenn wirklich etwas gesagt werden musste. Sparsamkeit in jeder Bewegung, jeder Handlung, vielleicht auch jedem Gedanken. So kam es, dass er immer das Richtige sagte und tat und nie etwas Unpassendes.
Von Zeit zu Zeit unternahm er lange, stumme Spaziergänge durch das Haus mit mir. Es war ein großes Haus, drei Stockwerke und ein staubiger Keller, doch seine beste Zeit lag weit zurück. Beerholm hatte es billig erstanden und seither, sparsam auch hier, nichts unternommen, um den Verfall aufzuhalten. Es war zwar mehr oder weniger sauber, doch Dielenbretter krümmten sich, feuchte Flecken breiteten sich an den Decken aus, und zuweilen sah man aus dem Augenwinkel kleine Spinnen davonkrabbeln, als wäre ein Stück vom Teppichmuster plötzlich lebendig geworden. Und durch dieses Haus nun gingen Beerholm und ich Hand in Hand, die Treppe hinauf, durch die einzelnen Zimmer, die Treppe hinunter, ins Erdgeschoß, noch eine Treppe hinunter in den Keller, durch graue Kellerräume, die Treppe wieder hinauf. Es begann immer mit Beerholms Frage »Wollen wir eine Wanderung machen?«, über die ich kurz nachzudenken hatte, um schließlich »Warum nicht!« zu antworten. Und dann gingen wir, langsam, schweigend und ernst.
Einmal fand ich in einer Schublade (wie viele Geschichten beginnen so; doch diese nicht) ein Paket Tarotkarten. Ich sah sie an, legte sie aus, sammelte sie wieder ein, ließ mir von ihrer kitschigen Unheimlichkeit Angst machen und versuchte vergeblich, meine Zukunft in ihnen zu sehen. Dann entdeckte ich, dass die Reihenfolge der Karten unverändert blieb, sooft man auch abhob. Mit diesem Grundgesetz der Kartenkunst ausgerüstet, führte ich Beerholm einen Kartentrick vor. Ein ziemlich kläglicher Versuch, und Beerholm war nicht Schauspieler genug, um das zu verbergen. Ich versuchte es dann noch bei meinen zwei besten — einzigen — Freunden, einem Jungen namens Fritz und einem anderen, von dem ich nur noch weiß, dass er grotesk verfaulte Vorderzähne hatte, stets an Bonbons kaute und ein unangenehmes Karamellaroma verströmte. Nur Fritz war ein wenig überrascht, als ich seine Karte — Die Liebenden — wiederfand, der andere zuckte mit den Achseln und wusste gar nicht, worum es gegangen war. Nach diesen Niederlagen legte ich das Tarot weg und vergaß mein ärmliches Debüt in der Täuschungskunst. Keine Vorzeichen, keine Verheißung und keinerlei frühe Berufung.
In einer anderen Sache war es ganz ähnlich. In größeren Abständen wurde unsere Schulklasse in die Kirche geführt, zu ausgedehnten, musikreichen Messen. Der Priester trug einen pelzigen Vollbart, einen Strickpulli und Jeans, und er besaß eine Gitarre. Auf ihr spielte er, begleitet von einem Doppelgänger am Schlagzeug, und sang und war überhaupt sehr fröhlich. Wir mussten mitsingen und in die Hände klatschen und dazu rhythmisch mit den Füßen stampfen. Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer war: die Peinlichkeit oder die Langeweile.
Ein Mädchen neben mir blätterte in einem Donald-Duck-Heft, was gar nicht einfach war bei all dem Klatschen und Stampfen; ich spielte mit Fritz eine Partie Schach auf einem winzigen Steckschachbrett und verlor. Das Gebäude um uns war von ergreifender Hässlichkeit: Viereckige Betonsäulen trugen eine flache Decke mit kreuzförmig angebrachten Neonröhren. An der Ostwand, hinter einem niedrigen Holzaltar, blickte ein kubistisch zersplitterter Christus unbehaglich um sich; er hatte ein gelbes Gesicht und sah aus, als hätte er Zahnschmerzen.
Und der Priester — er hieß übrigens Pfarrer Gudfreunt — geriet nun erst richtig in Begeisterung und begann, mit schwingenden Armen vor seinem Mikrofon auf und ab zu hüpfen. Dann hielt er eine endlose Predigt, niemand wusste, worüber. Und schließlich sang er die Messe zu Ende.
Mehrere Monate lang hatte ich bei ihm Unterricht für meine erste Kommunion. Wir saßen in der Kirche, er ging auf und ab und stellte bedeutungsschwere Fragen. (»Wenn du damals dabei gewesen wärst bei den Fischern, was hättest du denn gesagt zum Jesus? Nein, komm einfach raus und spiel es uns vor! Nicht nachdenken! Ganz spontan!«) Einmal (»Jetzt machen wir ein Soziogramm, ja?«) stellte er eine Wandtafel vor uns hin und schrieb unsere Namen darauf. »Und jetzt macht jeder einen Pfeil von sich zu seinen drei besten Freunden!« Ich erinnere mich noch an die drei dünnen Linien, die auf mich wiesen, bloß drei, während andere ein Dutzend hatten. Und eine davon war auch noch gnadenhalber gezogen worden, von einem älteren Jungen, den ich kaum kannte. Ein andermal trug Pfarrer Gudfreunt die Geschichte vom verlorenen Sohn vor. Ich verstand den Beruf nicht recht, den der Sohn in der Fremde annimmt, und fragte zweimal nach: »Was bitte?« — »Schweinehirt.« — »Was?« — »Schweinehirt!« Ich hatte keine Ahnung, was das war; die Pointe der Erzählung — jener Sohn, der alles falsch gemacht hat, wird wieder angenommen, der andere, der immer da war und sein Bestes getan hat, wird zurückgesetzt — erschien mir grotesk. Irgendwo musste es da einen Irrtum geben! Doch Gudfreunt vermied es, die Sache aufzuklären. Und mit Recht. Es gibt keinen Grund, Kinder mit der schrecklichsten von allen Wahrheiten zu behelligen. Der nämlich, dass Gott auswählt, ohne Gründe zu haben, dass Seine Gnade nicht erworben werden kann, durch keine Bemühung, durch keine Tat. Dass Seine Liebe ungerecht ist.
Die Zeremonie der Erstkommunion war unendlich lang und erfüllt von vielstrophigen Gesängen. Kurz davor hatte ich meine erste Beichte abgelegt, und Gudfreunt hatte meine Sünden von mir abgelöst. Es war seltsam, schuldlos zu sein: Meine Faulheit, einige nicht gemachte Hausaufgaben, böse Gedanken über dumme Bekannte — nichts davon hing mir mehr nach. Und so saß ich da, umplätschert von Gudfreunts Gitarrenklängen, mit einem Gefühl milder Langeweile und erhobenen Geistes. Der scheußliche Kirchenraum schien in einem matten heiligen Glanz zu liegen. Vor mir sang Pfarrer Gudfreunt, hinter mir wogte ein brummendes Gemisch von Stimmen; immer wieder konnte ich deutlich Beerholms Bass erkennen. Ich sah mich nach ihm um, da stand er und nickte mir zu. Und neben ihm Ella. Sie hatte noch drei Monate.
Gudfreunt leitete das Begräbnis. Seine Rede hielt sich in Bereichen des Allgemeinen, der Fall warf Probleme auf, die er lieber vermeiden wollte. So sagte er nur, dass alles einen Sinn habe, dass Trauer den Menschen forme und dass wir uns eines Tages, am Ende der Tage, wiedersehen würden im rosenfingrigen Sonnenaufgang unter den Mauern des Neuen Jerusalem. Die Sonne schien, Schmetterlinge umflatterten uns wie zum Leben erwachte Blumen. Ich sehe alles in einer Klarheit vor mir, mich selbst und Beerholm und die namenlosen, dunkel gekleideten Menschen und das längliche Loch in der Erde und die leuchtenden Farben der Kränze auf dem Holzkasten, als hätte meine Erinnerung es mit einer Eisschicht überzogen. Ich sehe mich dastehen, aufrecht, die Hände auf dem Rücken gefaltet und mit dem Wissen, dass nichts, was in der Welt geschieht, mich jetzt noch berühren kann. Ich weiß nicht, wie ich nachher nach Hause kam, ich weiß nichts über die nächsten Tage und Wochen. Aber von dem Begräbnis besitze ich noch jede Einzelheit. Seltsam: Ist unser Gedächtnis so löchrig, dass es bloß einige Augenblicke aus der davonfließenden Zeit filtern kann; oder besitzen wir tatsächlich nur selten und kurz die volle Kraft unserer Wahrnehmung? Was, wenn ich zurücksehe, bleibt mir denn wirklich?
Ein Blick aus dem Fenster in meinem ersten Winter in Les Vescaux. Die Sonne geht über dem Neuschnee auf, in dem noch kein Vogelfuß eine punktierte Linie gezogen hat. Die unverletzte weiße Fläche funkelt wie Feuer, die schräg einfallenden Strahlen tasten sich langsam und gelblich vorwärts, am Horizont leuchten die Gletscher, als ob sie mir, und nur mir, etwas sagen wollten. Die Verzweiflung darüber, dass ich sie nicht verstehen kann, die hilflose Sehnsucht.
Ein Spätnachmittagshimmel, ich weiß weder wo noch wann ich ihm begegnete; ein Krähenschwarm zieht vielstimmig vorbei, ein Vogel kippt plötzlich, die anderen folgen ihm, schwarze flatternde Körper wirbeln durcheinander, ordnen sich neu, stürzen in den Horizont und verbrennen im Abendrot.
Der Petersdom von oben betrachtet; ich stehe in Michelangelos Kuppel, und die Leute unten sind lachhaft klein im Miniaturgewitter ihrer Fotoapparate. Aus versteckten Fenstern fallen Lichtstrahlen in die Tiefe und zeichnen lange, geometrisch reine Geraden in den Raum, unberührt von der angeborenen Ungenauigkeit der Materie. Und ich überlege, ob ich mich an einer von ihnen festhalten soll und mich hinuntertragen lassen auf den mosaikbunten Marmorboden.
Mein erster Auftritt: der Lichtnebel, das überirdisch helle Gleißen der Scheinwerfer, die schwarzen Silhouetten der Zuschauer in den ersten Reihen.
Du natürlich, immer und immer wieder du.
Und meine Volksschullehrerin, die ich frage: »Ist zwei mal fünf immer zehn? Warum immer?« Sie sieht, dass ich keinen Witz machen will, sondern ein Problem ausspreche, das mich tagelang beschäftigt hat. »Denk nach, Arthur! Weil fünf mal zwei zehn ist und die Hälfte von zehn fünf und ein Fünftel von zehn zwei.« Ich verstehe das nicht, und sie wiederholt es langsam. Ein Papierflieger segelt vorbei, neben mir flüstert jemand. Und auf einmal begreife ich. Begreife, warum zwei mal fünf zehn ist, jetzt und immer und zu aller Zeit, in dieser Welt und in der anderen. Ich sehe die Tafel mit ihren Kreideflecken und den Löschschlieren darauf, das abgetragene Gesicht der Lehrerin und die der stumpfen, verschlafenen Kinder und weiß, dass ich mir diesen Moment einprägen, dass ich ihn der fliehenden Zeit entreißen muss. Ich habe eine Wahrheit gefunden, die im Grund der Welt wurzelt, die mich nicht im Stich lassen wird und mit mir sein von jetzt bis ans Ende.
Zwei
Bei unfreundlichem Wetter, im Abteil eines Schnellzugs, ausgestattet mit Schinkenbroten und mehreren Dosen Coca-Cola, verließ ich meine Geburtsstadt für immer. Ich war zehn Jahre alt.
Es regnete; eintönige Wiesen, einsam graue Häuser und misslaunige Bäume zogen vorbei. Vor mir saß ein Mann und blätterte in einer Zeitung. Seine Frau neben ihm schälte ein hartgekochtes Ei, die Schalenstückchen rieselten auf den Boden. Sie gähnte, einmal, noch einmal und noch einmal, bis ihr Tränen in die Augen traten. Als sie bemerkte, dass ich sie ansah, lächelte sie und sagte: »Na, du!« Ich verzog keine Miene, sie wiederholte, doch diesmal fragend: »Na, du?« Jetzt musste auch ich gähnen.
Ich war unterwegs, so viel wusste ich, in ein Internat im Land der Gletscher, Uhren und Taschenmesser, wo man mich erziehen sollte, bis aus mir etwas Besonderes werden würde, eine Ausnahmeerscheinung in der Gattung Mensch. All die Leute auf der Straße mit ihren Bärten, Schirmen und Hüten, sie waren das Normale. Ich würde anders sein. So ungefähr hatte ich Beerholm verstanden. Und wie auch immer: Keine Entfernung der Erde war groß genug, um mich von einem bestimmten braunen Grasfleck zu trennen.
Die Entscheidung, mich wegzuschicken, war erst wenige Wochen zuvor und völlig unerwartet gefallen. Damals machte ich mir kaum Gedanken darüber; heute weiß ich, dass Dinge dahintersteckten, von denen ich nichts ahnte. Drei Monate nach meiner Abreise heiratete Beerholm unsere Haushälterin. Es amüsiert mich, mir vorzustellen, was zwischen den beiden vorgegangen sein muss, ohne dass ich etwas davon bemerkte. Selbst für ein Kind war ich ziemlich naiv. Nach sieben Monaten kam das erste Kind, ein Mädchen, nach einem Jahr folgte ein zweites. Wenn ich in den Ferien zu Besuch kam, sah ich die beiden goldlockig über die Teppiche kriechen, unter den Blicken ihrer schönen Mutter und ihres alten Vaters. »Sie haben entzückende Enkel!« — der Alptraumsatz seiner Parkspaziergänge. Später, nach Beerholms ruhigem Tod, erfuhr ich, dass meine Erbschaft auf den vorgeschriebenen Pflichtteil eingeschränkt worden war, und auch der war durch verschwundene Sparbücher und rätselhaft geleerte Safes auf eine traurige Winzigkeit geschrumpft. Natürlich war ich enttäuscht, aber in rein finanzieller, nicht in persönlicher Hinsicht. Wenn der Staat mich als Beerholms Sohn betrachten will, ist das seine Sache. Ich bin es nicht, und ich war es nicht. Beerholm schuldete mir nichts.
Meiner Stiefmutter vor dem Gesetz begegnete ich Jahre später unerwartet und durch Zufall auf einem beängstigenden Cocktailempfang. Ich war Ehrengast und ganz unschuldig da hineingeraten und auf der Suche nach einem Fluchtweg. — Da stand sie vor mir. Gealtert. Ihre Haare waren gelb eingefärbt, und die Gier hatte ihr tiefe Falten in Mund und Hals geschnitten. Sie reichte mir die Hand, ich, unsicher, wie ich mich verhalten sollte, griff danach und schüttelte sie. Aber fühlte ich da nicht eine eigenartige Verkrampftheit, eine unruhige Spannung in ihrem Blick? Nicht schlechtes Gewissen, das sicher nicht, sondern etwas anderes: Angst! Mein Gott, sie hatte Angst! Eine niedrige, kreatürliche Furcht vor mir. Hatte ich nicht die Macht, ihren Schlaf zu zerbrechen, einen funkelnden Bannfluch um sie zu legen, eine Heerschar blutdürstiger Dämonen auf sie zu hetzen? Ich hatte sie nicht, leider. Aber ich genoss ein paar Sekunden lang ihr Zittern, dann ließ ich ihre Hand fallen und ging davon. Inzwischen hat sie wieder geheiratet, einen Produzenten kleiner Fernsehserien. Im Grunde ist es doch seltsam, dass der Vorrat an scheußlichen Menschen nie zur Neige geht; immer und immer erstehen sie neu, lachend, vielbeschäftigt, erfolgreich, die Fürsten Babylons. Sind denn wirklich auch sie erlöst …? Ja, vermutlich auch sie.
Doch zurück in meinen Zug. Hier sitze ich, esse ein Schinkenbrot und werde einem unbekannten Ziel entgegengetragen. Die Berge wachsen, die Wälder weichen zurück, das Gras versickert im Gestein. Bald bin ich in Les Vescaux.