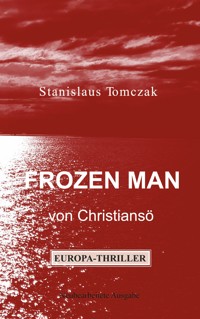Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende zweite und neu beararbeitete Ausgabe des Buches "BEFREIER OHNE MANDAT", (die erste Ausgabe erschien 1989 bei Paul Schlüter-Hary Verlag, die polnische Ausgabe "NIEPROSZONY WYZWOLICIEL WARSZAWY" 2018), bietet dem interessierten Leser die Möglichkeit, auf belletristische Weise, die Geschehnisse der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, hier speziell die Zeiten des Ersten Weltkriegs in Deutschland, Polen, der Ukraine und Russland, zu erkunden. Im geschichtlichen Rahmen ist mittels der Hauptfigur, des Eugen Marquardt, eines Schwaben, eine Handlung eingewoben, die einerseits die Sinnlosigkeit des Krieges, anderseits die damit verbundenen Veränderungsprozesse in den Kriegsteilnehmern selbst, darstellt. Anhand einer Palette von Gestalten aus den ehemaligen deutschen Ländern, des Zarenreiches und auch Japans, wird die ein Jahrhundert zurückliegende Zeit lebendig vermittelt. Der deutschen Niederlage folgte in Europa ein langer sozialer und politischer Umwälzungsprozess, bevor sich in den meisten europäischen Staaten demokratische Strukturen sicher und unumkehrbar stabilisieren konnten. Eugen Marquardt leistete seinen Beitrag dazu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor Stanislaus Tomczak; Jahrgang 1944; Ingenieur, bilingualer Schriftsteller und passionierter Historiker.
Das vorliegende Buch »BEFREIER OHNE MANDAT« ist eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe des vergriffenen Buches »Befreier ohne Auftrag«, das 1989 bei Paul Schlüter-Hary Verlag erschien Sie bietet dem Leser die Möglichkeit, auf belletristische Weise, die Geschehnisse der ersten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, hier speziell die Zeiten des Ersten Weltkriegs in Deutschland, Polen, der Ukraine und Russland, zu erkunden.
Im geschichtlichen Rahmen ist mittels der Hauptfigur, des Eugen Marquardt, eines Schwaben, eine Handlung eingewoben, die einerseits die Sinnlosigkeit des Krieges, anderseits die damit verbundenen Veränderungsprozesse in den Kriegsteilnehmern selbst, darstellt Anhand einer Palette von Gestalten aus den ehemaligen deutschen Ländern, des Zarenreiches und auch Japans, wird die ein Jahrhundert zurückliegende Zeit lebendig vermittelt Der deutschen Niederlage folgte in Europa ein langer sozialer und politischer Umwälzungsprozess, bevor sich in den meisten europäischen Staaten demokratische Strukturen sicher und unumkehrbar etablieren konnten. Eugen Marquardt leistete seinen Beitrag dazu.
Der ehemalige Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, Dt Karl Dedecius, der »Papst« der literarischen deutsch-polnischen Beziehungen, der diesem Buch Pate stand, bezeichnete 1985 die ihm damals vom Autor vorgelegten Manuskripte als »sehr bewegende menschliche Dokumente«.
Dem gegenseitigen Verstehen gewidmet.
Autor
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
QUELLEN-UND LITERATURVERZEICHNIS
1.
Das erste Kriegsjahr 1914 sorgte für viel Enttäuschung unter den so genannten Kongress-Polen, die auf die deutsche Befreiung von dem zaristischen Russland hofften. Kongress-Polen war ein 1815 auf dem Wiener Kongress aus den Resten des im Jahre 1795 aufgelösten Königreichs Polen und Litauen geschaffenes Staatsgebilde mit dem russischen Zaren als polnischen König. Ähnlich Finnland wurde das Land von Petersburg aus regiert Den anrückenden deutsch-österreichischen Truppen stellte sich der Russe tapfer entgegen. Er antwortete mit Gegenoffensiven und fiel in Ostpreußen und in die Karpaten ein. Die russische Kavallerie sorgte in den ostpreußischen Grenzbezirken für Angst und Schrecken. Doch im mittleren Frontabschnitt sah die Lage ganz anders aus. Die schnelle Einnahme von Lodz, einer Grenzstadt mit starker Industrie, ermöglichte ein rasches Vorrücken der deutschen Truppen in Richtung Osten.
Als gefährlicher Faktor stellte sich bald die Eigenart der polnischen Landschaft, »Polens Natur«, dar. Schon 1807 hatte Napoleon I. in »polnischer Not« ein ihm bis dahin unbekanntes Element der Kriegsführung entdeckt; an der gleichen Klippe scheiterte 1831 auch der kraftvolle Russe Diebitsch bei der Niederwerfung des polnischen Aufstandes. Die im Sommer unerträglich staubigen Straßen werden im Herbst und Frühjahr zu einem undurchdringlichen Morast Nur der Winter schafft, solange Schnee und Eis herrschen, dem Verkehr Erleichterung, denn dann gleiten die Schlitten leicht über schneebedeckten Weiten, erstarrten Sümpfe und gebändigten Flüsse. Gerade der November mit semen starken Regengüssen gehört zu den gefährlichsten Monaten. Richtige Landstraßen sind eine große Seltenheit, und schon im Frieden gehört eme Fahrt in der hin und her schwankenden Troika auf den schmalen Sand-und Lehmwegen durchaus nicht zu den Annehmlichkeiten, mögen die Glocken des Dreigespannes ihr eintöniges Lied auch noch so verführerisch in die Einsamkeit hinaus rufen.
Nun aber waren die Lehm- und Sandstraßen schon von den ersten Kolonnen bald vollständig ausgefahren und die Nachfolgenden mussten wohl oder übel ihren Weg durch die aufgewühlten Felder fortsetzen, oft eingesunkene Wagen mit Vorspann, Hebeln und Menschenkraft herausholen, sowie stundenlang auf das Schlagen von Notbrücken durch die Pioniere warten. Unglaubliches musste den armen Gäulen zugemutet werden und alle paar hundert Meter sah man die Kadaver der den ungeheueren Anstrengungen erlegenen oder aus Mitleid schließlich erschossenen Zugpferde liegen. Es ist erstaunlich, dass trotz alldem von den Fuhrparkkolonnen täglich im Durchschnitt fünfundzwanzig Kilometer zurückgelegt wurden. Was selbst ein Napoleon nicht zu besiegen vermochte, deutsche Organisation und deutsche Unverdrossenheit hat es zu überwinden gewußt.
Wo anderswo hohe Gebirgszüge oder tief eingeschnittene Wasserläufe den natürlichen Schutz eines Landes gegen feindliche Angriffe bilden, so sind es hier versumpfte Ströme, grundlose Moraste und verwilderte Wälder. Bedenkt man hier die äußerst schlechte Beschaffenheit der wenigen Wege, den Mangel an guter Unterkunft und rechnet noch die Versorgungsproblematik hinzu, so ergibt sich, dass die Kriegsführung hier beständig auf nur schwer zu bewältigende Hindernisse stößt.
Vor allem werden an die Ausdauer der Truppen, an die Weitsicht der Führer und an die Leistungsfähigkeit der Verwaltungsorgane ganz andere Anforderungen gestellt als im Hilfsquellen reichen Westeuropa mit seinem engmaschigen und weit verzweigten Straßen- und Eisenbahnnetz. Eine rasche Kriegsführung mit entscheidenden Schlägen ist ungemein erschwert, bei länger andauerndem Regenwetter fast unmöglich.
Den meisten der Soldaten erschloss sich beim Einrücken in Polen eme völlig neue Welt, aber durchaus keine schöne. Es wehte eine eigenwillige Luft in diesen vemachlässigten Landen. Die endlosen Weiten und die stille Einsamkeit wirken bedrückend, der trübe, regenschwangere Herbsthimmel prägte trostlose Schwermut Aus weiter Ferne wirken die hohen Ziehbrunnen, die plumpen Ziegelrohbauten der Bahnhöfe wie ein Scherenschnitt am Horizont Weit ab davon liegen die Städtchen, die sich mit ihren Gemischtwarenläden und den armseligen jüdischen Gasthöfen mit ihren wackeligen Möbeln, erblindeten Spiegeln und dem »Pejsachowka«-Schnaps, gleichen wie ein Ei dem anderen. Auf weiter Flur, zwischen verkrümmten Weiden, taucht ab und zu ein winziges, schweigendes Dorf mit halb eingesunkenen Hütten und geschwärzten Strohdächern auf, bewohnt von Elenden und Hungernden, von einem wartenden und sehnsüchtigen Volk.
Diese todtraurige Melancholie der Landschaft, der Heimat von Frederic Chopin, wird, als ob von der Natur gewollt, von einer ungewöhnlich lebendigen Sprache erfüllt Sie schlägt bald rau, bald weich ans Ohr, bald erschreckend mit harten Lauten, bald schmeichelnd mit süßen Kosenamen, bald wie ein Kampfruf aus finsterer Wildnis, bald wie die Töne liebender Zärtlichkeit Das ist auch die Heimat der Mazurka und Polonäse.
Für die Soldaten war bei solcher Armut natürlich fast nichts Essbares zu bekommen; höchstens anfangs noch Eier, Hühner und Gänse aber bei anstrengenden Eilmärschen blieb nur selten die nötige Zeit zur Zubereitung des Geflügels.
Die strategische Lage Polens erscheint auf den ersten Blick fast noch ungünstiger als die Ostpreußens, denn die Tüchtigen des Wiener Kongresses schufen 1815 eine riesige Ausbuchtung, die im Falle eines Krieges gegen Deutschland und Österreich-Ungarn auf drei Seiten von feindlichem Gebiet umzingelt ist Gegenwärtig fiel aber dieser Vorteil weg, denn von einer Aufstellung überlegener oder auch nur gleichstarker Truppenkörper gegenüber den Riesenheeren des Zarenreiches waren die Deutschen und ihre Verbündeten nicht im Stande. Vielmehr blieb für die Russen der Vorteil der inneren Linie, der namentlich durch das großzügig ausgebaute strategische Eisenbahnnetz hinter der Weichsel die rasche Verschiebung großer Heeresteile gestattete. Die Landesteile westlich der Weichsel liegen ziemlich offen, umso stärker war die Weichsellinie befestigt. Die einhundertfünfzig Kilometer lange Befestigungslinie mit Eckpunkten wie die Festungen Nowo-Georgiewsk und Sierock im Norden, mit Warschau und Brest-Litowsk in der Mitte und mit Iwangorod im Süden, mit ihren zweitausendfünfhundert Geschützen und zahlreichen Forts, stellte eine gefährliche Grenze für die deutsch-österreichisch-ungarischen Armeen dar. Auf der russischen Seite in Westpolen standen eigentlich nur schwache Beobachtungstruppen: zwei Kavalleriekorps, eine vorgeschobene Infanteriedivision und eine Gardeschützenbrigade.
In einem so wegearmen Lande wie Polen spielten die wenigen vorhandenen Eisenbahnlinien eine doppelt bedeutsame Rolle. Feldmarschall von Hindenburg hatte beim Vormarsch die westpolnischen Bahnlinien tüchtig ausgenutzt und weiter ausgebaut. Die Russen wurden durch den in einer Frontbreite von zweihundertdreißig Kilometer erfolgten, unvermuteten Vorstoß Hindenburgs, den sie mit seinen Hauptkräften noch immer in Ostpreußen glaubten, zunächst völlig überrascht. Ihre Vortruppen wurden einfach über den Haufen gerannt Die Gardeschützen wurden schon am 4. Oktober 1914 bei Opotow von schlesischer Landwehr zersprengt, am nächsten Tag bei Radom erwischte es auch das Kavalleriekorps, und am 6. siegten Österreicher und Ungarn über die Infanteristen. Das zur Deckung des linken deutschen Flügels den Vormarsch nördlich begleitende deutsche Kavalleriekorps trieb die an der Bshura stehenden russischen Reiter nach glänzendem Gefecht über die Weichsel, wo sie zunächst unter den Kanonen von Nowo-Georgiewsk Zuflucht suchten. So war der deutsche Vormarsch den Bahnlinien entlang, trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten, mit verblüffender Schnelligkeit, glatt und programmmäßig vor sich gegangen. Der linke Flügel rückte über Skierniewice und Grodzisk gegen Warschau selbst an, der rechte, aus Österreichem und Ungarn bestehend, gegen Iwangorod.
Die deutsche Mitte drang zwischen den beiden Festungen vor. Am 10. Oktober bei Grojec schlug sie die gemischten Abteilungen unter dem russischen General von Krause in die Flucht. Die Russen stellten ihn vor ein Kriegsgericht, er wurde des Verrats für schuldig befunden und erschossen. Auf die Nachricht, dass die Deutschen nur noch fünfzehn Kilometer entfernt vor den Toren Warschaus stehen, erlitt der die russischen Truppen befehligende General Scheidemann einen Nervenzusammenbruch.
Das am 10. Oktober in die Gegend zwischen Kutno und Sochaczew vorgerückte deutsche Kavalleriekorps überquerte mit seinem linken Flügel die Bshura und erreichte die Straße Nowo-Georgiewsk — Warschau. Der rechte Flügel blieb bei den Ortschaften Lubiec und Leszno stehen und wartete weitere Befehle ab.
Am Sonntag, den 11. Oktober, kündigte sich süd-östlich von Leszno, dem Gewitterdonner ähnlich, das Vorrücken der deutschen Armeen unter dem Kommando des Generals von Mackensen an. Man sah die unermessliche Ebene nachts von brennenden Dörfern schauerlich erleuchtet, konnte deutlich die verschiedenen Tonarten im Krach der Geschütze unterscheiden, fühlte förmlich den eisernen Sturmwind durch die Lüfte laufen, bis er dann in erdbebenartigem Donner endigte. Es dauerte nicht lange, bis die langen Kolonnen, die aus dem Westen auf der Straße Lodz — Warschau nach Osten zogen, auf die ersten Kavallerieeinheiten aus dem Norden, stießen. Dieses Zusammentreffen bei der Ortschaft Blonie, zwanzig Kilometer westlich von Warschau gelegen, führte zu einer folgenschweren Entscheidung des kommandierenden Kavalleriegenerals. Mit dem rechten Flügel sollten die Ortschaften Blonie, Leszno und Lubiec gehalten werden, während die Ortschafen Rybitew und Malocice, direkt vor den Kazun — Nowo-Georgiewsk-Forts gelegen, einzunehmen waren, was auch am 12. Oktober gelang. Außerdem sollte ein kleiner Truppenteil einen Erkundungskampf auf der Straße Kazun — Mociny — Warschau, dem Weichselufer entlang, proben. Während hier tapfere Kavalleristen bis zum Dorf Lomna, zwischen der Straße nach Warschau und dem Weichselufer gelegen, vordrangen, erreichten die Hauptarmeen nach mörderischen Kämpfen am 12. Oktober das Städtchen Pruszkow, nur zwölf Kilometer südwestlich von Warschau entfernt.
Doch hier machte sich am nächsten Tag das Eingreifen großer russischer Verstärkungen bemerkbar. In den nächsten fünf Tagen tobte ein erbitterter Kampf, der durch den Einsatz von zwanzig Haubitzen schwersten Kalibers aus Brest-Iitowsk zu Gunsten der Russen entschieden wurde. Man stand bei Blonie bis an die Hüften im Morast und schlug Mann gegen Mann mit Kolben und Bajonett aufeinander. Die stündlich wachsende russische Übermacht wurde immer erdrückender. Schließlich mussten die Deutschen Blonie aufgeben und einen schnellen Rückzug antreten.
Die Armee des Generals Russki griff weit westwärts aus und schob ihre Kavallerie bis nach Sochaczew und an die Bshura vor, um den linken deutschen Flügel zu umklammern. Während im Zentrum der Russe Scheidemann die deutsche Schlachtlinie fesselte, wurden die Osterreicher und Ungarn durch die Armeen unter den russischen Generälen Shilinski und Iwanow bis auf die Linie Tschenstochau — Krakau — Tarnow zurückgedrängt. Bei ihrem Rückzug führten die Verbündeten fünfzigtausend Gefangene und achtunddreißig Feldgeschütze mit sich. Die erste Schlacht von Warschau endete unentschieden.
Die Hauptfront der Verbündeten bewegte sich westwärts, ohne irgendwo dem Gegner eine Lücke oder Blöße zu bieten, bis die Linie Krakau — Tschenstochau — Sieradz erreicht war. Die Bewohner der schlesischen und posenschen Grenzgebiete hatten bange Stunden erlebt, als die russischen Reiterdivisionen Krakau bedrohten und über die Warthe setzten. Aber auf deutschen Boden wollte Hindenburg die Russen nicht kommen lassen. Zu dieser Zeit war aber auch die deutsche Frontumstellung beendet. Am 7. November 1914 besiegten die Deutschen die angreifenden Russen bei Kolo, am 13. bei Kutno und schließlich am 15. bei Wloclawek. Wie mit einem Zauberschlag war die gesamte Kriegsszene in Polen wieder verändert, die Front kam zum Stehen.
2.
Nordwestlich von Warschau, begrenzt im Norden und Osten durch die Weichsel, die hier gegenüber von Jablonna einen gewaltigen Bogen in westliche Richtung beschreibt, liegt der sagenumwobene Kampinos-Wald. Nur ein einziger guter Weg führte durch die Wildnis: die Straße Danzig — Thorn — Warschau. Über den Wald erzählte man unter den Polen viele schreckliche Legenden und die Reisenden dankten beim Anblick der Warschauer Zollhäuser still dem Herrgott für das gute Geleit. Zu jener Zeit beherbergte der Wald nicht nur wilde Tiere, sondern auch Menschen, die hier ideale Zuflucht fanden. Es gab hier einige kleine Waldsiedlungen, die im Aussehen sich der wilden Umgebung gut anpassten.
Die im Dorf Lomna stehende deutsche Kavalleriegruppe kam unter starken Beschuss der russischen Artillerie, die auf dem Weichselufer stand und durch ihre geradezu unheimliche Treffsicherheit zu den besten russischen Truppen zählte. Die russischen Batterien nahmen ungern Stellung an oder auf Höhen. Bei der Schlacht um Warschau standen sogar mehrere schwere Batterien auf dem morastigen Weichselufer.
Eine Kavalleriepatrouille, sieben Mann zu Ross, verließ am Morgen des 13. Oktobers die in Lomna stehende Mannschaft. Die Aufgabe hieß: Erkundung des Waldkomplexes und Durchbruch in Richtung Lubiec — Leszno zu den Armeen des Generals von Mackensen. Denn durch das Auftauchen der starken Kavallerieverbände der Russen im Norden war der Kontakt zur Haupttruppe verloren gegangen, zudem durch das Artilleriefeuer deutlich markiert war. Richtung Süden, wo die polnische Hauptstadt lag, war der Weg durch neueingetroffene sibirische Einheiten versperrt und westlich lag das grüne Meer des Kampinos-Waldes, eine »terra incognita«.
Wachtmeister Schulze ritt mit seinen sechs Männern vorsichtig durch den dichten Wald in südwestliche Richtung. Nach zwei Stunden sichteten sie eine kleine Waldsiedlung. Den Aussagen der Bauern aus dem Dorf Lomna nach handelte es sich hier um den Weiler Boernerowo. Wie früher abgesprochen, teilten sich die Männer in zwei Dreiergruppen. Die Pferde blieben aus Sicherheitsgründen mit dem siebenten Mann tief im Wald verborgen. Mit aufgesetzten Bajonetten näherten sie sich den Häusern der Siedlung. Die Erregung war den Männern in die Gesichter gezeichnet: »Sitzt hier der Russe in den Häusern verborgen, geht man hier in eine Falle?« Junge Männer sind in solchen Gefahrensituationen wie verwandelt. Sie denken an das Zuhause, an die Mutter und an die Frauen mit den Kindern in der fernen Heimat. Sie denken an die Fotos der Nächsten mit der Widmung auf der Rückseite. »Wird man sie auch morgen betrachten dürfen?« Tausende von Gedanken schießen durch den Kopf in solchen Augenblicken.
Schulze, versteckt hinter der Hausecke des ersten Hauses, überlegte kurz das weitere Vorgehen. Schreien und Stürmen mit seinem sechs Mann starken Spähtrupp hat doch keinen Sinn. »Anklopfen und nach dem Russen fragen?« — dieses Vorgehen erschien ihm erfolgversprechend. Als Posener, und dazu noch seit Jahren an der Warthe Beheimateter, hatte er sich ein hartes aber gut verständliches Polnisch angeeignet. Mit Handzeichen bat er den Dragoner Minz um Rückendeckung. Morgendämmerung und die Wald Nähe sorgten für eine trügerische Stille. Mit dem ersten Klopfzeichen kam Leben ins Haus. Eine starke männliche Stimme donnerte aus der Stube, was sofort den draußen angebundenen Hund auf die Beine stellte. Sein Bellen schlug Salven in den Morgen.
»Marta, guck doch mal nach!«
»Guck doch selber, ich habe Angst!« — antwortete frech, der Stimme nach, ein resolutes Weib. Schulze musste richtig überlegen, ob er sich nicht verhört hatte, aber der hinter ihm stehende Minz sagte leise mit hörbarer Überraschung in der Stimme: »Herr Wachtmeister, das war doch Deutsch!«
»Sie haben recht, Minz« — antwortete Schulze. Der Hund draußen spielte verrückt. Kurz danach erklang auf Polnisch eine männliche Stimme: »Kto tam? Wer da?«
»Machen Sie auf, Mann. Hier sind deutsche Soldaten!« — klang die Antwort des Wachtmeisters Schulze.
»Mein Gott, mein Gott, die Deutschen sind da!«
Krachend ging die Tür auf und mit erstaunten Gesichtern stand man sich gegenüber.
»Mann, seid ihr Deutsche?!« — fragte der völlig verwirrte Schulze die inzwischen auf fünf Personen angewachsene Gruppe in der Tür. Ein starker, dunkelhaariger Bauer und seine blonde, schöne Frau mit drei Kindern antworteten blitzschnell: »A jo, wir sind deutsche Kolonisten und heißen Boerner Hans und Marta und das sind unsere drei Kinder.«
»Habt ihr Russen im Dorf?«, fragte sichtlich erleichtert Schulze wieder.
»Bei uns sind seit einer Woche keine Russen mehr da, die haben sich angeblich bis nach Marymont zurückgezogen.«
»Das sind gute zwanzig Kilometer von hier«, sagte Schulze auf die Karte blickend.
»Und fünfzehn Kilometer von Warschau«, ergänzte Boerner. Der dritte Mann aus der Gruppe kam um die Ecke, noch mit aufgepflanztem Bajonett.
»Alles in Ordnung Herr Wachtmeister?« — fragte er, sich vorsichtig der Gruppe nähernd.
»Alles in Ordnung, Marquardt. Wir sind zufällig auf eine deutsche Waldsiedlung gestoßen!«
»0 Herrgott, das ist ein echtes Wunder!«
»Nein, nein, kein Wunder« — widersprach der kräftige Bauer.
»In Marymont leben auch deutsche Siedler und selbst in Zoliborz findet ihr welche!«
»Jetzt leck mi no!« — staunte der Schwabe Marquardt.
»Soldat Marquardt!« — ermahnte ihn Schulze. »Gehen Sie zurück und rufen Sie unsere Leute zusammen. Und vergessen Sie nicht unseren Mann mit den Pferden mitzunehmen. Sammelpunkt hier vor dem Haus.«
»Das kommt nicht in Frage« — fuhr der Bauer Boerner dazwischen und fügte schnell hinzu: »Als Treffpunkt schlage ich meinen Tisch in der warmen Stube vor.«
Eine halbe Stunde später saßen fünf deutsche Soldaten mit der Familie Boerner gemütlich am Esstisch, die Pferde fürsorglich im Stall untergebracht. Marquardt mit Piertulla, einem Oberschlesier, der mit den Pferden bis jetzt im Walde versteckt wartete, hatten das Pech, draußen die Wache schieben zu müssen. Das deutsche Gespräch auf polnischem Boden schien kein Ende zu nehmen, aber schließlich schickte Schulze die Männer doch ins Bett. Selber fragte er noch den Bauer nach dem Weg nach Marymont aus, und erst dann erlaubte er sich ein Schläfchen. Aufgeregte Stimmen vor dem Haus und das lebhafte Hundegebell rissen Schulze aus dem Schlaf. Auch die anderen Kavalleristen waren schon wach.
Auf einem Pferdefuhrwerk lag schwer verwundet Rittmeister von Borkowitz, sein Offizier! Es dauerte einige Minuten, bis sich Schulze der Lage bewusst wurde. Der Mann, der den Verletzten gefunden und mitgebracht hatte, war Boerners Schwager. Er wohnte in Marymont, war Pole und wollte mit seiner schwangeren Frau die unruhige Zeit bei den Boerners abwarten. Unterwegs war ihnen in Richtung Norden reitende russische Kavallerie aufgefallen. Obwohl sie zweimal durch Kosakenpatrouillen angehalten wurden, durften sie weiterfahren. Die deutlich erkennbare Schwangerschaft der Frau machte ihnen den Weg jedes Mal frei. Kurz vor Lomna sahen sie mehrere Tote, Russen und Deutsche, auch Pferdekadaver — alles deutete auf einen Kampf hin. Lomna war fest in russischer Hand. So bogen sie schnell in den Wald ab und nahmen einen nur ihnen bekannten Schleichweg. Nach ein paar hundert Meter stießen sie auf den schwer verletzten Offizier, der neben seinem toten Pferd lag. Bei näherer Betrachtung stellte Glowa fest, so hieß der Bauer, dass der Mann noch lebte und nahm ihn bis nach Boernerowo mit.
Anfangs standen alle um den Wagen herum, in der Hoffnung, dass der Rittmeister die Augen aufmachen würde, dann aber haben die Frauen den Verletzten in die Stube bringen lassen, um die Wunden zu säubern. Schulze gab Befehl, Beobachtungsposten rund um die Siedlung zu errichten und folgte dem Verletzten in die Stube. Draußen kündigten die ersten Regentropfen eine Wetterverschlechterung an.
Der Verwundete öffnete die Augen und nur langsam konnte er den neben dem Bett stehenden Schulze erkennen. Seine Lippen bewegten sich. Leise, kaum hörbar, Schulze hatte große Mühe die Worte zu verstehen, fing er an zu reden: »Am 13. Oktober, eine Stunde nachdem Ihr...«, hier musste er eine Pause machen, »nachdem Ihr mit dem Spähtrupp weggeritten seid, kam ein Kurier aus der hart umkämpften Ortschaft Blonie mit dem Befehl für unsere Kavallerie, sofort den Rückzug in Richtung ostpreußische Grenze anzutreten. Blonie war nicht mehr zu halten und der ganze Frontabschnitt Mitte musste zurückweichen. Die Russen haben elf neue sibirische Korps in den Kampf geworfen und damit die Initiative ergriffen.« Er blutete leicht aus den Mundwinkeln.
Schulze erhob sich: »Herr Rittmeister, versuchen Sie doch etwas zu schlafen. Sie können mir das Ganze doch später...« »Nein Schulze«, entgegnete ihm der geschwächte Offizier, »Ich muss jetzt sprechen, ich weiß es, ich werde diesen Tag nicht überleben...« Mühsam erzählte er weiter. »Während unsere Kavallerie sofort den Rückzug Richtung Malocice antrat, habe ich den Befehl erhalten, mit fünfzig Mann bis zur Abenddämmerung im Dorf zu bleiben und Ausschau nach Euch und euren Männern zu halten. Gegen Mittag war aber schon alles vorbei. Die Russen kamen von allen Seiten auf uns zu und der ganze Kampf dauerte nur wenige Minuten. Ich versuchte noch ein paar Leute um mich zu sammeln, mit dem Hintergedanken den Wald zu erreichen. Doch die Russen holten uns ein und meine letzten Männer starben direkt am Waldrand. Mein angeschossenes Pferd trug mich tief in den Wald. Mehr weiß ich nicht, nicht einmal wie ich hierher kam...« Er wurde bewusstlos.
Schulze rief den Frauen zu, sie sollten sich um den Verletzten kümmern und ging hinaus. Tausende von Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Der Wind blies ihm kalte Regentropfen ins Gesicht. Eines wurde ihm plötzlich bewusst, sie saßen hinter den russischen Linien fest!
Am Abend waren sie alle, die Soldaten und die Zivilisten, um den Leichnam des Rittmeisters von Borkowitz versammelt. Er war gestorben ohne nur noch ein Wort gesagt zu haben. Schulze sprach ein paar Abschiedsworte und der Regen spielte eine Trauer-Mazurka dazu. Die Melancholie der Natur und die Trauer der Menschen bildeten hier eine Symbiose. Am nächsten Morgen markierte ein hölzernes Kreuz am Rande des Dorfes die letzte Ruhestätte des Offiziers. In der warmen Stube versammelte Schulze seine Soldaten zur Lagebesprechung. Er schaute nachdenklich auf die um ihn herum stehende Gruppe.
Minz, Robert, zwanzig, aus Straßburg, stand rechts von ihm und schaute ihn mit fast schwarzen Augen, die in sich noch was Kindliches hatten, an. Seine Haut war auffallend dunkel, die lockigen, schwarzen Haare passten gut dazu. Von zu Hause sprach er ein gutes Französisch und kam als Freiwilliger zur Kavallerie. Er machte seine Arbeit gut, ging mit dem Pferd gut um, aber er schien ihm noch zu jung.
Neben ihm stand der Schwabe Marquardt, Eugen, mit einundfünfzig Jahren der Älteste in dieser Runde und der Zuverlässigste. Bis er was sagte, dauerte es manchmal länger als bei den anderen, aber das hatte dann »Händ‘ und Fiaß«, wie er immer schön schwäbisch sagte. Schulze schätzte ihn sehr.
Piertulla, Walter, vierunddreißig, Oberschlesier, sprach wie er auch, gut Polnisch. Schmal, dunkelblond, mit fragenden Augen, mit Ohren, die immer nach Geräuschen lauschten, machte er den Eindruck eines Fuchses. Er sprach wenig und fragte nicht viel. Für Sondereinsätze war er gut geeignet. Bei dieser Überlegung fiel es Schulze ein, dass er eigentlich aus dem Mann nie schlau wurde.