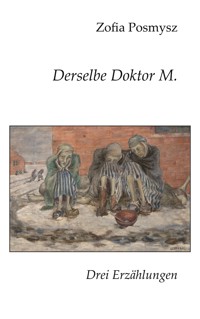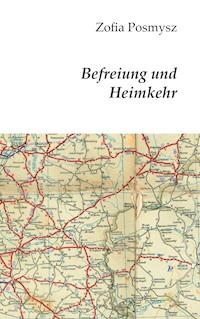
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
„Wir waren dreiundzwanzig an jenem Tag, an dem unter dem Ansturm der Häftlinge das Tor des Konzentrationslagers in Neustadt-Glewe aufbrach, es war das letzte Lager, bevor der Weg in die Freiheit begann. Für manche war es ein Weg in den Tod, der – wie es heißt – auch frei machen kann.“ Erst nach dem Ende des Kalten Krieges wendet sich die polnische Auschwitz-Überlebende Zofia Posmysz dem Thema ihrer Heimkehr aus der Lagerhaft zu, in einem Bericht, der vor Auflösung der Volksrepublik Polen so nicht hätte veröffentlicht werden können. Auf die mit Rückblenden durchbrochene Chronik der Ereignisse während des etwa zweiwöchigen, größtenteils zu Fuß zurückgelegten Weges von Neustadt-Glewe nach Polen folgen kurze Abrisse des späteren Lebens aller Frauen und offenbaren die problematischen Verhältnisse in einem von seinen Befreiern kontrollierten Land.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Weg
Teresas Bericht
„Die verborgenen Gesänge der Zukunft“
Glossar
Zu dieser Ausgabe
Autorin und Werk
Der Weg
Wir waren dreiundzwanzig an jenem Tag, an dem unter dem Ansturm der Häftlinge das Tor des Konzentrationslagers in Neustadt-Glewe aufbrach, es war das letzte Lager, bevor der Weg in die Freiheit begann. Für manche war es ein Weg in den Tod, der – wie es heißt – auch frei machen kann.
Wanda war die Erste von uns, die ums Leben kam, vier Tage nach der Befreiung. Sie war nach dem Warschauer Aufstand in Auschwitz eingetroffen und daher in einem besseren gesundheitlichen Zustand nach Neustadt-Glewe gelangt als die Frauen, die schon viel länger in Lagerhaft waren. Sie war siebenundzwanzig Jahre alt, besaß eine Wohnung im Warschauer Stadtteil Praga und ein gut gehendes Geschäft. Mit ihrem Tod, verursacht durch den Alkohol, den die sowjetischen Befreier mitbrachten, endeten ihre Überlegungen, wie sie schnellstmöglich nach Hause zurückkehren könne, bevor Diebe ihren Besitz plündern.
Die Zweite, die wenige Stunden später starb, war Lidia, eine Tschechin aus Prag. Bevor sie das Bewusstsein verlor, bat sie uns inständig, Milena nicht zu sagen, wie ihr Ende gewesen sei. Wir kannten ihre Tochter aus ihren Erzählungen, wir wussten, dass sie Cello spielte, dass sie sehr musikalisch war und ein fast absolutes Gehör hatte. Wir glaubten das gern, denn auch Lidia konnte wunderbar singen. Uns gefiel besonders ein Lied über Prag: Praha je krásná – Prag ist schön ... Lidia starb so wie Wanda, an dem gleichen vergällten Alkohol.
Und dann noch Mila. Sie war mit dem ersten Polinnen-Transport nach Auschwitz gekommen, mit dem aus Tarnów. Sie stammte aus einem Dorf. An harte Arbeit, karges Essen und mangelnde Hygiene gewöhnt, überstand sie drei Jahre, ohne die rosige Wangenfarbe einzubüßen, die man von den drallen Bauernmädchen auf den Bildern Wodzińskis kennt. Bevor wir nach Polen aufbrachen, wollten wir sie im Krankenhaus in Neustadt-Glewe zurücklassen. Sie flehte uns jedoch an, sie mitzunehmen. Sie sei doch am Leben, möglicherweise habe sie weniger getrunken als die anderen beiden, vielleicht sei sie widerstandsfähiger, dieses Giftzeug habe sie bisher nicht umgebracht, also werde es sie auch jetzt nicht mehr umbringen, sie müsse nach Hause, sie werde es nach Hause schaffen. Wir gaben nach. Sie war körperlich so robust, dass sie zwanzig Kilometer mit uns zurücklegte.
*
Diesen Bericht über unseren Weg nach Polen habe ich erst viele Jahre nach der Rückkehr geschrieben, warum, weiß ich nicht.
Es hat wohl mit einem Brief an Marta angefangen, den ich übrigens nie abgeschickt habe. Ihre Flucht in den Westen habe ich als eine Art Verrat angesehen. Gerade sie war es doch gewesen, die uns dazu überredet hatte, nicht in Richtung Elbe, sondern in Richtung Oder zu marschieren. Die Amerikaner hatten uns vor ihrem Rückzug geraten, hinter die Demarkationslinie bis Ludwigslust zu gehen. Denn hierher werde die Rote Armee kommen und über deren Verhalten seien äußerst beunruhigende Gerüchte im Umlauf. Uns fiel es jedoch schwer, an so etwas Unvernünftiges zu glauben wie das Abtreten von erobertem Gebiet – und sei es auch an die Sowjets. Wir wollten uns nicht von der Stelle bewegen. Wir hatten uns bequem eingerichtet. Das geräumige Haus, in das wir eingezogen waren, war das Quartier der Piloten gewesen. Unser Lager befand sich nämlich in einer aufgelassenen Kaserne neben einem Flughafen und einer Fabrik – oder vielleicht war das nur eine Flugzeughalle.
Die Unterkunft gefiel uns also sehr. Die Toiletten, Waschbecken und Duschen funktionierten. Wir konnten uns erholen, neue Kräfte sammeln und in Ruhe überlegen, was wir weiter mit der Freiheit anfangen wollten, von der zu träumen einfacher und leichter gewesen war, als sie zu besitzen. In Auschwitz hatten wir die Befreiung vom Osten her sehnsüchtig erwartet und uns damit dem Schicksal gefügt. Den Gesprächen der SS-Männer, die wir belauschten, hatten wir nämlich entnommen, dass die Offensive der Alliierten nicht vom Süden her kommen würde. Die, auf die wir dort, von wo es nur ein Katzensprung nach Hause war, vergeblich gewartet hatten, befreiten uns hier, auf fremder Erde, hunderte Kilometer von der Heimat entfernt. Sie befreiten uns und zogen wieder ab. Das tat uns leid, denn wir waren jung und die Soldaten sahen genauso aus wie die in den amerikanischen Filmen: Sie waren glatt rasiert, trugen scheinbar frisch gebügelte Uniformen, dufteten nach Aftershave, lächelten und – das überraschte uns besonders angenehm – sie erwarteten keinerlei Gegenleistung für das, was sie uns an Köstlichkeiten anboten. Wir hätten gern ein bisschen Zeit mit ihnen verbracht, wären gern mit dieser anderen, exotischen, uns nur von der Leinwand bekannten Welt näher in Kontakt gekommen. Aber sie zogen sich hinter die Elbe zurück und überließen uns unserem Schicksal. Wie ungewiss dieses Schicksal sein sollte, davon hatten wir damals nicht die geringste Vorstellung. Wir waren also im Zwiespalt: Sollten wir vielleicht doch den Amerikanern nach Ludwigslust folgen?
Wir taten es nicht und ausschlaggebend dafür war Martas Haltung. Sie und ihre beiden älteren Schwestern, Maria und Jadzia, zögerten keinen Moment: Sie würden auf jeden Fall zurückkehren. „Vielleicht ist Wacek zu Hause“, sagte Marta. Sie nährte diese Hoffnung, obwohl schon im Jahr 1944 Häftlinge aus der Schreibstube ihr die Nachricht überbracht hatten, dass Wacław S. erschossen worden sei, ebenso wie der Mann von Maria. In Auschwitz starben auch die Eltern und zwei Brüder. Eigentlich gab es niemanden, zu dem Marta hätte zurückkehren können. Auf Maria hingegen wartete ihr kleiner Sohn, der bei ihrer Festnahme von Verwandten in Obhut genommen worden war. Jadzia war gar nicht erst gefragt worden, es war klar, dass sie das tun würde, was die Schwestern taten. Hatte sie mit ihrem steifen Bein eine andere Wahl? Der Rest unserer Gruppe war zwischen widersprüchlichen Entschlüssen hin- und hergerissen. Es fuhren noch keine Züge und es gab auch keine anderen Transportmittel. Wie sollte man eine solche Strecke zu Fuß bewältigen?
Dennoch brachen wir am 8. Mai in aller Frühe auf, ausgerüstet mit einer Militärkarte, die wir im Haus gefunden hatten – gen Osten, der Sonne entgegen, die an diesem Tag strahlend am wolkenlosen Himmel aufging, als ob sie uns – wie einst der Stern zu Bethlehem den Heiligen Drei Königen – den Weg weisen wollte. Die Älteste von uns, Frau Dr. P. aus Radom, war über vierzig, die Jüngste, Walunia aus der Gegend von Zamość, gerade mal sechzehn. Auf einem Handwagen, den wir von einem verlassenen Gehöft mitgenommen hatten, transportierten wir unsere armselige Habe: Decken, Pullover, ein paar Päckchen vom Roten Kreuz und ... Dankas Akkordeon.
Aber nur neunzehn von uns machten sich nach Polen auf. Außer Wanda und Lidia, die auf dem Friedhof in Neustadt-Glewe lagen, fehlten Hélène und Ziuta. Sie hatten die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen: Westen.
Wie oft haben wir später mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung an ihre weise Voraussicht gedacht! Warum sind wir trotzdem nicht umgekehrt? Noch war es möglich. Massen von Menschen waren in unterschiedliche Richtungen unterwegs: Franzosen, Italiener, Holländer, Tschechen, Polen ... Wenn wir aneinander vorbeigingen, tauschten wir Grüße aus. Und Vorschläge: „Kommt mit uns mit!“ „Nein, kommt ihr doch mit uns mit!“, entgegneten wir, stolz auf unsere Entscheidung. Was drängte uns Richtung Osten? Der Instinkt der Vögel, die in ihre Nester zurückkehren? Oder – weniger triebhaft – die Sehnsucht nach den zurückgelassenen Ehemännern, Eltern und Kindern, das unbewusste Verlangen nach dem Leben, das durch die Verhaftung jäh unterbrochen worden war? Auch wenn dieses Leben nicht in allen Fällen glücklich gewesen war und es sich kaum lohnte, blindlings dahin zurückzueilen. Der gesunde Menschenverstand gebot, mit der Entscheidung zu warten. Wandas und Lidias Tod hätte uns eine Warnung sein sollen. Aber wir gingen, wir gingen immer weiter.
*
Das Lager in Neustadt-Glewe wurde am 2. Mai 1945 befreit. Es war sehr warm an diesem Tag. Der Frühling in Mecklenburg kommt zeitig. Schon im April hatten sich die Birken an der Straße, die zum Lager führte, in einen flirrenden, goldgrünen Schleier gekleidet, die Kletterrosen an den Hauswänden trieben Knospen, der Rasen auf dem stillgelegten Flughafen spross und grünte.
Zweimal am Tag zogen Bombengeschwader über die Stadt. Die Wände der Baracken vibrierten, die Pritschen wackelten. Das Zittern erfasste auch uns. Einige sprachen einen Psalm, „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt ...“, andere drängten sich an der Tür, um die Richtung Osten, sehr niedrig fliegenden und von keiner Flak bedrohten Flugzeuge zu zählen. Die hübsche Agnisia aus Brzesko stürzte herein und rief: „Es sind schon tausend vorbeigeflogen!“ Und den Singenden – „Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln“ – antwortete sie: „Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen.“
Wenn ein Luftangriff uns bei der Arbeit überraschte, trieb der SS-Mann das Kommando in das nächstgelegene schüttere Wäldchen. „Zweitausend über Berlin“, bemerkte er finster und dann drohte er: „Auf dem Gelände des Lagers sind Benzintanks vergraben. Wenn eine Bombe fällt, dann fliegt alles in die Luft.“ Aber er suchte in den Gesichtern der Zuhörenden vergeblich nach Zeichen der Angst. Die Flugzeuge haben andere Ziele als das Lager, auch wenn es in einer Militäranlage untergebracht ist, darauf vertrauten wir. Aber eines Tages wurde das monotone Brummen von Pfeifgeräuschen und Detonationen jäh unterbrochen – das letzte Geschwader hatte eine Sprengladung abgeworfen.
„Auf das Lager, genau wie in Dachau“, stellte der Chef feindselig fest, „dort hat eine amerikanische Bombe zwei Baracken zerstört und dabei sechzig Häftlinge getötet.“ Glücklicherweise kam – entgegen seiner Vermutung – nicht das Lager, sondern ein wenige Kilometer entferntes Dorf zu Schaden.
Aber am darauffolgenden Tag ...
Am darauffolgenden Tag sahen wir während des Morgenappells hinter dem Stacheldraht Männer in Sträflingskleidung. Und einen Lastwagen. Sie waren in der Nacht aus Ravensbrück gebracht worden. Evakuierung. Andere hatte man zu Fuß hierhergetrieben. Irgendwas hatten sie mit denen vor. Vielleicht wollten sie sie gegen Kriegsgefangene austauschen? Einstweilen wurden sie bei der Trümmerräumung in dem bombardierten Dorf eingesetzt. Abends warfen sie uns über den Drahtzaun große Brocken von verkohltem, halb rohem Fleisch zu. Und sie sagten, die Freiheit könne jeden Tag kommen, wir sollten uns darauf einstellen. Wir wollten es lieber nicht glauben. Hatten wir die Befreiung nicht schon im Januar erhofft, als die Rote Armee uns buchstäblich auf den Fersen war? Und dann sind wir doch hier gelandet.
Noch zwei Tage kampierten die Häftlinge hinter dem Stacheldrahtzaun, offensichtlich wusste man nicht, wohin man sie bringen sollte. Und schließlich kam ein Morgen, dadurch seltsam, weil er so ruhig war. Keine Pfiffe, kein Appell, keine Schreie: „Tee holen!“ Wir verließen, eine nach der anderen, vorsichtig die Baracke. „Es sind keine SS-Männer da“, lautete die erste Mitteilung. „Und auf den Wachtürmen?“ Ein paar Mutige wagten sich zum Stacheldrahtzaun vor. „Auf den Wachtürmen ist auch niemand.“
Stunden vergingen. Mittags hätte der um diese Zeit übliche Luftangriff kommen müssen. Er kam nicht. Es herrschte angespannte Stille. Und plötzlich ... Geschützfeuer. Keine Bombenexplosion, sondern Artilleriebeschuss, in nächster Nähe. Das hörte so schnell auf, wie es eingesetzt hatte. Stille. Hoffnung und Angst. Das Brummen eines einzelnen Flugzeuges erschien irgendwie nicht bedrohlich. Woher kam es und warum hatte es keinen Fliegeralarm gegeben? Paradoxerweise erwies sich ausgerechnet dieser Überraschungsangriff als gefährlich. Die Explosionen erschütterten den Raum. „Das Benzin! Wir fliegen alle in die Luft!“ Wie auf Kommando spuckten sämtliche Baracken auf einmal ihren menschlichen Inhalt aus. Die Bomben schlugen in die Flugzeugfabrik neben dem Lager ein. Eine Feuersäule schoss in die Höhe, ihr greller Schein verhöhnte die strahlende Sonne. Die Menge bewegte sich vom Appellplatz in Richtung Lagertor. Aber dort ...
Solche Szenen behält man für immer in Erinnerung. Männliche Skelette in Sträflingsanzügen stemmten sich von außen gegen die geschlossenen Torflügel. Auf der anderen Seite halfen ihnen die dünnen Arme der weiblichen Häftlinge. Das Quietschen der nachgebenden Scharniere wurde von einem langen, durchdringenden Laut begleitet, teils Schrei, teils Ächzen, teils Seufzer, aus tausend verkrampften Kehlen. Die Menschenmenge, von nur einem Gedanken getrieben, strömte durch den geöffneten Engpass, schoss vor und blieb plötzlich stehen. Alle erstarrten. Nun waren wir frei. So also sah die Freiheit aus? Hatten wir sie uns nicht genau so vorgestellt? Auf die andere Seite des Stacheldrahtzauns gehen und sich auf den Weg machen. Nur das. Nicht mehr. Aber wohin sollten wir gehen? Der offene Raum erschien zu groß, schien unpassierbar, die in der Sonne glänzenden Rasenflächen flimmerten vor den Augen, es wurde einem schwindlig davon. Einige setzten sich hin oder warfen sich bäuchlings mit ausgebreiteten Armen auf den Boden, andere blickten um sich, in den Augen die bange Frage: Wer gibt uns heute dieses kümmerliche, kostbare tägliche Stück Brot? Eine von uns machte, nachdem sie sich noch einmal umgesehen hatte, kehrt und ging zurück in Richtung Lager. Es folgten ihr erst eine, dann zwei, dann zehn Frauen. Die immer dichter werdende Menge fing plötzlich an zu rennen. Im Lager, bei den Magazinen, drängten sich Menschenmassen. Die Häftlinge warfen Lebensmittel heraus: verschimmelte Nudeln, verdorbene Graupen und Kohlrüben. Brot war keines da.
Es kam am Nachmittag um fünf zusammen mit den Amerikanern und dem Roten Kreuz. Ein Lastwagen nach dem anderen fuhr vor. Für den, der nicht weiß, was wahres Glück ist – das ist es: Brot, wenn man Hunger hat. Und steht das nicht auch für Freiheit? An diesem Abend schliefen wir, wenn auch auf denselben Lagerpritschen, glücklich ein, ohne jenes Übelkeit erregende Ziehen im Magen, jede von uns mit einem Päckchen am Kopfende und einem Laib Brot in den Armen, wie Kinder.
Am nächsten Tag war die Baracke ab dem Morgen von einem Lied erfüllt: „Dein Festtag, Muttergottes, der dritte Mai, gibt Kraft dem Volk und macht es frei.“ Dieses Lied sollte uns in das verloren geglaubte Leben zurückführen, uns erneut in der Tradition verankern, dank der wir diesen gesegneten Tag erlebten. Später fuhren uns die amerikanischen Soldaten auf dem Flugplatz herum, in ihren Jeeps, die voller Schätze waren: Schokolade, Kekse, Konservendosen verschiedenen Inhalts. Agnisia stürzte herein, die Arme bepackt mit diesen Köstlichkeiten.
„Ich habe wieder ein paar Worte dazugelernt“, teilte sie uns mit.
Für die alltägliche Verständigung waren sie allerdings nicht sehr hilfreich: „hübsche Nase“, „du gefällst mir“, „komm mit mir nach Ohio“. Was konnte man damit anfangen? Auf jeden Fall mehr brachten uns die Konservendosen. Das Öffnen der ersten Dose wurde von einem allgemeinen Seufzer begleitet. Ananas in Scheiben.
„Dass es so etwas auf der Welt gibt ...“ Walunia schüttelte den Kopf, sie kannte wahrscheinlich noch nicht einmal den Namen dieses „etwas“.
Das Glück währte nicht lange. Am 5. Mai zogen sich die Amerikaner hinter die Elbe zurück.
Eher misstrauisch als ängstlich beäugten wir die in die Stadt einfahrenden sowjetischen Panzer. Die Soldaten darauf waren grau. Ihre mit Staub und Ruß bedeckten Gesichter erinnerten an Masken.
„Versengt vom Feuer der Schlacht“, stellte Danka fest, die – und darüber machten wir uns lustig – immer sprach wie ein Buch.
„Die sehen aus wie Teufel.“ In Walunias Stimme schwang Angst mit.
*
Danka war in unserem Haufen das einzige Fräulein „aus gutem Hause“, wenn man eine wohlhabende Familie so bezeichnen möchte. Höhere Tochter aus dem Warschauer Großbürgertum, Einzelkind, Absolventin des Konservatoriums. Im Juni 1939 hatte sie geheiratet, im September war der junge Gatte in den Krieg gezogen und nicht mehr zurückgekehrt. Als das Verbrechen von Katyń aufgedeckt wurde, war sich Danka sicher, dass er dort ums Leben gekommen war. Das ganze Regiment war von den Russen eingeschlossen worden, erzählte einer, der es geschafft hatte, dem Kessel zu entfliehen. Danka heiratete zum zweiten Mal. Nicht lange erfreute sie sich ihres Eheglücks. Ihr Mann war in der Heimatarmee. Im Jahr 1942 wurde sie zusammen mit ihm verhaftet. Er wurde im Pawiak zu Tode gefoltert, sie selbst wurde nach Auschwitz gebracht. Danka überlebte dank der Anstellung im Lagerorchester.
*
Walunia war vor kurzem sechzehn Jahre alt geworden. Nach der Zerstörung ihres in der Gegend von Zamość gelegenen Dorfes war sie zusammen mit ihrer Mutter nach Birkenau gekommen. Ihr Vater hatte als Partisan sein Leben gelassen, der Großvater war erschossen worden, als er versucht hatte, das in Brand gesetzte Haus zu löschen. Die Mutter starb im Lager an Fleckfieber. Die kleine, zarte Walunia kam glücklicherweise in den Kinderblock. Später wurde sie in unser Kommando aufgenommen und war unser Töchterchen, so eine Art Kind des Regiments.
*
Die „Teufel“ statteten uns noch am gleichen Tag vor Einbruch der Dämmerung einen Besuch ab. Sie erwiesen sich übrigens als nicht sehr satanisch. Sie hatten Sterne auf den Schulterklappen und waren sauber gewaschen. Der eine, mit einem pechschwarzen, kurz gestutzten Schnurrbart, trug einen dunklen Umhang und Danka befand sogleich, dass er wie ein Dämon aussehe, wie der Dämon bei Lermontow. Er war Georgier. Der andere, ebenfalls ein Oberleutnant, stellte sich als Ukrainer vor. Aus der Ostukraine, fügte er mit Nachdruck hinzu, er habe nichts zu tun mit den Mördern aus Galizien, den Verbündeten Hitlers.
Die Gäste brachten Dosenfleisch, Wodka und eine Ziehharmonika mit. Sie baten um Becher „dlja wsech“ – für alle –, waren aber nicht beleidigt, als wir den Alkohol ablehnten. Sie selbst tranken direkt aus der Flasche, dann nahm der Ukrainer die Ziehharmonika und begann zu spielen.
„Nehm ich die Bandura, stimme sie und sing“, sang er mit einer matten, warmen Baritonstimme.
Es war ein mitreißendes, beschwörendes Lied. Als ob der Sänger mit dieser sehnsuchtsvollen Zauberformel, „Nehm ich die Bandura“, alle Strapazen des zurückgelegten Weges aus dem Gedächtnis löschen, das schmutzige, mühevolle Geschäft des Krieges vergessen und die so lange zugeschlagene Tür zur menschlichen Existenz, zur Musik, zur Poesie, zum Guten öffnen wollte. Als das Lied verklungen war, trat der Schnurrbärtige in die Mitte des Zimmers.
„Djewuschki! Damy! Mädchen! Meine Damen!“ Er verbeugte sich galant vor den Älteren. „Der Krieg ist zu Ende. Stoßen wir auf den Frieden an! Und auf das Leben!“
Er nahm einen Schluck aus der Flasche und reichte sie dem Ziehharmonikaspieler. Und dann erklang ein Walzer. Der Georgier warf den Schoß seines Umhangs über den Arm, stellte sich vor mich hin und streckte seine Hand aus. Ich stand auf und mied dabei Marias besorgten Blick. Der erste Tanz in der Freiheit. Sich daran berauschen, den Geschmack der wiedererlangten Jugend auskosten, auf die Zukunft hoffen – all das war im Strudel, im Rhythmus der „Donauwellen“, einer Melodie, die bei den Tanzabenden in der Schule, auf Hochzeiten und Jahrmärkten bis zum Gehtnichtmehr gespielt worden war und die nun völlig neu erschien und ein neues Kapitel in meinem Leben einleitete. Mein Tanzpartner warf den Umhang ab, schleuderte ihn in eine Ecke und bedeutete uns, einen Kreis zu bilden, er selbst stellte sich in die Mitte, um alle paar Augenblicke eine andere aus der Runde herauszuholen und sie im Tanz zu drehen. Er kniete dabei nieder, klopfte sich auf die Schenkel und trippelte auf den Zehen wie eine Ballerina beim Spitzentanz, mit ausgestreckten Armen und hoch erhobenem Kopf ... Dieser Reigen wäre wohl nie zu Ende gegangen, wenn der Ziehharmonikaspieler nicht plötzlich abgebrochen hätte.
„So, es reicht!“ Er legte die Ziehharmonika beiseite, langte reflexartig nach der Flasche und als er feststellte, dass sie leer war, stieß er sie voller Überdruss von sich.
Und da fragte Danka, ob sie das Instrument ausprobieren dürfe. Der überraschte, aber auch neugierig gewordene Ukrainer gab ihr die Ziehharmonika. Etwas unsicher, denn schließlich war das kein Klavier, spielte sie den „Türkischen Marsch“ von Mozart. Damit verblüffte sie die Gäste.
„Sie können ja spielen!“ Der Musiker verbarg seine Verwunderung nicht.
Und noch mehr beeindruckt war er, als Frau Dr. P. ihm sagte, Danka habe das Konservatorium abgeschlossen.
„Ja, Sie sind offenbar eine Künstlerin ...“
In Danka erwachte ein Teufelchen. „Ich bin keine Künstlerin, ich bin eine Scharlatanin“, trällerte sie, wie immer ein bisschen falsch, denn im Singen war sie nicht gut. Damit hatte sie die Vokalistinnen im Lager erpresst, wenn sie sich allzu sehr zierten: „Dann singe ich eben, wenn du nicht willst.“ Diese Drohung hatte immer gewirkt. Danka nahm die Ziehharmonika und begann erneut zu spielen. Die Zuhörerinnen sangen die Melodie bereitwillig mit und aus dem Haus, in dem gestern noch Porträts von Hitler hingen, drang in die dunkel werdende Weite vor dem Fenster der Gassenhauer mit den unverständigen und unverständlichen Worten: „Oh, du mein Kremser, Amerikaner!“ Der Ziehharmonikaspieler war gerührt.
„Ach, jetzt was zu trinken!“, seufzte er und warf dem „Dämon“ einen vielsagenden Blick zu.
In Aktion aber trat Frau Dr. P. Ihr Russisch war ebenso gut wie ihr Polnisch und nun bediente sie sich dieser sprachlichen Fähigkeit. Sie entschuldigte sich bei den Herren Offizieren, dass wir sie nicht länger hierbehalten könnten, es sei schon spät geworden und die Mädchen seien infolge des Lagers erschöpft, manche sogar krank, sie müssten sich ausruhen und sollten nicht tanzen. Sie als Ärztin fühle sich für ihre Gesundheit verantwortlich.
Sie widersprachen nicht. Als sie sich verabschiedeten, sagten sie, dass sie morgen Verpflegung mitbringen würden und für die Künstlerin vielleicht ein Akkordeon. Nachdem sie weggefahren waren, kommentierte Marysia Russisches Herz – so genannt, weil sie aus Baranawitschy stammte und von sich sagte, dass sie ein gutes, ein russisches Herz habe – den Besuch:
„Das sind gar nicht so schreckliche Teufel, wie Walunia gemeint hat.“
*
Marysia Russisches Herz war Zwangsarbeiterin gewesen, bevor sie nach Auschwitz kam. Sie hatte sich irgendetwas zuschulden kommen lassen, „eine unnötige und dumme Sache“, wie sie mit Bedauern sagte, denn es war ihr nicht schlecht ergangen, an Essen hatte es nicht gemangelt, vielleicht nur ein wenig an Schlaf. Der Bauer war eigentlich anständig und gutmütig gewesen, bei der Gestapo hat er sie wahrscheinlich nur aus Angst denunziert. Wir mochten Marysia Russisches Herz, weil sie tatkräftig und mutig war und willens, auch im schlechtesten Menschen noch irgendeine gute Eigenschaft zu entdecken, in der schwierigsten Lage noch irgendetwas Positives zu sehen. Zuvorkommend und bereit, Schwächeren zu helfen, wurde sie oftmals ausgenutzt, was sie mit Humor nahm.
*
Frau Dr. P. teilte, ähnlich wie Maria, den Optimismus von Marysia Russisches Herz nicht. Das Haus besaß keine Schlösser und bot keine Sicherheit. Und wenn die betrunkenen Rotarmisten nun doch zurückkommen oder, noch schlimmer, andere auftauchen würden, die weniger ritterlich waren? Wir beratschlagten, was zu tun sei. Schließlich schleppten wir einen großen Schrank zur Eingangstür und stellten noch zwei Tische übereinander davor. Wir legten uns jedoch nur zögerlich auf unsere Pritschen und hörten, durch diesen ungewöhnlichen Abend in eine träumerische Stimmung versetzt, nicht auf, Bemerkungen über die romantischen Teufel auszutauschen, über den von Lermontow und über den aus der ukrainischen Dumka. Wie gut sie aussahen! Und wie viel Charme hatte der Tanz des einen und der wehmütige Gesang des anderen gehabt!
Am nächsten Tag verhängte Maria nach dem Frühstück eine „Ausgangssperre“. Keine von uns durfte das Haus verlassen.
„Wir haben zu essen und zu trinken, wir können uns hier waschen und unsere Notdurft verrichten, die Tür bleibt verbarrikadiert und die Fenster lassen wir geschlossen, damit es so aussieht, als ob hier niemand sei.“
Diese Worte waren vor allem an die Jüngeren gerichtet, die zog es nämlich in die Stadt, zu anderen Menschen, zu der neuen, unbekannten, aus den Kriegsverwüstungen aufgetauchten Welt. Einige wollten bloß das beschauliche Städtchen Neustadt-Glewe genießen, das zu einem Bummel auf der Hauptstraße einlud, ohne dabei wachsam und verstohlen zur Seite blicken, Ausschau halten zu müssen, ob und woher ein Stein geflogen kam oder ein Schrei wie ein Peitschenhieb niederging, andere hingegen hätten gerne in den verlassenen Häusern nach etwas Essbarem gesucht – und vielleicht nicht nur danach.
Wir fügten uns jedoch. In Maria war etwas, das Gehorsam gebot.
*
Sie war etwas über dreißig, schien aber alterslos. Zart und sanft, wie sie war, hätte sie hinter dem Stacheldrahtzaun nicht einen Monat überlebt, wenn nicht Marta gewesen wäre, die im Brotmagazin arbeitete und für ihre zwei Schwestern eine Beschäftigung in der Schneiderei erkaufen konnte. Sie musste die beiden aber zusätzlich mit Lebensmitteln versorgen, was sie auch tat und wobei sie sich selbst in Gefahr brachte. Einmal prahlte Maria, als sie vom Abendappell zurückkam, vor der Schwester mit einer Errungenschaft – es war ein Küchentuch mit einem kunstvoll eingestickten Spruch: „Ein feste Burg ist unser Gott.“ Zuversichtlich lächelnd erklärte Maria, dass sie es für eine Portion Wurst von einer Jüdin aus „Kanada“ erworben habe. Marta regte sich auf: „Du gibst Essbares für etwas, das dir nicht den Magen füllt und dich auch nicht wärmt?“ Maria, die nie ihre Stimme hob, antwortete ruhig, dass sie darin eine Botschaft der Mutter sehe. „Was denn für eine Botschaft?“ Marta wurde noch ärgerlicher. „Erinnerst du dich an das, was Mutter gesagt hat? Dass Gott uns beschützt und dass wir auf ihn vertrauen sollen.“ Aber Marta war zu theologischen Erörterungen nicht aufgelegt. „Die fromme Hausfrau, in deren Küche dieser erhabene Spruch hing, hat bestimmt einen Mann oder einen Sohn, der bei der SS ist.“ „Muss es denn unbedingt eine Deutsche gewesen sein?“ Maria versuchte, Marta zu einer anderen Denkrichtung zu bewegen. „Das ist doch wohl Deutsch, oder?“ Marta kochte vor Wut. Maria schwieg. Erst nach einer Weile sagte sie, während sie sich das Tuch in den Ausschnitt steckte: „Meinst du nicht, dass man sich in jeder Sprache zu Gott bekennen kann?“
*
Wir saßen also mucksmäuschenstill in dem Haus und langweilten uns furchtbar. Wir wagten noch nicht einmal zu kochen, um uns durch den Essensgeruch nicht zu verraten. Trotzdem fuhr gegen elf Uhr ein Jeep vor dem Haus vor. Es waren die „Ritter“ von gestern. Der mit den hellen Haaren trug ein Akkordeon. Der „Dämon“ schleppte mit beiden Händen ein verdächtiges Bündel, wobei er die Arme so weit wie möglich vom Körper weghielt. Die versperrte Tür überraschte sie. Sie kamen zum Fenster.
„Djewuschki! Mädchen! Wir sind’s!“
Frau Dr. P. zersauste sich ihre grauen Haare (das machte sie immer, damit sie wie eine alte Frau aussah) und öffnete die Oberlichte.
„Warum macht ihr nicht auf?“, kam die etwas barsche Frage.
Unsere Erklärung, dass die Tür verbarrikadiert sei, weil wir uns vor ungebetenen Gästen fürchteten, gefiel ihnen nicht. Nach einem Moment des Zögerns jedoch zeigten sie Verständnis.
„Richtig so“, stellte der Georgier fest.
„Vollkommen richtig“, pflichtete der Ukrainer bei.
Daraufhin brachte Frau Dr. P. noch eine zusätzliche Begründung vor: Nicht alle seien so ritterlich wie sie. Dem stimmten sie vorbehaltlos zu und baten darum, das Fenster zu öffnen, damit sie uns ihre Geschenke übergeben könnten.
„Das ist für die Künstlerin.“ Der Ziehharmonikaspieler reichte ein Akkordeon herein.
„Und das ist für alle.“ Der „Dämon“ warf einen feuchten, schmierigen Sack auf das Fensterbrett. Das sei die Verpflegung. Die müsse man kochen oder braten, wir würden schon wissen, was wir damit machen müssten, wir seien doch wohl nicht alle Künstlerinnen. Sie kämen in zwei, drei Stunden zum Mittagessen und zum Konzert. Aber weil Frau Dr. P. etwas konsterniert schwieg, fügte er bedeutungsvoll hinzu, dass wir in der Gesellschaft von Offizieren sicherer seien, was auch immer geschehen sollte. Frau Dr. P. verstand.
„Also, Sie sind herzlich eingeladen, meine Herren Offiziere“, sagte sie im Tonfall einer höflichen Gastgeberin.
Sie stiegen in den Jeep und fuhren weg. Die „Künstlerin“ befasste sich sofort mit dem Akkordeon, die Verpflegung aber blieb am Fenster liegen. Keine von uns hatte es eilig damit, alle Blicke ruhten auf Marysia Russisches Herz. Die schüttelte nur den Kopf, nahm das Bündel und brachte es in die Küche. Es war ein Ferkel, vielleicht vor einer Stunde geschlachtet, voller Blut. Teresa, unsere Sängerin klassischer Lieder, wurde leichenblass und rannte zur Toilette. Auch andere, die beim Auspacken des Bündels zugegen waren, wandten den Blick ab.
„Oh Gott, was sollen wir denn damit anfangen?“
Diese weinerliche Frage verärgerte Marysia Russisches Herz.
„Na, was wohl? Fressen! Und sich danach die Finger ablecken! Oder was denkt ihr?“ Sie brüllte, dass uns Hören und Sehen verging. „Was meint ihr denn, wer euch versorgen wird? Die Amerikaner? Die haben sich aus dem Staub gemacht, soll uns doch Väterchen Stalin füttern! Vergesst horse meat, ham und jam!“
Sie brachte uns in Verlegenheit. Kleinlaut drückten wir unsere Absicht zu helfen aus, damit „das da“ bloß ausgenommen und zerlegt würde, damit es bloß schon Fleisch wäre und kein Tier mehr, das gerade erst in irgendeinem Gehöft fröhlich herumgelaufen und herumgesprungen war. Marysia erwiderte nichts, sie suchte in der Küche nach einem großen Messer und ging zu der blutigen Tierleiche.
„Wer helfen will, kann hier anfassen.“ Sie drehte das Ferkel auf den Rücken und bog die Hinterbeine auseinander.
Wortlos traten Mila und die andere Marysia, wegen ihrer Größe und ihrer stattlichen Figur „die Große“ genannt, zu ihr.
„Und ihr anderen alle raus hier, ihr Zimperliesen!“ Marysia Russisches Herz drohte den Gafferinnen mit dem Messer.
*
Über Marysia die Große wussten wir nicht viel. Sie war schweigsam und mürrisch oder vielleicht auch nur traurig und sehr verschlossen, sie mied jeden näheren Kontakt. Sie war unter uns fremd, weil sie es so wollte. In Neustadt-Glewe war sie in unserer Baracke gewesen und hatte sich uns angeschlossen, als wir in das Fliegerquartier umzogen. Aber sie blieb immer auf Distanz. Nur mit mir wechselte sie manchmal ein paar Worte, vielleicht deshalb, weil sie mich von der Arbeit auf den Feldern kannte: Vornübergebeugt zertrümmerten wir nebeneinander mit Hacken die Erdschollen auf dem steinharten Boden und sie brachte es fertig, bei dieser Schufterei andauernd die gleiche Melodie, das gleiche Lied zu singen: „Wo bist du? Wo? Sicher weit fort. An einem fernen, unbekannten Ort. Und selbst wenn nicht, selbst wenn du nahe bist, bin ich noch trauriger, weil dein Antlitz mir fremd geworden ist.“ Ihr Blick wanderte zu den Häftlingen, die hinter dem Pflug hergingen, sie hatten fahle Gesichter und tiefe Augenhöhlen. Würde sie etwa in einer dieser zerlumpten Gestalten ihren Geliebten erkennen? Es kamen einem die Tränen bei diesem Gesang. Aber mit umso größerer Verbissenheit hackte man auf die Schollen der harten Erde ein. Wer hier weinte, war verloren.
*