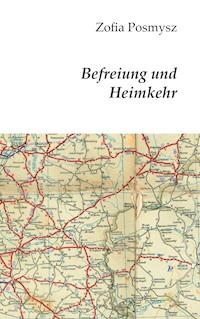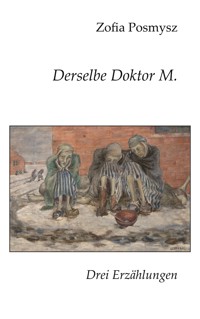
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch mit den drei in diesem Band veröffentlichten Erzählungen legte Zofia Posmysz ein Geflecht aus autobiographischen und fiktionalen Elementen vor, um das eigene Trauma zu verarbeiten und zugleich einem literarisch interessierten Publikum hautnah zu vermitteln. In "Die Sängerin" nimmt uns die Autorin mit in das erste Frauen-Straflager Budy, während sie in "Derselbe Doktor M." die Überwindung ihrer Fleckfiebererkrankung in einen zeitgenössischen Erzählrahmen stellt. "Ave Maria" ist eine Erzählung, der wie dem Roman "Die Passagierin" ein Hörspiel zugrunde liegt. Abermals wird ein Ehemann mit der Auschwitz-Vergangenheit seiner Frau konfrontiert, in diesem Fall jedoch der eines ehemaligen Häftlings.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Sängerin
Ave Maria
Derselbe Doktor M
.
Glossar
Über die Autorin
Die Sängerin
„Mittagsruhe.“ Mittagspause – eine halbe Stunde. Wir dürfen uns hinsetzen, ja sogar hinlegen. Die Julisonne steht im Zenit, die senkrecht einfallenden Strahlen blenden mit ihrem gleißenden Licht. Wenn eine von uns wie durch ein Wunder noch ihre Arbeitsschürze hat, kann sie damit ihren Kopf bedecken. Der Wald ist ganz in der Nähe, mit seinem Harzgeruch, mit seiner vielversprechenden Kühle. Es würde reichen, ein paar Meter weiterzurücken, um im Schatten zu sein. Aber keine von uns wagt es. Niemand will sich auf den Tod zubewegen. Trotz allem. Noch haben wir einen Rest an Hoffnung, dass wir es schaffen. Dass wir es schaffen, zu überleben. Oder wenigstens der SK, der Strafkompanie, zu entkommen. Der Körper ist ein Sack aus Schmerzen und Fleisch, zitternd mit jeder Faser. Der Eulenspiegel hat sich heute gelangweilt. Die Spaten mussten niedersausen, mussten, als wären sie Beile, die Wurzeln zerhacken, die dicken Wurzeln der Bäume des alten Waldes, wo wir Gräben ziehen. Nun spüre ich am Schädelansatz ein Pulsieren, ich schiebe einen am Spaten hängen gebliebenen Klumpen frischer Erde darunter.
„Vilja, oh Vilja, du Waldmägdelein“, ertönt es in der sengenden Mittagshitze, in der Stille der Mittagsruhe.
„Hure“, knurrt Luśka, „verdammte Hure.“
Luśka verwendet als Einzige von allen Polinnen solche Worte. Nur sie trägt den schwarzen Winkel. Sie wurde wegen Prostitution verhaftet. Das gibt ihr das Recht, mit den roten Winkeln nicht solidarisch zu sein. Sie vertritt gern die Anweiserin. „Weiter, los, bewegt euch, ihr rotzigen Intelligenzlerinnen!“, brüllt sie, wenn eine von uns Trudes momentane Unachtsamkeit ausnutzt, um für einen Augenblick den Rücken durchzustrecken oder sich auf den Spaten zu stützen. Luśka ist gemein und aus eigenem Antrieb bereit, andere zu quälen, und sie ist lästig mit ihrem Gossenjargon. Gegen diese Mittagskonzerte allerdings kann sie nichts ausrichten und ist daher wütend. Sie hebt den Kopf, schreit: „Ruhe!“, und legt sich dann flach auf die Erde. Der Gesang verstummt nicht, hinten bei der Obstwiese, die erkennen lässt, dass hier einmal ein Wohnhaus mit Wirtschaftsgebäuden und Garten war, erhebt sich Trude. Dünne Beine mit blauen, von Abszessen stammenden Narben, ein buckliger Rücken, auf dem langen Körper ein kleiner Kopf mit gelben, dünnen Haaren. Eine Sadistin, unermüdlich im Prügeln und Töten – heute ist sie träge und schwerfällig, weil sie sich den Bauch mit unseren Kartoffeln vollgeschlagen hat, und müde von der Hitze. Sie hat keine Lust herauszufinden, wer von uns die Frechheit hatte, „Ruhe“ zu schreien, als ob sie selbst die Anweiserin sei. Sie ruft bloß warnend in unsere Richtung:
„Maul halten dort, sonst …“
Luśka heult beinahe:
„Ich bringe diese verdammte Sängerin um, ich erwürge sie irgendwann in der Nacht.“
Schweigen folgt diesen Worten. Liegt darin Zustimmung? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es keine ablehnenden Bemerkungen. Dieses Mal regt sich niemand über Luśkas Wortwahl, über ihre Drohung gegen eine von uns auf. Noch nicht einmal mit einem Blick reagieren wir. Wir liegen reglos da. Unter der Häftlingskleidung ragen unsere Schienbeine hervor mit schlaffer, herunterhängender Haut anstelle der Waden und dick angeschwollenen Knöcheln.
Das Vilja-Lied hört endlich auf, der Schlaf kommt, wird aber sofort wieder vertrieben durch Schuberts Serenade „Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir …“. Wie gut passt das zu dieser idyllischen Landschaft: zu dem von der Sonne beschienenen Wald, zu dem verwaisten, melancholischen Garten, zu dem satten Grün der frischen Wiesen. Aus dem Gedächtnis tauchen Bilder auf: ein Park im Mondenschein, eine weiße Terrasse mitten in der Nacht, der Kopf eines Pianisten über dem Klavier, der Film „Leise flehen meine Lieder“ irgendwann irgendwo gesehen …
Die Sängerin singt leise, sie weiß, dass wir sie verfluchen, sie versucht, uns zu schonen, sie beginnt immer leise, mit gedämpfter Stimme, bis der Eulenspiegel sagt: „Los, sing mal anständig!“, denn der Eulenspiegel weiß, was sie kann, und er mag es, wenn der Gesang ein Gesang ist und nicht bloß ein Vor-sich-hin-Summen. Also gibt es kein Entrinnen.
Jeden Tag dasselbe, auf die gleiche Weise: Eiliges Schlürfen der Brennnesselsuppe, dazu drei oder meist nur zwei Kartoffeln mit Schale, die natürlich niemand pellt, danach krampfartiges Zu-Boden-Fallen, um wenigstens für einen kurzen Moment einzunicken. Aber wenn der ersehnte Schlaf fast schon da ist, die kraftspendende Rettung für die zweite Hälfte des Tages, ertönen die Rufe der Anweiserinnen:
„Die Sängerin! Wo ist die Sängerin? Sie soll zum Rottenführer kommen!“
Und die zarte Gestalt huscht geduckt, damit sie möglichst nicht zu sehen ist, unter der Schusslinie unserer feindseligen Blicke zu dem Platz, wo der Eulenspiegel sich mit seinem Hofstaat ausgebreitet hat, sie wird verfolgt von Luśkas hasserfülltem Flüstern:
„Ich erwürge diese Hure und die jüdische Professorin gleich mit.“
Dann erhebt sich zwischen den liegenden Frauen eine andere Gestalt und läuft unauffällig hinter der ersten her, möglichst weit entfernt von Luśka. Gehetzter Blick, verkrampftes Gesicht. Ema trägt eine Nummer mit einem roten Winkel und dem Buchstaben P, nicht den Stern. Im Besitz dieser arischen Kennzeichnung sieht sie eine große Chance. Abends spricht sie zusammen mit den anderen katholische Gebete, singt Kirchenlieder, erinnert sich an Weihnachten daheim und an den Tag ihrer Firmung. Sie ist Katholikin, eine von uns, hungrig und geschlagen wie alle, aber sie wird nicht deswegen geschlagen, weswegen die geschlagen werden, die den Stern tragen, nicht wegen ihrer Rasse. Darauf stützt sie ihre Hoffnung, dass sie überleben wird, und diese böse Person hier ruft ihr das schreckliche Wort „Jüdin“ hinterher. Ema hat Angst vor diesem Wort, mehr Angst als vor allem anderen, es jagt ihr eine größere Angst ein als Trude und Lore, macht ihr mehr Angst als der Rottenführer. Vor denen schützt sie einstweilen die Protektion der Sängerin. Sie wissen nämlich, wer ihr all diese Lieder beibringt: Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, Vergiss mich, wenn du kannst, Ich küsse Ihre Hand, Madame – Filmschlager, Arietten, aber auch Lieder von bedeutenden Komponisten, sogar Arien. Womit würde die Sängerin ihre Ohren erfreuen, wenn Ema nicht wäre? Der Rottenführer hatte sehr schnell genug gehabt von den polnischen Liedern und forderte:
„Sing mal deutsch!“
Aber die Sängerin kannte nichts in deutscher Sprache. Also wurde sie weggeschickt, aber Trude riet ihr großmütig:
„Du kannst doch etwas lernen, oder nicht?“
Und die Sängerin lernte – dank Ema. Ema bietet ihr das, was der Rottenführer sich wünscht. Nun weiß sie, wofür die sorgfältige Erziehung, die musikalische Ausbildung, derentwegen sie sogar nach Wien gegangen war, und der echte Bechstein in dem großen Salon in der Dietl-Straße in Krakau gut waren. Sie erteilt einer Unterricht, die sterben sollte, aber nicht gestorben ist, weil sie Talent hat. Ema hat ebenfalls Talent. Und auch sie wird leben. Sie wird von der Sängerin gebraucht, das wissen alle. Denn was für ein Repertoire hat diese vorher gehabt? Ein paar völlig primitive Liedchen. Erst Ema hat sie herangezogen, mehr noch: Sie hat ihr eine Position verschafft. Ja, eine Position. Sie hat aus ihr die Sängerin der Strafkompanie in Budy gemacht. Sie hat dabei keine Mühe gescheut und sich um den Schlaf gebracht. Der Unterricht findet nämlich immer nachts statt, in der Latrine. Sie hocken auf den Fersen, denn zu stehen ist unmöglich nach der Schinderei den ganzen Tag über und sich auf den Beton zu setzen ist gefährlich, weil man sich den Unterleib verkühlen kann. Ema trommelt mit den Fingern in die Luft und gibt Töne von sich, die die Klavierbegleitung imitieren sollen: „Pa-ram-pam-pam-pam-pam, pa-ram-pam-pam-pam-pam.“ Und nach dieser Einleitung summt sie: „Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir.“ Die Sängerin wiederholt die Melodie zusammen mit dem Text und macht das so gut, dass Ema ganz benommen ist. Vor Rührung über die Gelehrigkeit der Schülerin, so meint sie, in Wirklichkeit aber vor Hunger. Der Gesang der Sängerin wird vorläufig nicht belohnt und somit auch der Unterricht nicht. Die einzige Vergütung ist die Hoffnung. Beim Essensnachschlag, bei der Einteilung zur Arbeit und bei jeder anderen Gelegenheit, die in der Strafkompanie in Budy darüber entscheidet, wie schnell der Tod erfolgt. Das nämlich ist die Perspektive für uns alle. Irgendein bestimmtes Ereignis beschleunigt die Sache nur. So war das mit unseren sieben Toten. Und so war das mit der Sängerin, obwohl heute das erschöpfte, dezimierte Kommando sich nicht daran erinnern will, dass sie das Los ihrer ermordeten Vorgängerinnen teilen sollte, dass sie von Anfang an dazu verurteilt war.
Im Montelupich-Gefängnis war sie noch nicht die Sängerin. Wir waren nicht gegen sie, obwohl sie wie kaum eine von uns ständig von ihrer Unschuld sprach. „Es kann nicht sein, dass ich hier festgehalten werde, das ist unmöglich, ich habe doch gar nichts getan, das muss ein Missverständnis sein.“ So redete sie, als sie weinend in die Zelle gepfercht wurde, und auch später, als schon einige Tage vergangen waren und sie nicht freigelassen worden war, und noch später, als sie sah, wie die anderen Frauen, ihre Zellengenossinnen, misshandelt von den Verhören zurückkamen.
Gegen sie wurde keine Anklage erhoben. Schon gar keine politische. Sie war bei einer Razzia aufgegriffen worden, die bei ihrem Schuster stattgefunden hatte. Man brachte sie zur Gestapo, obwohl sie hoch und heilig versicherte, dass sie bloß Schuhe zum Besohlen hatte abgeben wollen. Sie war entsetzt und schockiert, aber sie hörte nicht auf zu glauben, dass sich das Missverständnis aufklären und die Gestapo sie freilassen werde, sobald sie sich von ihrer Unschuld überzeugt habe. Als nach zwei Monaten Gefängnisaufenthalt die Aufseherin Ula Ślązaczka ihren Namen aufrief, warf sie sich ihr an den Hals. „Nach Hause! Ich kann nach Hause!“, stieß sie hervor. „Du kommst nach Auschwitz“, hörte sie als Antwort. Da sagte sie wieder: „Das ist nicht möglich. Das muss ein Irrtum sein. Ich will mit dem Kommandanten sprechen. Ich habe nichts getan.“ Sie rief ihr „Ich habe nichts getan“, bis eine der Gefangenen, die Frau eines Offiziers mit einer sehr schwerwiegenden Anklage wegen Waffenbesitzes, zu ihr sagte: „Gib endlich Ruhe! Du musst nichts getan haben. Es reicht, dass du Polin bist.“
Im Montelupich-Gefängnis erging es ihr einigermaßen. Sie bekam zwar keine Päckchen – vielleicht wusste die Familie nichts von ihrem Schicksal oder sie war zu arm, um sie zu unterstützen –, aber als Häftling ohne konkrete Anklage wurde sie zum Putzen der Büroräume des Gefängnisses abgestellt, von wo sie immer Zigaretten zum Tauschen oder ein Stück Brot mitbrachte. Abends jedoch sang sie. Übrigens nicht nur sie. Es war erstaunlich, wie viele Sängerinnen es in der Zelle gab, wie viele Neigungen, ja sogar künstlerische Talente in dieser schrecklichen Zeit zum Vorschein kamen – eine formte aus Brot oder Seife Figuren, eine andere rezitierte Gedichte, eine dritte wiederholte Sketche aus Radiosendungen und alle, fast alle erzählten.
Die Kunst des Erzählens gehörte zu den am meisten geschätzten Fähigkeiten in Zelle sechsundzwanzig des Montelupich-Gefängnisses. Es wurden Filme erzählt, Theaterstücke, Bücher und Geschichten, die man gehört hatte. Über eines aber wurde nicht gesprochen: über die Angelegenheit, derentwegen man hier gelandet war, und über die Angst und darüber, wie es einem das Herz zusammenzog, wenn sich die Schritte des Wächters der Zelle näherten. Dieses Thema war verboten, auch in unseren Gedanken. Und so wurden verschiedene Künste in Zelle sechsundzwanzig zum Besten gegeben, wobei das Singen die höchste Anerkennung genoss.
Damals liebten wir es, ihren Gesang zu hören. Wir baten die Sängerin um Lieder. Und sie hatte ein unterhaltsames Repertoire; es war ein heilloses Durcheinander, meinten diejenigen, die sich auskannten. Sie sang fromme Lieder, Gassenhauer im Stil von „Stach, komm zurück, ich vergeb’ dir deine Schuld“, ukrainische Dumki, die besonders in Südpolen beliebt waren, Pfadfinderlieder und patriotische Lieder, wie wir sie von der Schule kannten – alles mit derselben Ergriffenheit. Das Frauengefängnis in der Montelupich-Straße befand sich im sogenannten Helcel-Haus, das vor dem Krieg als Altersheim gedient hatte. Die ehemaligen Schlafräume waren zu Zellen umgebaut und die hohen Fenster mit Gittern versehen worden. Der Blick hinaus aber war uns nicht genommen. Vor unseren nach Freiheit dürstenden Augen erstreckte sich ein Garten mit Reihen von Obstbäumen, die nun im Mai mit Blüten übersät waren. Wir sahen diesen Zauber der Natur und sagten: „Sing was!“ Sie ließ sich nicht lange bitten. Und schon erklang „Warum hat er mich vergessen“ oder eine ähnlich sentimentale Klage eines verlassenen Mädchens und die inhaftierten Frauen, bedroht von Verhör, Folter und Tod, dachten verwundert, wie weit doch all das weg war, wie lächerlich und dumm das war, und fragten sich selbst insgeheim, ob sie irgendwann, wenn sie überlebten, erneut von so etwas gerührt sein würden. Manchmal stellte sich die Sängerin auf die Fensterbank und hielt sich mit beiden Händen am Gitter fest. Vielleicht konnte sie so besser singen oder vielleicht mochte sie es, wenn das Echo ihrer Stimme von der Begrenzungsmauer widerhallte. Gelegentlich rief der Wächter im Innenhof: „Du, geh mal runter!“ Singen war nämlich streng verboten. Aber es kam vor, dass er zur Seite trat und zuhörte. Die Sängerin war die Primadonna des Montelupich-Gefängnisses.
In Auschwitz war sie plötzlich ein Niemand. Die Nacht im Lager – von zweiundzwanzig Uhr bis drei Uhr morgens – war zu kurz, um wegen irgendwelcher Gesangsdarbietungen nicht zu schlafen. Zumal man ohnehin alle paar Minuten aufgeweckt wurde durch die Flöhe oder durch das Gejammer und Angstgeschrei derjenigen, die aus einem Alptraum erwacht waren und sich in dem anderen, tausendfach schlimmeren Alptraum der Realität wiederfanden. Die Tage hingegen waren erfüllt entweder von der Stille des Appells oder vom Schreien und Fluchen der Sklaventreiber. Der Gesang hatte keinen Platz in dieser Wirklichkeit, so wie auch die Hoffnung keinen Platz darin hatte.
Die Sängerin aber machte sich noch immer etwas vor. Im Gegensatz zu den anderen, die davon überzeugt waren, dass nur das Ende des Krieges oder der Einfluss der Weltöffentlichkeit das Schicksal der Häftlinge wenden könnte. Sie hingegen wartete auf eine eigene, eine persönliche Befreiung. Die Befreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Sie rechnete immer noch damit. Sie hatte doch nichts getan, sie war doch unschuldig. Hartnäckig glaubte sie an das Einschreiten irgendwelcher Mächte, die das ordnungsgemäße Vorgehen der nationalsozialistischen Justiz überwachten, an einen übernationalen, systemübergreifenden Gerechtigkeitssinn, demzufolge ein Mensch, der keiner konkreten Straftat bezichtigt wurde, nicht in ein Lager gesteckt werden darf, sie glaubte also letztendlich an die Menschlichkeit der Mörder.
Dazu hatte sie im Übrigen eine gewisse Veranlassung. Ihr waren nämlich unbegreifliche Dinge geschehen, ihr gegenüber war Mitleid gezeigt worden. Einmal hatte mittags ein lettischer SS-Mann ihr den Rest seiner Suppe gegeben und ihr bei dieser Gelegenheit einen kosmetischen Rat erteilt: Sie möge, um Sonnenbräune zu vermeiden und um ihre wunderbare Hautfarbe zu bewahren, ihr Gesicht mit Urin einreiben. Ein anderes Mal interessierte sich ein Rottenführer dafür, wie alt sie sei und weshalb sie eigentlich hierhergebracht worden war. Und schließlich, als sie ohnmächtig war und wir sie auf einem Holzkarren ins Lager zurückbrachten, zeigte sogar die Lagerführerin Langefeld, die die Kommandos beim Einmarsch zählte, Mitleid mit ihr, indem sie Worte äußerte, die völlig unglaublich waren: „Mein Gott, so jung …“ Die Sängerin zog nämlich die Aufmerksamkeit auf sich durch ihr kindliches Aussehen, durch ihre sehr helle Haut, durch ihren verwunderten Gesichtsausdruck, der aufgrund der weit oben liegenden und immer wie hochgezogen wirkenden Augenbrauen entstand und etwas Hilfloses und Entwaffnendes hatte. Der Vorfall aber, der sie am meisten in ihrer Überzeugung bestärkte, dass ein Mensch, selbst ein SS-Mann, nicht fähig ist, das menschliche Element in sich völlig zu beseitigen, ereignete sich im Wasserkommando – so wurde die zweihundertköpfige Gruppe von Frauen genannt, die die Fischteiche säuberte. In dem Moment, als ich zum ersten Mal diese Teiche sah, die zwischen den grünen Dämmen wie Spiegel glänzten, überkam mich plötzlich die Erinnerung an den Heiligabend. Mein Vater, ein Eisenbahner, mochte es, wenn er in der Woche vor Weihnachten nach Oświęcim fahren musste, wo man billig Karpfen kaufen konnte. Oświęcim bedeutete damals für die Familien von Eisenbahnern: viel Fisch beim Essen am Heiligabend. Wer hätte ahnen können, wofür dieser Name einige Jahre später stehen sollte?
In den Fischteichen, die verwildert waren und mit Schilf zugewachsen, arbeiteten wir nun schon zwei Wochen. Es war sehr kühl, ein für Juni untypisches Wetter. Zum Hunger kam also noch die Qual der Kälte hinzu. Wir wateten manchmal hüfthoch durchs Wasser, es half nicht, dass wir unsere Kleider und Hemden hochrafften, am Ende des Tages war sowieso alles nass. Und natürlich wurden die Sachen in der Nacht nicht trocken.
Jeden Morgen, wenn wir die Häftlingskleidung anzogen, die steif war wie Leder, trösteten wir uns mit dem Gedanken, dass wir vielleicht heute zu einer anderen Arbeit eingeteilt werden würden. Oder dass die Sonne sich zeigen würde. Aber weder das eine noch das andere geschah. Wir traten zum Appell an, mit klappernden Zähnen, dann kam der Abmarsch und das unvermeidliche, kalte Wasser, in das man hineinmusste, und die Schinderei den ganzen Tag im Schlamm; die scharfen Gräser hinterließen blutige Schnitte an Armen und Beinen und die Wasserinsekten saugten sich an diesen Wunden fest. Und dazu die Gewissheit, dass sich nichts ändern würde. Weder morgen noch in einer Woche – nie. Nie mehr würde die Sonne scheinen und nie mehr würde unsere Kleidung trocknen.
In der Nacht, unter der Decke, die genauso stach wie die Flöhe – unsere Sachen hatten wir aufgehängt, damit sie wenigstens ein bisschen Feuchtigkeit verloren –, versuchten wir vergeblich einzuschlafen. Alle paar Augenblicke wurde man wach, weil die Blase schmerzte oder weil ein lang anhaltender und durchdringender Schrei ertönte, wie das Quietschen von Rädern auf Schienen. Das waren aber keine bremsenden Waggons, wie ich dachte, als ich dieses Geräusch zum ersten Mal hörte. So einen Schrei gibt ein Mensch von sich, der einen Stromschlag bekommt. Während wir zum Morgenappell antraten, hatten wir im Stacheldrahtzaun hängende Gestalten vor unseren Augen, die in seltsamen Verrenkungen erstarrt waren. Wir bemühten uns, sie nicht zu sehen. Zumindest am Anfang vermieden wir, in die Richtung zu schauen, wo jemand diesen Akt der Befreiung vollzogen hatte. Im Wasserkommando aber lernten wir, den Blick nicht abzuwenden und uns mit dem Gedanken an so ein Ende vertraut zu machen.
An diesem Tag herrschte eine bittere und gar noch durchdringendere Kälte. Es regnete. Unter eisernem Schweigen bewegte sich das Kommando von der Mitte des Teiches zum Ufer und wieder zurück. Kein Wort, kein Blickwechsel. Nur so konnte man es ertragen: indem man in den Augen der anderen nicht das Spiegelbild der eigenen Verzweiflung sah, indem man in den Stimmen der anderen nicht den Widerhall des eigenen Schmerzes hörte. Am Tag zuvor hatte ein Hund eine Gefangene gebissen, weil sie nicht schnell genug ins Wasser gegangen war. Heute konnten wir, dank des Regens, wenigstens ab und zu ein bisschen verschnaufen. Der Aufseher und die Aufseherin hatten es sich unter seinem Tuchmantel und ihrer schwarzen Pelerine unter einer Weide auf dem Damm bequem gemacht. Der Hund war in ihrer Nähe, er lag in sicherer Entfernung von uns auf der Lauer. Das Kommando bewegte sich fast im Laufschritt. Es musste niemand ins Wasser gejagt werden. Denn dort war es trotz allem wärmer.
Ich trug zusammen mit der Sängerin eine Trage. Sie ging vorne, vor mir hatte ich ihren mageren gebeugten Rücken und, wenn wir ans Ufer kamen, ihre Beine. Blut lief daran herunter, in feinen Rinnsalen, manchmal auch in dickeren Klümpchen. Die Blätter der Kletten konnten Monatsbinden nicht ersetzen. Die Sängerin weinte. Ich hob den Kopf, um nicht auf ihre Beine schauen zu müssen, und da sah ich, wie ihre Schultern unter ihrem Schluchzen bebten. Ich schwieg, denn was hätten irgendwelche Worte ihr geben können? Ich hatte solche Worte nicht. Ich hatte überhaupt keine Worte.
Am Nachmittag trieb uns der Kapo zum anderen Ende des Damms. Wir mussten an dem Hund vorbeigehen, der Damm war nicht breit. Ich überlegte, wie ich das machen könnte, ohne die Aufmerksamkeit dieser Bestie auf mich zu ziehen. Die Sängerin weinte die ganze Zeit. Der Posten bemerkte zunächst dieses befremdliche, ungehemmte Weinen und dann den Grund dafür. Er murmelte: „Schweinerei“, und wandte den Kopf ab. Ich sah, wie sein Gesicht einen beschämten Ausdruck annahm. Als wir zurückkamen, hielt er uns an und befahl der Sängerin, am Ufer zu bleiben. Er war Aufseher und nicht Kommandoführer und hatte somit keine Befugnis, jemanden von der Arbeit freizustellen. Und doch … Sie solle sich ins Gebüsch setzen und warten, sagte er. Und dann murmelte er wieder sein „So ’ne Schweinerei …“. Die Aufseherin, dieselbe, die am Tag vorher den Hund auf einen Häftling gehetzt hatte, protestierte nicht. Und so glaubte die Sängerin weiterhin an diesen Funken Menschlichkeit, der nicht völlig erloschen war.
Es hörte schließlich auf zu regnen und es wurde sofort heiß. Nun war das Wasserkommando besser als andere Kommandos. Die Arbeit verlief ruhiger, da wir weit weg waren von den Kapos, die selbst bei dieser Hitze nicht in den Teich gingen. Aber dann wurden wir ausgerechnet bei der Heuernte eingesetzt. Der Marsch vom Lager dorthin dauerte über eine Stunde. Das Gestrüpp, neben dem wir uns aufhielten, erinnerte an das Dickicht von Flussweiden, aber hinter diesem Strauchwerk waren die Umrisse eines zweistöckigen Gebäudes zu erkennen, das kein Dach und keine Fenster hatte – es war die Ruine eines ausgebrannten Schlosses. Später, als ich die Grasschwaden unter den Sträuchern zusammenrechte, kam ich näher an das Gebäude heran und sah eine Terrasse, die noch nicht ganz verfallen war, und eine schöne Treppe, die in einen Park mit alten Bäumen führte. Durch die Fenster- und Türöffnungen schien das Blau des Himmels und dieser Anblick, der etwas Nostalgisches hatte und an romantische Aquarelle erinnerte, entriss mich für einen Augenblick der Wirklichkeit, in der ich mich befand.
Diese Tage bei der Heuernte am Fluss Soła waren beinahe wie die Sommerferien bei den Großeltern, wo man aus eigenem Antrieb den Rechen in die Hand nahm. Der lange Marsch erschöpfte einen zwar und der Hunger setzte einem von Tag zu Tag mehr zu, aber das Grasrechen selbst konnte man aushalten. Viel schlimmer war es gewesen, die steinharten, trockenen Erdschollen der schweren Böden mit der Hacke zu zerschlagen oder das Schilf herauszuschneiden. Und auch die Anweiserinnen quälten uns weniger als in den vorherigen Kommandos, obwohl wir in kleine, zehnköpfige Gruppen eingeteilt worden waren und daher besser beaufsichtigt werden konnten. Der Mensch ist von Natur aus optimistisch. Er braucht nicht viel, um sich in Bezug auf sein Schicksal etwas vorzumachen. Uns reichte diese kleine Linderung, wie eine Frau aus den Bergen es nannte, um zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken.
Leider endete das Ganze plötzlich und dramatisch. Eine Polin floh aus dem Kommando. Sie war während der Suppenausgabe ohnmächtig geworden und die Aufseherin befahl nach einigen vergeblichen Versuchen, sie wieder zu sich zu bringen, sie in den Schatten zu legen, entweder würde sie von selbst das Bewusstsein erlangen oder eben sterben. Anfangs sahen die Anweiserinnen noch nach ihr, später vergaßen sie sie. Sie erinnerten sich erst an sie, als wir ins Lager zurückkehren sollten und als sich herausstellte, dass ein Häftling fehlte. Unter dem Baum, unter den man sie gelegt hatte, war nur eine Spur aus zerdrücktem Gras zu sehen. Es wurde Alarm geschlagen. Wir hörten die Explosion von Raketen und dann – weiter weg – die Sirenen: im Lager und in der Stadt.
Flucht. Aus unserem Kommando. Also auch das mussten wir durchmachen. Dass jemand geflohen war, davon hatten wir bisher nur gehört. Es flohen ausschließlich Männer und auch das kam nicht oft vor. Und nun war es bei uns geschehen. Gelähmt vor Angst warteten wir auf die Ankunft des Kommandanten. Dezimierung. Was konnte man tun, um dem Schicksal zu entgehen? Die einen beteten, die anderen verfluchten die geflohene Person, wieder andere weinten. Nur die Sängerin schien sich nicht zu fürchten. Hatte sie den Ernst der Lage nicht erkannt oder war sie schon so abgestumpft? Weder das eine noch das andere. Sie glaubte einfach nicht an die Dezimierung.
„Es gibt keinen Grund dafür“, sagte sie. „Sind wir denn schuld? Wir sind doch nicht geflohen. Haben wir etwa davon gewusst? War einer von uns befohlen worden, auf sie aufzupassen? Das muss ihnen doch einleuchten.“ So argumentierte sie, nachdem der Posten, der an unseren Reihen entlanggegangen war, sich entfernt hatte. Sie warnte uns: „Malt den Teufel nicht an die Wand mit eurem dummen Gerede.“ Sie meinte, es sei nicht möglich. Es sei einfach nicht möglich.
Dieses Mal konnte sie triumphieren. Ihre naive Erwartung, die sich angesichts der Logik der KZ-Rechtsprechung auf irrationale Annahmen stützte, sollte sich bestätigen. Denn es erfolgte keine Dezimierung. Nach einigen Stunden der Ungewissheit wurde uns – dann schon im Lager – die Entscheidung mitgeteilt. Sie kam angeblich direkt aus Berlin. Vor der Dezimierung rettete uns die Tatsache, dass die geflohene Person ein krimineller Häftling war und kein politischer. In unserem Kommando hingegen waren überwiegend politische Häftlinge. Und so wurden wir nur zum Haarescheren und zur Strafkompanie verurteilt. Die Sängerin wiederholte:
„Na, seht ihr? Seht ihr?“
Der Verlust unserer Haare traf uns schmerzlich. SK? Strafkompanie? Das sagte uns nichts. Was hatten wir schon zu befürchten? Wir hatten unsere Rekrutenzeit im Lager in Feld- und Wasserkommandos überstanden. Was konnte noch Schlimmeres kommen? Budy – was sollte sich dahinter schon verbergen? Es war der Name eines der hiesigen Dörfer oder Ansiedlungen. Mehr nicht. So wie das Wort Oświęcim einst die Bezeichnung für eine Stadt war, eine Stadt unter tausend anderen, keine besondere Stadt, aber auch nicht die allerschlechteste. Bis dieser Name durch ein anderes Wort ersetzt wurde: Auschwitz. Da begann die andere Geschichte von Oświęcim, die sich von jener unterschied, die jahrhundertelang das ruhige Dasein dieses Ortes geprägt hatte, und die die verbrecherischste aller verbrecherischen Ideen beinhaltete: den Völkermord. Uns, unserem Kommando, das aus zweihundert Polinnen und zweihundert Jüdinnen bestand, fiel es zu, die ersten Seiten der Geschichte der Strafkompanie in Budy zu schreiben. Damals ahnten wir nicht, wie blutig diese Geschichte sein sollte. Überwältigt von dem Wunder, dank dessen wir der Dezimierung entgangen waren, zerbrachen wir uns nicht den Kopf über den nächsten Tag. Wir konnten nicht voraussehen, dass das Kommando nach nicht ganz zwei Monaten ins Lager zurückkehren würde mit Verlusten, die um ein Vielfaches größer waren als die, die durch die Dezimierung entstanden wären.
Die Tage im Juni sind lang. Und lang, furchtbar lang war der Marsch nach Budy. Das Kommando schleppte sich auf Feldwegen dahin, über Wiesen und Äcker, völlig abgestumpft durch Erschöpfung und Hunger. Die Ration für das Abendessen und das Frühstück war nicht ausgegeben worden, wir sollten sie erst am neuen Bestimmungsort bekommen. Der Gedanke daran gab uns Kraft. Wir wollten zu diesem Brot und verwünschten diejenigen, die nur mühsam vorankamen und das Tempo verlangsamten.
Noch wurde der Himmel vom Schein der untergegangenen Sonne erhellt. Noch waren nicht alle Lerchen verstummt. Die Grillen zirpten zu beiden Seiten des Weges, sonst waren – außer uns – keine Menschen und keine Tiere weit und breit zu sehen. Nur Obstbäume deuteten darauf hin, dass hier früher Gehöfte gewesen sein mussten. Manchmal erinnerte ein noch nicht ganz abgerissenes Haus daran, dass das „Interessengebiet“ des Konzentrationslagers erst seit kurzem hier existierte. Ein paar einzelne Häuser waren dennoch zu sehen. Das waren prachtvolle Gebäude, die vom Wohlstand ihrer Besitzer zeugten. Bestimmt hatte die Lagerführung ihnen irgendeine Funktion zugeteilt, die sie zu erfüllen hatten.
Es war schon völlig dunkel, als vor uns ein Gebäude auftauchte, das von einem drei Meter hohen, doppelten Zaun aus Stacheldraht umgeben war. Das war das Lager der Strafkompanie.
Die Sängerin trat mit einem Lächeln durch das Tor. Mit diesem ihr eigenen Lächeln, das aufgrund ihrer hochgezogenen Augenbrauen etwas Verwundertes, Zuversichtliches und Entwaffnendes hatte. Sie konnte sich selbst nicht sehen. Sie wusste nicht, wie sehr die geschorenen Haare ihr Äußeres verändert hatten. Sie sah nicht mehr hübsch und frisch aus und auch nicht mehr jung. Ihr Gesicht mit den an der Stirn hochstehenden, ungleichmäßig geschnittenen Borsten war von Schmach gezeichnet und erweckte keinerlei Assoziationen mehr mit einem verletzbaren Kind. Das Lächeln auf so einem Gesicht rief Empörung hervor, als sei es etwas Unschickliches, etwas, das sich nicht gehörte. Der Kommandant der Strafkompanie, ein junger Unterscharführer mit feinen, edlen Gesichtszügen, unterbrach das Zählen. Mit dem Griff seiner Peitsche schob er das Kinn der Sängerin so hoch, dass auf ihrem mageren Hals die Adern hervortraten.
„Hier gibt’s nichts zu lachen“, sagte er, ohne die Stimme zu heben. „Hier ist SK.“ Und dann wiederholte er laut und ließ dabei seinen Blick über die Reihen schweifen: „SK. Und nicht das Sanatorium Auschwitz. Merkt euch das!“
Uns wurde befohlen, ins Gebäude zu gehen. Es war einst eine Schule gewesen. Eine dieser entzückenden, aus vier Klassen bestehenden Dorfschulen, mit zwei oder drei Unterrichtsräumen und einer Wohnung für den Lehrer. Erst vor kurzem war in diesen Räumen noch rezitiert worden: „Dein Vaterland, Kind, ist das ganze Land …“ Oder gesungen: „Lerche, graues Vögelein, warum lässt du unsere Felder allein?“ Nun befanden sich in diesen Räumen anstelle von Schulbänken Strohsäcke auf dem Boden, einer neben dem anderen, blank, ohne Decken. Wir stürzten los, um die Strohsäcke zu belegen. Es entstand sofort ein Tumult, denn die Strohsäcke reichten nicht für alle. Wir wurden angewiesen, uns zu zweit auf einen Strohsack zu legen. Diejenigen, für die unten kein Platz mehr war, kamen auf den Dachboden. Die hatten es übrigens letztendlich besser. Sie waren weiter weg vom Knüppel der Blockältesten.
Brot haben wir an diesem Abend nicht bekommen. Wir haben überhaupt nichts zum Essen oder zum Trinken bekommen. Mit einer Mahlzeit konnten wir frühestens am nächsten Tag zu Mittag rechnen. Und das war das Schlimmste. Wir hatten schon vergessen, dass wir der Dezimierung entgangen waren. Wir legten uns hin. Aber der Hunger, an den wir immer denken mussten, ließ uns nicht einschlafen. Wir verspürten ein Würgen in der Kehle, also setzten wir uns auf, um uns nicht zu übergeben, aber mit flatterndem Herzen sanken wir auf den Strohsack zurück. Und so ging es die ganze Zeit. Gegen Morgen wurde es außerdem noch kalt, denn wir hatten ja nichts zum Zudecken. Angeblich sollten wir die Decken, so wie auch das Essen, am nächsten Tag bekommen, wenn das Kommando formell in den Bestand des Lagers in Budy aufgenommen werden würde. Instinktiv rückten wir enger zusammen, um uns gegenseitig zu wärmen. Aber bevor die Benommenheit in Schlaf überging, ertönte der Gong und die Stubenältesten stürmten in den Raum. Sie rannten an den liegenden Frauen entlang und schlugen blindlings mit ihren Stöcken auf sie ein.
„Los! Aufstehen! Aber schnell! Los!“
Das war die SK. Die Strafkompanie. Die Strafkompanie in Budy.
Die Frau wollte nicht sterben und das Töten zog sich hin. Deshalb konnte das Kommando ein wenig verschnaufen und deshalb gab es kein weiteres Todesopfer. Trude und Lore waren immer noch mit der dort beschäftigt, die sich als verdammt zäh herausstellte. Verschwitzt kamen sie aus dem Erlenwäldchen und ließen in Richtung der Wiese, auf der wir das Gas zusammenrechten, ein paar ihrer üblichen Drohungen los und dann verschwanden sie wieder zwischen den Bäumen. Abwechselnd. Einmal die eine, einmal die andere. Um sich nicht zu verausgaben. Über der Wiese trällerten die Lerchen. Es mussten viele sein, vielleicht einige hundert. Wir konzentrierten uns auf ihren Gesang, um nicht die Geräusche hören zu müssen, die aus dem Erlenwäldchen zu uns herüberdrangen: Schläge, als würde Getreide gedroschen, und das Stöhnen der Sterbenden. Der Mensch in uns beschwor uns, dorthin zu gehen und einzugreifen und zu verhindern, was geschah. Man musste ihn mit etwas ablenken, beruhigen. Jedes Mal, wenn eine der beiden Schinderinnen auf der Wiese erschien, sagten wir uns, es ist zu Ende, in der Hoffnung, dass es nun still werden würde in dem Erlenwäldchen, dass das Gezwitscher über uns wieder das sein würde, was es von Natur aus war, nämlich Vogelgesang und nicht die Begleitmusik zu einem Mord.
Die fast zu Tode Gequälte trugen wir auf eine Weise ins Lager zurück, die wir uns noch im Stammlager von den männlichen Häftlingen abgeschaut hatten: wie ein Heiligenbild bei einer Prozession. Die Rechen, die wir uns auf die Schultern gelegt hatten, dienten als Stangen und quer darüber hing die Sterbende. Die Frau – sie stammte aus den Bergen – war noch nicht tot. Sie röchelte. Aus ihrem offenen Mund tropfte Blut. Wir beteten für sie. Wir flehten zu Gott, zum Teufel und zu allen Heiligen und zum reinen, strahlenden Blau des Himmels, dass sie sterben möge, bevor wir das Lager erreichten. Denn Trude und Lore kreisten wie Hyänen ständig um die vier herum, die die Misshandelte trugen, ihre Arme hatten sich wieder erholt, sie waren erneut bereit, mit ihren Stöcken auf sie einzudreschen. Wir sagten zu ihnen: „Sie ist tot.“ Und wir beteten zum großen Unbekannten, sie möge schon tot sein.
(Als einige Jahre später ihr Sohn mich fragte, woran seine Mutter gestorben sei, sagte ich, an Herzversagen. Das tröstete ihn, denn es stimmte mit der offiziellen Benachrichtigung überein. Aber gleichzeitig war er verwundert, seine Mutter sei gesund gewesen, sie habe nie einen Arzt gebraucht … Ich erwiderte, dass sie an Fleckfieber erkrankt sei und das habe den Herzmuskel geschädigt. Das überzeugte ihn. Er dankte mir und ging beruhigt fort.)
Unsere erste Tote. Aus unserem Transport, aus unserem Kommando. Sie stammte aus einem Dorf in den Bergen. Sie war gesund und kräftig, sie hielt die schwere Arbeit aus, sie war unempfindlich gegen Kälte und immun gegen Krankheiten. Die Wunden an den Füßen, die sie sich auf der gemähten Wiese zugezogen hatte, trockneten sofort und heilten, ihr drohten weder eiternde Blasen noch Hautentzündungen. Sie hatte wie keine andere von uns die Chance zu überleben. Wenn sie außerdem noch hätte hungern können … Die drei Pellkartoffeln, die sie zusätzlich mittags zu der Brennnesselbrühe bekam, waren alle verfault. Zuerst weinte sie, dann bat sie Lore, sie gegen andere auszutauschen. Die Anweiserin sah sich die schwarzen, stinkenden Knollen genau an.
„Was gefällt dir daran nicht?“, fragte sie leise mit ihrer vom Schreien heiseren Stimme. Aber die Frau aus den Bergen kannte sich mit Tonfällen nicht aus.
„Ist kaputt“, beschwerte sie sich. „Bitte, ich Hunger.“ Sie zeigte auf ihren Bauch.
Da rammte ihr Lore mit voller Wucht den Ellbogen in den Magen. Die Frau krümmte sich und rief:
„Warum? Warum schlagen?“
„Waruuum?“, krächzte Lore und stürzte sich auf sie. Die Frau stieß sie zurück. Unglücklicherweise war sie stark. Sie wurde unsere erste Tote. Sie bildete den Anfang der unheilvollen Zahl von zweihundertdreiundvierzig Opfern in den ersten beiden Monaten des Bestehens der Strafkompanie in Budy.
Die Sängerin sagte:
„Sie ist selbst schuld. Auf so eine Art etwas fordern? Sich mit der Anweiserin anlegen?“
In diesen Sätzen war erneut der Versuch enthalten, die Wirklichkeit des Lagers und seiner Regeln logisch zu interpretieren. Trotz allem, entgegen allem. Und vor allem trotz der eigenen Zweifel. Denn in ihren Augen waren diese Zweifel schon zu sehen. Die Zweifel und auch der Wahnsinn. Keine von uns ließ sich auf eine Diskussion ein. Denn wir wollten ja, dass sie Recht hatte. So wie damals vor der vermeintlichen Dezimierung. Nichts wünschten wir mehr, als ihr zu glauben. Die nächsten, die mit einem Stock oder mit dem Knüppel zu Tode geprügelt wurden, wehrten sich nicht, wenn der erste Schlag kam, sie versuchten noch nicht einmal, sich zu schützen. Und trotzdem erfüllte sich ihr Schicksal gemäß dem Gesetz der Strafkompanie, das mit diesem Ausdruck umschrieben wurde: dran sein. Ein Häftling, der einmal geschlagen worden war, musste sterben. Der erste Schlag war wie ein Stempel, so wie man einen Baum kennzeichnet, den man fällen, oder ein Tier, das man schlachten will. Die Leiche der betreffenden Person wurde irgendwann ins Lager getragen – wenn nicht an dem Tag, dann am nächsten. Denn seit der ersten Toten gab es keinen Tag mehr, an dem nicht eine Leiche prozessionsartig ins Lager zurückgetragen wurde. Eine oder mehrere.
Auch sie war dran, unsere Sängerin aus dem Montelupich-Gefängnis. Es geschah bei der Heuernte, in der dritten Woche unseres Aufenthaltes in Budy. Das war der Anfang vom Ende. Die kargen Rationen, die wir in Auschwitz bekommen hatten, wurden hier noch einmal um die Hälfte reduziert. Es gab keine Zulage, also keine Extraportion für schwer Arbeitende, die in Auschwitz manche Kommandos erhalten hatten. Die Funktionshäftlinge klauten wie die Raben. Das Kommando bekam nur das, was sie nicht gemeinsam mit den SS-Leuten aufessen konnten. Denn mit denen standen sie auf gutem Fuß. Sie teilten sich mit ihnen unsere Verpflegung und erwiesen ihnen auch Dienste anderer Art. Sie sprachen ja die gleiche Sprache wie sie.
Wir wussten, dass das Kommando verurteilt war. Wir wurden im Morgengrauen aufs Feld gejagt und mussten lange bis nach Sonnenuntergang schuften. Vier Plagen – der Hunger, die Hitze, die Kälte und die mörderische Arbeit – setzten uns zu. Nur die Angst gab uns Kraft, sie zwang uns, uns aufzuraffen, wenn auch in immer geringerem Maße. Der Rottenführer hieß Hans. Mit seinem rotbackigen, runden Gesicht, seinen schlauen, bösen Augen und seinen abstehenden, spitzen Ohren sah er aus wie Eulenspiegel. Er hatte Fäuste wie ein Boxer. Ein Schlag und man war sofort bewusstlos. Das Opfer stand in der Regel nicht mehr auf. Dann traten Trude und Lore in Aktion, Lore, die wegen ihrer goldenen, lockigen Haare Lorelei genannt wurde. Der Einsatz der beiden endete immer auf die gleiche Weise: mit einer Prozession.
An diesem Tag waren die Bewegungen der Sängerin langsamer, ihre Reflexe schwächer. Sie bemerkte nicht, dass sie beobachtet wurde. Sie hatte Durchfall. Um ihn zu bekämpfen, hatte sie nichts gegessen. Trotzdem hatte der Durchfall nicht nachgelassen. Unglücklicherweise vermochte die Kranke es nicht, sich in aller Öffentlichkeit zu erleichtern. Dieses Kunststück hatte sie noch nicht gelernt, sie hatte noch keine tierischen Verhaltensweisen angenommen. Sie musste auf die Seite gehen, was in Budy durch spezielle Regeln abgesichert war, es bedurfte der Begleitung eines Aufsehers. So einer stand neben ihr, während sie sich hinhockte, er sah auf die Uhr, er schlug ihr mit einem Stock auf den nackten Hintern. „Mach schneller, Mensch!“
Er stand schon das sechste Mal neben der Sängerin, das konnte ihm nicht gefallen. Er merkte sich sie und zählte mit. Nicht deshalb hatte man schließlich Siege an allen Fronten Europas errungen, um diese stinkenden Kreaturen beim Austreten zu bewachen. Vor allem, weil die da es gar nicht nötig hatte. Er sah, was sie zurückließ. Das war so gut wie nichts. Er verpetzte sie beim Eulenspiegel. Und als sie das nächste Mal, sich den Bauch haltend, zu dem Posten lief, schickte der sie zu ihm. Es gab keinen Ausweg, sie musste folgen. Der Schlag gegen den Kopf warf sie zu Boden, ein paar Meter weiter von der Stelle, an der sie gestanden hatte. Sie kam dennoch wieder auf die Beine, offenbar war der Stoß nicht präzise genug gewesen. Taumelnd versuchte sie strammzustehen. Einen Moment lang sah der Eulenspiegel sie an. Trude und Lore hatten sich schon neben ihm eingefunden und warteten, sie waren einsatzbereit. Er sagte:
„Heb den Rechen auf!“
Wie durch ein Wunder verstand sie ihn. Sie beugte sich jäh nach vorn, wurde schwindlig und fiel auf die Knie, sie stand jedoch wieder auf. Er ging zu ihr. Den Rechen hält man so und nicht so. Sie nickte eifrig mit dem Kopf.
„Jawohl, jawohl, Herr Rottenführer.“
Sie fing an zu rechen, hastig, mit aller Kraft, die sie in den Armen hatte, und so schnell sie atmen konnte. Sie taumelte. Er machte einen Schritt zurück und beobachtete ihre Bewegungen, die immer langsamer wurden. Nach dem nächsten Schlag stand sie nicht mehr auf. Sie war bewusstlos. Er trat gegen ihren regungslosen Körper. Wir konnten aufgrund der Geräusche ausmachen, wohin er traf. Kopf, Schultern, Hüften. Toni, die dritte Anweiserin, sagte:
„Jetzt geht’s aber los!“
Es lag ein wenig Mitleid darin. Die fröhliche Toni, die einzige unter den Anweiserinnen der Strafkompanie, die sich einen Funken Menschlichkeit bewahrt hatte – sie hat sich nie an den Morden beteiligt.
An diesem Tag kehrte die Sängerin aber noch aus eigener Kraft ins Lager zurück. Das verdankte sie der Hitze. Oder vielleicht der Tatsache, dass Samstag war? Oder verdankte sie es möglicherweise noch etwas anderem? Zum Beispiel den Bedürfnissen, die sich in den SS-Männern an diesem nach gemähtem Heu duftenden Julitag regten? Bis zum Abmarsch jedenfalls fand in dem Wäldchen ein Trinkgelage mit den Wachposten statt. Da der Leiter der Landwirtschaftsbetriebe im Konzentrationslager Auschwitz, der SS-Obersturmbannführer Caesar, die gemeine Angewohnheit hatte, den arbeitenden Kommandos gelegentlich hoch zu Ross einen Besuch abzustatten, stand die fröhliche Toni Wache, um bei Gefahr zu warnen. Das bedeutete zwar nicht, dass sie selbst sich von derartigen Vergnügungen fernhielt, aber jetzt überließ sie ohne Bedauern ihren älteren und hässlicheren Kameradinnen das Feld. Also bestimmt auch diesem Freundschaftsdienst verdankte die Sängerin die Tatsache, dass sie an jenem Tag noch nicht aus dem Personenbestand des Lagers gestrichen wurde. Trude und Lore ließen sie nämlich in Ruhe und widmeten sich einer Beschäftigung, die sie letztendlich wohl doch dem Töten vorzogen.
In der Nacht aber regnete es und der Regen hörte bis zum Morgenappell nicht auf. Bis wir durchgezählt waren, trieften wir vor Nässe. Das Wasser lief uns am Körper und an den Beinen hinunter bis in die Pantinen und floss aus ihnen heraus, sodass an der Stelle, wo das Kommando stand, sich eine große, bis an die Knöchel reichende Pfütze bildete. Auf diesem Hof hatten einst Kinder fröhlich getobt und gespielt, waren Rufe wie „Franek!“und „Jasiek!“ erklungen, bis das Klingelzeichen sie alle wieder zurück in den Unterricht rief. Was war mit all dem geschehen und würde hier irgendwann erneut eine Schule sein?
Der Regen ließ nicht nach. Den Himmel bedeckten dichte, tiefe Wolken, sie lagen auf den Wipfeln der Bäume des nahen Waldes, der im Dunst kaum zu sehen war. Was bedeutet eine Minute, die man im Regen, in der Hitze oder in der Kälte stehend verbringen muss? Niemand wusste, wie lange man uns hier so festhalten würde. Die Posten mit den Hunden, die die Kommandos bei der Arbeit überwachten, erschienen nicht. Der Unterscharführer war, eingehüllt in eine Pelerine, mit dem Fahrrad irgendwohin gefahren. Als er zurückkam, wurden wir angewiesen, in den Block zurückzukehren. Wir wrangen unsere Kleider und Hemden aus, so gut es ging, hängten sie auf, wo Platz war, und krochen unter unsere Decken. Wer durch den Hunger nicht am Einschlafen gehindert wurde, schlief. Und war zu beneiden. Die anderen lagen da und beteten, wieder andere fingen Läuse. Und alle lauschten, ob der Regen wohl nicht aufgehört hatte, dieser gesegnete Regen, der ewig hätte dauern sollen, der dieses Stück Erde hätte überschwemmen, der die Wachtürme hätte umstürzen, der den Stacheldrahtzaun hätte wegspülen sollen und uns ermöglichen, das Gefängnis zu verlassen.
Der Dachboden, auf dem wir hausten, versank im Halbdunkel. Die beiden Giebelfenster waren nicht besonders groß, wie das auf Dachböden so ist, und ließen nur wenig Licht herein. Die hellen Plätze belegten natürlich die Deutschen, die Funktionshäftlinge. Direkt unter einem Fenster hatte Lore ihre Schlafstelle. Nachts, wenn der Unterscharführer nicht im Lager war, drängten sie und die anderen sich an den zwei Fenstern, um mit dem Posten lange Gespräche zu führen. Das sah geradezu romantisch aus: Er auf dem Holzturm, sie an diesen Fenstern wie gefangene Königstöchter im gläsernen Berg, die versuchten, den sie bewachenden Drachen für sich einzunehmen. Sie fragten den Drachen, woher er komme, vom Land oder aus der Stadt, ob er Geschwister habe, was er von Beruf sei. Und sie erzählten rührselige Märchen über sich, mit weicher und zärtlicher Stimme schütteten sie ihr Herz aus in Worten, die aufrichtig klangen. Sie beklagten die Ungerechtigkeit des Schicksals. Sie sprachen über ihre Sehnsucht nach dem Elternhaus, nach der Mutter, nach der Freiheit. Sie gurrten wie Tauben. Und tagsüber mordeten sie. Sie waren keine Bestien, denn eine Bestie tötet nicht ohne Grund, sondern Monster, einzigartige Kreaturen der KZ-Erziehung.
An diesem Sonntagmorgen waren sie so ausgelassen wie Mädchen in einem Pensionat. Die gestrigen Erlebnisse mit den SS-Männern waren der Mittelpunkt ihrer Gespräche. Sie erinnerten sich, gaben poetische oder zynische Bemerkungen von sich und lachten rau. Und sie fraßen und fraßen und fraßen. Sie hatten eine unbegrenzte Menge an Margarine, Brot und Wurst. Abgezweigt von unseren Rationen. Sie machten sich Brote, wie in der Freiheit, sie beschmierten die Schnitten dick mit Margarine und belegten sie mit Wurst und Scheiben aus gekochten Kartoffeln, die waren gesalzen, denn sie hatten auch Salz aus der Küche, die von deutschen Häftlingen geführt wurde. Sie hantierten vor den Augen der aushungerten Frauenmenge. Ohne zu befürchten, dass diese aufspringen und sich ihren Anteil holen würde. Sie waren sich ihrer Sache gewiss. Schließlich waren sie fertig und legten sich auf ihre Strohsäcke.
Da griff eine von ihnen nach ihrer Schürze, die sie zu einem Bündel gefaltet hatte. Sie stand auf, holte ein paar Krümel heraus und streute sie zwischen die liegenden Frauen, so, wie man Hühner füttert. Und wie Federvieh hüpften die Häftlinge zu diesen Resten, sie drängten sich, sie schubsten sich, sie traten sich, sie beschimpften sich. Dieser Anblick machte die schon schläfrig gewordenen Funktionshäftlinge wieder munter. Sie griffen nach den Vorräten, die sie gesammelt hatten – die Brotscheiben waren ganz offensichtlich für unsere Rationen geschnitten worden, sie waren verschimmelt oder vertrocknet –, und warfen sie der menschlichen Hühnerschar vor die Füße. Was war das für ein Spaß! Was für ein triumphierendes Gelächter beim Anblick dieser vom Hungerdelirium erfassten Wesen, die miteinander um die letzten Krumen kämpften und sie vom staubigen Lehmfußboden des Dachbodens aufklaubten.
Ich war nicht dabei. Zum Glück war ich imstande, auf meinem Platz zu bleiben. Noch war ich dazu imstande. Ich sagte mir: du bist zu schwach, um etwas zu erwischen, etwas zu ergattern. Und so bewegte ich mich nicht von der Stelle. Nicht weit von mir lag Monika, im früheren Leben die Frau eines Generals, im Lager gelegentlich Übersetzerin, ab und zu Vorarbeiterin. Vor Budy, in den vorhergehenden Kommandos, hatte sie manchmal diese Funktion erfüllt. Wer in ihre Gruppe kam, konnte damit rechnen, den Tag zu überleben. Man arbeitete dort ruhig und so viel, wie nötig, um nicht unangenehm aufzufallen. Wenn keine von den Deutschen in der Nähe war, konnte man sich ausruhen, indem man sich auf den Spaten stützte. Monika passte auf und warnte:
„Der Kapo kommt, weitermachen!“
In der Strafkompanie aber waren alle Funktionen, sogar die niedrigsten, den deutschen Häftlingen vorbehalten. Und Monika arbeitete so wie wir alle, sie war denselben Gefahren ausgesetzt. Jetzt wandte sie die Augen von diesem erbärmlichen Anblick ab:
„Oh Gott, wie weit ist es mit uns gekommen!“
Die Sängerin, die neben ihr zusammengekrümmt dalag und sich den Bauch hielt, sah sie an:
„Was haben Sie denn? Die sind halt hungrig“, sagte sie leise. Zu Monika sagten wir nämlich Sie. Sogar Luśka traute sich nicht, sie zu duzen.
„Wir sind alle hungrig. Die da drüben unterm Dach auch.“ Monika zeigte auf die Häftlinge, die auf der gegenüberliegenden Seite saßen. „Und ich und sie und du ebenfalls.“
Die Sängerin, die damals noch nicht die Sängerin war, sondern bloß eine von uns, erwiderte:
„Ich habe Durchfall.“ Und sie drehte sich auf den Bauch, das Gesicht zum Boden.
Plötzlich ertönte in dem Tumult Lores raue Stimme:
„Jetzt aber Ruhe!“ Und zusammen mit ihr brüllten auch die anderen:
„Ruhe! Habt ihr gehört? Maul halten, ihr Saupolacken!“ Und schon bewegten sie sich mit ihren Knüppeln auf die aufgewühlte Menge zu. Die zerstob im Handumdrehen. Verschwand wie Ratten in ihre Löcher. Die Funktionshäftlinge zogen sich zurück. Gut gesättigt schliefen sie nach diesem amüsanten Vergnügen sofort ein.
Es regnete immer noch. Gleichmäßig, unablässig, rhythmisch, aber nicht mehr so stark. Das Mittagessen bekamen wir glücklicherweise im Lager. Die Suppe wurde wie immer von der Blockältesten zusammen mit dem Stubendienst verteilt. Jetzt aber standen Trude und Lore daneben und betrachteten aufmerksam jede, die zum Kessel ging. Bei einigen kontrollierten sie die Nummer. Sie blickten in die Gesichter der Häftlinge, besonders in die Gesichter derjenigen, die den Buchstaben P trugen. Es war nicht schwer, sich den Grund zu denken. Sie suchten das gestrige, nicht getötete Opfer. Als ich vom Kessel zurückkam, ging ich an der wartenden Schlange vorbei. Ich sah die Sängerin nicht. Ich fand sie auf dem Dachboden, zusammengekrümmt, sich den Bauch mit den Händen wärmend. Ich fragte sie, ob sie sich kein Mittagessen hole. Sie antwortete, nein, denn sie habe Durchfall.