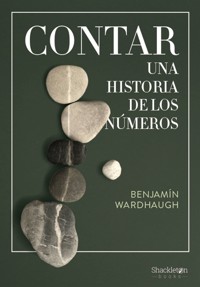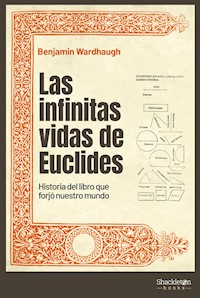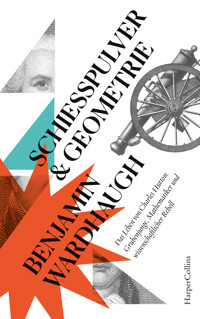16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Euklid auf den Fersen – eine grandios erzählte Reise zu den Anfängen der Mathematik Seit dreiundzwanzig Jahrhunderten prägen Euklids »Elemente« die Welt. Die Zusammenstellung von Fakten über den Raum und seine Eigenschaften – Linien und Figuren, Zahlen und Verhältnisse – bestimmen bis heute Philosophie, Kunst, Musik, Literatur und Mathematik. Dreizehn Bände, die nicht nur Wissenschaftsgeschichte schrieben, sondern auch zu ersten globalen Bestsellern wurden. Benjamin Wardhaugh entstaubt Euklids Vermächtnis und begibt sich auf eine Zeitreise. Von Ptolemaios bis Isaac Newton, von Lewis Carroll bis Max Ernst – hautnah erleben wir den Einfluss der »Elemente« auf die jeweilige Zeit und ihre Protagonisten. Die spannende Geschichte über das Grundlagenwerk menschlichen Wissens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem TitelBook of Wonders. The Many Lives of Euclid’s Elements bei William Collins, London.
© 2020 by Benjamin Wardhaugh © 2022 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with William Collins, an imprint of HarperCollins Publishers, UK Covergestaltung von wilhelm typo grafisch Coverabbildung von Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung, Hamburg E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749950911www.harpercollins.de
Widmung
Für meine Eltern
Prolog
Alexandria. Alexándreia. Zu Regierungszeiten von Ptolemaios, Erster der Alexandriner. Vielleicht im zehnten Jahr seiner Herrschaft, nicht lange nach 300 v. Chr.
Ankunft über das Meer, auf dessen Wasser die ägyptische Sonne scheint. Durch den Hafen geht es in die Stadt hinein, vorbei an einem Bauwerk nach dem anderen, die ausladende Kanopische Straße hinauf. Weißer Marmor, Staub und Hammerklänge – Baustellen, wohin man blickt. Die größte aller Städte. Breite Straßen, durch die man mit dem Wagen fahren kann. Gepflasterte Wege und die weißen Fassaden der Gebäude. Das Rauschen des Meeres.
An der Kreuzung links führt die Straße zum Sema: lang und kühl, der Wind pfeift hindurch. Es folgt der Palastbezirk. Tempel, Museion, Bibliothek.
Zu den Menschen, die im berühmten Kulturviertel tätig sind, gehört ein Mann namens Euklid. Eines seiner Bücher heißt Elemente. Wenn Ptolemaios’ glorreiches Alexandria zu Staub zerfallen ist, wird dieses Buch fortbestehen.
*
Seit dreiundzwanzig Jahrhunderten verändern die Elemente die Welt. Die Zusammenstellung von Fakten über den Raum und seine Eigenschaften – Linien und Figuren, Zahlen und Verhältnisse – hat unzählige Leser in die grenzenlose Welt der abstrakten Schönheit und der reinen Ideen gelockt. Dabei hat das Werk eine unglaubliche Reise zurückgelegt. Nur eine gewisse Zahl von Artefakten überlebt den Zusammenbruch der Kultur, die sie hervorgebracht hat; nur eine gewisse Zahl von Texten überlebt das Aus-dem-Gebrauch-Kommen der Sprache, in der sie verfasst sind. Den Elementen ist beides gelungen. Und nicht nur das – sie scheinen von der Verpflanzung in ganz unterschiedliche Kontexte sogar profitiert zu haben. Gerade aufgrund der Schlichtheit des Textes entdeckten Leser Dinge darin, die ihr Interesse weckten, Qualitäten, die ihm auch in anderen Zeiten und an anderen Orten Bedeutung verliehen.
Am rechten Portal der Westfassade der Kathedrale von Chartres gibt es ein Halbrelief, das Euklid zeigt. Die Gelehrten im abbasidischen Bagdad übersetzten sein Werk ins Arabische. Ein amerikanischer Maler überführte die Diagramme in Kunst, ein Philosoph aus Athen kommentierte sie. Die Elemente waren Teil der wissenschaftlichen Revolution, der schicksalsträchtigen Entscheidung, das Buch der Natur zu lesen, als sei es in der Sprache der Mathematik geschrieben.
In Peking verbrachten der Gelehrte Xu Guangqi und der italienische Jesuit Matteo Ricci zwischen August 1606 und dem darauffolgenden April ihre Zeit damit, die Elemente, eines der Bücher, die Ricci aus dem fernen Westen mitgebracht hatte, ins Mandarin zu übersetzen. Dabei machten ihnen sowohl die Terminologie und die Struktur des Textes als auch ihre unterschiedlichen Voraussetzungen in Bezug auf den Inhalt zu schaffen. Dreimal überarbeiteten sie ihre Fassung, bevor sie mit ihr zufrieden waren und sie zur Veröffentlichung freigaben.
Auf der anderen Seite der Erde hielt sich Anne Lister von Mai bis November 1817 jeden Vormittag dafür frei, sich gleichermaßen mit Arithmetik und Euklid auseinanderzusetzen. Bis zum Herbst hatte sie einen größeren Teil der Elemente durchgearbeitet als die meisten Universitätsabsolventen.
Beinahe ein Jahrtausend zuvor griff die Kanonissin Roswitha im niedersächsischen Gandersheim Euklids Definition der vollkommenen Zahlen in einem ihrer Dramen auf. Die Figur der »Weisheit« wendet diese Definition an, um sich über Kaiser Hadrian lustig zu machen, der sie und ihre Töchter der Folter unterziehen will, damit sie dem christlichen Glauben abschwören.
*
Immer wieder sind neue Generationen an neuen Orten auf die Elemente gestoßen und haben Neues damit gemacht. Das Werk ist durch Welten gereist, die sich die Griechen, die es als Erstes aufschrieben und lasen, nie hätten erträumen können.
Was bedeutet es für ein Buch, zweitausend Jahre und länger zu existieren? Den Untergang der Kultur zu überstehen, die es hervorgebracht hat? Immer und immer wieder neue Leser zu finden, an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Zeiten? Welch enorme Bandbreite von Bedeutungen müssen die Leser in ihm finden? Welch enorme Bandbreite an Lesern muss das Buch finden?
Begeben wir uns auf die Reise und finden es heraus.
I Der Autor
Alexandria
Der Geometer und der König
Alexandria, um 300 v. Chr.
Ein Abendessen, sagen wir: ein Festmahl, im Palastbezirk, vielleicht im Museion. Ptolemaios selbst ist anwesend – General, Kriegsheld, König, für manche ein beinahe göttliches Wesen. Das Gespräch kommt auf die Geometrie: »Warum ist sie so schwierig? Warum gibt es keinen leichteren Weg?« Der Geometer – ein unauffälliger Mann, aber selten um Worte verlegen – antwortet: »Majestät, es gibt keinen Königsweg zur Geometrie.«
*
Die Anekdote über den brüskierten Ptolemaios ist eine dieser unwiderstehlichen Geschichten. Der Mann war ein Kindheitsfreund Alexander des Großen gewesen, einer seiner Leibwächter – vielleicht sein illegitimer Halbbruder, ein geschätzter General (sein Name soll vom griechischen Wort für »kriegerisch« herrühren), besonnen, aber ebenso begabt für die große Geste – ein Mann, der sich nichts bieten ließ.
Außerdem war er ein Überlebenskünstler. Er schaffte es, sich in dem zwei Jahrzehnte währenden Chaos durchzusetzen, das auf Alexanders Tod folgte und viele fähigere Männer das Leben kostete. Von allen Nachfolgern Alexanders, die dessen kurzlebiges, Kontinente umspannendes Reich unter sich aufteilten, schuf er die beständigste Dynastie, den stabilsten Staat. Er entschied sich für Ägypten und setzte es nie für ein größeres Reich aufs Spiel. Auf ihn folgten vierzehn ptolemäische Herrscher, bis Kleopatra in der Schlacht bei Actium zweihundertfünfzig Jahre später alles verlor. Er war der erste König der letzten ägyptischen Dynastie: basileus für die Griechen, Pharao für die Ägypter, Erbe der dreitausend Jahre währenden ägyptischen Königstradition und, ja, auch ein Gott. Im Jahr 306 v. Chr. wehrte er einen Angriff auf Rhodos so entschieden ab, dass man ihm Altäre errichtete und ihm den Titel »der Retter« verlieh. Nach seinem Tod stiftete sein Sohn und Nachfolger ihm zu Ehren die Ptolemäischen Spiele, die ab 278 v. Chr. abgehalten wurden, alle vier Jahre, wie die Olympischen Spiele.
Ptolemaios I.
Silberstater von Ptolemaios I., 305–285 v. Chr. Cleveland Museum of Art 1916.994. (Creative Commons/lizenzfrei,CC01.0)
Die Person des Geometers hingegen – ein Mann namens Euklid, Eukleídēs – bleibt weitgehend im Dunkel der Geschichte. An der Königsweganekdote ist leider nichts dran; das Gleiche erzählt man sich über einen anderen Geometer (Menaichmos) und einen anderen König (Alexander), und es gibt wenig Anlass zu glauben, dass sich das Gespräch wirklich so ereignet hat. Selbst die Annahmen zu Euklids Lebenszeit – irgendwann um 300 v. Chr. – sind bloße Vermutungen von Autoren, die Jahrhunderte später schrieben. Anders als Ptolemaios, dessen Leben äußerst gut dokumentiert ist, hinterließ Euklid keinerlei Spuren. Er begründete keine Dynastie, baute keine Paläste. Sein Erbe war ein rein intellektuelles.
Doch welch ein Erbe das war! Die Schar seiner Schüler in Alexandria überdauerte ihn. Sein Buch überdauerte die ganze Kultur.
Was war das für eine Stadt, die einen solchen Mann und ein solches Buch hervorbrachte? Alexandria war die passende Umgebung für die Elemente. Sie war Ptolemaios’ größte Leistung. Ihren Bau hatte Alexander selbst verfügt, an einem Ort, wo sich einst bloß ein Dorf befunden hatte, und sie trug wie Dutzende andere seinen Namen. Er selbst erlebte nicht mit, wie auch nur eine Mauer errichtet wurde, aber Ptolemaios machte die Stadt zu seiner Hauptstadt und verlegte den ägyptischen Königssitz aus Memphis hierher. Alexandria war eine griechische polis in einer zutiefst ungriechischen Welt, eine Neugründung in einem Land, in dem die Städte auf eine zweitausendjährige Geschichte zurückblickten. Ptolemaios tat alles, um ihr zu Glanz zu verhelfen; die Stadt hatte eine Volksversammlung, einen Rat, eigene Münzen, eigene Gesetze. Es gab breite Prachtstraßen, Säulengänge, Alleen und Straßenlaternen. 321 v. Chr. brachte Ptolemaios sich in den Besitz von Alexanders Leichnam und stellte ihn in seiner neuen Königsstadt zur Schau.
Der Standort war hervorragend, an einer Stelle, an der zwei Kontinente zusammentrafen, knapp westlich des Nildeltas. Über Jahrhunderte sollte die Stadt ein wichtiges Seehandelszentrum bleiben und diente bis zum Zweiten Weltkrieg als strategisch günstig gelegener Militärstützpunkt. Außerdem begann Ptolemaios mit dem Bau des berühmten Leuchtturms: Festung und Symbol zugleich, nach seiner Fertigstellung unter seinem Sohn eines der sieben Weltwunder, 130 Meter hoch und bekrönt mit einer Statue von Zeus (oder Poseidon). Das Bauwerk stand fünfzehnhundert Jahre lang. Eine derart gesegnete Stadt zog Menschen aus der gesamten griechischen Welt an, und so war Alexandria bald nicht nur berühmt für seine Größe und Pracht, sondern auch für seine Menschenmassen und die kosmopolitische Atmosphäre; in den Straßen wimmelte es von Griechen, Makedonen, Ägyptern, Juden und Syrern wie in einem Ameisenhaufen. Innerhalb weniger Generationen stieg die Zahl ihrer Einwohner auf mehr als eine Million.
Ptolemaios kümmerte sich nicht nur um die Planung der Stadt und die Errichtung zahlloser Gebäude, sondern auch um die Kulturpolitik – und das mit einer Effizienz, die für ihn charakteristisch war. Um als ägyptischer Pharao zu überzeugen, ließ er entsprechende Skulpturen anfertigen und rief den neuen Kult des Serapis ins Leben, einer unverfroren erfundenen Gottheit mit einer hybriden Ikonografie. Wie alle seine Unternehmungen war auch der Kult langlebig: Der zugehörige Tempel, das Serapeum von Alexandria, bestand sechshundert Jahre lang.
Um das Herz und die Seele der Griechen zu erfreuen, gab es Festumzüge, Feierlichkeiten und einen Palast mit Wandteppichen, die den Neid der Götter geweckt hätten. Alexandria verfügte über »Reichtum, Ringschulen, Macht, heitre[n] Himmel, Ruhm, stets was zu schau’n, gelehrte Herren [= Philosophen], Gold und junge Männer, der Geschwistergötter Tempel … das Museum [= Museion], Wein – kurz alles Gute, was man nur wünschen mag«, wie es ein Zeitgenosse zusammenfasste.
All das war von unschätzbarem Wert, um einer zutiefst andersartigen Umgebung die Macht der Griechen zu demonstrieren und ihr eine Vorstellung der griechischen Kultur zu vermitteln. Es besagte: So machen wir es in der großartigen Welt der Griechen. Wir haben das Recht zu herrschen.
Ein Bestandteil dessen war das Museion, das Heiligtum der Musen. Es wurde vom König finanziert und führte Gelehrte aller möglichen Disziplinen zusammen. An der Spitze stand ein Musenpriester, und unter den Gelehrten fanden sich Dichter, Grammatiker, Geschichtsschreiber, Philosophen, Ärzte, Naturphilosophen, Geografen, Ingenieure und Konstrukteure, Astronomen und natürlich Geometer. Das Ganze ging zum Teil auf Ptolemaios selbst und zum Teil auf Demetrios von Phaleron zurück, einen berühmten Schüler von Aristoteles, der aus Athen geholt worden war, um die Entstehung der neuen Institution zu beaufsichtigen. Im Museion gab es Innenhöfe, Wandelgänge und Gärten, einen Speisesaal und eine Sternwarte. Die Anzahl der Gelehrten belief sich auf rund vierzig, und sie verbrachten ihre Zeit damit, zu forschen, zu schreiben und manchmal zu lehren. Sie veranstalteten »Symposien«, Gastmahle, an denen hin und wieder auch der König teilnahm. Es war eine bemerkenswerte Versammlung von Menschen, die gelegentlich etwas säuerlich mit der Tiersammlung, die Ptolemaios ebenfalls begründet hatte, verglichen wurde: »wohlgenährte Bücherwürmer, die endlos lange im Vogelkäfig der Musen diskutierten«. Und wo Bücherwürmer waren, gab es natürlich auch Bücher: Die Bibliothek von Alexandria sollte die berühmteste der Welt werden, auch wenn sie in der Form wohl erst später entstand, unter Ptolemaios’ Sohn.
Und so kam es, dass auch der berühmte griechische Mathematiker in Ägypten landete. Gehörte Euklid zu Ptolemaios’ Sammlung, hatte man ihn geholt, um das Ansehen des Museions zu mehren? Es ist nicht gesichert, ob er in Alexandria geboren wurde oder ein Zugezogener war, auch wenn Letzteres so kurz nach Gründung der Stadt wahrscheinlicher ist. Woher kam er dann? Seine nüchternen Texte enthalten keine Hinweise auf einen Dialekt, im Gegensatz zu Archimedes, einem Vertreter der folgenden Generation, dessen Werke im dorischen Dialekt von Syrakus verfasst sind.
Was Euklid (und vielleicht auch weitere Mathematiker; es ist nicht klar, ob Euklid der einzige war) nach Alexandria mitbrachte, war die bewährte Tradition der griechischen Geometrie. Die Griechen hatten eine Vorliebe für das Nachdenken, und sie pflegten mit Begeisterung ihre Liebhabereien. Manche fuhren Wagenrennen, andere sprachen über Philosophie, wieder andere befassten sich mit Politik. Etwa ab dem späten fünften Jahrhundert v. Chr. betrieben einige von ihnen Geometrie.
Wie sah das aus? Vielleicht stellt man sich die griechische Geometrie am besten als eine Nebenerscheinung der griechischen Vorliebe für das Gespräch, genauer die Disputation, die Kunst, ein Streitgespräch zu führen, vor. Geometrie war in erster Linie eine Vorführung.
Man zeichnete eine Linie, ein Quadrat, einen Kreis. Dabei dachte man laut nach, richtete sich an das unvermeidliche Publikum. Aus diesen Anfängen entstand das langlebige Spiel der geometrischen Herleitung. Die Figur des Geometers, der in den Sand zeichnet, prägt bis heute das Bild des antiken griechischen Mathematikers: Er bearbeitete den »gelehrten Staub«, wie es der römische Redner und Politiker Cicero nannte. Archimedes beschrieb er als Mann, der »Sandkasten und […] Zeichenstab« nutzte. (Doch wer schon einmal versucht hat, ein detailliertes Diagramm in trockenem Sand zu skizzieren, weiß: Tafeln, ob aus ungebranntem Ton, aus Wachs oder – für Demonstrationen vor einem größeren Publikum – aus Holz, dürften wahrscheinlicher gewesen sein.)
Die Anzahl der griechischen Mathematiker war nie sonderlich groß, und sie mussten ihre Erkenntnisse über Linien und Kreise niederschreiben – es gab anscheinend nicht genügend von ihnen, damit eine rein mündliche Überlieferung gewährleistet war. So entstand eine eigene Gattung: eine bestimmte Art der mathematischen Notation. Sie sollte die westliche Mathematik für mehr als zwei Jahrtausende prägen, mit ähnlich strengen Vorgaben, wie sie für das Versmaß in der Lyrik galten, und genauso langlebig. Ihre Bestandteile waren die Behauptung (etwas, was zu beweisen war), das Diagramm, dessen einzelne Punkte mit Buchstaben markiert waren, und eine Beweiskette, die aus bereits bekannten Tatsachen neue Erkenntnisse ableitete. Die Kette endete mit dem vorgegebenen angestrebten Ergebnis, und der gesamte Abschnitt – die »Proposition« – schloss mit dem Hinweis »was zu beweisen war«: hóper édei deîxai; quod erat demonstrandum; q. e.d. oder QED. In manchen Fällen lautete der Schluss auch »was zu zeichnen war«. Hier ein Beispiel:
Wie man ein gleichseitiges Dreieck zeichnet
Man beginne mit einer beliebigen geraden Linie und nenne die Enden A und B.
Jetzt zeichne man zwei Kreise, deren Radius jeweils der Länge der Linie entspricht – einen rund um das Zentrum A, einen um das Zentrum B.
Die beiden Kreise überschneiden sich an zwei Punkten. Man wähle einen von ihnen aus und nenne ihn C. Nun verbinde man A, B und C. Sie bilden ein gleichseitiges Dreieck.
Warum?
Weil die Entfernung zwischen A und B verwendet wurde, um C zu ermitteln. C ist genauso weit von A entfernt wie B, und C ist genauso weit von B entfernt wie A. Mit anderen Worten: Alle drei Seiten des Dreiecks – AB, BC und CA – sind gleich lang. Daher handelt es sich um ein gleichseitiges Dreieck. Was zu zeichnen war.
In den gleichen antiken Quellen, die berichten, wann Euklid lebte, ist auch die Rede von schriftlichen, auf Griechisch verfassten Sammlungen geometrischer Erkenntnisse, die etwa 400 v. Chr. entstanden sein sollen – ein Jahrhundert vor Euklid. Die Quellen beschreiben recht ausführlich, welche Themen darin behandelt wurden, und enthalten manchmal sogar einzelne Ergebnisse und Methoden. Die Werke selbst sind jedoch nicht überliefert, was Zweifel an der ganzen Behauptung aufkommen lässt. Die Versuchung ist groß, eine Geschichte der mathematischen Ideen einfach zu erfinden, weil es an Belegen mangelt. Daher gilt heute nur: Ja, vielleicht haben die Pythagoreer den Kreis studiert und vielleicht auch Zahlen und ihre Eigenschaften.
Die Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks
Christophorus Clavius, Euclidis elementorum libriXV (Rom, 1574), fol. 21v. (Sammlung des Autors. Foto © Benjamin Wardhaugh)
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich ein Geometer namens Eudoxos im frühen vierten Jahrhundert v. Chr. mit Größenverhältnissen beschäftigt hat. Ein Teil der Erkenntnisse zu den regelmäßigen Körpern ist einem Mann namens Theaitetos zuzuschreiben. Doch die Behauptung, dass es vor Euklid ausführliche Werke mit dem Titel Elemente der Geometrie gegeben habe, ist deutlich zweifelhafter.
Was war dann Euklids Rolle? Er führte alle einfacheren Erkenntnisse, die den griechischen Geometern seiner Zeit bekannt waren, in einem einzigen Buch zusammen. Er organisierte das Wissen, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Sicherlich ergänzte er es um eigenes Material, obwohl niemand mit Gewissheit sagen kann, was neu war und was nicht. Die Historiker streiten bis heute darüber – und werden es wohl weiterhin tun –, inwieweit Euklids Werk eine Kompilation oder eine Komposition war, eine Zusammenstellung oder eine Neuschöpfung. Euklid war ein Sammler wie Ptolemaios, und er, der sozusagen ein Teil des Museions war, wurde selbst zu einem Kurator und die Elemente zu einer Art kleinerem Museion.
Doch dieses Museion (oder Museum) enthielt eine ganze Welt. Es präsentierte den geometrischen Schreibstil, in einer unaufhörlichen, ritualisierten Abfolge von Propositionen – insgesamt vierhundert, unterteilt in dreizehn »Bücher« oder Kapitel. Alle Verben standen im Perfekt, Passiv und Konjunktiv: »Ein Kreis sei gezeichnet worden.« Das hatte einen hypnotischen Effekt und wirkte zutiefst beruhigend. Das Buch begann mit Definitionen: Was ist mit dem Begriff »Linie« gemeint? Mit »Punkt«? Mit »Kreis«? Dann folgten ganz einfache Konstruktionen aus Linien und zweidimensionalen Figuren – wie man verschiedene Dreiecke zeichnet, wie man eine Linie oder einen Winkel in zwei Hälften teilt. Die Tatsache, dass die Summe zweier beliebiger Seitenlängen im Dreieck immer größer ist als die dritte Seitenlänge. Die epikureischen Philosophen meinten, dass diese letzte Information »selbst einem Esel einsichtig« sei, denn »wenn man am Ende einer Seite Heu platziere, wird ein Esel auf der Suche nach Futter diese Seite entlanglaufen und nicht entlang der beiden anderen«.
Euklid war es ganz egal, wie offensichtlich das war. Er versammelte und erläuterte alle grundlegenden Techniken und Erkenntnisse, die zu seiner Zeit bekannt waren, samt Argumentationswegen und Beweisverläufen; Fakten, die Geometer meist als gegeben betrachteten und anwendeten, aber selten vollumfänglich nachwiesen. Am Ende des ersten Buches platzierte er den Satz des Pythagoras: Man zeichne ein Dreieck, bei dem ein Winkel ein rechter Winkel ist. Dann zeichne man ein Quadrat über die kürzeste Seite, dessen Seitenlänge der dieser Seite des Dreiecks entspricht. Nun wiederhole man das Gleiche mit den beiden längeren Seiten, sodass man drei unterschiedlich große Quadrate erhält, die jeweils auf den Seiten des Dreiecks aufliegen. Wie sich herausstellt, entsprechen die Flächen der beiden kleineren Quadrate zusammengerechnet der des größeren – eine überraschende Erkenntnis, die nicht jedem Esel einsichtig war und die Euklid in seiner typischen genauen Art bewies.
Und so wurden die Ideen und Diagramme im Verlauf des Buches immer schwieriger und komplizierter. Es gab rein geometrische Abschnitte, etwa die Beschreibung, wie man innerhalb eines bestehenden Kreises ein regelmäßiges Fünfeck oder Sechseck zeichnet. Teile des Buches drehten sich nicht um Geometrie, sondern um Zahlen und Verhältnisse, angefangen bei den grundlegendsten Tatsachen (»Wenn man eine ungerade Zahl mit einer ungeraden Zahl multipliziert, ist das Produkt ungerade.«) bis hin zu einem Verfahren, die geheimnisvollen »vollkommenen« Zahlen zu ermitteln, die gleich der Summe ihrer Teiler sind.
Schließlich wandte sich Euklid den dreidimensionalen Figuren zu. Die letzten drei Bücher der Elemente – Buch 11, 12 und 13 – befassten sich mit Kugeln, Kegeln und Zylindern, mit Würfeln und Quadern und mit den regulären (oder platonischen) Körpern. Letztere sind wunderschöne Polyeder, deren Seitenflächen deckungsgleiche regelmäßige Vielecke sind: Dreiecke, Quadrate oder Fünfecke. Davon gab es insgesamt nur fünf Stück: das Tetraeder (vier dreieckige Seitenflächen), den Würfel (Hexaeder), das Oktaeder (acht Dreiecke), das Dodekaeder (zwölf Fünfecke) und das Ikosaeder (zwanzig Dreiecke). Euklid zeigte, wie man einen solchen Körper konstruierte, ausgehend von beispielsweise einem Dreieck oder einem Kreis; er legte dar, wie man dessen Oberfläche und Volumen bestimmte. Seine Untersuchungen in diesen letzten Büchern waren häufig genial und bewiesen manchmal eine fast unglaubliche Fähigkeit zum unorthodoxen Denken. Obwohl die Elemente einfach begannen und eine Vielzahl von Tatsachen enthielten, die jeder verstehen konnte, stellten sie als Gesamtwerk eine Meisterleistung dar, einen Weg, dem nur die geometrisch Begabtesten bis zum Ende folgen konnten.
Der griechische Text umfasste insgesamt mehr als zwanzigtausend Zeilen. Euklid bewies Sorgfalt, war aber kein Übermensch, und so zeigten sich einige Nahtstellen und Lücken. Manche Definitionen (Rechteck, Raute und Parallelogramm) schienen aus älteren Quellen übernommen, aber nie geprüft worden zu sein. Nicht wenige der Begriffe wurden vorher nicht definiert. Manche der verwendeten Wörter waren mehrdeutig. Eine überraschend große Menge an Wissen über die Eigenschaften von Punkten und Linien wurde als selbstverständlich vorausgesetzt und nicht explizit in den Annahmen dargelegt. Einige Propositionen waren nur Sonderfälle vorausgegangener; andere waren streng genommen überflüssig, weil es sich um die logische Konsequenz zuvor vorgestellter handelte. Doch trotz dieser Holprigkeiten waren die Elemente ein solides, sogar ein Ehrfurcht gebietendes Monument für alles, was die griechische Geometrie bisher erreicht hatte.
Doch Euklid schrieb nicht nur dieses eine Buch. Es gilt als gesichert, dass er weitere Werke verfasst hat, wenngleich die zeitliche Abfolge unklar ist. Möglicherweise kommen vier weitere Bücher zu Spezialbereichen der elementaren Geometrie dazu, außerdem Bücher über die Anwendung mathematischer Prinzipien, unter anderem in der Musik, der Astronomie und der Optik. Insgesamt werden ihm in den frühen Quellen fast ein Dutzend Werke zugeschrieben; acht Texte sind bis heute überliefert, auch wenn die Urheberschaft der meisten von ihnen unter Historikern umstritten ist.
*
Zurück ins Gewimmel von Alexandria, wo weiterhin überall gebaut wird und die Straßen voller sind als je zuvor. Als Euklids Leben zu Ende geht, ist auf Pharos der große Leuchtturm errichtet worden (ein faszinierender Gedanke: Haben sich die Architekten von Euklid beraten lassen?); die Bibliothek und das Museion sind fast fertiggestellt, und die Palastanlage ist prachtvoller denn je. Die Arbeit an den Elementen ist abgeschlossen: dreizehn Rollen Papyrus mit sauber angelegten Spalten voller Text und Diagrammen. Und Euklid lehrt weiterhin und nimmt immer noch neue Schüler an.
Ein Anfänger ist ungeduldig, wie einst der König. Als er die erste Proposition verstanden hat, platzt er heraus: »Und was habe ich nun gewonnen, wenn ich das gelernt habe?«
Ein verächtlicher – oder vielleicht mitleidiger – Blick. Euklid ruft einen Diener herbei. »Gib ihm eine Münze, wenn ihm alles, was er lernt, einen Gewinn einbringen muss.«
Möglicherweise ist das nur eine weitere romantische Legende, wie man sie sich später, zu Zeiten der römischen Herrschaft, in Griechenland erzählte. Wie die Anekdote vom Königsweg trug auch sie dazu bei, den Ruf der Unterwürfigkeit, der Speichelleckerei zu zerstreuen, der Euklid anhing, wie jedem, der mit dem ptolemäischen Alexandria und seinen Institutionen in Verbindung gebracht wurde. Sie unterstrich und veranschaulichte die Vorstellung, dass die Geometrie eine Beschäftigung der Muße und der Kultur war, ein Teil des Geisteslebens. Kein gewinnbringendes Geschäft, sondern rein, wahrhaftig und schön um ihrer selbst willen.
Rund dreihundertfünfzig geometrische Propositionen in höchst trockenem Stil. Es ist seltsam, dass so etwas zu einem der beständigsten kulturellen Artefakte der griechischen Welt wurde. Das ptolemäische Alexandria ist heute größtenteils zu Staub zerfallen; gelegentlich werden ein paar Statuenreste ausgegraben oder aus dem Meer geborgen, doch der Glanz ist vergangen. Ptolemaios’ Dynastie starb mit Kleopatra. Die Bibliothek ist in alle Winde zerstreut. Aber die Bücher – unter ihnen die Elemente –, die Bücher leben weiter.
Elephantine
Tonscherben
Auf der Nilinsel Elephantine, zu Zeiten von Ptolemaios’ Enkel Ptolemaios III., der von 246 bis 221 v. Chr. herrschte. Eine griechische Garnison am Ende der Welt. Ein Mann, der gerade nicht im Dienst ist, will etwas aufschreiben.
Er schnappt sich den nächstbesten Gegenstand, der sich dafür eignet: eine Tonscherbe eines zerbrochenen Gefäßes. Ein kurzes Kratzen und Kritzeln ergeben ein schnelles Diagramm, ein paar Zeilen Text. Seine Hand bewegt sich souverän, und nur ein kleines bisschen weniger souverän ist seine Erinnerung an die mathematischen Sachverhalte. War es so? Oder so? Ja, so stimmt es.
Als sein Geist und seine Hand wieder wach sind, wandert die Scherbe, das billigste verfügbare Schreibmaterial – vielleicht das billigste überhaupt – auf den Müll, wo sie hingehört.
*
Euklids Originalmanuskripte sind uns nicht überliefert und auch nichts, was ihnen nahekäme. Der Papyrus, auf dem er schrieb, ist unter den richtigen Bedingungen durchaus haltbar. Jahrhundertealte Schriftrollen waren in der Antike gar nicht ungewöhnlich, und sie konnten selbst über einen noch längeren Zeitraum hinweg weich, biegsam und lesbar bleiben. Über einen Museumsdirektor des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Anekdote überliefert, dass er die Festigkeit und die Flexibilität von Papyrus demonstrierte, indem er eine dreitausend Jahre alte ägyptische Schriftrolle ungeniert auf- und abrollte (das war in den 1930er-Jahren, als man Ausstellungsstücke noch etwas weniger ehrerbietig behandelte als heute).
Doch das gilt nur unter den geeigneten Bedingungen. Die meisten Bedingungen sind ungeeignet. Ist es zu feucht, verrottet Papyrus; bei zu großer Trockenheit zerfällt er. Insektenlarven mögen Papyrus, und in der Antike ist so mancher literarische Ruhm von Würmern zerfressen worden. Oder von Ratten. Außerdem rissen die langen Rollen schnell und wurden dann weggeworfen. Das hat zur Folge, dass kaum große oder vollständige Papyri aus der Antike erhalten sind. Deutlich häufiger findet man Fragmente: weggeworfene Schriftrollen, Teilstücke, die als Mumienkartonagen wiederverwendet wurden, Fetzen von Müllhalden oder aus zerstörten Behausungen. Diese Funde, die durch die Zeit rau, dunkel und brüchig geworden sind, stammen fast alle aus Mittel- und Oberägypten, wo das trockene Klima ihre Erhaltung begünstigte. Die Fragmente wurden auf Friedhöfen im Niltal, im Fayyum-Becken und in einigen Dörfern entdeckt. Aus den großen Städten hingegen ist so gut wie nichts erhalten: Aus Alexandria selbst sind aufgrund des hohen Grundwasserspiegels keine Papyri überliefert.
Schon seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gibt es Bemühungen, die vielen Papyrusfragmente systematisch zu bergen, und mittlerweile geht ihre Zahl in die Hunderttausende. Und, ja, einige von ihnen enthalten Teile von Euklids Elementen. Genau genommen sieben, mit insgesamt sechzig vollständig und weiteren sechzig teilweise erhaltenen Zeilen Text.
Um welche Teile der Elemente handelt es sich? Drei Propositionen aus Buch 1 ungefähr aus dem Jahr 100 v. Chr. mit einem zusammenfassenden Beweis (alles in Form von Zitaten in einer philosophischen Abhandlung, die den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. in Herculaneum überstand und damit, wenn auch angesengt, eine Ausnahme darstellt, was das Überleben von Papyrus allgemein anbelangt). Außerdem eine Behauptung aus Buch 2 mit einer groben Zeichnung, festgehalten um 100 n. Chr. in der ägyptischen Stadt Oxyrhynchos. Teile zweier weiterer Propositionen aus Buch 1, niedergeschrieben in Arsinoe (dem heutigen Fayyum) in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Eine Abschrift aus dem zweiten Jahrhundert, die drei Figuren und Behauptungen aus Buch 1 enthält, mit sorgfältig an geraden Linien ausgerichteten Diagrammen. Und eine im dritten Jahrhundert von einem Lehrer oder Schüler angefertigte Abschrift der zehn ersten Definitionen.
Das ist nicht viel – es handelt sich nur um kurze Abschnitte aus dem leichteren Teil des Werkes, in einem Fall ganz vom Anfang. Doch sie sagen etwas darüber aus, wie sich die Elemente verbreiteten. Sie verblieben nicht in Alexandria; schon wenige Jahrhunderte nach ihrer Entstehung erstellten Menschen überall in der griechischsprachigen Welt, in Hunderten Kilometern Entfernung, Abschriften des Textes oder einzelner Teile. So gelangte er aus dem kulturellen Zentrum in die Provinzen.
Euklids Elemente dürften auf die in der Antike übliche Weise verbreitet worden sein: Man gab den Text in die Hände von Schreibern, die mehrere Abschriften zum Verkauf erstellten. Doch die meisten der Papyrusfragmente sind nicht Teil solcher Abschriften, nur das Fragment aus Fayyum scheint das Werk eines professionellen Kopisten zu sein. Die anderen Fragmente enthalten Hinweise darauf, dass sie von Einzelpersonen stammen, die Teile des Textes zu ihrem eigenen Nutzen abschrieben, zum Lernen oder Lehren.
Somit stellen die Verfasser dieser Papyrusfragmente die »Zielgruppe« der griechischen Geometrie dar: eine winzig kleine Minderheit in einer Welt, in der ohnehin nur ein geringer Teil der Gesellschaft lesen und schreiben konnte. Die Leser waren Menschen, die mit Geometrie vertraut waren, die deren Konventionen akzeptierten und anerkannten, die genug über die Grundlagen und Methoden wussten, um Euklids Buch zu verstehen. Man kann davon ausgehen, dass ihre Interessen darüber bestimmten, was geschrieben wurde und wie es geschrieben wurde. Allein schon die Darstellung der mathematischen Sachverhalte in einer in sich geschlossenen Form verweist darauf, dass es diese Zielgruppe gab. Doch das ist es auch schon, was man über sie weiß.
Außerdem sagen die Funde nur etwas über die Orte aus, an denen es trocken genug war, dass die Papyrusfragmente die Zeit überstanden. Über den Rest der griechischen Welt – etwa die Inseln und das Festland nördlich des Mittelmeeres – weiß man aus Mangel an Funden nichts, weder positiv noch negativ. So gelangten die Elemente beispielsweise sicherlich nach Athen, doch Beweise dafür haben wir erst Jahrhunderte später.
*
Neben Papyrus existierte auch ein billigeres Schreibmaterial: Ostraka (Einzahl: Ostrakon), also Tonscherben. Es handelte sich um die Überreste zerbrochener Gefäße – Abfall und daher umsonst. Ostraka wurden in Ägypten schon vor den Ptolemäern und bis zum Ende der Antike benutzt, in Athen ab dem siebten Jahrhundert v. Chr. Man schrieb mit Tinte darauf oder ritzte etwas in sie ein – Bilder und Texte, in hieratischer oder demotischer Schrift, auf Griechisch, Koptisch oder Arabisch. Schüler, Soldaten, Priester und Steuerbeamte – alle verwendeten Ostraka. (Außerdem fungierten sie als eine Art »Stimmzettel« – wem das Wort vage bekannt vorkommt, der hat vielleicht schon einmal vom Ostrakismos, dem »Scherbengericht«, gehört: ein Verfahren, mit dem ein Mann, der im Verdacht stand, sich illoyal verhalten zu haben, für zehn Jahre aus der Stadt verbannt werden konnte; die Abstimmung lief mittels Tonscherben, in die der Name eingeritzt wurde. Das Scherbengericht wurde über weite Teile des fünften Jahrhunderts v. Chr. in Athen und auch in anderen Städten Griechenlands praktiziert.)
Ein euklidisches Ostrakon
Ostrakon, Elephantine, 3. Jhd. v. Chr. Berliner Papyrusdatenbank P. 11999. (© bpk-Bildagentur)
Ein Satz Ostraka, der in Elephantine mit einem geometrischen Text versehen wurde, schaffte es, nicht durch das Sieb der Geschichte zu fallen. Die Scherben wurden in den beiden Wintern 1906 und 1907 von dem deutschen Archäologen Otto Rubensohn ausgegraben und befinden sich heute in der Berliner Papyrussammlung. Ihr Inhalt wurde in den 1930er-Jahren transkribiert und veröffentlicht. Bei ihnen handelt es sich um den ältesten erhaltenen Nachweis für Euklids Elemente überhaupt.
Elephantine liegt mehr als 800 Kilometer südlich von Alexandria – eine Insel am nördlichen Ende des ersten Katarakts. Im dritten Viertel des dritten Jahrhunderts v. Chr., als die Ostraka beschrieben wurden, verlief hier die Grenze des ptolemäischen Reiches. Die schon seit Urzeiten besiedelte »Elfenbeininsel« oder »Elefanteninsel« war traditionell die Hauptstadt des ersten oberägyptischen Gaus, also Verwaltungsbezirks, und kontrollierte den Handel mit den Steinbrüchen in der Kataraktregion und die Handelsstraße nach Nubien. Die Garnisonsstadt war weit entfernt von den Zentren der griechischen Kultur und ständig von Räubern bedroht.
Elephantine hatte Tempel, Priester und recht aufwendig konstruierte Bauwerke, und es war durchaus etwas los – als es zum Byzantinischen Reich gehörte, gab es dort sogar einen öffentlichen Kamelhof. Doch die überlieferten Dokumente aus der Zeit – erneut hauptsächlich Papyri – sind von den typischen Sorgen von Soldaten geprägt, die fernab ihrer jeweiligen Heimatregion stationiert waren. Im dritten Jahrhundert v. Chr. lebten in Elephantine Männer aus griechischen Städten, von Inseln wie Kreta und Rhodos, aus Alexandria und Festlandsregionen wie Euböa und Phokis – eine wahrhaft homerische Mischung. Sie mieden den Kontakt zu den einheimischen Ägyptern, nannten ihre Stadt »die Festung« und nutzten Papyri, um Testamente zu verfassen, zu heiraten, Paten zu bestimmen, ihren Vorgesetzten Bericht zu erstatten oder Gerechtigkeit zu erbitten. Das ist keine Umgebung, in der man die frühesten Nachweise für das Werk Euklids erwartet hätte.
Auf den Ostraka – sechs Stück, von denen eines eindeutig an allen Seiten Bruchkanten aufweist – steht geschrieben, wie man ein reguläres Polyeder konstruiert. Das entspricht den Propositionen 10 und 16 aus dem dreizehnten Buch der Elemente, fast ganz am Ende des Werkes. In diesen Propositionen wird mithilfe eines Fünfecks, eines Sechsecks und eines Zehnecks ein Ikosaeder geschaffen, ein regelmäßiger Körper mit zwanzig Seitenflächen aus deckungsgleichen gleichseitigen Dreiecken. Das unvermeidliche Diagramm ist, samt der Buchstaben, klar auf einem der Ostraka zu erkennen, und man erhält den Eindruck, dass jemand diese Scherben genutzt hat, um das zu tun, was jeder griechische Geometer tat: ein Bild zu zeichnen und eine Geschichte dazu zu erzählen.
Die Propositionen in den Elementen bauen aufeinander auf, in einer komplexen, baumähnlichen Struktur: Jede bezieht sich implizit auf eine ganze Reihe der vorausgehenden. Ein souveräner Umgang mit einem Abschnitt so weit hinten im Buch war nur möglich, wenn man bereits vieles von dem, was davor kam, durchgearbeitet hatte. Doch einen direkten Beweis dafür liefern die Ostraka nicht. Die Handschrift darauf ist zielstrebig und fließend – das Werk eines erfahrenen Schreibers, der Grammatik und Rechtschreibung sicher und fehlerfrei beherrschte.
Wer war der Verfasser? Dass wir die Antwort darauf nicht kennen, ist äußerst frustrierend. Die Mathematikhistorikerin Serafina Cuomo, deren Spezialgebiet die Antike ist, bemerkt zu den Ostraka: »Während ihr Inhalt auf einen hohen Bildungsgrad hinweist, scheinen sowohl das bescheidene Material als auch der Fundort (ein abgelegener Außenposten im Herzen des ›ägyptischen‹ Ägyptens) dieser Schlussfolgerung zu widersprechen.« Priester, Lehrer, Soldat oder jemand aus dem Umfeld des Militärs? Wir werden niemals wissen, wessen Hand das älteste überlieferte Fragment des euklidischen Werkes in den Ton ritzte.
Und es gibt noch ein weiteres Rätsel. Der Sachverhalt, der auf den Ostraka behandelt wird, stammt direkt aus Buch 13 der Elemente, das Diagramm ist identisch, ebenso wie das Grundkonzept, doch der Text entspricht nicht dem uns bekannten. Das gilt in geringerem Maße auch für die frühen Papyrusfragmente mit Ausschnitten der Elemente: Ihr Text stimmt nicht genau mit dem überein, was in späteren, vollständigeren Fassungen des Werkes zu lesen ist.
Das stützt die These, dass die griechische Geometrie im Grunde eine aktive Tätigkeit war – man zeichnete ein Diagramm und beschrieb dabei die einzelnen Schritte, sich selbst oder einem Publikum. Bei den Texten handelte es sich um eine Mitschrift des Vorgeführten, eine Gedächtnisstütze, ein Gerüst oder eine Reihe von Stichwörtern, zusammen mit einer vollendeten statischen Version des Diagramms, das im Vortrag selbst dynamisch gewachsen war. Diese Notizen dienten möglicherweise dem privaten Studium oder als Hilfsmittel für Lehrer, die immer wieder denselben Beweis demonstrieren mussten. Außerdem ließen sich die Überlegungen hinter Beweisen oder Konstruktionen in einem Buch wie den Elementen auch für Menschen an einem weit entfernten Ort oder in einer weit entfernten Zeit festhalten.
Deshalb lässt sich ein geometrischer Beweis nicht wie ein Roman oder ein Gedicht lesen. Man kann ihn nur nachvollziehen, indem man die ursprüngliche Vorführung nachstellt, indem man zu Stift und Papier, Papyrus oder Tonscherbe greift und das Diagramm beim Lesen konstruiert, um zu verfolgen, wie es wächst.
Die niedergeschriebenen Fassungen der geometrischen Propositionen waren also nicht unbedingt dazu gedacht, sklavisch gelernt und abgeschrieben zu werden, sondern dienten eher als Stichworte, die besagten: Hier ist etwas Interessantes, probiere es selbst einmal aus. Die Elemente waren keine trockene Ansammlung von Fakten, sondern ein Hilfsmittel zum praktischen Lernen, eine Einladung, die Beweise eigenständig durchzuführen, so wie Rhetorikwerke Schülern beibringen sollten, sich gekonnt auszudrücken. Mit diesem Wissen im Hinterkopf ist es deutlich weniger überraschend, dass die frühen Fragmente der Elemente, die auf Tonscherben und Papyrus zu finden sind, ziemlich »wilde« Versionen des Textes enthalten. Gerade der Satz Ostraka sollte wahrscheinlich genau so verstanden werden: als ein Versuch, etwas nachzuvollziehen, was der Schreibende gelesen hatte oder was ihm gezeigt worden war.
Es ist durchaus passend, dass die frühesten Quellen der euklidischen Elemente Rätsel aufgeben, kaum direkte Verbindungen zu den Elementen selbst aufweisen und buchstäblich nur Fragmente sind. Der Text und seine Inhalte reisten so weit, wie es einem kulturellen Erzeugnis nur möglich ist, doch diese Reise veränderte sie auch. Heute weiß man nicht einmal mehr, ob die Elemente je ein klar umrissenes, einheitliches Werk waren, selbst zu Anfang. Euklid war kein Meister, sondern eine Muse, eine Inspiration – er führte nicht nur Tatsachen auf, sondern stellte eine Reihe von Aufgaben. Seine Leser wussten, dass sie immer noch tiefer vordringen und mehr erreichen konnten, denn obwohl die Elemente bereits alles enthielten, war doch noch so viel zu tun.
Hypsikles
Das vierzehnte Buch
Zurück in Alexandria, immer noch zu Zeiten von Ptolemaios III. Eine weitere Legende, dieses Mal überliefert von Galen, dem römischen Arzt.
Ptolemaios’ Begeisterung für das Sammeln alter Texte kommt einer Besessenheit, einer Manie gleich, und er lässt die im Hafen anlegenden Schiffe nach Werken durchsuchen, die für seine Bibliothek von Interesse sein könnten. Bei einer Gelegenheit erlangt er die wertvollen Schriftrollen mit den Stücken von Aischylos, Sophokles und Euripides, eine Leihgabe aus Athen, und hinterlegt die gewaltige Summe von 15 Silbertalenten als Sicherheit. Die Abmachung lautet, dass er Kopien der Schriftrollen anfertigen lässt und die Originale zurücksendet.
Und er lässt auch Kopien anfertigen, auf dem besten Papyrus. Doch dann schickt er diese Kopien zurück nach Athen und behält die Originale für seine Bibliothek. Die Athener sind machtlos, sie hatten das Silber angenommen und damit eingewilligt, dass es in ihren Besitz überginge, wenn sie die Schriftrollen nicht zurückbekämen. Also akzeptieren sie die Kopien und das Geld.
*
Ptolemaios I. (der gelernt hatte, dass es keinen Königsweg zur Geometrie gab) hatte 284 v. Chr. zugunsten seines Sohnes abgedankt, aber die von ihm gegründeten kulturellen Institutionen wuchsen weiter, ebenso wie die prächtige, sagenhafte Stadt Alexandria. Die Bibliothek entwickelte sich zur größten Büchersammlung der Welt, ein beispielloses Symbol der literarischen Kultur, eine umfassende Bestandsaufnahme der griechischen Welt, die alles übertraf, was in Griechenland selbst zu finden war. Der Bücherhunger der Ptolemäer wurde zur Legende, ebenso wie die Anstrengungen, die sie unternahmen, um sich wichtige Werke zu sichern – wie in der oben zitierten Anekdote über Ptolemaios III., der in der nächsten Generation eine enorme Summe für die Athener Originale der großen Tragödien zahlte. Neben Theaterstücken, historischen Werken und Epen fanden sich in der Bibliothek auch Schriften über das Kochen, Fischen und über Magie; kein Thema wurde verschmäht.
In der Mathematik galten Euklids Elemente weiterhin als anerkannte Sammlung der üblichen Methoden und Resultate, dank derer spätere griechische Geometer allerhand Neues entdeckten. Wo sich Euklid mit Punkten, Linien und Kreisen befasst hatte, studierten sie nun Figuren, die an der Schnittfläche von Kegeln und Ebenen entstanden, und Körper, die sich ergaben, wenn man diese Schnittflächen um ihre eigene Achse rotieren ließ – ungewöhnliche Figuren, sicherlich an der Grenze dessen, was sich der menschliche Geist ohne Unterstützung durch Algebra oder digitale Visualisierungsmethoden vorstellen kann. Trotzdem verwendeten die Mathematiker Euklids Terminologie und bezogen sich immer wieder auf seine Propositionen. Außerdem erweiterten sie den Stil der griechischen Geometrie um Mittel, die den kulturellen Gepflogenheiten in Alexandria entsprachen, etwa unerwartete Wendungen, Überraschungsmomente und ein plötzliches Aufblitzen von Genialität.
Kaum eine Generation nach Euklid machte sich Archimedes (um 287–212 v. Chr.) einen Ruf als der brillanteste unter den griechischen Geometern – ein Meister der Spannung, Überraschung und aufsehenerregender, unerwarteter Enthüllungen. Zu seinen bekanntesten Erkenntnissen zählte die Tatsache, dass die Volumina einer Kugel und eines Zylinders mit der gleichen Höhe und dem gleichen Durchmesser im Verhältnis zwei zu drei zueinander stehen.
Der größte Geometer der folgenden Generation war Apollonios von Perge (um 262–190 v. Chr.), der verwirrenderweise denselben Namen trug wie ein Dichter aus Alexandria, der die Bibliothek leitete (und nach seinem Umzug auf die Insel den Beinamen »Rhodios« oder »von Rhodos« trägt). Laut einer antiken Quelle hatte er in Alexandria zusammen mit den Schülern Euklids studiert (diese Information stammt aus demselben – und einzigen – Text, der Euklid in Alexandria verortet). Apollonios ersann eine Systematik der Kegelschnitte – Kurven, die an der Schnittfläche durch einen Kegel entstehen – und übernahm die archimedische Präsentationsweise, bei der lange Herleitungen am Ende elegant in überraschende Ergebnisse mündeten.
Und so ging es immer weiter. 235 v. Chr. übernahm der Astronom und Geometer Eratosthenes die Leitung der Bibliothek (als Nachfolger von Apollonios dem Dichter) – ein wichtiger Augenblick für die Verbindung zwischen der Geometrie und der Kultur des Museions. Eratosthenes sollte dafür berühmt werden, dass er aus astronomischen Beobachtungen korrekt auf den Erdumfang schloss.
Ikosaeder und Dodekaeder in einem Holzschnitt der Renaissance
Luca Pacioli, Divina proportione (Venedig, 1509), Abb. XXII und XXVIII. Getty Research Institute, 47289. (Internet Archive/lizenzfrei)
Eines der geometrischen Kunststücke, mit denen sich diese Geometer beschäftigten, war Folgendes: Man nehme ein Dodekaeder und ein Ikosaeder der gleichen Größe, das heißt, die Kugeln, in die diese Körper exakt hineinpassen, müssen gleich groß sein. Die Seitenflächen des Dodekaeders sind Fünfecke, die des Ikosaeders Dreiecke. Nun stellt sich – völlig unerwarteterweise – heraus, dass die Fünfecke und die Dreiecke gleich groß sind, in dem Sinne, dass der Kreis, der jedes der Fünfecke umschließt, deckungsgleich ist mit dem Kreis, der jedes der Dreiecke umschließt. Das ist bloß eine interessante Beobachtung ohne große Bedeutung, aber ein trefflicher Beleg für die geistige Gewandtheit der Geometer. Er zog genügend Bewunderung auf sich, um über mehrere Generationen weitergegeben und schließlich an die Elemente angehängt zu werden.
Entdeckt hatte diese Tatsache ein Geometer namens Aristaios, der sie in einem Werk über die fünf regulären Körper veröffentlichte, das sicherlich von den Darlegungen zum Abschluss der Elemente inspiriert war. Apollonios behandelte das Thema in einer Abhandlung, die sich ausschließlich mit dem Dodekaeder und dem Ikosaeder beschäftigte. Als später ein gewisser Basilides von Tyros nach Alexandria kam, das Thema mit einem Kollegen diskutierte und Apollonios’ Erörterungen für mangelhaft befand, brachte Apollonios eine neue Version seines Textes heraus, in der er den bemerkenswerten Beweis erbrachte, dass die Volumina eines gleich großen Dodekaeders und Ikosaeders im selben Verhältnis zueinander stehen wie ihre Oberfläche. Zu guter Letzt nahm sich ein Mann namens Hypsikles des Themas an und führte alles zusammen, was ihm in den bisherigen Schriften sinnvoll erschienen war.
Das geschah Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr., rund hundertfünfzig Jahre nach Euklid. Von Hypsikles weiß man wenig sicher, doch es scheint, als sei er nicht nur Geometer, sondern auch Astronom gewesen. Neben einem verschollenen Werk über die Sphärenharmonie und möglicherweise einem Text über Zahlen schrieb er auch ein Werk über den Aufgang und den Untergang der Sterne. Es war im euklidischen Stil gehalten und legte dar, wie man (in etwa) berechnete, wann eine beliebige Stelle des Himmels – beispielsweise ein bestimmter Stern – von einem beliebigen Platz auf der Erdoberfläche aus zu sehen war. Das Werk war auch deshalb bemerkenswert, weil es als erster griechischer Text den Kreis in dreihundertsechzig Einheiten unterteilte, eine Praxis, die ursprünglich aus Babylonien stammte.
Auf Apollonios’ überarbeitetes Werk reagierte Hypsikles mit einem eigenen Text, in dem er Dodekaeder und Ikosaeder gleicher Größe verglich. Er lieferte neue Beweise für die wichtigsten Erkenntnisse: dass die einzelnen Seitenflächen in den gleichen Kreis passen und dass die Volumina im gleichen Verhältnis zueinander stehen wie die Oberflächen. (Nimmt man einen Würfel der gleichen Größe hinzu, ist das Verhältnis zwischen seiner Seitenlänge und der Seitenlänge des Ikosaeders übrigens ebenfalls das gleiche.) Es war ein kurzes Buch, mit nur fünf Propositionen sowie drei Hilfssätzen (»Lemmata«) und einem alternativen Beweis.
Es ist wenig darüber bekannt, wie solche Schriften zirkulierten, doch klar ist, dass die Abhandlung von Hypsikles, trotz oder gerade wegen ihres schwer verständlichen Themas, einige Verbreitung fand und gelesen, zitiert und bewundert wurde. Doch dann sollte ihr ein seltsames Schicksal widerfahren: Ein Unbekannter hängte sie an Euklids Elemente an; und da Euklid dreizehn Bücher verfasst hatte, wurde der Text von Hypsikles zu »Buch 14« und galt von da an als Teil der Elemente. In diesem Rahmen wurden ein paar redaktionelle Anpassungen vorgenommen; man veränderte den Beginn und das Ende des »Buches« und fügte eine zusätzliche Proposition in das von Euklid verfasste Buch 13 ein, um die Verbindung zu stärken. Es erscheint unglaublich, aber das »vierzehnte Buch« galt anderthalb Jahrtausende lang als allgemein akzeptierter Teil der Elemente.
Die beeindruckende Versammlung von Büchern und Menschen in Alexandria und die mathematische Tradition, die immer stärker mit der Stadt verbunden wurde, beeinflussten einander auf seltsame Art und Weise und sorgten für einige unvorhersehbare Ergebnisse. Die Räume voller Kisten mit Schriftrollen brachten unerwartete Konstellationen, gelegentliche Fehlzuschreibungen und ungewöhnliche Verquickungen hervor. Das galt auch für die Elemente, die ständig neuen Nachforschungen, Kontroversen und Verbesserungen ausgesetzt waren, selbst als sie schon von Generation zu Generation weitergereicht wurden.
Theon von Alexandria
Bearbeiter der Elemente
Alexandria um das Jahr 370. Nach wie vor ist die Stadt Teil der griechischen Welt und präsentiert sich stolz und prachtvoll. Doch sie befindet sich im Wandel: Tempel schließen, Kirchen entstehen. Die Bibliothek ist verschwunden, und im Museion ist die letzte Generation von Gelehrten am Werk.
Einer von ihnen ist Theon; er arbeitet mit seiner Tochter zusammen. Sie lehren in der Stadt Geometrie, Astronomie und Philosophie. Dafür braucht man Bücher, und die beiden erstellen neue Fassungen klassischer Texte – von Claudius Ptolemäus’ Schriften zur Astronomie, den orphischen Hymnen, von Büchern zur Weissagung und auch von Euklids Arbeiten über die Geometrie.
Dabei handelt es sich um umfangreiche Werke. Den ganzen Tag lang kratzen Schilfrohre über den Papyrus; Finger schmerzen.
Als Theon bei Proposition 33 im sechsten Buch der Elemente angelangt ist, stellt er fest, dass diese in seinen Augen nicht ganz vollständig ist. Er fügt einen Abschnitt hinzu, erweitert das Ergebnis. Und so werden Euklids Elemente etwas länger und – so hofft er – etwas besser.
*
Zu Glanzzeiten war Alexandria die größte, reichste, prunkvollste Stadt der griechischsprachigen Welt, die Ptolemäer Förderer jeder Kunst und Wissenschaft. Doch wie alle Dynastien hatte auch sie ihre Probleme, und nach der Seeschlacht bei Actium wurde Ägypten 31 v. Chr. zu einer römischen Provinz. Das änderte allerdings nichts daran, dass die Metropole nach wie vor reich und grandios war, architektonisch blieb sie die vielleicht schönste Stadt im Mittelmeerraum.
Die Bibliothek überstand all das. Die Bibliomanie der Ptolemäer hatte sie auf eine Größe anwachsen lassen, die selbst Zeitgenossen nur schätzen konnten. Einer meinte, dass dort fast eine halbe Million Schriftrollen versammelt seien – eine Zahl, die sicherlich unmöglich war. Doch unabhängig davon, wie viele Kilometer Text und wie viele Hektar Papyrus sich dort befanden, war die Bibliothek ein Archiv der gesamten griechischen Welt und auch all dessen, was sich zusammentragen und ins Griechische übersetzen ließ. Ein überaus bedeutsames Symbol des Kosmopolitismus war die im zweiten und dritten Jahrhundert v. Chr. angefertigte Übersetzung der heiligen Schriften des Judentums ins Griechische, die Septuaginta.
Doch Bücher sind empfindlich und Bibliotheken ebenso. In Zeiten politischer Instabilität haben kulturelle Institutionen nicht immer Vorrang. Einem beständig wiederholten – und wahrscheinlich zutreffenden – Bericht zufolge wurden einige der Bücher zerstört, möglicherweise in den Lagerstätten direkt am Meer, als Julius Cäsar Alexandria 47 v. Chr. aus Versehen in Brand steckte. Andererseits ist belegt, dass die Bibliothek ein Jahrhundert später noch benutzt wurde. Und auch das Museion bestand fort und blühte unter der römischen Herrschaft zunächst sogar noch auf.
Doch in dieser Periode sah Alexandria auch Bürgerkriege und Aufstände, mindestens so viele, wie es in einer Stadt dieser Größe zu der Zeit normal war. Die Bewohner erlangten in den ersten Jahrhunderten unter den Römern sogar den Ruf, besonders aufrührerisch und gewalttätig zu sein. Im späten dritten Jahrhundert verwandelten Unruhen den ganzen alten Palastbezirk (Brucheion bzw. Brouchion in römischer Zeit) in eine »Wüste«, wie es ein Zeitgenosse beschrieb, und von der Bibliothek und vom Museion war danach wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Mit Sicherheit kann das niemand sagen. Laut den überlieferten Quellen war der letzte Mitarbeiter des Museions Theon, der dort von etwa 360 bis möglicherweise zum Ende des Jahrhunderts Mathematik unterrichtete.
Wie auch immer sich der langsame Untergang gestaltete – die wissenschaftliche Tradition der Bibliothek hatte entscheidende Wirkung auf die griechische Literatur gehabt und sogar deren Überleben gesichert. Praktisch jeder noch so kurze griechische Text, der die Zeit überdauert hat, war Teil des Bibliotheksbestands gewesen.
Mit der Zeit hatte sich die Bibliothek auf die Textkritik älterer Werke spezialisiert: Was hatten die Autoren wirklich geschrieben? Welche Werke waren authentisch? Welche Passagen waren mit der Zeit verändert worden? Hier entstand das langlebige Bild des entstellten Textes, des Textes, der geheilt, der vom Schmutz und der Verunreinigung befreit werden musste, die er durch den Kontakt mit Menschen auf sich gezogen hatte.
Die Gelehrten der Bibliothek ersannen Zeichen, die vermerkten, welche Zeilen eines Textes fragwürdig waren und wie und wo sie korrigiert worden waren. Sie fanden Markierungen für Anfang und Ende eines Abschnitts und sogar für Zeilentrennungen. Satzzeichen gab es aber immer noch nicht; die Texte bestanden weiterhin aus einer fortlaufenden Buchstabenfolge:
VOLLSTÄNDIGINGROSSBUCHSTABENOHNEWORTZWISCHENRÄUMEAKZENTEODERSATZZEICHENWODURCHSIESEHRSCHWERZULESENWAREN.
Diese Techniken und Innovationen waren für das Studium und die Vermittlung der klassischen Literatur entwickelt worden, zunächst der homerischen Werke (wobei man einer Deutungstradition folgte, die auf die Homer-Rezitatoren im antiken Athen zurückging), dann der Athener Dramatiker und anderer Autoren. Über Prosa hatten die Gelehrten der Bibliothek weniger zu sagen, und noch zurückhaltender waren sie, wenn es um wissenschaftliche Texte ging. Es gibt beispielsweise keinerlei Hinweise darauf, dass die Werke Aristoteles’ in Alexandria in dieser Weise bearbeitet worden wären. Möglicherweise verlangte die Mathematik eine etwas andere Herangehensweise, auch wenn der Grundgedanke, den Text zu bereinigen, derselbe gewesen sein dürfte.
Der Text von Euklids Elementen war in mancher Hinsicht schon in den ersten Jahrhunderten instabil gewesen, und die überlieferten Quellen weisen auf weitere offene Fragen hin. Es ist durchaus möglich, dass Euklid selbst mehr als eine Fassung seines Werkes erstellt hatte, was einige der Abweichungen erklären würde, die sich in den Quellen finden. Mindestens genauso wahrscheinlich ist allerdings, dass sich übereifrige Bearbeiter im zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. am Text zu schaffen machten und so Versionen entstanden, die sich vom Original und vielleicht auch voneinander unterschieden.
Gesichert ist, dass es zumindest im Zeitraum zwischen dem ersten und dem fünften Jahrhundert n. Chr. durchaus üblich war, einen Kommentar zu Büchern wie den Elementen zu verfassen, auf Griechisch und häufig in Alexandria. Fehlte eine Definition? Wurde ein Begriff definiert, dann aber nicht verwendet? War eine Proposition eine Sackgasse, weil sie nie in weiteren Beweisen aufgegriffen wurde? Stand sie an der falschen Stelle, kam sie nach einem Sachverhalt, zu dessen Beweis sie beitragen sollte? Auf all das konnte man in Kommentaren hinweisen, damit Lehrer und Schüler beim Umgang mit dem Text nicht über diese kleinen Unschärfen stolperten. Da es schwer zu vermeiden war, dass derartige Kommentare Verbesserungsvorschläge für den Text enthielten, lieferten sie eine Art Rohmaterial für die davon unabhängige, aber artverwandte Tätigkeit der Textbearbeitung, bei der eine neue Fassung des Textes geschaffen wurde, etwa für die eigenen Schüler.
*
Kommen wir nun zu Theon und den letzten Tagen des Museions. Theon lehrte und verfasste für seine Schüler Bücher. Außerdem erstellte er – vermutlich auf der Grundlage seiner Lehre – eine kommentierte Fassung der astronomischen Werke von Claudius Ptolemäus (der, soweit bekannt, nicht mit der Königsfamilie der Ptolemäer verwandt war) aus dem zweiten Jahrhundert. Zu den sogenannten Handtafeln verfasste er sogar gleich zwei Arten von Kommentar: einen für erfahrene Astronomen und einen für diejenigen, die noch nicht in der Lage waren, den Gedankengängen und mathematischen Prozessen des Buches zu folgen. Darüber hinaus scheint Theon Abhandlungen zur Bedeutung von Omen und über die orphischen Hymnen geschrieben zu haben. Und es gibt eine Handvoll Gedichte von ihm, in denen er seiner Hingabe für die perfekte Welt des Himmels, der Götter und der Sterne Ausdruck verleiht.
Darüber hinaus war er als Bearbeiter und Herausgeber tätig und erstellte einheitliche, verbesserte Versionen klassischer Texte für die Lehre. Unter ihnen waren mit Sicherheit die Elemente und andere Werke Euklids sowie Ptolemäus’ Almagest. Theon tat, was viele Bearbeiter in jener Zeit mit mathematischen Schriften taten: Er räumte auf und glättete Unstimmigkeiten. Er wählte zwischen mehreren Varianten eines Textes aus oder kombinierte verschiedene Versionen, sodass manche Passagen zwei unterschiedliche Beweise für eine einzige Proposition enthielten. Er füllte Lücken – echte und eingebildete. Während die homerischen Bearbeiter sich selbst als Außenstehende der Welt der Epen betrachteten, neigten die Mathematiker im späten Alexandria dazu, Euklid als einen Kollegen und sich selbst als Vertreter einer fortbestehenden Tradition zu sehen. Statt textlicher Reinheit und Treue (»Was hat Euklid wirklich geschrieben?«) schätzten sie Korrektheit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit.
Ungewöhnlich ist, dass Theon eine seiner konkreten Änderungen an den Elementen dokumentierte. In einem anderen Werk – seinem Ptolemäus-Kommentar – erwähnt er einen nebensächlichen Punkt, »den wir in unserer Fassung der Elemente am Ende des sechsten Buches bewiesen haben«. So hielt er für die Nachwelt fest, dass eine bestimmte Passage des Textes auf ihn zurückging und also er solche Änderungen vorgenommen hatte.
Der fragliche Satz besagt, dass die Länge der gekrümmten Seite eines Kreisausschnitts – einer Art Tortenstück, begrenzt von zwei geraden Linien, die sich im Kreismittelpunkt treffen – in einem proportionalen Verhältnis zum Winkel am Mittelpunkt steht. Theons Ergänzung lautet, dass das auch für die Fläche des Ausschnitts gelte. Das ist leicht zu glauben und auch nicht allzu schwer zu beweisen.
Theons beiläufige Bemerkung hat unter den Wissenschaftlern, die sich mit den Elementen befassten, über die Jahre viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sich daraus die verlockende Möglichkeit ergab, hinter den redaktionellen Bearbeitungen der Antike den echten Euklid auszumachen. Wenn diese Ergänzung mit Sicherheit Theon zugeschrieben werden konnte, waren die Forscher vielleicht auch in der Lage, seine weiteren Änderungen zu identifizieren und zu revidieren.
Leider hat sich die Zuordnung bestimmter Änderungen über diese eine hinaus als äußerst fragwürdige Angelegenheit erwiesen, auch wenn sich viele daran versucht haben. Was dem einen wie eine logische Lücke erschien, war dem anderen eine elegante Verknappung. Was der eine für einen Einschub von Theon hielt, war in den Augen des anderen ein echter Patzer Euklids. Die Quellen – von denen die meisten weit nach Theons Zeiten entstanden sind und zahllose Vermischungen von Theons Version und der vorausgehenden Fassung oder den vorausgehenden Fassungen enthalten – lassen keinerlei Gewissheit zu.
Die Geschichte ist seitdem nicht gerade wohlwollend mit Theon umgesprungen. Da sich die Einstellung zu Texten und zur Frage der Authentizität im Lauf der Zeit änderte, war man nicht gerade begeistert über die Eingriffe, die er und seinesgleichen vorgenommen hatten. Historiker der jüngeren Vergangenheit haben Theons Werk als »triviale Bearbeitung« und »mathematisch banal«, seine akademischen Fähigkeiten als »vollständig unoriginell« bezeichnet. Sein Biograf im Dictionary of Scientific Biography fällt ein vernichtendes Urteil: »Für einen derart mittelmäßigen Gelehrten war Theon ungewöhnlich einflussreich.«
Vielleicht sollte man nicht allzu hart mit ihm ins Gericht gehen, vor allem, wenn er bei seiner Arbeit die Lehre im Sinn hatte. Es stimmt zwar, dass weite Teile von Euklids Elementen wirklich »elementar« im Sinne von leicht verständlich sind, von den einfachen Konstruktionen aus Linien, Kreisen und Dreiecken bis hin zu den Eigenschaften der Zahlen (eine gerade Zahl multipliziert mit einer geraden Zahl ergibt eine gerade Zahl) und der Verhältnisse. Doch darüber hinaus enthält das Buch Sachverhalte, die so komplex sind, dass es einem die Tränen in die Augen treibt, und die ein ausgeprägtes Talent für Mathematik und viel Zeit verlangen. Ein Beispiel dafür ist Euklids erschöpfende Klassifikation der verschiedenen Möglichkeiten, wie zwei Strecken in einem Größenverhältnis, das sich nicht in ganzen Zahlen ausdrücken lässt, zueinander stehen können (enthalten in Buch 10) – das Thema umfasst 115 Propositionen. Ein weiteres ist die Konstruktion von Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder und ihre relative Größe innerhalb einer Kugel, die die Ecken so gerade berührt. Gut vorstellbar, dass Theons Bemühungen, den Text zu glätten, zu erläutern und zu strukturieren, so manchem Schüler eine große Hilfe waren.
Einflussreich war Theons Bearbeitung sicherlich. Obwohl ältere Fassungen der Elemente weiterhin im Umlauf waren, wurde sie begeistert aufgenommen, und fast alle vollständigen Handschriften, die bis heute existieren, scheinen seine Version zu enthalten. Mittelmäßigkeit hin oder her – mit seinen Eingriffen bestimmte Theon den Text stärker als irgendjemand seit Euklid selbst.
*
Aufmerksame Leser werden bemerkt haben, dass Theons Tochter erwähnt wurde. Sie hieß Hypatia, wurde um 355 geboren, und frühe Quellen legen nahe, dass ihr mathematisches Talent das ihres Vaters noch überstieg, obwohl nur die Titel ihrer Schriften überliefert sind. Dabei scheint es sich um Kommentare und möglicherweise auch eigenständige Abhandlungen über Mathematik und Astronomie gehandelt zu haben.
Theon lebte in einer Welt, die im Wandel begriffen war. Kaiser Konstantin bekannte sich seit 312 – zumindest offiziell – zum Christentum und schaffte im darauffolgenden Jahr die rechtlichen Hindernisse für christliche Gottesdienste ab. Überall in der griechischen Welt wurden die Tempel – langsam – von Kirchen abgelöst. Noch zu Theons Lebzeiten wurde in Alexandria das Serapeum zerstört, der Tempel des von Ptolemaios geschaffenen Kults, der seit 325 geschlossen war, aber wahrscheinlich immer noch eine der wichtigsten Bibliotheken der Stadt enthielt.
Die Alexandriner standen weiter in dem Ruf, zu Gewaltausbrüchen zu neigen, und eines der Opfer war Hypatia selbst. Anfang der 390er-Jahre unterrichtete sie Philosophie und verfügte über einen festen Kreis an Schülern. Da ihre Lehre auch Geometrie umfasste, ist sie eine der letzten Personen, von denen bekannt ist, dass sie die Tradition des Geometrieunterrichts in der Geburtsstadt der Elemente fortführten. Hypatia war eine angesehene Persönlichkeit in Alexandria, vielleicht sogar eine Art Star. Die meisten ihrer bekannten Schüler waren – oder wurden später – Christen, und der heidnische Glaube der Lehrerin scheint nicht als Hindernis empfunden worden zu sein. Doch in den 410er-Jahren kam es zu einem gewaltsamen Konflikt zwischen ihrem Unterstützer, dem römischen Präfekten Orestes (einem Christen), und dem Patriarchen von Alexandria, und im März 415 wurde Hypatia im Zuge eines Racheakts ermordet – ein Opfer politischer Eifersucht, wie es ein Historiker der Antike ausdrückte. Ihr tragisches Lebensende ist seit dem neunzehnten Jahrhundert häufiges Thema fiktionaler Darstellungen gewesen, oft auf ziemlich reißerische Weise.
Einer von Theons astronomischen Kommentaren beinhaltet eine unklare Aussage, die sich auf seine Tochter bezieht. Sie ist mehrfach so interpretiert worden, dass Hypatia (mindestens) jenen Teil von Theons Kommentar überprüft oder korrigiert oder aber sogar den von Theon kommentierten Text ganz oder teilweise redigiert oder überarbeitet habe. Offensichtlich gab es eine Zeit, in der sie und Theon sich gemeinsam mit mathematischen und astronomischen Themen befassten. Doch die überlieferten Quellen bringen sie nicht mit seiner Fassung von Euklids Elementen in Verbindung. Es ist möglich, dass sie daran mitgearbeitet hat, und der Gedanke ist verlockend, dass die spätere Geometrielehrerin dem Text der Elemente irgendwie ihren Stempel aufgedrückt hat. Doch Theons aktive Zeit hatte definitiv vor seiner Zusammenarbeit mit seiner Tochter begonnen und setzte sich danach wahrscheinlich noch fort, was bedeutet, dass er Euklid genauso gut allein hätte redigieren können. Wie bei so vielen Aspekten zur Überlieferung der Elemente gilt auch hier: Man kann sich unmöglich sicher sein.
Stephanos der Schreiber
Euklid in Konstantinopel
Konstantinopel im Jahr der Welt 6397 (888 n. Chr.), im Skriptorium eines Klosters.
Der Schreiber greift zum letzten Bogen Pergament. Er spreizt die müden Finger, streckt den schmerzenden Rücken durch und fügt eine letzte Notiz hinzu:
Geschrieben von der Hand des Schreibers Stephanos, im Monat September der siebten Indiktion, im Jahr der Welt 6397. Erstanden durch Arethas von Patras, zum Preis von 14 Goldmünzen.
*
Im fünften Jahrhundert brach der westliche Teil des Römischen Reiches zusammen, von Britannien über Portugal bis hin zum Balkan. Spätestens seit 480 gab es dort keinen Kaiser mehr. Doch im östlichen Teil, wo man Griechisch sprach und seit der Reichsteilung 395 einen eigenen Kaiser hatte, blühte das Reich weitere tausend Jahre lang. Der Sitz der Macht war Konstantinopel.
Byzantion. Konstantinopel. Die alte griechische Stadt war 324 de facto als neue Hauptstadt des östlichen Reichsteils vorgesehen, ein weiteres gewaltiges Eitelkeitsprojekt, und 330 als »Neues Rom« offiziell zur Hauptstadt erklärt worden; als solche erhielt sie den Namen ihres Gründers Kaiser Konstantin. Im Jahr 425 eröffnete dort eine Art Universität.
Das neue Reich war weniger wohlhabend und weniger gebildet als sein Vorgänger. Schulen – die Universitäten jener Zeit – gab es in Alexandria, Antiochia, Athen, Beirut, Gaza und Konstantinopel. Doch sie verloren rasch an Bedeutung, und Mitte des sechsten Jahrhunderts waren nur noch die in Konstantinopel und Alexandria übrig. Letztere wurde 619 von den Persern erobert und stand ab 641 unter der Herrschaft der Kalifen. Die griechischsprachige Welt kollabierte, und das Zentrum der griechischen Kultur bildete nun größtenteils eine einzige Stadt: Konstantinopel.
Wenn die Barbaren eine Art Lösung für die Probleme des schwer regierbaren Römischen Reiches gewesen waren, lieferte die enorme Konzentration der Kultur eine ähnliche Lösung für die überwältigende Masse griechischer Literatur. Die Produktion griechischer Bücher ging drastisch zurück, und was nicht in Konstantinopel erhalten blieb, verschwand. Es fiel den Würmern anheim, und auf einmal war die Literatur der griechischen Welt wieder überschaubar.
Die oströmischen Gelehrten unterteilten das Material zu Lehrzwecken in einen literarischen und einen wissenschaftlichen Teil; beide zusammen bildeten die »sieben freien Künste«, die auch im Westen studiert wurden. Die Zusammenstellung der sieben Disziplinen hat ihre Ursprünge im klassischen Athen; es ist nicht gesichert, wann und wo daraus ein offizieller Lehrplan wurde, möglicherweise um 100