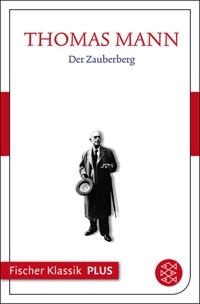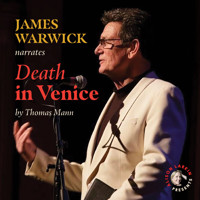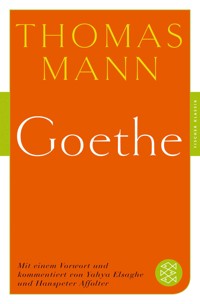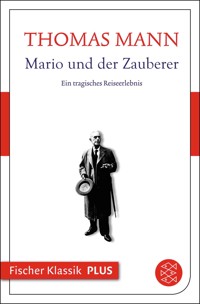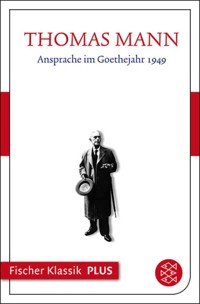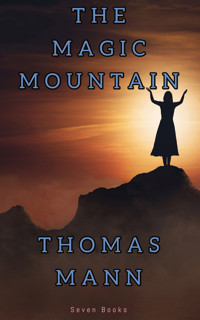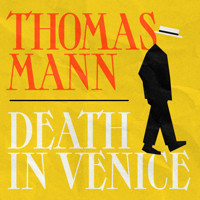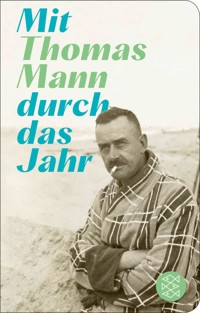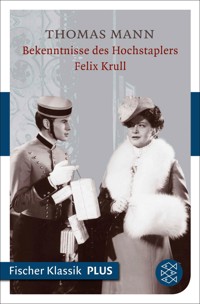
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thomas Mann, Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke, Briefe, Tagebücher
- Sprache: Deutsch
Thomas Mann krönt sein umfangreiches Romanwerk mit der Hochstaplergeschichte von Felix Krull. Die sprachliche Eleganz dieser fiktiven Autobiographie, ihre ironische Doppelbödigkeit erweisen ebenso wie Krulls Handeln, dass er »der Gott der Diebe« ist. Ein Tausendsassa, der jeder neuen und unerwarteten Situation gewachsen ist. Kein anderes Werk hat Thomas Mann über einen so langen Zeitraum beschäftigt wie der Krull-Roman. Begonnen 1910, erschien der Roman 1954 und begleitete damit beinahe das gesamte schriftstellerische Leben des Autors. In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) Mit Daten zu Leben und Werk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas Mann
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
Der Memoiren erster Teil
Roman
FISCHER E-Books
Roman
In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA)
Mit Daten zu Leben und Werk
Inhalt
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Indem ich die Feder ergreife, um in völliger Muße und Zurückgezogenheit – gesund übrigens, wenn auch müde, sehr müde (so daß ich wohl nur in kleinen Etappen und unter häufigem Ausruhen werde vorwärtsschreiten können), indem ich mich also anschicke, meine Geständnisse in der sauberen und gefälligen Handschrift, die mir eigen ist, dem geduldigen Papier anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen nach Vorbildung und Schule denn auch gewachsen bin. Allein, da alles, was ich mitzuteilen habe, sich aus meinen eigensten und unmittelbarsten Erfahrungen, Irrtümern und Leidenschaften zusammensetzt und ich also meinen Stoff vollkommen beherrsche, so könnte jener Zweifel höchstens den mir zu Gebote stehenden Takt und Anstand des Ausdrucks betreffen, und in diesen Dingen geben regelmäßige und wohlbeendete Studien nach meiner Meinung weit weniger den Ausschlag, als natürliche Begabung und eine gute Kinderstube. An dieser hat es mir nicht gefehlt, denn ich stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause; mehrere Monate lang standen meine Schwester Olympia und ich unter der Obhut eines Fräuleins aus Vevey, das dann freilich, da sich ein Verhältnis weiblicher Rivalität zwischen ihr und meiner Mutter – und zwar in Beziehung auf meinen Vater – gebildet hatte, das Feld räumen mußte; mein Pate Schimmelpreester, mit dem ich auf sehr innigem Fuße stand, war ein vielfach geschätzter Künstler, den jedermann im Städtchen »Herr Professor« nannte, obgleich ihm dieser schöne, begehrenswerte Titel von Amts wegen vielleicht nicht einmal zukam; und mein Vater, wiewohl dick und fett, besaß viel persönliche Grazie und legte stets Gewicht auf eine gewählte und durchsichtige Ausdrucksweise. Er hatte von seiner Großmutter her französisches Blut ererbt, hatte selbst seine Lehrzeit in Frankreich verbracht und kannte nach seiner Versicherung Paris wie seine Westentasche. Gerne ließ er – und zwar in vorzüglicher Aussprache – Wendungen wie »c’est ça«, »épatant« oder »parfaitement« in seine Rede einfließen; auch sagte er öfters: »Ich goutiere das« und blieb bis gegen das Ende seines Lebens ein Günstling der Frauen. Dies nur im voraus und außer der Reihe. Was aber meine natürliche Begabung für gute Form betrifft, so konnte ich ihrer, wie mein ganzes trügerisches Leben beweist, von jeher nur allzu sicher sein und glaube mich auch bei diesem schriftlichen Auftreten unbedingt darauf verlassen zu können. Übrigens bin ich entschlossen, bei meinen Aufzeichnungen mit dem vollendetsten Freimut vorzugehen und weder den Vorwurf der Eitelkeit noch den der Schamlosigkeit dabei zu scheuen. Welcher moralische Wert und Sinn wäre auch wohl Bekenntnissen zuzusprechen, die unter einem anderen Gesichtspunkt als demjenigen der Wahrhaftigkeit abgefaßt wären!
Der Rheingau hat mich hervorgebracht, jener begünstigte Landstrich, welcher, gelinde und ohne Schroffheit sowohl in Hinsicht auf die Witterungsverhältnisse wie auf die Bodenbeschaffenheit, reich mit Städten und Ortschaften besetzt und fröhlich bevölkert, wohl zu den lieblichsten der bewohnten Erde gehört. Hier blühen, vom Rheingaugebirge vor rauhen Winden bewahrt und der Mittagssonne glücklich hingebreitet, jene berühmten Siedlungen, bei deren Namensklange dem Zecher das Herz lacht, hier Rauenthal, Johannisberg, Rüdesheim, und hier auch das ehrwürdige Städtchen, in dem ich, wenige Jahre nur nach der glorreichen Gründung des Deutschen Reiches, das Licht der Welt erblickte. Ein wenig westlich des Knies gelegen, welches der Rhein bei Mainz beschreibt, und berühmt durch seine Schaumweinfabrikation, ist es Hauptanlegeplatz der den Strom hinauf und hinab eilenden Dampfer und zählt gegen viertausend Einwohner. Das lustige Mainz war also sehr nahe und ebenso die vornehmen Taunusbäder, als: Wiesbaden, Homburg, Langenschwalbach und Schlangenbad, welch letzteres man in halbstündiger Fahrt auf einer Schmalspurbahn erreichte. Wie oft in der schönen Jahreszeit unternahmen wir Ausflüge, meine Eltern, meine Schwester Olympia und ich, zu Schiff, zu Wagen und mit der Eisenbahn, und zwar nach allen Himmelsrichtungen: denn überall lockten Reize und Sehenswürdigkeiten, die Natur und Menschenwitz geschaffen. Noch sehe ich meinen Vater in kleinkariertem, bequemem Sommeranzug mit uns in irgendeinem Wirtsgarten sitzen – ein wenig weitab vom Tische, weil sein Bauch ihn hinderte, nahe heranzurücken – und mit unendlichem Behagen ein Gericht Krebse nebst goldenem Rebensaft genießen. Oftmals war auch mein Pate Schimmelpreester dabei, betrachtete Land und Leute scharf prüfend durch seine rundäugige Malerbrille und nahm das Große und Kleine in seine Künstlerseele auf.
Mein armer Vater war Inhaber der Firma Engelbert Krull, welche die untergegangene Sektmarke »Lorley extra cuvée« erzeugte. Unten am Rhein, nicht weit von der Landungsbrücke, lagen ihre Kellereien, und nicht selten trieb ich mich als Knabe in den kühlen Gewölben umher, schlenderte gedankenvoll die steinernen Pfade entlang, welche in die Kreuz und Quere zwischen den hohen Gestellen hinführten, und betrachtete die Heere von Flaschen, die dort in halbgeneigter Lage übereinandergeschichtet ruhten. Da liegt ihr, dachte ich bei mir selbst (wenn ich auch meine Gedanken natürlich noch nicht in so treffende Worte zu fassen wußte), da liegt ihr in unterirdischem Dämmerlicht, und in euerem Innern klärt und bereitet sich still der prickelnde Goldsaft, der so manchen Herzschlag beleben, so manches Augenpaar zu höherem Glanze erwecken soll! Noch seht ihr kahl und unscheinbar, aber prachtvoll geschmückt werdet ihr eines Tages zur Oberwelt aufsteigen, um bei Festen, auf Hochzeiten, in Sonderkabinetten eure Pfropfen mit übermütigem Knall zur Decke zu schleudern und Rausch, Leichtsinn und Lust unter den Menschen zu verbreiten. Ähnlich sprach der Knabe; und so viel wenigstens war richtig, daß die Firma Engelbert Krull auf das Äußere ihrer Flaschen, jene letzte Ausstattung, die man fachmännisch die Coiffure nennt, ein ungemeines Gewicht legte. Die gepreßten Korke waren mit Silberdraht und vergoldetem Bindfaden befestigt und mit purpurrotem Lack übersiegelt, ja ein feierliches Rundsiegel, wie man es an Bullen und alten Staatsdokumenten sieht, hing an einer Goldschnur noch besonders herab; die Hälse waren reichlich mit glänzendem Stanniol umkleidet, und auf den Bäuchen prangte ein golden umschnörkeltes Etikett, das mein Pate Schimmelpreester für die Firma entworfen hatte und worauf außer mehreren Wappen und Sternen, dem Namenszuge meines Vaters und der Marke »Lorley extra cuvée« in Golddruck eine nur mit Spangen und Halsketten bekleidete Frauengestalt zu sehen war, welche, mit übergeschlagenem Beine auf der Spitze eines Felsens sitzend, erhobenen Armes einen Kamm durch ihr wallendes Haar führte. Übrigens scheint es, daß die Beschaffenheit des Weines dieser blendenden Aufmachung nicht vollkommen entsprach. »Krull«, mochte mein Pate Schimmelpreester wohl zu meinem Vater sagen, »Ihre Person in Ehren, aber Ihren Champagner sollte die Polizei verbieten. Vor acht Tagen habe ich mich verleiten lassen, eine halbe Flasche davon zu trinken, und noch heute hat meine Natur sich nicht von diesem Angriff erholt. Was für Krätzer verstechen Sie eigentlich zu diesem Gebräu? Ist es Petroleum oder Fusel, was Sie bei der Dosierung zusetzen? Kurzum, das ist Giftmischerei. Fürchten Sie die Gesetze!« Hierauf wurde mein armer Vater verlegen, denn er war ein weicher Mensch, der scharfen Reden nicht standhielt. »Sie haben leicht spotten, Schimmelpreester«, versetzte er wohl, indem er nach seiner Gewohnheit mit den Fingerspitzen zart seinen Bauch streichelte, »aber ich muß billig herstellen, weil das Vorurteil gegen die heimischen Fabrikate es so will – kurz, ich gebe dem Publikum, woran es glaubt. Außerdem sitzt die Konkurrenz mir im Nacken, lieber Freund, so daß es kaum noch zum Aushalten ist.« Soweit mein Vater.
Unsere Villa gehörte zu jenen anmutigen Herrensitzen, die, an sanfte Abhänge gelehnt, den Blick über die Rheinlandschaft beherrschen. Der abfallende Garten war freigebig mit Zwergen, Pilzen und allerlei täuschend nachgeahmtem Getier aus Steingut geschmückt; auf einem Postament ruhte eine spiegelnde Glaskugel, welche die Gesichter überaus komisch verzerrte, und auch eine Äolsharfe, mehrere Grotten sowie ein Springbrunnen waren da, der eine kunstreiche Figur von Wasserstrahlen in die Lüfte warf und in dessen Becken Silberfische schwammen. Um nun von der inneren Häuslichkeit zu reden, so war sie nach dem Geschmack meines Vaters sowohl lauschig wie heiter. Trauliche Erkerplätze luden zum Sitzen ein, und in einem davon stand ein wirkliches Spinnrad. Zahllose Kleinigkeiten: Nippes, Muscheln, Spiegelkästchen und Riechflakons waren auf Etageren und Plüschtischchen angeordnet; Daunenkissen in großer Anzahl, mit Seide oder vielfarbiger Handarbeit überzogen, waren überall auf Sofas und Ruhebetten verteilt, denn mein Vater liebte es, weich zu liegen; die Gardinenträger waren Hellebarden, und zwischen den Türen waren jene luftigen Vorhänge aus Rohr und bunten Perlenschnüren befestigt, die scheinbar eine feste Wand bilden und die man doch, ohne eine Hand zu heben, durchschreiten kann, wobei sie sich mit einem leisen Rauschen oder Klappern teilen und wieder zusammenschließen. Über dem Windfang war eine kleine, sinnreiche Vorrichtung angebracht, die, während die Tür, durch Luftdruck aufgehalten, langsam ins Schloß zurücksank, mit feinem Klingen den Anfang des Liedes »Freut euch des Lebens« spielte.
Zweites Kapitel
Dies war das Heim, worin ich an einem lauen Regentage des Wonnemondes – einem Sonntage übrigens – geboren wurde, und von nun an gedenke ich nicht mehr vorzugreifen, sondern die Zeitfolge sorgfältig zur Richtschnur zu nehmen. Meine Geburt ging, wenn ich recht unterrichtet bin, nur sehr langsam und nicht ohne künstliche Nachhilfe unseres damaligen Hausarztes, Doktor Mecum, vonstatten, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich mich – wenn ich jenes frühe und fremde Wesen als »ich« bezeichnen darf – außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei verhielt, die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die ich später so inständig lieben sollte. Dennoch war ich ein gesundes, wohlgestaltes Kind, das an dem Busen einer ausgezeichneten Amme aufs hoffnungsvollste gedieh. Ich kann aber nach wiederholtem eindringlichem Nachdenken nicht umhin, mein träges und widerwilliges Verhalten bei meiner Geburt, diese offenbare Unlust, das Dunkel des Mutterschoßes mit dem hellen Tage zu vertauschen, in Zusammenhang zu bringen mit der außerordentlichen Neigung und Begabung zum Schlafe, die mir von klein auf eigentümlich war. Man sagte mir, daß ich ein ruhiges Kind gewesen sei, kein Schreihals und Störenfried, sondern dem Schlummer und Halbschlummer in einem den Wärterinnen bequemen Grade zugetan; und obgleich mich später so sehr nach der Welt und den Menschen verlangte, daß ich mich unter verschiedenen Namen unter sie mischte und vieles tat, um sie für mich zu gewinnen, so blieb ich doch in der Nacht und im Schlaf stets innig zu Hause, entschlummerte auch ohne körperliche Ermüdung leicht und gern, verlor mich weit in ein traumloses Vergessen und erwachte nach langer, zehn-, zwölf-, ja vierzehnstündiger Versunkenheit erquickt und befriedigter als durch die Erfolge und Genugtuungen des Tages. Man könnte in dieser ungewöhnlichen Schlaflust einen Widerspruch zu dem großen Lebens- und Liebesdrange erblicken, der mich beseelte und von dem an gehörigem Orte noch zu sprechen sein wird. Allein ich ließ schon einfließen, daß ich diesem Punkte wiederholt ein angestrengtes Nachdenken gewidmet habe, und mehrmals habe ich deutlich zu verstehen geglaubt, daß es sich hier nicht um einen Gegensatz, sondern vielmehr um eine verborgene Zusammengehörigkeit und Übereinstimmung handelt. Jetzt nämlich, wo ich, obgleich erst vierzigjährig, gealtert und müde bin, wo kein begieriges Gefühl mich mehr zu den Menschen drängt und ich gänzlich auf mich selbst zurückgezogen dahinlebe: jetzt erst ist auch meine Schlafkraft erlahmt, jetzt erst bin ich dem Schlafe gewissermaßen entfremdet, ist mein Schlummer kurz, untief und flüchtig geworden, während ich vormals im Zuchthause, wo viel Gelegenheit dazu war, womöglich noch besser schlief als in den weichlichen Betten der Palasthotels. – Aber ich verfalle in meinen alten Fehler des Voraneilens.
Oft hörte ich aus dem Munde der Meinen, daß ich ein Sonntagskind sei, und obgleich ich fern von allem Aberglauben erzogen worden bin, habe ich doch dieser Tatsache, in Verbindung mit meinem Vornamen Felix (so wurde ich nach meinem Paten Schimmelpreester genannt) sowie mit meiner körperlichen Feinheit und Wohlgefälligkeit, immer eine geheimnisvolle Bedeutung beigemessen. Ja, der Glaube an mein Glück und daß ich ein Vorzugskind des Himmels sei, ist in meinem Innersten stets lebendig gewesen, und ich kann sagen, daß er im ganzen nicht Lügen gestraft worden ist. Stellt sich doch das eben als die bezeichnende Eigentümlichkeit meines Lebens dar, daß alles, was an Leiden und Qual darin vorgekommen, als etwas Fremdes und von der Vorsehung ursprünglich nicht Gewolltes erscheint, durch das meine wahre und eigentliche Bestimmung immerfort gleichsam sonnig hindurchschimmert. – Nach dieser Abschweifung ins Allgemeine fahre ich fort, das Gemälde meiner Jugend in großen Zügen zu entwerfen.
Ein phantastisches Kind, gab ich mit meinen Einfällen und Einbildungen den Hausgenossen viel Stoff zur Heiterkeit. Ich glaube mich wohl zu erinnern, und oft ist es mir erzählt worden, daß ich, als ich noch Kleidchen trug, gerne spielte, daß ich der Kaiser sei, und auf dieser Annahme wohl stundenlang mit großer Zähigkeit bestand. In einem kleinen Stuhlwagen sitzend, worin meine Magd mich über die Gartenwege oder auf dem Hausflur umherschob, zog ich aus irgendeinem Grunde meinen Mund so weit wie möglich nach unten, so daß meine Oberlippe sich übermäßig verlängerte, und blinzelte langsam mit den Augen, die sich nicht nur infolge der Verzerrung, sondern auch vermöge meiner inneren Rührung röteten und mit Tränen füllten. Still und ergriffen von meiner Betagtheit und hohen Würde, saß ich im Wägelchen; aber meine Magd war gehalten, jeden Begegnenden von dem Tatbestande zu unterrichten, da eine Nichtachtung meiner Schrulle mich aufs äußerste erbittert haben würde. »Ich fahre hier den Kaiser spazieren«, meldete sie, indem sie auf unbelehrte Weise die flache Hand salutierend an die Schläfe legte, und jeder erwies mir Reverenz. Zumal mein Pate Schimmelpreester, stets zu Possen geneigt, war mir zu Willen, wenn er mich so antraf, und bestärkte mich auf alle Weise in meinem Dünkel. »Seht, da fährt er, der Heldengreis!« sagte er, indem er sich unnatürlich tief verbeugte. Und dann stellte er sich als Volk an meinen Weg und warf vivatschreiend seinen Hut, seinen Stock und selbst seine Brille in die Luft, um sich beinahe zu Schaden zu lachen, wenn mir vor Erschütterung die Tränen über die langgezogene Oberlippe rollten.
Diese Art von Spiel pflegte ich noch in späteren Knabenjahren, zu einer Zeit also, da ich die Unterstützung der Erwachsenen dabei nicht wohl mehr fordern durfte. Doch vermißte ich sie nicht, sondern freute mich vielmehr der Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit meiner Einbildungskraft. Ich erwachte zum Beispiel eines Morgens mit dem Entschlusse, heute ein achtzehnjähriger Prinz namens Karl zu sein, und hielt an dieser Träumerei während des ganzen Tages, ja mehrere Tage lang fest; denn der unschätzbare Vorzug solchen Spieles bestand darin, daß es in keinem Augenblick und nicht einmal während der so überaus lästigen Schulstunden unterbrochen zu werden brauchte. Gekleidet in eine gewisse liebenswürdige Hoheit, ging ich umher, hielt heitere und angeregte Zwiesprache mit einem Gouverneur oder Adjutanten, den ich mir einbildungsweise beigab, und niemand beschreibt den Stolz und das Glück, mit dem das Geheimnis meiner feinen und erlauchten Existenz mich erfüllte. Welch eine herrliche Gabe ist nicht die Phantasie, und welchen Genuß vermag sie zu gewähren! Wie dumm und benachteiligt erschienen mir die anderen Knaben des Städtchens, denen dies Vermögen offenbar nicht zuteil geworden und die also unteilhaft der verschwiegenen Freuden waren, welche ich mühelos und ohne jede äußere Vorkehrung, durch einen einfachen Willensentschluß daraus zog! Jenen freilich, die gewöhnliche Burschen mit hartem Haar und roten Händen waren, hätte es sauer werden und lächerlich zu Gesichte stehen mögen, hätten sie sich einreden wollen, Prinzen zu sein. Ich aber besaß seidenweiches Haar, wie man es nur selten beim männlichen Geschlechte findet, und welches, da es blond war, zusammen mit graublauen Augen, einen fesselnden Gegensatz zu der goldigen Bräune meiner Haut bildete: so, daß es gewissermaßen unbestimmt blieb, ob ich nun eigentlich blond oder brünett von Erscheinung sei, und man mich mit gleichem Rechte für beides ansprechen konnte. Meine Hände, auf die ich frühe achthatte, waren, ohne überschmal zu sein, angenehm im Charakter, niemals schweißig, sondern mäßig warm, trocken, mit geschmackvoll geformten Fingernägeln versehen und sich selbst ein Wohlgefallen; und meine Stimme hatte, schon bevor ich sie wechselte, etwas Schmeichelhaftes für das Ohr, so daß ich sie, wenn ich allein war, gern in glücklichen, gebärdenreichen, übrigens sinnlos kauderwelschen und nur täuschend angedeuteten Plaudereien mit meinem unsichtbaren Gouverneur erklingen ließ. Solche persönlichen Vorzüge sind meistens unwägbare Dinge, die nur in ihren Wirkungen zu bestimmen und selbst bei hervorragendem Geschick nur schwer in Worte zu fassen sind. Jedenfalls konnte mir nicht verborgen bleiben, daß ich aus edlerem Stoffe gebildet oder, wie man zu sagen pflegt, aus feinerem Holz geschnitzt war als meinesgleichen, und ich fürchte dabei durchaus nicht den Vorwurf der Selbstgefälligkeit. Das ist mir ganz einerlei, ob dieser oder jener mich der Selbstgefälligkeit anklagt, denn ich müßte ein Dummkopf oder Heuchler sein, wollte ich mich für Dutzendware ausgeben, und der Wahrheit gemäß wiederhole ich, daß ich aus dem feinsten Holze geschnitzt bin.
Einsam aufwachsend (denn meine Schwester Olympia war mir um mehrere Lebensjahre voraus), neigte ich zu sonderbaren und spintisierenden Beschäftigungen, wofür ich sofort zwei Beispiele anführen werde. Erstens war ich auf eine grillenhafte Manier verfallen, die menschliche Willenskraft, diese geheimnisvolle und oft fast übernatürlicher Wirkungen fähige Macht, an mir zu üben und zu studieren. Man weiß, daß die Pupillen unseres Auges in ihren Bewegungen, welche in einer Verengerung und Erweiterung bestehen, abhängig sind von der Stärke des Lichtes, das sie trifft. Ich nun hatte es mir in den Kopf gesetzt, diese unwillkürliche Bewegung eigensinniger Muskeln unter den Einfluß meines Willens zu beugen. Vor meinem Spiegel stehend und indem ich jeden anderen Gedanken auszuschalten suchte, versammelte ich meine ganze innere Kraft auf den Befehl an meine Pupillen, sich nach meinem Belieben zusammenzuziehen oder zu erweitern, und meine hartnäckigen Übungen wurden, wie ich versichere, wirklich von Erfolg gekrönt. Anfangs gerieten unter den inneren Anstrengungen, die mir den Schweiß austrieben und mich die Farbe wechseln ließen, meine Pupillen nur in ein unregelmäßiges Flackern; später aber hatte ich es tatsächlich in meiner Gewalt, sie sich zu winzigen Pünktchen verengern oder zu großen, schwarz spiegelnden Kreisen sich ausdehnen zu lassen, und die Genugtuung, die dieser Erfolg mir gewährte, war fast schreckhafter Art und von einem Schauer vor den Geheimnissen der menschlichen Natur begleitet.
Eine andere Grübelei, die damals oft meinen Geist unterhielt und noch heute nicht an Reiz und Sinn für mich verloren hat, bestand in folgendem. Was ist förderlicher: – fragte ich mich –, daß man die Welt klein oder daß man sie groß sehe? Und dies war so gemeint: Große Männer, dachte ich, Feldherren, überlegene Staatsköpfe, Eroberer- und Herrschernaturen jeder Art, welche sich gewaltig über die Menschen erheben, müssen wohl so beschaffen sein, daß die Welt ihnen klein wie ein Schachbrett erscheint, da sie sonst die Rücksichtslosigkeit und Kälte nicht hätten, keck und unbekümmert um das Einzelwohl und -wehe nach ihren übersichtlichen Plänen damit zu schalten. Andererseits aber kann eine solche verringernde Ansicht unzweifelhaft leicht bewirken, daß man es im Leben zu gar nichts bringe; denn wer Welt und Menschen für wenig oder nichts achtet und sich früh mit ihrer Belanglosigkeit durchdringt, wird geneigt sein, in Gleichgültigkeit und Trägheit zu versinken und einen vollkommenen Ruhestand jeder Wirkung auf die Gemüter verachtungsvoll vorzuziehen – abgesehen davon, daß er durch seine Fühllosigkeit, seinen Mangel an Teilnahme und Bemühung überall anstoßen, die selbstbewußte Welt auf Schritt und Tritt beleidigen und sich so die Wege auch zu unwillkürlichen Erfolgen abschneiden wird. Ist es, fragte ich mich, also ratsamer, daß man in Welt und Menschenwesen etwas Großes, Herrliches und Wichtiges erblicke, das jedes Eifers, jeder dienenden Anstrengung wert ist, um ein wenig Ansehen und Wertschätzung darin zu erlangen? Dagegen spricht, daß man mit dieser vergrößernden und respektvollen Sehart leicht der Selbstunterschätzung und Verlegenheit anheimfällt, so daß dann die Welt über den ehrfürchtig blöden Knaben mit Lächeln hinweggeht, um sich männlichere Liebhaber zu suchen. Allein auf der anderen Seite bietet eine solche Gläubigkeit und Weltfrömmigkeit doch auch große Vorteile. Denn wer alle Dinge und Menschen für voll und wichtig nimmt, wird ihnen nicht nur dadurch schmeicheln und sich somit mancher Förderung versichern, sondern er wird auch sein ganzes Denken und Gebaren mit einem Ernst, einer Leidenschaft, einer Verantwortlichkeit erfüllen, die, indem sie ihn zugleich liebenswürdig und bedeutend macht, zu den höchsten Erfolgen und Wirkungen führen kann. – So sinnierte ich und erwog das Für und Wider. Übrigens habe ich es unwillkürlich und meiner Natur gemäß stets mit der zweiten Möglichkeit gehalten und die Welt für eine große und unendlich verlockende Erscheinung geachtet, welche die süßesten Seligkeiten zu vergeben hat und mich jeder Anstrengung und Werbung in hohem Grade wert und würdig deuchte.
Drittes Kapitel
Wenn aber so träumerische Experimente und Spekulationen geeignet waren, mich von meinen Alters- und Schulgenossen im Städtchen, die sich auf herkömmlichere Weise beschäftigten, innerlich abzusondern, so kam hinzu, daß diese Burschen, Weingutsbesitzers- und Beamtensöhne, von seiten ihrer Eltern, wie ich bald gewahr werden mußte, vor mir gewarnt und von mir ferngehalten wurden, ja, einer von ihnen, den ich versuchsweise einlud, sagte mir mit kahlen Worten ins Gesicht, daß man ihm den Verkehr mit mir und den Besuch unseres Hauses verboten habe, weil es nicht ehrbar bei uns zugehe. Das schmerzte mich und ließ mir einen Umgang begehrenswert erscheinen, an dem mir sonst nichts gelegen gewesen wäre. Allein nicht zu leugnen war, daß es mit der Meinung des Städtchens über unser Hauswesen gewissermaßen seine Richtigkeit hatte.
Ich ließ schon weiter oben eine Anspielung einfließen auf die Störungen, welche durch die Anwesenheit des Fräuleins aus Vevey in unser Familienleben getragen wurden. In der Tat stellte mein armer Vater diesem Mädchen in verliebtem Sinne nach und gelangte denn auch wohl zu dem gesteckten Ziel, worüber sich Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und meiner Mutter entspannen, die weiter dahin führten, daß mein Vater sich auf mehrere Wochen nach Mainz begab, um dort, wie er es manches Mal zu seiner Erfrischung tat, das Leben eines Junggesellen zu führen. Übrigens hatte meine Mutter, die eine unscheinbare Frau von wenig hervorragenden Geistesgaben war, vollkommen unrecht, meinen armen Vater so unnachsichtig zu behandeln, denn sie sowohl wie meine Schwester Olympia (ein dickes und außerordentlich fleischlich gesinntes Geschöpf, das später nicht ohne Beifall die Operettenbühne beschritt) gaben ihm an menschlicher Schwäche durchaus nichts nach; nur daß seiner Leichtlebigkeit stets eine gewisse Anmut innewohnte, deren ihre dumpfe Vergnügungssucht fast ganz entbehrte. Mutter und Tochter lebten in seltener Vertraulichkeit miteinander, und ich erinnere mich zum Beispiel beobachtet zu haben, wie die Ältere mit einem Meterbande den Oberschenkel der Jüngeren nach seinem Umfange maß, was mich auf mehrere Stunden zur Nachdenklichkeit stimmte. Ein anderes Mal, zu einer Zeit, als ich für solche Dinge wohl schon ein ahnungsvolles Verständnis, aber noch keine Worte besaß, war ich heimlich Zeuge davon, wie sie einem im Hause beschäftigten Anstreichergesellen, einem dunkeläugigen Burschen in weißem Kittel, mit gemeinsamen neckischen Annäherungen zusetzten und ihm endlich so den Kopf erhitzten, daß der junge Mensch in eine Art Wut geriet und, mit einem Schnurrbart aus grüner Ölfarbe, den sie ihm angemalt, die kreischenden Frauen bis auf den Trockenspeicher verfolgte.
Sehr oft, da meine Eltern sich bis zur Erbitterung miteinander langweilten, hatten wir Gäste aus Mainz und Wiesbaden, und dann ging es überaus reichlich und aufgeräumt bei uns zu. Es waren buntscheckige Gesellschaften, bestehend aus einigen jungen Fabrikanten, Bühnenkünstlern beiderlei Geschlechts, einem kränklichen Infanterieleutnant, der später so weit ging, um die Hand meiner Schwester anzuhalten, einem jüdischen Bankier nebst seiner Gattin, die auf eindrucksvolle Weise überall aus ihrem mit Jett übersäten Kleide quoll, einem Journalisten mit Stirnlocke und Samtweste, der jedesmal eine neue Lebensgefährtin einführte, und anderen mehr. Man fand sich meistens zum Diner um sieben Uhr ein, und dann pflegte die Lustbarkeit, die Klaviermusik, das Schlürfen des Tanzes, das Gelächter, Gekreisch und Gejachter die ganze Nacht hindurch kein Ende zu nehmen. Besonders zur Zeit des Karnevals und der Weinlese gingen die Wogen des Vergnügens sehr hoch. Dann brannte mein Vater im Garten eigenhändig prächtige Feuerwerke ab, worin er große Sachkenntnis und Geschicktheit besaß; die Steingutzwerge erschienen in magischem Licht, und die launigen Masken, in denen sich die Gesellschaft zusammengefunden, erhöhten die Ausgelassenheit. Ich war damals gezwungen, die Oberrealschule des Städtchens zu besuchen, und wenn ich am Morgen um sieben oder halb acht Uhr mit neuwaschenem Antlitz das Speisezimmer betrat, um mein Frühstück einzunehmen, so fand ich die Gesellschaft noch, fahl, zerknittert und mit Augen, die das Tageslicht schlecht ertrugen, bei Kaffee und Likören versammelt und wurde unter großem Hallo in ihre Mitte aufgenommen.
Halbwüchsig durfte ich bei Tische und bei den nachfolgenden Belustigungen gleich meiner Schwester Olympia zugegen sein. Es wurde alltäglich ein guter Tisch bei uns geführt, und mein Vater trank zu jedem Mittagessen Champagner mit Sodawasser vermischt. Aber bei den geselligen Gelegenheiten gab es lange Speisenfolgen, die von einem Küchenchef aus Wiesbaden mit Hilfe unserer Köchin aufs feinste hergestellt wurden und in die erfrischende und den Appetit erneuernde Gänge, Gefrorenes und Pikantes, eingelegt waren. »Lorley extra cuvée« floß in Strömen, aber auch zahlreiche gute Weine kamen auf den Tisch, wie zum Beispiel »Berncastler Doktor«, dessen Würze mir ausnehmend zusagte. In meinem späteren Leben lernte ich noch andere vornehme Marken kennen und mit gelassener Miene bestellen, wie etwa »Grand vin Château Margaux« und »Grand crû Château Mouton Rothschild« – zwei elegante Tropfen.
Gern rufe ich mir das Bild meines Vaters vor die Seele zurück, wie er mit seinem weißen Spitzbart und seinem mit weißseidener Weste umhüllten Bauch der Tafel vorsaß. Er hatte eine schwache Stimme und schlug oft mit verschämtem Ausdruck die Augen nieder, aber der Genuß war ihm doch von der blanken und geröteten Miene zu lesen. »C’est ça«, sagte er, »épatant«, »parfaitement«, und mit ausgesuchten Bewegungen seiner Hände, deren Fingerspitzen aufwärtsgebogen waren, bediente er sich der Gläser, des Mundtuches, des Speisegeräts. Meine Mutter und Schwester überließen sich einer geistlosen Völlerei und kicherten zwischendurch mit ihren Nachbarn hinter gespreiztem Fächer.
Nach Tische, wenn um die Gaslüster der Zigarrenrauch schwamm, begannen der Tanz und die Pfänderspiele. War der Abend vorgeschritten, so wurde ich wohl zu Bette geschickt, aber da Musik und Getümmel mich nicht schlafen ließen, so stand ich meist wieder auf, hüllte mich in meine rotwollene Bettdecke und kehrte, so kleidsam vermummt, zum Jubel der Frauen in die Gesellschaft zurück. Die Erfrischungen und Imbisse, die Bowlen, Limonaden, Heringssalate und Weingelees nahmen bis zum Morgenkaffee kein Ende. Der Tanz war ausgelassen und üppig, die Pfänderspiele bildeten einen Vorwand für Küsse und andere körperliche Annäherungen. Die Frauen, in ausgeschnittenen Kleidern, beugten sich lachend über die Stuhllehnen, um Einblick in ihren Busen zu gewähren und so die Herrenwelt für sich zu gewinnen, und den Höhepunkt des Ganzen bildete nicht selten die Schelmerei, daß plötzlich das Gas ausgedreht wurde, was jedesmal ein unbeschreibliches Drunter und Drüber zur Folge hatte.
Diese geselligen Unterhaltungen waren vorzüglich gemeint, wenn unser Hauswesen im Städtchen für verdächtig galt, und man faßte, wie mir zu Ohren kam, dabei hauptsächlich die ökonomische Seite der Sache ins Auge, indem man nämlich munkelte (und nur zu recht damit hatte), daß die Geschäfte meines armen Vaters verzweifelt schlecht stünden und daß die kostbaren Feuerwerke und Diners ihm als Wirtschafter notwendig den Rest geben müßten. Dieses öffentliche Mißtrauen, das meiner Feinfühligkeit früh bemerkbar wurde, vereinigte sich, wie erwähnt, mit gewissen Sonderbarkeiten meines Charakters, um eine Vereinsamung zu zeitigen, die mir oft Kummer bereitete. Desto herzlicher beglückte mich ein Erlebnis, dessen Schilderung ich hier mit besonderem Vergnügen einrücken werde.
Ich zählte acht Jahre, als ich und die Meinen einige Sommerwochen in dem benachbarten und so namhaften Langenschwalbach verbrachten. Mein Vater nahm dort Moorbäder gegen die Gichtanfälle, die ihn zuweilen plagten, und meine Mutter und Schwester machten auf der Promenade durch Übertreibungen in der Form ihrer Hüte von sich reden. Mit dem gesellschaftlichen Verkehr, der sich uns dort, wie an anderen Plätzen, bot, war wenig Ehre einzulegen. Die in der Umgegend Ansässigen mieden uns wie gewöhnlich; die vornehmen Fremden kargten mit sich und verhielten sich abweisend, wie das im Wesen der Vornehmheit begründet ist, und was sich uns zu Anschluß und Gemeinsamkeit darbot, war nicht vom Feinsten. Dennoch war mir wohl zu Langenschwalbach, denn ich habe stets den Aufenthalt an Badeorten geliebt und später den Schauplatz meiner Wirkungen wiederholt an solche Plätze verlegt. Die Ruhe, die sorglos geregelte Lebensführung, der Anblick wohlgeborener und gepflegter Menschen auf den Sportplätzen und in den Kurgärten entspricht meinen tiefsten Wünschen. Was aber die stärkste Anziehungskraft auf mich ausübte, waren die Konzerte, die täglich von einem wohlgeschulten Orchester dem Badepublikum dargeboten wurden. Die Musik entzückt mich, ja obwohl ich nicht Gelegenheit genommen habe, ihre Ausübung zu erlernen, besitzt diese träumerische Kunst einen fanatischen Liebhaber in mir, und schon das Kind konnte sich nicht von dem hübschen Pavillon trennen, worin die kleidsam uniformierte Truppe unter der Leitung eines kleinen Kapellmeisters von zigeunerhaftem Ansehen ihre Potpourris und Opernstücke erklingen ließ. Stundenlang kauerte ich auf den Stufen des zierlichen Kunsttempels, ließ mein Herz von dem anmutig ordnungsvollen Reigen der Töne bezaubern und verfolgte zugleich mit eifrig teilnehmenden Augen die Bewegungen, mit denen die ausübenden Musiker ihre verschiedenen Instrumente handhabten. Namentlich das Geigenspiel hatte es mir angetan, und zu Hause, im Hotel, ergötzte ich mich und die Meinen damit, daß ich mit Hilfe zweier Stöcke, eines kurzen und eines längeren, das Gebaren des ersten Violinisten aufs getreueste nachzuahmen suchte. Die schwingende Bewegung der linken Hand zur Erzeugung eines seelenvollen Tones, das weiche Hinauf- und Hinabgleiten aus einer Grifflage in die andere, die Fingergeläufigkeit bei virtuosenhaften Passagen und Kadenzen, das schlanke und geschmeidige Durchbiegen des rechten Handgelenkes bei der Bogenführung, die versunkene und lauschend-gestaltende Miene bei hingeschmiegter Wange – dies alles wiederzugeben gelang mir mit einer Vollkommenheit, die besonders meinem Vater den heitersten Beifall abnötigte. Dieser nun, gut gelaunt unter dem wohltuenden Einfluß der Bäder, nimmt das langhaarige und fast stimmlose Kapellmeisterchen beiseite und verabredet mit ihm die folgende Komödie. Eine kleine Violine wird billig erstanden und der zugehörige Bogen sorgfältig mit Vaselin bestrichen. Während sonst für mein Äußeres nicht viel geschah, werden jetzt in einem Basar ein hübsches Matrosenhabit mit Fangschnur und goldenen Knöpfen, dazu seidene Strümpfe und spiegelnde Lackschuhe fertig angeschafft. Und eines Sonntagnachmittags, während der Kurpromenade, stehe ich, so ansprechend ausstaffiert, zur Seite des kleinen Kapellmeisters an der Rampe des Musiktempels und beteilige mich an der Ausführung einer ungarischen Tanzpièce, indem ich mit meiner Fiedel und mit meinem Vaselinbogen tue, was ich vordem mit meinen beiden Stöcken getan. Ich darf sagen, daß mein Erfolg vollkommen war.
Das Publikum, vornehmes und schlichteres, staute sich vor dem Pavillon, es strömte von allen Seiten herbei. Man sah ein Wunderkind. Meine Hingebung, die Blässe meiner arbeitenden Miene, eine Welle Haares, die mir über das eine Auge fiel, meine kindlichen Hände, deren Gelenke von den blauen, an den Oberarmen bauschigen und nach unten eng zulaufenden Ärmeln kleidsam umspannt waren – kurz, meine ganze rührende und wunderbare Erscheinung entzückte die Herzen. Als ich mit einem vollen und energischen Bogenstrich über alle Saiten geendigt hatte, erfüllte das Geprassel des Beifalls, untermischt mit hohen und tiefen Bravorufen, die Kuranlagen. Man hebt mich, nachdem der kleine Kapellmeister meine Geige nebst Bogen in Sicherheit gebracht, zur ebenen Erde nieder. Man überhäuft mich mit Lobsprüchen, mit Schmeichelnamen, mit Liebkosungen. Aristokratische Damen und Herren umdrängen mich, streicheln mir Haare, Wangen und Hände, nennen mich Teufelsbub und Engelskind. Eine alte russische Fürstin, ganz in veilchenfarbener Seide und mit gewaltigen weißen Ohrlocken, nimmt meinen Kopf zwischen ihre beringten Hände und küßt mich auf die feuchte Stirn. Hierauf nestelt sie leidenschaftlich eine große, funkelnde Diamantbrosche in Leiergestalt von ihrem Halse los und befestigt sie, unaufhörlich französisch redend, an meiner Bluse. Die Meinen traten herzu; mein Vater stellte sich vor und entschuldigte die Schwächen meines Spieles mit meinem zarten Alter. Man zog mich zur Konditorei. An drei verschiedenen Tischen bewirtete man mich mit Schokolade und Crêmeschnitten. Edelbürtige, schöne und reiche Kinder, die kleinen Grafen Siebenklingen, nach denen ich oft mit Sehnsucht ausgeschaut, die mich aber bisher nur kalter Blicke gewürdigt hatten, baten mich artig, eine Partie Krocket mit ihnen zu spielen, und während unsere Eltern miteinander Kaffee tranken, folgte ich, meine Brillantnadel auf der Brust, heiß und trunken vor Freude ihrer Einladung. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, vielleicht der unbedingt schönste. Viele Stimmen wurden laut, daß ich mein Spiel wiederholen möchte, und auch die Kurdirektion kam in diesem Sinne bei meinem Vater ein. Allein mein Vater erklärte, daß er nur ausnahmsweise seine Erlaubnis gegeben habe und daß ein wiederholtes öffentliches Auftreten sich nicht mit meiner gesellschaftlichen Stellung vertrage. Auch näherte unser Aufenthalt in Bad Langenschwalbach sich seinem Ende …
Viertes Kapitel
Jetzt werde ich von meinem Paten Schimmelpreester sprechen, einem nicht alltäglichen Manne. Um seine Person zu beschreiben, so war er untersetzt von Gestalt und trug sein früh ergrautes und gelichtetes Haar dicht über dem einen Ohr gescheitelt, so daß es fast gänzlich nach einer Seite über den Schädel gestrichen war. Sein rasiertes Gesicht mit der hakenförmigen Nase, den gekniffenen Lippen und den übergroßen, kreisrunden und in Zelluloid gefaßten Brillengläsern zeichnete sich noch besonders dadurch aus, daß es über den Augen nackt, das heißt ohne Brauen war, und zeugte im ganzen von einer scharfen und bitteren Sinnesart, wie denn zum Beispiel mein Pate seinem Namen eine sonderbar hypochondrische Deutung zu geben pflegte. »Die Natur«, sagte er, »ist nichts als Fäulnis und Schimmel, und ich bin zu ihrem Priester bestellt, darum heiße ich Schimmelpreester. Warum ich aber Felix heiße, das weiß Gott allein.« Er stammte aus Köln, wo er ehemals in den ersten Häusern verkehrt und als Festordner im Karneval eine hervorragende Rolle gespielt hatte. Aber durch irgendwelche Umstände oder Vorkommnisse, die niemals aufgeklärt wurden, war er genötigt worden, das Feld zu räumen, und hatte sich in unser Städtchen zurückgezogen, wo er sehr bald, schon mehrere Jahre vor meiner Geburt, der Hausfreund der Meinen geworden war. Ein regelmäßiger und unentbehrlicher Teilnehmer an unseren Abendgesellschaften, genoß er große Achtung bei allen unseren Gästen. Die Damen kreischten und suchten sich mit vorgehaltenen Armen zu schützen, wenn er sie, verkniffenen Mundes, aufmerksam und doch gleichgültig, wie man Dinge prüft, durch seine Eulenbrille fixierte. »Hu, der Maler!« riefen sie, »wie er schaut! Jetzt sieht er alles und bis ins Herz hinein. Gnade, Professor, und nehmen Sie doch Ihre Augen fort!« Aber wie sehr man ihn bewunderte, so dachte er doch selber von seinem Berufe nicht eigentlich hoch und tat häufig recht zweifelhafte Äußerungen über die Natur des Künstlers. »Phidias«, sagte er, »auch Pheidias genannt, war ein Mann von mehr als durchschnittsmäßigem Talent, wofür schon die Tatsache spricht, daß er des Diebstahls überführt und in das Athener Gefängnis gesteckt wurde; denn er hatte sich des Unterschleifs an dem Gold- und Elfenbeinmaterial schuldig gemacht, das man ihm für seine Athena-Statue anvertraut hatte. Perikles, der ihn entdeckt hatte, ließ ihn aus dem Prison entwischen (womit dieser Kenner bewies, daß er sich nicht nur auf die Kunst, sondern, was viel wichtiger ist, auch auf das Künstlertum verstand), und Phidias oder Pheidias ging nach Olympia, wo ihm der große Zeus aus Gold und Elfenbein in Auftrag gegeben wurde. Was tat er? Er stahl wieder. Und im Gefängnis zu Olympia verstarb er. Eine auffallende Mischung. Aber so sind die Leute. Sie wollen wohl das Talent, welches doch an und für sich eine Sonderbarkeit ist. Aber die Sonderbarkeiten, die sonst noch damit verbunden – und vielleicht notwendig damit verbunden – sind, die wollen sie durchaus nicht und verweigern ihnen jedes Verständnis.« Soweit mein Pate. Ich habe mir diese Äußerung wörtlich gemerkt, weil er sie oft mit denselben Redewendungen wiederholte.
Wie berichtet, so lebten wir in herzlicher Wechselneigung, ja ich darf sagen, daß ich seine besondere Gunst genoß, und heranwachsend diente ich ihm häufig als Vorbild für seine Kunstgemälde, was mich um so mehr ergötzte, als er mich dazu in die verschiedensten Trachten und Verkleidungen steckte, von denen er eine reichhaltige Sammlung besaß. Seine Werkstatt, eine Art Trödelspeicher mit großem Fenster, war unter dem Dache des abgesonderten Häuschens unten am Rheine gelegen, das er mit einer alten Aufwärterin mietweise bewohnte, und dort »saß« ich ihm, wie er es nannte, stundenlang auf einem roh gezimmerten Podium, während er an seiner Leinwand pinselte, schabte und schuf. Ich erwähne, daß ich ihm auch mehrmals nackend Modell stand für ein großes Tableau aus der griechischen Sagenkunde, welches den Speisesaal eines Mainzer Weinhändlers zu verschönern bestimmt war. Hierbei erntete ich viel Lob von seiten des Künstlers, denn ich war überaus angenehm und göttergleich gewachsen, schlank, weich und doch kräftig von Gliedern, goldig von Haut und ohne Tadel in Hinsicht auf schönes Ebenmaß. – Diese Sitzungen bilden immerhin eine eigenartige Erinnerung. Aber noch unterhaltender, meine ich, war es doch, wenn ich mich verkleiden durfte, was nicht nur in meines Paten Werkstatt geschah. Oft nämlich, wenn er gedachte, das Abendbrot bei uns einzunehmen, schickte er einen Ballen voll bunter Garderobe, Perücken und Waffen vor sich her, um sie mir nach Tische nur zum Vergnügen anzuprobieren und meine Erscheinung auch wohl, wie sie ihm am besten gefiel, auf einen Pappendeckel zu werfen. »Er hat einen Kostümkopf«, pflegte er zu sagen und meinte damit, daß alles mir zu Gesichte stünde, jede Verkleidung sich gut und natürlich an mir ausnähme. Denn, wie ich auch hergerichtet war – als römischer Flötenbläser in kurzem Gewande, das schwarze Kraushaar mit Rosen bekränzt; als englischer Edelknabe in knappem Atlas, mit Spitzenkragen und Federhut; als spanischer Stierfechter mit Glitzerjäckchen und Kalabreser; als jugendlicher Abbé der Puderzeit mit Käppchen, Beffchen, Mäntelchen und Schnallenschuhen; als österreichischer Offizier in weißem Waffenrock nebst Schärpe und Degen oder als deutscher Gebirgsbauer in Wadenstrümpfen und Nagelschuhen, den Gamsbart am grünen Hut: jedesmal schien es, und auch der Spiegel versicherte mich dessen, als ob ich gerade für diesen Aufzug recht eigentlich bestimmt und geboren sei; jedesmal gab ich, nach dem Urteile aller, ein vortreffliches Beispiel der Menschenart ab, die ich eben vertrat; ja, mein Pate wies darauf hin, daß mein Gesicht mit Hilfe von Tracht und Perücke sich nicht nur den Ständen und Himmelsstrichen, sondern auch den Zeitaltern anzupassen scheine, von denen ein jedes, wie er uns belehrte, seinen Kindern ein allgemeines physiognomisches Gepräge verleihe, – während ich doch, wenn man unserem Freunde glauben durfte, als florentinischer Stutzer vom Ausgang der Mittelzeit so sehr einem zeitgenössischen Gemälde entsprungen schien wie im Schmuck jener pomphaften Lockenwolke, mit welcher ein späteres Jahrhundert die vornehme Herrenwelt beschenkte. – Ach, das waren herrliche Stunden! Wenn ich aber nach beendeter Kurzweil meine schale und nichtige Alltagskleidung wieder angelegt hatte, so befiel mich wohl eine unbezwingliche Trauer und Sehnsucht, ein Gefühl unendlicher und unbeschreiblicher Langerweile, das mich den Rest des Abends mit ödem Gemüt in tiefer und wortloser Niedergeschlagenheit hinbringen ließ.
Nur soviel für jetzt über Schimmelpreester. Später, am Ende meiner aufreibenden Laufbahn, sollte dieser ausgezeichnete Mann auf entscheidende und rettende Weise in mein Schicksal eingreifen …
Fünftes Kapitel
Forsche ich nun in meiner Seele nach weiteren Jugendeindrücken, so habe ich des Tages zu gedenken, da ich die Meinen zum erstenmal nach Wiesbaden ins Theater begleiten durfte. Übrigens muß ich hier einschalten, daß ich mich bei der Schilderung meiner Jugend nicht ängstlich an die Jahresfolge halte, sondern diese Lebensperiode als ein Ganzes behandle, worin ich mich nach Belieben bewege. Als ich meinem Paten Schimmelpreester als Griechengott Modell stand, war ich sechzehn bis achtzehn Jahre alt und also beinahe ein Jüngling, obschon in der Schule sehr rückständig. Aber mein erster Theaterbesuch fällt in ein früheres Jahr, nämlich in mein vierzehntes – immerhin also in eine Zeit, als meine körperliche und geistige Reife (wie gleich noch weiter auszuführen sein wird) schon weit vorgeschritten und meine Empfänglichkeit für Eindrücke sogar besonders lebhaft zu nennen war. In der Tat haben sich die Beobachtungen dieses Abends meinem Gemüt tief eingeprägt und mir zu unendlichem Nachsinnen Stoff gegeben.
Wir hatten vorher ein Wiener Café besucht und dort süßen Punsch getrunken, während mein Vater Absinth durch einen Strohhalm zu sich genommen hatte, was alles bereits geeignet gewesen war, mich im tiefsten zu bewegen. Aber wer beschreibt das Fieber, das sich meiner Natur bemächtigte, als eine Droschke uns an das Ziel meiner Neugier getragen und der erleuchtete Logensaal uns aufgenommen hatte! Die Frauen, die sich in den Balkons den Busen fächelten; die Herren, die sich plaudernd über sie neigten; die summende Versammlung im Parkett, zu der wir gehörten; die Düfte, die aus Haaren und Kleidern quollen und sich mit dem Geruch des Leuchtgases vermischten; das sanft verworrene Getöse des stimmenden Orchesters; die üppigen Malereien an der Saaldecke und auf dem Vorhang, die eine Menge entblößter Genien, ja ganze Kaskaden von rosigen Verkürzungen zeigten: wie sehr war das alles danach angetan, die jungen Sinne zu öffnen und den Geist für außerordentliche Empfängnisse vorzubereiten! Eine solche Vereinigung von Menschen in hohem, prunkvollem Kronensaal hatte ich bis dahin nur in der Kirche gesehen, und in der Tat erschien mir das Theater, dieser feierlich gegliederte Raum, wo an erhöhtem und verklärtem Orte berufene Personen, bunt gekleidet und von Musik umwoben, ihre vorgeschriebenen Schritte und Tänze, Gespräche, Gesänge und Handlungen vollführten: in der Tat, sage ich, erschien mir das Theater als eine Kirche des Vergnügens, als eine Stätte, wo erbauungsbedürftige Menschen, im Schatten versammelt gegenüber einer Sphäre der Klarheit und der Vollendung, mit offenem Munde zu den Idealen ihres Herzens emporblickten.
Man spielte ein Stück von bescheidenem Genre, ein Werk der leichtgeschürzten Muse, wie man wohl sagt, eine Operette, deren Namen ich zu meinem Leidwesen vergessen habe. Die Handlung begab sich zu Paris (was die Stimmung meines armen Vaters sehr erhöhte), und in ihrem Mittelpunkt stand ein junger Müßiggänger oder Gesandtschaftsattaché, ein bezaubernder Schwerenöter und Schürzenjäger, der von dem Stern des Theaters, einem überaus beliebten Sänger namens Müller-Rosé, zur Darstellung gebracht wurde. Ich erfuhr seinen persönlichen Namen durch meinen Vater, der sich seiner Bekanntschaft erfreute, und sein Bild wird ewig in meinem Gedächtnis fortleben. Es ist anzunehmen, daß er jetzt alt und abgenutzt ist, gleich mir selbst; allein wie er damals die Menge und mich zu blenden, zu entzücken verstand, das gehört zu den entscheidenden Eindrücken meines Lebens. Ich sage: zu blenden, und ich werde etwas weiter unten erklären, wieviel Sinn dieses Wort hier umschließt. Vorderhand werde ich die Bühnenerscheinung Müller-Rosés aus lebhafter Erinnerung nachzumalen versuchen.
Bei seinem ersten Auftreten war er schwarz gekleidet, und dennoch ging eitel Glanz von ihm aus. Dem Spiele nach kam er von einem Treffpunkt der Lebewelt und war ein wenig betrunken, was er in angenehmen Grenzen, auf eine verschönte und veredelte Weise vorzutäuschen verstand. Er trug einen schwarzen, mit Atlas ausgeschlagenen Pelerinenmantel, Lackschuhe zu schwarzen Frackhosen, weiße Glacés und auf dem schimmernd frisierten Kopf, dessen Scheitel nach damaliger militärischer Mode bis zum Nacken durchgezogen war, einen Zylinderhut. Das alles war vollkommen, vom Bügeleisen im Sitz befestigt, von einer Unberührtheit, wie sie im wirklichen Leben nicht eine Viertelstunde lang zu bewahren wäre, und sozusagen nicht von dieser Welt. Besonders der Zylinder, der ihm auf leichtlebige Art schief in der Stirn saß, war in der Tat das Traum- und Musterbild seiner Art, ohne Stäubchen noch Rauheit, mit idealischen Glanzlichtern versehen, durchaus wie gemalt, – und dem entsprach das Gesicht dieses höheren Wesens, ein Gesicht, das wie aus dem feinsten Wachs gebildet erschien. Es war zart rosenfarben und zeigte mandelförmige, schwarz umrissene Augen, ein kurzes, gerades Näschen sowie einen überaus klar gezeichneten und korallenroten Mund, über dessen bogenförmig geschwungener Oberlippe sich ein abgezirkeltes, ebenmäßiges und wie mit dem Pinsel gezogenes Schnurrbärtchen wölbte. Elastisch taumelnd, wie man es in der gemeinen Wirklichkeit an Betrunkenen nicht beobachten wird, überließ er Hut und Stock einem Bedienten, entglitt seinem Mantel und stand da im Frack, mit reich gefältelter Hemdbrust, in welcher Diamantknöpfe blitzten. Mit silberner Stimme sprechend und lachend, entledigte er sich auch seiner Handschuhe, und man sah, daß seine Hände außen mehlweiß und ebenfalls mit Brillanten geziert, ihre Innenflächen aber so rosig wie sein Antlitz waren. An der einen Seite der Rampe trällerte er den ersten Vers eines Liedes, das die außerordentliche Leichtigkeit und Heiterkeit seines Lebens als Attaché und Schürzenjäger schilderte, tanzte alsdann, die Arme selig ausgebreitet und mit den Fingern schnalzend, zur anderen Seite und sang dort den zweiten Vers, worauf er abtrat, um sich vom Beifall zurückrufen zu lassen und vor dem Souffleurkasten den dritten Vers zu singen. Dann griff er mit sorgloser Anmut in die Geschehnisse ein. Dem Stücke zufolge war er sehr reich, was seiner Gestalt eine bezaubernde Folie verlieh. Man sah ihn bei fortschreitender Handlung in verschiedenen Toiletten: in schneeweißem Sportanzug mit rotem Gürtel, in reicher Phantasie-Uniform, ja gelegentlich einer ebenso heiklen wie zwerchfellerschütternden Verwicklung sogar in Unterhosen aus himmelblauer Seide. Man sah ihn in kühnen, übermütigen, bestrickend abenteuerlichen Lebenslagen: zu den Füßen einer Herzogin, beim Champagner-Souper mit zwei anspruchsvollen Freudenmädchen, mit erhobener Pistole, bereit zum Duell mit einem von Grund aus albernen Nebenbuhler. Und keine dieser eleganten Strapazen konnte seiner Makellosigkeit etwas anhaben, seine Bügelfalten zerrütten, seine Glanzlichter auslöschen, seine rosige Miene unangenehm erhitzen. Zugleich gefesselt und gehoben durch die musikalischen Vorschriften, die theatralischen Förmlichkeiten, aber frei, keck und leicht innerhalb der Gebundenheit, war sein Benehmen von einer Anmut, der nichts Fahrlässig-Alltägliches anhaftete. Sein Körper schien bis in das letzte Fingerglied von einem Zauber durchdrungen, für den nur die unbestimmte Bezeichnung »Talent« vorhanden ist und der ihm offensichtlich ebensoviel Genuß bereitete wie uns allen. Zu sehen, wie er die silberne Krücke seines Stockes mit der Hand umfaßte oder beide Hände in die Hosentaschen gleiten ließ, gewährte inniges Vergnügen; seine Art, sich aus einem Sessel zu erheben, sich zu verbeugen, auf- und abzutreten, war von einer Selbstgefälligkeit, die das Herz mit Lebensfreude erfüllte. Ja, dies war es: Müller-Rosé verbreitete Lebensfreude, – wenn anders dies Wort das köstlich schmerzhafte Gefühl von Neid, Sehnsucht, Hoffnung und Liebesdrang bezeichnet, wozu der Anblick des Schönen und Glücklich-Vollkommenen die Menschenseele entzündet.
Das Parkettpublikum, das uns umgab, setzte sich aus Bürgern und Bürgersfrauen, Kommis, einjährig dienenden jungen Leuten und kleinen Blusenmädchen zusammen, und so unaussprechlich ich ergötzt war, besaß ich doch Gegenwärtigkeit und Neugier genug, umherzuschauen, mich nach den Wirkungen umzutun, welche die Darbietungen der Bühne auf die Genossen meines Vergnügens ausübten, und die Mienen der Umsitzenden mit Hilfe meiner eigenen Empfindungen zu deuten. Der Ausdruck dieser Mienen war töricht und wonnig. Ein gemeinsames Lächeln blöder Selbstvergessenheit umspielte alle Lippen, und wenn es bei den kleinen Blusenmädchen süßer und erregter war, bei den Frauen die Eigenart einer mehr schläfrigen und trägen Hingabe aufwies, so sprach es dafür bei den Männern von jenem gerührten und andächtigen Wohlwollen, mit welchem schlichte Väter auf glänzende Söhne blicken, deren Existenz sich weit über ihre eigene erhoben hat, und in denen sie die Träume ihrer eigenen Jugend verwirklicht sehen. Was die Kommis und Einjährigen betraf, so stand alles in ihren aufwärts gewandten Gesichtern weit offen, die Augen, die Nasenlöcher und die Münder. Und dabei lächelten sie. Wenn wir in unseren Unterhosen dort oben stünden, mochten sie denken – wie würden wir bestehen? Und wie keck und ebenbürtig er mit zwei so anspruchsvollen Freudenmädchen verkehrt! – Wenn Müller-Rosé vom Schauplatze abtrat, so fielen die Schultern hinab und eine Kraft schien von der Menge zu weichen. Wenn er, erhobenen Armes einen hohen Ton aushaltend, in sieghaftem Sturmschritt vom Hintergrunde zur Rampe vordrang, so schwollen die Busen ihm entgegen, daß die Atlastaillen der Frauen in den Nähten krachten. Ja, diese ganze beschattete Versammlung glich einem ungeheuren Schwarme von nächtlichen Insekten, der sich stumm, blind und selig in eine strahlende Flamme stürzt.
Mein Vater unterhielt sich königlich. Er hatte nach französischer Sitte Hut und Stock mit in den Saal genommen. Jenen setzte er auf, sobald der Vorhang gefallen war, und mit diesem beteiligte er sich an dem frenetischen Applaus, indem er laut und andauernd damit auf den Boden stieß. »C’est épatant!« sagte er mehrmals ganz schwach und hingenommen. Allein nach Schluß der Vorstellung, draußen auf dem Gange, als alles vorüber war und um uns her die berauschten und innerlich gesteigerten Kommis in der Art, wie sie gingen, sprachen, ihre roten Hände betrachteten und ihre Stöcke handhabten, dem Helden des Abends nachzuahmen suchten, sagte mein Vater zu mir: »Komm mit, wir wollen ihm doch die Hand schütteln. Gott, als ob wir nicht genaue Bekannte wären, Müller und ich! Er wird enchantiert sein, mich wiederzusehen.« Und nachdem er unseren Damen befohlen hatte, in der Vorhalle auf uns zu warten, brachen wir wirklich auf, um Müller-Rosé zu begrüßen.
Unser Weg führte uns durch die zunächst der Bühne gelegene und schon finstere Loge des Theaterdirektors, von wo wir durch eine schmale Eisentür hinter die Kulissen gelangten. Das Halbdunkel des Schauplatzes war spukhaft belebt von räumenden Arbeitern. Eine kleine Person in roter Livree, die im Stücke einen Liftjungen dargestellt hatte und in irgendwelche Gedanken versunken mit der Schulter an der Wand lehnte, kniff mein armer Vater scherzend dort, wo sie am breitesten war, und fragte sie nach der gesuchten Garderobe, worauf sie uns übellaunig die Richtung wies. Wir durchmaßen einen getünchten Gang, in dessen eingeschlossener Luft offene Gasflammen brannten. Schimpfen, Lachen und Schwatzen drang durch mehrere Türen, die auf den Korridor mündeten, und mein Vater machte mich heiter lächelnd mit dem Daumen auf diese Lebensäußerungen aufmerksam. Aber wir schritten weiter bis zur letzten, an der unteren Schmalseite des Ganges gelegenen Tür, und dort klopfte mein Vater, indem er sein Ohr zu dem pochenden Knöchel hinabbeugte. Man antwortete drinnen: »Wer da?« oder: »Was, zum Deibel!« Ich erinnere mich nicht genau des hellen, aber unwirschen Anrufs. »Darf man eintreten?« fragte mein Vater; worauf es antwortete, daß man vielmehr etwas anderes, in diesen Blättern nicht Wiederzugebendes tun dürfe. Mein Vater lächelte still und verschämt und versetzte: »Müller, ich bin es – Krull, Engelbert Krull. Man wird Ihnen doch wohl noch die Hand schütteln dürfen!« Da lachte es drinnen und sprach: »Ach, du bist es, altes Sumpfhuhn! Na, immer ’rein ins Vergnügen! – Sie werden ja wohl«, hieß es weiter, als wir zwischen Tür und Angel standen, »nicht Schaden nehmen durch meine Blöße.« Wir traten ein, und ein Anblick von unvergeßlicher Widerlichkeit bot sich dem Knaben dar.
An einem schmutzigen Tisch und vor einem staubigen und beklecksten Spiegel saß Müller-Rosé, nichts weiter am Leibe als eine Unterhose aus grauem Trikot. Ein Mann in Hemdärmeln bearbeitete des Sängers Rücken, der in Schweiß gebadet schien, mit einem Handtuch, indes er selber Gesicht und Hals, die dick mit glänzender Salbe beschmiert waren, vermittels eines weiteren, von farbigem Fett schon starrenden Tuches abzureiben beschäftigt war. Die eine Hälfte seines Gesichtes war noch bedeckt mit jener rosigen Schicht, die sein Antlitz vorhin so wächsern idealisch hatte erscheinen lassen, jetzt aber lächerlich rotgelb gegen die käsige Fahlheit der anderen, schon entfärbten Gesichtshälfte abstach. Da er die schön kastanienbraune Perücke mit durchgezogenem Scheitel, die er als Attaché getragen, abgelegt hatte, erkannte ich, daß er rothaarig war. Noch war sein eines Auge schwarz ummalt, und metallisch schwarz glänzender Staub haftete in den Wimpern, indes das andere nackt, wässerig, frech und vom Reiben entzündet den Besuchern entgegenblinzelte. Das alles jedoch hätte hingehen mögen, wenn nicht Brust, Schultern, Rücken und Oberarme Müller-Rosés mit Pickeln besät gewesen wären. Es waren abscheuliche Pickel, rot umrändert, mit Eiterköpfen versehen, auch blutend zum Teil, und noch heute kann ich mich bei dem Gedanken daran eines Schauders nicht erwehren. Unsere Fähigkeit zum Ekel ist, wie ich anmerken möchte, desto größer, je lebhafter unsere Begierde ist, das heißt: je inbrünstiger wir eigentlich der Welt und ihren Darbietungen anhangen. Eine kühle und lieblose Natur wird niemals vom Ekel geschüttelt werden können, wie ich es damals wurde. Denn zum Überfluß herrschte in dem von einem eisernen Ofen überheizten Raum eine Luft – eine aus Schweißgeruch und den Ausdünstungen der Näpfe, Tiegel und farbigen Fettstangen, die den Tisch bedeckten, zusammengesetzte Atmosphäre, daß ich anfangs nicht glaubte, ohne unpäßlich zu werden, länger als eine Minute darin atmen zu können.
Dennoch stand ich und schaute – und habe weiter nichts Tatsächliches über unseren Besuch in Müller-Rosés Garderobe beizubringen. Ja, ich müßte mir vorwerfen, um nichts und wieder nichts so eingehend von meinem ersten Theaterbesuch gehandelt zu haben, wenn ich meine Erinnerungen nicht in erster Linie zu meiner eigenen Unterhaltung und erst in zweiter zu der des Publikums niederschriebe. Auf Spannung und Proportion richte ich gar kein Augenmerk und überlasse diese Rücksichten solchen Verfassern, die aus der Phantasie schöpfen und aus erfundenem Stoff schöne und regelmäßige Kunstwerke herzustellen bemüht sind, während ich lediglich mein eigenes, eigentümliches Leben vortrage und mit dieser Materie nach Gutdünken schalte. Bei Erfahrungen und Begegnissen, denen ich eine besondere Belehrung und Aufklärung über mich und die Welt verdanke, verweile ich lange und führe jede Einzelheit mit spitzem Pinsel aus, während ich über anderes, was mir weniger teuer ist, leicht hinweggleite.
Was damals zwischen Müller-Rosé und meinem armen Vater geplaudert wurde, ist meinem Gedächtnis fast ganz entschwunden, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil ich nicht Zeit fand, darauf achtzuhaben. Denn die Bewegung, die unserem Geist durch die Sinne mitgeteilt wird, ist unzweifelhaft viel stärker als die, welche das Wort darin erzeugt. Ich erinnere mich, daß der Sänger, obgleich doch der begeisterte Beifall des Publikums ihn seines Triumphes hätte müssen versichert haben, unaufhörlich fragte, ob er gefallen, in welchem Grade er gefallen habe – und wie sehr verstand ich seine Unruhe! Ferner schweben mir einige Witze in vulgärem Geschmacke vor, die er ins Gespräch flocht, wie er denn zum Beispiel auf irgendeine Neckerei meines Vaters antwortete: »Halten Sie die Schnauze!« um sofort hinzuzufügen: »oder die Pfoten für das Schmackhaftere?« Aber diesen und anderen Äußerungen seines Geistes lieh ich, wie gesagt, nur ein halbes Ohr, tief angestrengt beschäftigt, wie ich war, das Erlebnis meiner Sinne innerlich aufzuarbeiten.
Dies also – so etwa gingen damals meine Gedanken –, dies verschmierte und aussätzige Individuum ist der Herzensdieb, zu dem soeben die graue Menge sehnsüchtig emporträumte! Dieser unappetitliche Erdenwurm ist die wahre Gestalt des seligen Falters, in welchem eben noch tausend betrogene Augen die Verwirklichung ihres heimlichen Traumes von Schönheit, Leichtigkeit und Vollkommenheit zu erblicken glaubten! Ist er nicht ganz wie eines jener eklen Weichtierchen, die, wenn ihre abendliche Stunde kommt, märchenhaft zu glühen befähigt sind? Die erwachsenen und im üblichen Maße lebenskundigen Leute aber, die sich so willig, ja gierig von ihm betören ließen, mußten sie nicht wissen, daß sie betrogen wurden? Oder achteten sie in stillschweigendem Einverständnis den Betrug nicht für Betrug? Letzteres wäre möglich; denn genau überdacht: wann zeigt der Glühwurm sich in seiner wahren Gestalt, – wenn er als poetischer Funke durch die Sommernacht schwebt, oder wenn er als niedriges, unansehnliches Lebewesen sich auf unserem Handteller krümmt? Hüte dich, darüber zu entscheiden! Rufe dir vielmehr das Bild zurück, das du vorhin zu sehen glaubtest: diesen Riesenschwarm von armen Motten und Mücken, der sich still und toll in die lockende Flamme stürzte! Welche Einmütigkeit in dem guten Willen, sich verführen zu lassen! Hier herrscht augenscheinlich ein allgemeines, von Gott selbst der Menschennatur eingepflanztes Bedürfnis, dem die Fähigkeiten des Müller-Rosé entgegenzukommen geschaffen sind. Hier besteht ohne Zweifel eine für den Haushalt des Lebens unentbehrliche Einrichtung, als deren Diener dieser Mensch gehalten und bezahlt wird. Wieviel Bewunderung gebührt ihm nicht für das, was ihm heute gelang und offenbar täglich gelingt! Gebiete deinem Ekel und empfinde ganz, daß er es vermochte, sich in dem geheimen Bewußtsein und Gefühl dieser abscheulichen Pickel mit so betörender Selbstgefälligkeit vor der Menge zu bewegen, ja, unterstützt freilich durch Licht und Fett, Musik und Entfernung, diese Menge das Ideal ihres Herzens in seiner Person erblicken zu lassen und sie dadurch unendlich zu erbauen und zu beleben!
Empfinde noch mehr! Frage dich, was den abgeschmackten Witzbold trieb, diese abendliche Verklärung seiner selbst zu erlernen! Frage dich nach den geheimen Ursprüngen des Gefälligkeitszaubers, der vorhin seinen Körper bis in die Fingerspitzen durchdrang und beherrschte! Um dir antworten zu können, brauchst du dich nur zu erinnern (denn du weißt es gar wohl!), welche unnennbare, mit Worten nicht ungeheuerlich süß genug zu bezeichnende Macht es ist, die den Glühwurm das Leuchten lehrt. Beachte doch, wie der Mensch sich nicht satt hören kann an der Versicherung, daß er gefallen, daß er wahrhaftig über die Maßen gefallen hat! Lediglich der Hang und Drang seines Herzens zu jener bedürftigen Menge hat ihn zu seinen Künsten geschickt gemacht; und wenn er ihr Lebensfreude spendet, sie ihn dafür mit Beifall sättigt, ist es nicht ein wechselseitiges Sich-Genüge-Tun, eine hochzeitliche Begegnung seiner und ihrer Begierden?
Sechstes Kapitel
Obige Zeilen deuten in großen Zügen den Gedankengang an, den mein Geist, erhitzt und eifrig, in Müller-Rosés Garderobe zurücklegte und auf dem er sich in den folgenden Tagen, ja Wochen, aber- und abermals strebend und träumend betraf. Eine tiefe Ergriffenheit war stets die Frucht dieser inneren Forschungen, eine Sehnsucht, Hoffnung, Trunkenheit und Freude, so stark, daß noch heute, meiner großen Müdigkeit ungeachtet, die bloße Erinnerung daran den Schlag meines Herzens zu schnellerem Takte befeuert. Damals jedoch war diese Empfindung von solcher Macht, daß sie zuweilen meine Brust zu sprengen drohte, ja mich gewissermaßen krank machte und mir nicht selten zum Anlaß diente, die Schule zu meiden.
Meine wachsende Abneigung gegen dies feindselige Institut noch besonders zu begründen, erachte ich für überflüssig. Die Bedingung, unter der ich einzig zu leben vermag, ist Ungebundenheit des Geistes und der Phantasie, und so kommt es, daß die Erinnerung an meinen langjährigen Aufenthalt im Zuchthause mich weniger unliebsam berührt als diejenige an die Bande der Knechtschaft und Furcht, in welche die scheinbar ehrenvollere Disziplin des kalkweißen, kastenartigen Hauses drunten im Städtchen die empfindliche Knabenseele schlug. Stellt man zum Überfluß meine Vereinsamung mit in Rechnung, deren Ursprünge ich auf früherem Blatte aufgedeckt habe, so wird es nicht wundernehmen, daß ich früh darauf sann, dem Schuldienst nicht nur an Sonn- und Feiertagen zu entkommen.
Dabei leistete mir eine lange spielerische Übung, die Handschrift meines Vaters nachzuahmen, vorzügliche Dienste. Ein Vater ist stets das natürliche und nächste Muster für den sich bildenden und zur Welt der Erwachsenen hinstrebenden Knaben. Unterstützt durch geheimnisvolle Verwandtschaft und Ähnlichkeiten der Körperbildung, setzt der Halbwüchsige seinen Stolz darein, sich von dem Gehaben des Erzeugers anzueignen, was die eigene Unfertigkeit ihn zu bewundern nötigt – oder, um genauer zu sein: Diese Bewunderung ist es, die halb unbewußt zu der Aneignung und Ausbildung dessen führt, was erblicherweise in uns vorgebildet liegt. Dereinst so rasch und geschäftlich leicht die Stahlfeder zu führen wie mein Vater war schon mein Traum, als ich noch hohe Krähenfüße in die liniierte Schiefertafel grub, und wieviel Fetzen Papiers bedeckte ich später, die Finger genau nach seiner schlanken Manier um den Halter geordnet, mit Versuchen, die väterlichen Schriftzüge aus dem Gedächtnis nachzubilden. Das war nicht schwer, denn mein armer Vater schrieb eigentlich eine Kinderhand, fibelgerecht und ganz unausgeschrieben, nur daß die Buchstaben winzig klein, durch überlange Haarstriche jedoch so weitläufig, wie ich es sonst nie gesehen, auseinandergezogen waren, eine Manier, deren ich rasch aufs täuschendste habhaft wurde. Was den Namenszug »E. Krull« betraf, der, im Gegensatz zu den spitzig-gotischen Zeichen des Textes, den lateinischen Duktus aufwies, so umhüllte ihn eine Schnörkelwolke, die auf den ersten Blick schwer nachzuformen schien, jedoch so einfältig ausgedacht war, daß gerade die Unterschrift mir fast stets zur Vollkommenheit gelang. Die untere Hälfte des E nämlich lud weit zu gefälligem Schwunge aus, in dessen offenen Schoß die kurze Silbe des Nachnamens sauber eingetragen wurde. Von oben her aber, den u-Haken zum Anlaß und Ausgang nehmend und alles von vorn umfassend, gesellte sich ein zweiter Schnörkel hinzu, welcher den E-Schwung zweimal schnitt und, gleich diesem von Zierpunkten flankiert, in zügiger S-Form nach unten verlief. Die ganze Figur war höher als breit, barock und kindlich von Erfindung und eben deshalb so vortrefflich zur Nachahmung geeignet, daß der Urheber selbst meine Produkte als von seiner Hand würde anerkannt haben. Welcher Gedanke aber lag näher als der, eine Fertigkeit, in der ich mich anfangs nur zu meiner Zerstreuung geübt hatte, in den Dienst meiner geistigen Freiheit zu stellen? »Mein Sohn Felix«, schrieb ich, »war am 7ten currentis durch quälendes Bauchgrimmen genötigt, dem Unterricht fernzubleiben, was mit Bedauern bescheinigt – E. Krull.« Oder auch etwa: »Eine eitrige Geschwulst am Zahnfleisch sowie die Verstauchung des rechten Armes waren schuld, daß Felix vom 10.–14. hujus das Zimmer hüten und zu unserem Leidwesen vom Besuche der Lehranstalt absehen mußte. Es zeichnet mit Hochachtung – E. Krull