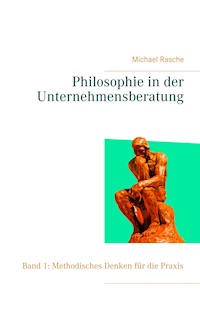Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Es genügte mir nicht, das Christentum zu leben. Ich wollte es auch verstehen. Vielleicht war das mein Fehler." Michael Rasche war katholischer Priester und Professor für Philosophie. Als Seelsorger hat er Sterbende begleitet und Kinder getauft, an der Universität hat er über die Kirche geforscht, gelesen und nachgedacht. Er wollte die Kirche tiefer verstehen, ihre Lehre, ihre Strukturen, ihre Menschen, ihre Krise. Doch je mehr er verstand, desto mehr löste sich das auf, woran er geglaubt hatte. Michael Rasche entschied sich schließlich, dieses katholische Leben hinter sich zu lassen und zu heiraten. In diesem Buch erzählt Michael Rasche seine katholische Geschichte - eine spannende Entdeckungsreise im Inneren der Kirche, die dem auf den Grund geht, warum die Kirche so ist, wie sie ist, und warum sie sich aus der Krise nicht befreien kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Michael Rasche, PD Dr. Dr., geb. 1974, wurde 2001 in Essen zum katholischen Priester geweiht und war danach viele Jahre in der Seelsorge und an der Universität tätig. 2015 wurde er Professor für Philosophie an der KU EichstättIngolstadt. 2016 trat Rasche von seinen kirchlichen Ämtern zurück. Er lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Rotterdam, Niederlande, und ist freiberuflich als Philosoph, Redner und Berater tätig.
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
„Die Wahrheit einer Sache liebt es, verborgen zu sein.“
Heraklit
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
DAS PARADIES
IM „KASTEN“: DAS PRIESTERSEMINAR
SEMINARIST
THEOLOGIE
ERSTE BRÜCHE
ROM: IM ZENTRUM DER KIRCHE
RÖMISCHES LEBEN
SCHOLASTIK
MACHT
AUF DEM WEG ZUR PRIESTERWEIHE
ZURÜCK IN BOCHUM
ALLES IST AUSLEGUNG
PASTORALKURS
PRIESTERWEIHE
PROMOTION I
START ALS PRIESTER
IM ESSENER SÜDEN
JUGEND UND KIRCHE
JOHANNES PAUL II.
DAS RECHT
STRUKTURREFORM
WACHSENDE GRÄBEN
PROMOTION: VON I ZU II
BOTTROP
VON DER KRISE DER KIRCHE ZUR KRISE GOTTES
IM SCHATTEN
DIE FROMME SAUCE
SPRACHE
HABILITATION?
EICHSTÄTT: EINE REISE INS GESTERN
BAYERN
UNIVERSITÄT
GLAUBE UND VERNUNFT
PAPSTWECHSEL
MISSBRAUCH
SELBSTBLOCKADE
DAS „WARUM“ DES CHRISTENTUMS
ENTSCHEIDUNG
KATHARINA
ZÖLIBAT
PROFESSUR
TROST DER PHILOSOPHIE
WAS WILL ICH?
WAS IST AUFKLÄRUNG?
THEOLOGIE?
ABSCHIED
EPILOG
Ich habe nichts zu sagen. Nur zu zeigen.
Walter Benjamin
Vorwort
Ein Priester schreibt über die katholische Kirche. Das ist vor allem dann spannend, wenn es entweder um seinen Weg in die Kirche hinein oder aus der Kirche hinausgeht. Entweder die Geschichte einer Bekehrung oder die eines Abschieds. Meine ist die eines Abschieds.
Dieser Abschied hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen Abschieden aus der Kirche. Viele verlassen die Kirche oder ein kirchliches Amt, weil sie mit dem Leben in der Kirche nicht zufrieden sind. Sie stören sich an der Arroganz der Amtsträger, der Unbeweglichkeit der Kirche, der Geringschätzung von Frauen, dem sexuellen Missbrauch. Vielleicht sind sie selbst Opfer sexuellen oder auch psychischen Missbrauchs geworden. So oder so haben sie sich gegen die Kirche entschieden, weil das, was die Kirche getan hat, sie abstößt. Diese Dinge mögen auch bei mir eine große Rolle gespielt haben. Ich bin nicht blind gewesen und habe viel gesehen und erfahren, was mich abstieß. Das für mich Entscheidende war jedoch nicht, was die Kirche tat, sondern was sie lehrte.
Das ist ungewöhnlich. Normalerweise geht es um das christliche Leben: das des einzelnen Christen wie auch der Kirche. Es geht zumeist um Gelingen oder Scheitern dieses christlichen Lebens und um mögliche Konsequenzen daraus. Ich stand immer im christlichen Leben, zuerst als aktiver Christ in einer Kirchengemeinde, schließlich 15 Jahre lang als Priester. Aber es genügte mir nicht, das Christentum zu leben, ich wollte es auch verstehen. Vielleicht war das mein Fehler. Ich wollte wissen, warum es so ist, wie es ist, im Guten wie im Schlechten. Viele Jahre habe ich das Christentum studiert. Zuerst als Student, schließlich als Professor. Ich habe mir die Lehre der Kirche angeschaut. Wie sie entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat. Ich habe die Vergangenheit der Kirche studiert und ihre Gegenwart intensiv miterlebt. Ausschlaggebend für meinen Abschied war nicht das in vielerlei Hinsicht kaputte Leben der Kirche, sondern das immer tiefere Verstehen ihrer Lehre und ihrer Wahrheit. Und damit verbunden schließlich die Einsicht, dass das in vielerlei Hinsicht kaputte Leben der Kirche mit ihrer Lehre und ihrer Wahrheit zu tun hat und sogar ihre logische Konsequenz ist.
Dieses Buch ist keine Abrechnung mit der Kirche. Ich werde natürlich von ihren Schwächen berichten, aber auch von ihren Stärken. Weil ich selbst nicht nur unter ihren Schwächen gelitten, sondern auch an ihre Stärken geglaubt habe. Dieses Buch enthält keine skandalösen Enthüllungen, die ich der Welt als Neuigkeit mitteilen möchte. Die Skandale, von denen ich berichte, wollen keinen Sensationseffekt erzielen, sie wollen etwas erklären.
Ein Buch über die Kirche, das ein ehemaliger Priester schreibt, ist immer auch eine Autobiographie. Es ist die Geschichte meines Lebens mit der Kirche. Dabei geht es um die Kirche, aber eben auch um mich und meine persönlichen Erfahrungen. Diese mögen für viele nachvollziehbar sein, für viele vielleicht auch nicht. Ich erzähle dennoch von ihnen, in der sicheren Autorität dessen, der das Christentum wirklich erlebt und viele Jahre in seinem Innersten verbracht hat.
Es geht mir aber nicht darum, mein Leben zu beschreiben. So eitel bin ich nicht. Es geht mir darum, die Kirche zu beschreiben, das Scheitern der Kirche, das sich auch in meinem Leben vollzogen hat und in dem sich vielleicht auch viele andere wiedererkennen, die auf das Scheitern der Kirche blicken – seien sie Christen oder nicht. Mein Leben war ein Wachsen und ein Auflösen des Christlichen. In diesem meinem Leben wurde sichtbar, welche große Kraft das Christentum besitzt – aber warum es trotzdem scheitert. Nicht nur in meinem Leben.
Neben Ereignissen aus meinem Leben werde ich auch Einblicke in theoretische Gedankengänge bieten. Dabei habe ich mich bemüht, jeden Fachjargon zu vermeiden und verständlich zu sein. Dennoch erfordern diese Dinge für den Leser vielleicht etwas mehr Geduld und Konzentration. Aber es ist unvermeidbar, denn mein Weg aus der Kirche hat nicht nur mit dem zu tun, was ich erlebt, sondern noch mehr mit dem, was ich gedacht und verstanden habe.
Ich hege als ehemaliger Priester keine Rachegefühle gegenüber der Kirche. Sie hat mir keine Lebenszeit geraubt, sondern vieles geschenkt. Trotzdem musste ich mich gegen sie entscheiden und davon möchte ich erzählen. Dabei will ich die Kirche nicht schädigen, sondern davon berichten, wie sie es selbst tut.
Augustinus, ein großer Gelehrter aus der Spätantike, hat ein Buch geschrieben, das den Titel „Bekenntnisse“ trägt. In diesem Buch beschreibt Augustinus seinen wechselvollen Weg zum Christentum. Dieser Mann und dieses Buch war eine der großen Inspirationen meines Lebens. Im Gedenken an ihn schreibe ich meine „Bekenntnisse“, auch wenn mein Weg umgekehrt verlief: er führte mich aus dem Christentum heraus. Im Weg, den Augustinus beschrieb, haben sich unzählige Menschen wiedererkannt. Vielleicht erkennen sich viele auch in meinem Weg wieder.
Das einzige Paradies ist das verlorene Paradies.
Marcel Proust
Das Paradies
Die Kirche ist bitterkalt. Eine Gruppe von vielleicht 20 Personen hat sich festlich gekleidet in der dunklen Taufkapelle versammelt, die von Kerzen und einigen wenigen Lampen nur notdürftig beleuchtet wird. Gegenüber dieser Kapelle öffnet sich der weite Raum der modernen Kirche, die von großen Fensterfronten erhellt wird, selbst an diesem verregneten Tag. Die Rückwand des Altarraums wird von riesigen Weihnachtsbäumen verdeckt, an denen elektrische Kerzen funkeln. Es ist der 2. Weihnachtstag 1974, der Tag meiner Taufe.
Mein Eintritt ins Leben war zugleich der Eintritt in die katholische Kirche. Kirche und Leben waren in unserer Familie nicht zu trennen. Dies passierte nicht in einem Fanatismus oder in einem frommen Eifer, sondern mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit. Katholisch zu sein, war nicht das Ergebnis einer besonderen Bemühung, man war es einfach. Und das seit vielen Generationen. Soweit man die Verästelungen und Verzweigungen meiner Familie zurückverfolgen kann, gab es nicht einen einzigen Protestanten. Dafür gab es drei Priester: einen Professor und Weihbischof in Trier, der im 19. Jahrhundert lebte, einen Domprobst in Köln, der den klingenden Nachnamen „Ketzer“ trug und nicht nur deshalb den „Orden wider den tierischen Ernst“ erhalten hatte, sowie einen Großonkel, der es bis zum Professor in Rom gebracht hatte. Daneben muss es irgendwann früher noch einige Ordensschwestern gegeben haben, aber von denen habe ich nie Genaues gehört. Man kann unsere Familie also mit vollem Recht als katholisch bezeichnen. Man ging am Sonntag in die Kirche, vor jeder Mahlzeit wurde ein Tischgebet gesprochen, Namenstage wurden genauso feierlich begangen wie die Geburtstage. Auch mit genauso großen Geschenken, was für uns Kinder eine feine Sache war.
In diese Welt wurde ich im Oktober 1974 hineingeboren. Etwa zwei Monate später, am 2. Weihnachtstag, wurde ich in der Taufkapelle der Barbarakirche in Mülheim an der Ruhr vom Kaplan getauft. Wie es mit Blick auf mein späteres Leben selbstverständlich erscheint, habe ich diese Zeremonie mit würdevoller Gelassenheit über mich ergehen lassen, so wurde mir berichtet. Wie es mit Blick auf mein späteres Leben ebenfalls selbstverständlich erscheint, war zusätzlich neben dem Kaplan noch der Pfarrer in der Bank betend anwesend. Doppelt genäht hält besser.
Wir lebten im Norden von Mülheim an der Ruhr, im Stadtteil Dümpten. Wie so viele Orte im Ruhrgebiet bestand Dümpten vor 150 Jahren noch aus einzelnen Gehöften, bevor dann der große Boom durch Kohle und Stahl ausbrach und aus kleinen Dörfern riesige Siedlungen mit Tausenden Bewohnern wurden. Dümpten, von den Einwohnern stolz „Königreich“ genannt, liegt an einem Hügel. Wir wohnten oben, also in Oberdümpten, unsere Pfarrkirche St. Barbara lag unten, in Unterdümpten, etwas über einen Kilometer entfernt. Die alte Barbarakirche, benannt nach der Heiligen Barbara, der Patronin der Bergleute, war im Krieg zerstört worden. Unter vielen Mühen konnte die neue Barbarakirche gebaut werden. Sie wurde 1955 eingeweiht und galt damals als revolutionär, da sie bereits vieles vorwegnahm, was später durch die Liturgiereformen und ein modernes Architekturverständnis gefordert wurde. Der Stil wurde unter Architekten als „neue Sachlichkeit“ definiert, was schlimmer klingt, als die Kirche letztendlich geworden ist. Im Unterschied zu vielen anderen modernen Kirchen war die Barbarakirche in der Lage, im Gottesdienst eine gute Atmosphäre zu erzeugen und stellt ein durchaus gelungenes Beispiel moderner kirchlicher Architektur dar.
Mit der Taufe in der kalten, dunklen Kapelle der Barbarakirche begann meine offizielle kirchliche Laufbahn. Wenige Jahre später folgte der katholische Kindergarten, direkt hinter der Kirche. Auf diesen wiederum die katholische Grundschule am Schildberg. Immer begleitet vom katholischen Zuhause und von der katholischen Kirchengemeinde. Wir gingen an jedem Sonntag in die Kirche. Dort ging es mir wie wohl den meisten Kindern in dieser Situation: spannend fand ich es nicht, in eine Holzbank eingepfercht zu sein. Was ich allerdings spannend fand, war das Geschehen oben im Altarraum. Und so war für mich schnell klar, dass ich nach oben in den Altarraum wollte: dahin, wo was passiert. Ich wollte Messdiener werden.
Zu dieser Zeit – Ende der 1970er Jahre – gab es in unserer Gemeinde weit über 100 Messdiener. Dummerweise konnte man erst Messdiener werden, wenn man zur Erstkommunion gegangen war. Also musste ich warten. Aber irgendwann war es dann soweit: am Heiligen Abend 1982 konnte ich endlich meine erste Messe „dienen“ – im Unterschied zu meiner Schwester, denn es waren nur Jungen zugelassen.
Wochenlang hatte ich auf diesen Moment hingefiebert. Dem ersten Einsatz als Messdiener ging eine längere Ausbildungsphase voraus. Der Kaplan übte mit uns neuen Messdienern: wie steht man richtig, wie läuft man richtig, wann muss man wohin laufen, wann muss man etwas bringen oder abholen, wie kniet man zeitgleich mit anderen 20 Messdienern nieder. Das klingt vielleicht nach militärischem Drill – und den wird es in vielen Kirchengemeinden früherer Zeiten auch gegeben haben –, im Kern ging es aber weniger darum, die Bewegungsabläufe möglichst zackig zu machen, sondern erst einmal darum, sich nicht im Altarraum zu verlaufen und beim Gehen und Stehen eine würdevolle Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, wie es dem Charakter eines Gottesdienstes entspricht. So galt die Losung: „Wenn du schon falsch gelaufen bist, mache es würdevoll weiter, dann merkt es keiner!“ Dass dieses Motto auch sonst in der Kirche gelebt wurde, konnte ich noch nicht ahnen, aber dazu später mehr.
Was macht ein Messdiener? Er „dient“ bei der Messe. Das heißt, er hilft dem Priester in der Durchführung der Messfeier und anderer Gottesdienste. Von denen gab es damals in unserer großen Gemeinde eine ganze Menge: fünf Messen und eine Andacht an jedem Wochenende (die frühen AchtUhrMessen am Sonntag waren natürlich nicht so beliebt bei uns Messdienern), dazu noch Taufen, Hochzeiten und andere Gottesdienste. Bei normalen Messen waren vier Messdiener dabei, bei großen Hochämtern entsprechend mehr. So wurde an den großen Festtagen wie Weihnachten und Ostern alles an Messdienern aufgeboten, was Beine hatte. Dies galt besonders für das Fronleichnamsfest, bei dem der Gottesdienst draußen stattfand und damit Messdienerscharen möglich waren, die sonst kaum in den Altarraum der Kirche gepasst hätten.
Bei den Messdienern gab es – wie könnte es in der katholischen Kirche auch anders sein – eine klare Hierarchie. Bei meiner ersten Messe am Heiligen Abend war ich „Stufenputzer“, offiziell „Flambeauträger“. Ein Flambeau ist ein schlanker Kerzenhalter, den man gut in der Hand halten kann und der etwa einen Meter hoch ist. In meiner ersten Messe war ich nicht viel höher. Bei besonders festlichen Anlässen wurden 10 bis 20 Flambeauträger eingesetzt, um bestimmte Momente im Gottesdienst mit mehr Glanz und Würde zu versehen: wenn es wichtig wurde, kamen die Flambeaus. Das bedeutete konkret, dass die Flambeauträger im Laufe des Gottesdienstes mehrere Male in Prozession in den Altarraum hinein und wieder hinauszogen. Ein großer Vorteil dabei: während der Predigt – gewöhnlich der langweiligste Teil der Messe – konnte man in der Sakristei oder draußen herumtoben und ein bisschen Spaß haben. Sei es mit Fangenspielen oder Zigaretten, je nach Alter.
Die Flambeauträger wurden nur bei besonders festlichen Anlässen eingesetzt. In der Hackordnung der Messdiener waren sie unten angesiedelt, sie waren eben die „Stufenputzer“, mehr oder weniger schmückendes Beiwerk. Im Mittelfeld dieser inoffiziellen Hierarchie standen die Dienste, die es in jedem Gottesdienst gab, die aber mehr Verantwortung und Eigenständigkeit erforderten als nur Flambeaus von rechts nach links zu tragen und auf Kommando zu knien: Altardienst und Kerzendienst. Diese versahen die „normalen“ liturgischen Dienste: Begleitung des großen Evangelienbuches, Bringen der Gaben zum Altar usw.
Oben in der Hierarchie der Messdiener standen „Kreuz“ und „Weihrauch“. Der Messdiener, der „Kreuz“ hatte, ging bei Ein und Auszug in die Kirche mit einem großen Tragekreuz vorneweg und führte die Prozession an. Er gab die Kommandos für die Flambeauträger und war – natürlich unterhalb des Priesters – der Chef im Ring. Mir persönlich gefiel allerdings in späteren Messdienerjahren – als ich längst Leiter war und mir den Dienst aussuchen konnte – der Weihrauchdienst deutlich besser. Zum einen war das Tragekreuz doch recht schwer für einen damals noch schmächtigen Kerl wie mich, zum anderen machte es als Weihrauchträger einfach Spaß, den Altarraum und die ganze Kirche mit einem heiligen Nebel zu erfüllen. Je dichter, desto besser. Hierbei hagelte es oft Beschwerden von Gottesdienstbesuchern, die in diesem Rauch weniger an fromme Hingabe denken konnten als vielmehr daran, die nächste Hustenattacke würdevoll zu vermeiden. Entsprechend war der Weihrauchdienst immer ein Drahtseilakt zwischen dem eigenen Verlangen, den Kirchenraum komplett zu vernebeln, und der Einschätzung, wieviel der Geistliche zu tolerieren bereit war – nicht an Rauch, sondern an späteren Beschwerden. Im Laufe meiner langen Messdienerkarriere kann ich mir zu Gute halten, dort durchaus Grenzen verschoben zu haben.
Wochenlang hatte ich meinem ersten Einsatz als Messdiener entgegengefiebert. Am Heiligen Abend war es schließlich soweit. Ich war der Kleinste von vielleicht 40 Messdienern, die in dieser Messe Dienst hatten. Meine Aufgabe an diesem Abend war relativ simpel: das machen, was die anderen machen: in einer langen Reihe von Messdienern mitgehen, mitstehen und mitknien. Und dabei möglichst würdevoll aussehen. Trotz dieser eigentlich simplen Aufgabenstellung war es für mich als Achtjähriger natürlich aufregend, oben im Altarraum in einer großen, prallgefüllten Kirche zu stehen. Meine Eltern berichteten mir später, dass ich zwar körperlich ruhig gestanden hätte, aber meine Augen in Daueraktion gewesen wären und neugierig immer zwischen rechts und links hin und her gezuckt hätten. Ich saugte alles auf, was in dieser neuen Umgebung passierte. Ich wollte alles beobachten, war mir aber zugleich absolut sicher, dass jedes dieser vielen hundert Augenpaare während des ganzen Gottesdienstes nur mich beobachten würde. Was wohl auch so gewesen wäre, wenn ich den Kerzenleuchter hätte fallen lassen.
Nüchtern betrachtet ist die Tätigkeit eines Messdieners völlig sinnlos. Warum Kerzen von rechts nach links tragen? Warum Gefäße auf den Altar stellen, die man dort auch vorher hätte hinstellen können? Warum mit einem dicken Buch im Kreis um den Altar laufen? Warum dem Priester am Altar die Hände waschen? Sollte er das nicht vor dem Gottesdienst tun? Es geht um Symbolik. Und was das ist und wie sie funktioniert, das lernt man als Messdiener unbewusst im Laufe der Jahre.
Symbolisches Handeln bedeutet, etwas zu tun, was nicht in normalem Sinne „real“ ist, aber die Realität in einer neuen, vielleicht höheren Weise interpretiert, ihr eine neue Deutung verleiht. Die Messdiener treten zum Priester, übergießen seine Hände mit Wasser. Die Szene ist in dem Sinne nicht real, weil sie eigentlich deplatziert ist. In der Sakristei ist ein Waschbecken. Und hoffentlich wäscht sich der Priester auch außerhalb des Gottesdienstes seine Hände. Trotzdem erklärt diese Handwaschung etwas: sie macht deutlich, dass ab jetzt etwas Neues passiert, etwas, das mit dem Alltag (und seinem Schmutz) nichts zu tun hat, sondern über ihn erhoben ist und für das man sich reinigen und vorbereiten muss. Das Waschen ist nicht real, weil es nicht um die Reinigung der Hände an sich geht, sondern darum, das, was da jetzt passiert, einer bestimmten Uminterpretation zu unterziehen. So funktioniert Symbolik.
Nehmen wir als Beispiel einen der bedeutendsten symbolischen Akte des 20. Jahrhunderts, den Kniefall von Willy Brandt im Warschauer Ghetto 1970. Auch dieser Kniefall war eigentlich nicht real, nicht der Realität angemessen: warum soll man auf regennassen Steinplatten knien? Willy Brandt machte in diesem Augenblick etwas sehr Wichtiges deutlich: eine Demut und eine Scham angesichts dessen, was an diesem Ort passiert war und woran dieser Ort erinnert. Er gab diesem Augenblick eine neue, größere Bedeutung, die weit über das hinausreicht, was faktisch geboten wird: sich schmerzhaft auf Steine fallen lassen.
So funktioniert Symbolik, und ein katholischer Gottesdienst – viel mehr als ein evangelischer – ist Symbolik pur. Diese Symbolik greift allerdings nur dann, wenn derjenige, der sie ausführt, auch an das glaubt, was er da tut bzw. – um genau zu sein – an das, worauf er mit seinem symbolischen Tun hinweisen will. Der Priester am Altar macht in zahlreichen symbolischen Handlungen deutlich, dass es nun nicht um die normale Welt, nicht um ihn selbst, sondern um etwas irgendwie Höheres geht. In dem Augenblick, in dem er dies nicht tut, weil er selbst entweder nicht an dieses Höhere glaubt oder zu müde ist oder sich selbst mit diesem Höheren verwechselt, verschwindet das Symbolische, und es bleibt nur die lächerliche Realität: ein Kostümtanz, eine Karikatur.
Als Messdiener wird man groß mit diesem symbolischen Handeln. Man gewinnt ein Gespür dafür, was symbolisches Handeln ist, wie es funktioniert, wie man es setzen kann. Ganz einfach, weil man es jeden Sonntag durchführt. Dazu gehört es auch, eine Rolle zu übernehmen. Indem man sich im Altarraum bewegt, ist man nicht der Michael Rasche oder der Peter Müller, der gerade noch draußen über die Straße rannte, sondern man erfüllt eine Rolle, man geht in einer Funktion auf, die man im Altarraum besitzt. Man lernt im Laufe der Jahre, eine Rolle anzunehmen und zu erfüllen, man lernt, sich öffentlich zu verhalten: sich vor den Augen einer großen Menschenmenge zu bewegen, zu sprechen, etwas zu tun. Solche Fähigkeiten können später nützlich sein. Es ist kein Zufall, dass viele Leute aus dem Showbusiness eine Vergangenheit als Messdiener haben: Thomas Gottschalk, Frank Elstner, Harald Schmidt, Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Stefan Raab, Alfred Biolek und viele andere haben im Altarraum wichtige Grundlagen ihrer späteren Laufbahn gelegt. Für sie gilt das gleiche wie für einen Priester: die Gefahr ist groß, zu sehr in seiner Rolle aufzugehen, die Rolle mit der Realität zu verwechseln und als Karikatur abzustürzen.
Passiert ist es vielen. Sowohl im Showbusiness als auch in der Kirche. Vielleicht sogar der Kirche als Ganzer.
Ich wurde Messdiener und ging darin auf. Nicht nur, dass ich an jedem Sonntag in der Messe diente. Wenn sonst Not am Mann bzw. Messdiener war, stand ich bereit: bei Hochzeiten, Taufen usw. In den Ferien diente ich selbst an normalen Wochentagen in den Gottesdiensten. Besonders bei Beerdigungen freute sich der Küster über Unterstützung. Das bedeutete, dass ein normaler Vormittag in den Ferien so aussah: nach dem Frühstück den Berg runter zur Kirche; am Eingang der Sakristei entweder den Zigarre rauchenden Organisten grüßen oder – wenn ich etwas später ankam – den in einem Mauerloch steckenden Zigarrenstummel; dann in die Sakristei hinein, den meist mürrischen Küster begrüßen, in den Messdienerraum, Gewänder anziehen, auf den Priester warten und los ging es, mindestens zum Gottesdienst, vielleicht noch zum Friedhof. So sahen für viele Jahre die Morgenstunden meiner Schulferien aus.
Die zentrale Rolle in unserer Kirchengemeinde spielten natürlich die Priester, an erster Stelle der Pfarrer, oder – wie man in unserer Region sagte – der „Pastor“. Pastor Julius Buschmann wurde 1924 in Münster geboren, einer katholischen Hochburg. Im Krieg wurde er in Russland schwer verwundet und entschloss sich, wenn er überlebt, Priester zu werden. Er überlebte. Unmittelbar nach dem Krieg studierte er, wurde Priester und kam schließlich 1967, einige Jahre vor meiner Geburt, in unsere Gemeinde, St. Barbara in Mülheim.
Pastor Buschmann war ein tieffrommer Mann. Seine Frömmigkeit war bereits etwas aus der Zeit gefallen, aber sie war glaubwürdig, unaufgeregt und bescheiden. Er war alles andere als ein feuriger und mitreißender Prediger und ebensowenig jemand, der einen mit seiner Ausstrahlung und seinem Charisma erschlagen konnte; er war einfach jemand, der sich und seine Existenz im Dienst Gottes sieht. Betonung liegt auf „Dienst“: er begriff sein Leben als einen Dienst, den er zwar mit seiner Persönlichkeit ausstrahlte, den seine Persönlichkeit aber nie dominieren konnte oder wollte. Dies setzte ihn deutlich ab gegenüber vielen Geistlichen, die aus diesem Dienstamt eine persönliche Überhöhung machen. Pastor Buschmann trug jeden Tag die schwarze Priesterkleidung ohne dabei allerdings einen Standesunterschied markieren zu wollen. Das spürte man und das ist durchaus eine Kunst, die nicht viele Priester beherrschen. Dieser Mann sollte mit seinem tiefen Glauben einen großen Einfluss auf den Verlauf meines kirchlichen Lebens haben.
Ihm zur Seite standen jeweils zwei Kapläne, jüngere Geistliche, denen die Jugend und Messdienerarbeit anvertraut war und die alle vier bis fünf Jahre wechselten. Meistens waren sie einigermaßen motivierte und zugängliche Leute, mit denen wir Kinder und Jugendlichen gut klarkamen. Einen bleibenden Eindruck auf mich haben jedoch nicht sie, sondern der deutlich ältere Pastor hinterlassen. Auch in meinem späteren Leben haben eher ältere Leute für mich eine gewisse Vorbildfunktion ausgeübt. Natürlich hatte ich immer gute Freunde, die gleichaltrig oder auch jünger waren. Bei den älteren Menschen, gerade auch bei Senioren, fand ich jedoch oft eine große Lebenserfahrung, die ich spannend und lehrreich fand und aus der ich oft für mich viel mitnehmen konnte.
Dazu passend gab es in meiner Jugendzeit neben dem Heimatpfarrer einen noch älteren Priester, der für mich eine große Bedeutung haben sollte: Pastor Paul Hohmann, 1910 geboren, 1935 mit ca. 120 anderen Männern in Köln zum Priester geweiht. Er kam als Pensionär nach St. Barbara und war eine gute Ergänzung zu Pastor Buschmann: war jener in seiner Frömmigkeit immer etwas weltabgewandt, so verkörperte Paul Hohmann eine lebenslustige, rheinische Weltzugewandtheit. Diese war jetzt nicht laut und aggressiv, aber in seiner sehr freundlichen und herzlichen Weise am Menschen und an der Welt interessiert. Mit ihm entstand trotz des Altersunterschieds von satten 64 Jahren ein sehr persönliches und nahes Verhältnis. Pastor Hohmanns Augenlicht wurde im Laufe der Jahre immer schlechter, was bedeutete, dass er eine Hilfe brauchte, die ihm im Gottesdienst zur Hand ging. Dies galt für die Kirche, aber auch für das Altenheim, in dem er regelmäßig Gottesdienst feierte. Hier half ich ihm als Messdiener, was im Laufe der Zeit nicht nur zu einem sehr engen und freundschaftlichen Verhältnis zu Pastor Hohmann führte, sondern auch dazu, dass ich bereits als junger Mensch intensiv mit Alter und Gebrechlichkeit konfrontiert wurde. Als Pastor Hohmann im Frühjahr 2000 starb – ich hatte bereits das Studium beendet und war auf dem Weg zur Priesterweihe – habe ich das erste Mal seit vielen Jahren geweint.
Die Gemeinde St. Barbara war mit über 10.000 Katholiken eine der größten des Ruhrgebiets. Sie war eine sehr aktive Gemeinde, mit vielen verschiedenen Gruppierungen, die das Gemeindeleben mitgestalteten. Eine dieser Gruppierungen war die „Kolpingsfamilie“, in der meine Eltern Mitglied waren. Die Kolpingsfamilie ist benannt nach Adolph Kolping, einem Priester, der sich im 19. Jahrhundert für die soziale Frage und insbesondere für die Situation von Handwerkern eingesetzt hatte. Die Kolpingsfamilien in den einzelnen Gemeinden – so auch in St. Barbara – hatten zu meiner Zeit eigentlich nicht mehr viel mit Handwerkern zu tun, sondern bemühten sich, das alltägliche Leben ihrer Mitglieder in einem guten christlichen Sinne zu gestalten. Dies galt insbesondere für die Familien mit Kindern, mit denen man Ausflüge, gemeinsame Wochenenden oder sonstige Veranstaltungen durchführte. Für uns Kinder war dies immer eine tolle Sache, ein ganzes Wochenende mit vielen anderen Familien und Kindern wegzufahren. Glaube und Gottesdienst waren an diesen Wochenenden durchaus auch präsent, sie waren dennoch keine frommen Veranstaltungen. Als Jugendlicher wurde ich dann Mitglied bei „JungKolping“, der Jugendgruppe der Kolpingsfamilie. Dies bedeutete wöchentliche Treffen, die nett waren und bei denen wir das taten, was Jugendliche in diesem Alter halt so taten: quatschen, Tischtennis usw.
Meine Anbindung zur Kirchengemeinde war also sehr vielseitig. Was es in der Freizeit an Aktivität mit anderen Menschen gab, spielte sich nahezu ausschließlich im Dunstkreis der Kirchengemeinde ab. Im Zentrum stand das Messdienersein. Ich gebe gerne zu, dass es heutiger Sicht ungewöhnlich klingt, wenn ein Junge von 10 oder 12 Jahren in den Ferien morgens zu Gottesdiensten geht, um als Messdiener seinen Dienst zu tun. Warum tat ich es? Natürlich spielte das Elternhaus bzw. die ganze Familie eine große Rolle. Der katholische Glaube war eine Selbstverständlichkeit und der Besuch des Gottesdienstes am Sonntag eine nie hinterfragte Regel. Das beeinflusst auch ein Kind, das in diesem Dunstkreis groß wird. Dennoch muss ich sagen, dass es von dieser Seite keinen Druck gab, in den Ferien zur Kirche zu rennen. Die Idee war sogar von mir. Die Eltern forderten es nicht. Aber stolz drauf waren sie schon. Was ja wiederum auch Auswirkungen auf einen Sohn hat. In einer Welt wie der meinen, in der sich alles irgendwie um die katholische Gemeinde drehte, war es für ein Kind oder später einen Jugendlichen, der seine Position im Leben sucht, eine faszinierende Sache, gerade in dem Brennpunkt aktiv zu sein, den das Leben anscheinend bietet: der katholischen Kirche. Dem Gottesdienst in der Kirche.
Diese Dinge entwickelten sich im Laufe der Zeit. Als Kind fand ich es spannend, was da oben im Altarraum passierte: da wollte ich mitmachen! Dann konnte ich schließlich mitmachen und tat dies in einem derartigen Eifer, das von allen Seiten Lob und Anerkennung kamen. Welcher Junge von 12 Jahren wird auf der Straße von älteren Leuten freundlich und respektvoll gegrüßt? Macht es keinen Reiz aus, fast täglichen Umgang mit Leuten zu haben, die für die meisten Menschen weit oben stehen, wie dem Pfarrer? Das Hineinwachsen und Größerwerden in der Gemeinde hatte sicherlich viel mit Anerkennung zu tun. Nicht, dass ich mich danach sehnte oder irgendwie in den Vordergrund drängte. Das ist in diesem jungen Alter nur schwer möglich in einer Erwachsenenwelt. Die Anerkennung kam natürlich auch direkt, sie kam aber vor allem indirekt und zwar dadurch, dass ich mich bereits an Dingen beteiligen konnte, die von den meisten Menschen als sehr wichtig für ihr Leben angesehen wurden.
Es ging jedoch nicht nur um Anerkennung. Es hat einfach auch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, mit anderen Kindern und Jugendlichen aktiv zu sein und etwas zu machen. Und dann auch noch etwas, das man als sinnvoll ansieht. Denn auch mir als Kind war klar, dass es sinnvoller ist, einen Gottesdienst zu besuchen oder einem halbblinden Priester im Altenheim zu helfen, als in seiner Freizeit Plastikflaschen auf einem Spielplatz in die Luft zu sprengen oder Klingelmännchen zu spielen. Was ich als sinnvoll ansah, wurde mir natürlich von den (katholischen Menschen) in meiner Umgebung vermittelt, an erster Stelle der Familie.
Auch durch die Tatsache, dass es einen zahlenmäßigen Einbruch in der Messdienerschaft gab, rückte ich dort schnell in die erste Reihe. Dieser Einbruch Anfang der 1980er Jahre hatte wesentlich mit dem nicht allzu fleißigen Kaplan zu tun. Wenn monatelang keine Pläne veröffentlicht werden, wer wann Dienst hat, dann kommt eben keiner mehr. Die Zahl ging von über 100 runter auf etwa 20, um sich dann wieder langsam auf 4050 hochzukämpfen. Als Ergebnis dieser Entwicklung rückten ein weiterer Messdiener und ich schnell – mit vielleicht 14 oder 15 Jahren – in die Position als Leiter der Messdiener. Was bedeutete, die Dienstpläne zu erstellen, Gruppenstunden durchzuführen, neue Messdiener anzulernen, aber auch eine Mannschaft für das Pfarrfußballturnier fit zu machen. Es waren sehr vielfältige Dinge, die nicht alle in gleichem Ausmaß, aber doch überwiegend viel Spaß gemacht haben.
Die Kirchengemeinde war für mich ein Paradies. Nicht, dass alles toll war oder dort nur tolle Menschen herumliefen. Aber es war für mich als Kind und dann als Jugendlicher einfach schön, in der Kirchengemeinde zu leben und sie irgendwie mitzugestalten. Als Kind fühlte ich mich gut aufgehoben in dieser Gemeinschaft, als Jugendlicher freute ich mich über die Gestaltungsmöglichkeiten und die Anerkennung, die ich für mein Engagement bekam. Oben stand der Pfarrer, Pastor Buschmann, ihm zur Seite die Kapläne, dann die verschiedenen Gremien und Gruppierungen, deren Mitglieder mir seit frühester Kindheit vertraut waren. Generation folgte auf Generation, das Gemeindeleben lief weiter. Das hatte etwas Beruhigendes. Nun haben Paradiese es an sich, geschlossen zu sein. Schon das Paradies in der Bibel ist ja letztlich ein ummauerter Garten: schön, aber eben mit einer Mauer versehen. Die Kirchengemeinde hatte keine Mauer um sich herum, war aber trotzdem eine irgendwie geschlossene Angelegenheit. Vielleicht geht es auch nicht anders: man kann nicht gleichzeitig ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, ohne dabei auch dafür zu sorgen, dass es ein Gefühl von Abgeschlossenheit und Grenzen gibt. Sicherheit und Geschlossenheit hängen eng zusammen.
Zu der Geborgenheit und Sicherheit, aber auch den Grenzen, die die Kirchengemeinde vermittelte, gehörte es, dass es die „drinnen“ und die „draußen“ gab. Drinnen war der harte Kern der aktiven Gemeindemitglieder, draußen alle anderen. Mit diesen „anderen“ hatte man normalerweise nicht viel zu tun. Sie kamen vielleicht am Heiligen Abend in die Kirche und nahmen den Stammgästen die Sitzplätze weg. Ansonsten traf man noch am ehesten auf sie, wenn sie zu familiären Anlässen die Gottesdienste besuchten: Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. Die Geistlichen bemühten sich im Vorfeld, die Leute ein bisschen auf Sitten und Gebräuche bei einem Gottesdienstbesuch einzustimmen, aber das glückte natürlich nicht immer. Im Allgemeinen gingen die Geistlichen mit solchen Dingen aber sehr gelassen um, selbst wenn Leute kaugummikauend direkt vor dem Altar standen oder wünschten, dass bei der Beerdigung „Junge, komm‘ bald wieder“ gespielt wird.
Diese Grenze hatte auch für mich Konsequenzen und zwar da, wo ich sie jeden Tag überschreiten musste: in der Schule. Die Schule war der Ort, an dem ich noch am ehesten mit Leuten in Kontakt kam, die nichts mit der Kirche am Hut hatten. Zwar war den meisten Mitschülern bekannt, dass ich in der Kirche aktiv war, damit hausieren zu gehen, war für mich aber keine Option. Es wurde irgendwie akzeptiert, aber Pluspunkte machte man damit nicht. Ich gewöhnte mich daran, in zwei getrennten Welten zu leben. Die eine Welt der Kirchengemeinde, die andere Welt die der Schule. Beide Welten standen sich durchaus nicht feindlich gegenüber, tickten aber völlig anders und hatten nichts miteinander zu tun.
Das Leben in der Kirchengemeinde hatte etwas Paradiesisches, aber auch dieses Paradies war nicht so unverwundbar, wie es oft schien. Es bekam Risse. Die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten gingen langsam, aber stetig nach unten. Für mich als Kind oder Jugendlicher war das kaum spürbar, da einfach die Lebenszeit fehlte, um das beurteilen zu können. Aber die Erwachsenen erzählten eben von den früher volleren Kirchen, und wenn man dann genau hinschaute, konnte man auch selbst wahrnehmen, dass sich etwas tat. Es war aber sehr langsam und für den oberflächlichen Betrachter sehr unauffällig. Vor allem wurde es nicht als bedrohlich angesehen, sondern als irgendwie vorübergehend. Jetzt geht es runter, es wird auch wieder raufgehen. Und wenn nicht? Dann sind wir immer noch genug. In der Tat waren es ja auch genug, das Leben in dieser großen Kirchengemeinde auf hohem Niveau weiterlaufen zu lassen. Was konnte schlimmstenfalls passieren? Man hörte, dass die Priester weniger werden. Na gut, aktuell haben wir einen Pastor, zwei Kapläne, einen pensionierten Pastor und einen Diakon. Dann werden die uns wohl irgendwann einen Kaplan streichen … Mag sein, dass es im Pfarrhaus hinter den Kulissen größere Sorgen über die Zukunft gab. Aber wenn das so gewesen sein sollte, wurde das zumindest nicht sichtbar. Die Pfarrei existierte seit über 100 Jahren, die alte Kirche war im Krieg zerstört worden, die neue Kirche war in gemeinsamer Anstrengung nach dem Krieg gebaut worden: sollte man sich wirklich von leicht sinkenden Zahlen in Panik versetzen lassen?
Mein Eifer blieb nicht unbemerkt, und bereits im zarten Alter von 12 oder 13 Jahren war vielen Menschen in der Kirchengemeinde über mich klar: „Der wird Priester!“ Sowas habe ich in dem Alter erst einmal nicht an mich herangelassen, weil ich mich in diesem Alter überhaupt nicht damit beschäftigen wollte, was ich irgendwann einmal beruflich machen werde. Wenn überhaupt, sah ich meine berufliche Zukunft eher bei „Irgendwas mit Geschichte“. Seitdem ich lesen konnte, habe ich Geschichtsbücher verschlungen. Insbesondere die Römer und Griechen hatten es mir immer angetan, weswegen ich am Gymnasium in der Mülheimer Innenstadt auch die alten Sprachen lernte. In dieser Richtung hatte ich noch am ehesten einen Berufswunsch für die Zukunft. Aber es gilt: steter Tropfen höhlt den Stein, und wenn man ständig mit der Meinung konfrontiert wird, dass man sowieso Priester wird, beginnt man sich irgendwann ernsthaft damit zu beschäftigen. Ich war seit vielen Jahren an unterschiedlichsten Stellen in der Kirchengemeinde aktiv, es machte mir viel Spaß: also warum eigentlich nicht?
Es wird oft von der „Berufung“ gesprochen, die einen zum Priestertum führt. Dies wird meistens so interpretiert, dass es sich um ein externes, von Gott ausgelöstes Geschehen handelt: Gott „ruft“ einen. Vielleicht ist es das. Aber nicht direkt. Zumindest habe ich noch keinen Priester kennengelernt, der in direkter Weise die Stimme Gottes gehört hat. Es würde mich auch eher ein bisschen erschrecken. Die meisten PriesterBiographien sind der meinen sehr ähnlich: katholische Familie, aufgewachsen und sehr aktiv eingebracht in das Leben einer Kirchengemeinde, dort Blut geleckt, gute Priester kennengelernt und sich dann irgendwann entschieden, selbst Priester zu werden. So gab es auch bei mir nicht den einen großen Augenblick, in dem ich beschloss, Priester zu werden. Es war die irgendwie folgerichtige Konsequenz meines bisherigen Lebens, das sehr stark mit der Kirchengemeinde verwoben war und das ich auf diese Weise fortsetzen wollte. Die Leute sprachen sehr früh und sehr viel darüber, dass ich bestimmt Priester werden würde. Zuerst dementierte ich das. Dann dementiere ich es nicht mehr. Und irgendwann sagte ich: Ja, habe ich vor.
Bei dieser Entscheidung spielte natürlich auch Gott eine Rolle. Von frühester Kindheit an lebte ich in dem Grundvertrauen, dass oben im Himmel Gott sitzt und liebend auf uns Menschen herunterschaut. Ich hörte gerne die biblischen Geschichten, die mir als Kind eine faszinierende Welt nahebrachten. Als Jugendlicher wandelte sich dieses kindliche Grundvertrauen in Gott etwas mehr in Neugierde: wie oder was war Gott überhaupt? Da ich gehört hatte, dass Beten einen Gott näherbringt, versuchte ich es damit. Also nicht nur im Aufsagen auswendiggelernter Gebete, sondern im meditativen Gebet. Ich muss aber gestehen, dass mich diese Versuche nie besonders weit gebracht haben, weswegen ich sie schnell wieder aufgegeben habe. Die Neugier blieb, das Grundvertrauen aber auch.
Meine Eltern haben mich sicher nicht bedrängt, den Priesterberuf zu ergreifen, waren dann aber doch recht stolz, dass ich mich so entschieden hatte. In der Schule hielt ich mit dieser Entscheidung noch eine Weile unter der Decke. So viel Lust auf endlose Diskussionen und Rechtfertigungen hatte ich nun nicht. Als ich jedoch auch dort begann, von meinen Plänen zu berichten, waren die Reaktionen jedoch entspannter als ich vorher befürchtet hatte.
Geist wächst nicht auf trockenem Boden.
Aurelius Augustinus
Im „Kasten“: das Priesterseminar
Seminarist
Das Wort „Seminar“ kommt vom lateinischen „semen“ für „Samen“. Ein „seminarium“ ist also ein Gewächshaus. Entsprechend ist das Priesterseminar der Ort, an dem die Samen gepflanzt, begossen und beschnitten werden und gut behütet wachsen, um schließlich als Priester geerntet zu werden. Ich hatte vor meinem Eintritt in das Priesterseminar keine Ahnung, was genau das sein soll. Ich wusste, dass es so etwas gibt, um die Priester auszubilden, aber was genau dort passiert, war mir völlig unbekannt. Wie wohl den meisten Menschen.
Kurz vor dem Abitur bewarb ich mich schriftlich um die Aufnahme ins Priesterseminar. Dieses forderte anschließend Gutachten meines Heimatpfarrers und meines Religionslehrers an und lud mich zu einem Gespräch ein, das vom stellvertretenden Leiter des Priesterseminars geführt werden sollte, dem Subregens. Ich machte mich auf den Weg und fuhr in das Priesterseminar des Bistums Essen nach Bochum.
Das Gespräch mit dem Subregens war nett und relativ kurz. Er empfing mich freundlich und erkundigte sich nach meiner Motivation, nach meiner bisherigen Biographie usw. Ich erzählte aus meinem bisherigen, erst 19 Jahre langen Leben und anscheinend war in Ordnung, was der Subregens von mir hörte. Als er mich fragte, welche Tätigkeit als Priester zukünftig die für mich schönste sein würde, musste ich einen Augenblick nachdenken, um dann zu antworten, dass ich Spaß daran hätte, gemeinsame Reisen in der Kirchengemeinde zu organisieren, weil ich gerne reisen würde. Der Subregens guckte etwas verdutzt, nahm es aber lächelnd hin. Ob dieses Gespräch jetzt wirklich tiefschürfend war, sei dahingestellt. Ich vermute, dass die bereits gelieferten Gutachten eine große Rolle gespielt haben. Zumindest erteilte die einige Wochen nach unserem Gespräch tagende Aufnahmekommission die Genehmigung, dass ich zum nächsten Wintersemester 1994/95 als Priesteramtskandidat des Bistums Essen aufgenommen würde.
Hier muss hinzugefügt werden, dass nicht jeder Bewerber angenommen wurde. Ich habe hinterher gehört, dass normalerweise ein Drittel bis die Hälfte der Bewerber abgelehnt würde. Und dies gewöhnlich auch zu Recht. Es ist so, dass sich viele bewerben, die vor allem einen sicheren Hafen suchen und ansonsten oft nicht wirklich lebenstauglich sind. Das Bistum Essen hat immerhin versucht, diese Leute vom Priesteramt fernzuhalten. Andere Bistümer waren und sind da deutlich weniger zögerlich, um den Priestermangel zu bekämpfen. Was die allgemeine Qualität im eigenen Klerus nicht gerade fördert.
Im September 1994 stand ich mit einer Tasche vor dem Eingang des Priesterseminars: das neue Leben begann! Natürlich war ich neugierig und auch sehr aufgeregt, weil ich nicht genau wusste, was mich da eigentlich erwarten würde. Trotzdem ging ich eigentlich mit einem relativ großen Selbstvertrauen in das Priesterseminar, weil ich ja sehr genau wusste, wohin die Reise gehen sollte: in die vertrauten Gefilde einer Kirchengemeinde, in die mir einigermaßen bekannte Arbeit als Priester. Ein paar notwendige Jahre Ausbildung, dann sollte es losgehen.
Das Priesterseminar selbst war ein durchaus ansprechendes Gebäude, Ende der 1960er Jahre erbaut. Es war ein schlankes Backsteingebäude, das sich um einen Innenhof schlängelte und sanft an einem Hügel lag, dem Kalwes. Das Seminar war etwas abgelegen, in der Nähe lag noch ein Studentenwohnheim, ansonsten gab es nur Wald und Felder. Im Sommer war es sehr schön, im Winter war es doch etwas trüb, wenn man vom Schreibtisch in den nackten und trostlosen Wald schauen musste. Unterhalb des Priesterseminars lag der Kemnader See, ein Stausee, der schön anzusehen war und den man sicherlich auch als Spaziergänger gut umlaufen konnte, was ich aber in all den Jahren nie geschafft habe. Weiter als bis zum ersten Biergarten bin ich nie gekommen.
Wie jedes Priesterseminar hörte es auf den plumpen Spitznamen „Kasten“. Dieser Spitzname hat damit zu tun, dass die riesigen barocken Priesterseminare aus längst vergangenen Zeiten, die sonst in den alten Bistumsstädten stehen, riesige Kästen sind, die für viele hundert Seminaristen vorgesehen waren. Das junge, erst 1958 gegründete Bistum Essen konnte natürlich nicht auf ein solches altes Seminar zurückgreifen und baute Ende der 1960er Jahre in der Nähe der ebenfalls soeben erst erbauten RuhrUniversität in Bochum ihr neues Studienkolleg im Stil der Zeit. Das Studienkolleg war ursprünglich für 120 Studenten geplant – eine Zahl, die nie erreicht wurde. Da auch die Zukunft keinen großen Ansturm erwarten ließ, hatte man daher damit begonnen, die alten kleinen Zimmer zu modernisieren und zu größeren Zimmern zusammenzulegen. Neben den Zimmern und Aufenthaltsräumen für die Seminaristen gab es verschiedene Arbeitsräume, Säle, Fernsehzimmer, einen Speisesaal, eine große Küche, die Räume des Sekretariats, Wohnungen für die Hausleitung, Ordensschwestern, Hausangestellte oder sonstige Gäste, eine Hausbar, eine gut ausgestattete Bibliothek usw. Es war also durchaus ein großes Haus, das durch seine Architektur dennoch nicht riesig und erschlagend wirkte.
Als Neulinge bezogen wir Zimmer, die in einem der älteren Trakte untergebracht waren. In den frisch renovierten Trakten gab es zu jedem Zimmer, das nun doppelt so groß war, ein Badezimmer und einen eigenen Telefonanschluss; in den alten Zimmern, die wir bezogen, musste man sich pro Etage – auf denen man zu siebt wohnte – eine Dusche, zwei Toiletten und ein Telefon teilen. Neben den Einzelzimmern gab es dann auf jeder Etage einen Etagenraum, in dem eine kleine Küche war und in dem man sich gemeinsam in der freien Zeit aufhielt.
In den ersten Wochen – vor dem Beginn des Semesters an der Universität – wurden wir in die Abläufe des Priesterseminars und der Universität eingeführt. Ältere Studenten zeigten uns die Universität und halfen uns bei der Einschreibung, die Hausleitung brachte uns nahe, wie das Priesterseminar funktioniert. Die Hausleitung bestand aus dem Direktor des Priesterseminars, dem Regens, und seinem Stellvertreter, dem Subregens, den ich ja bereits vorher kennengelernt hatte. Der Regens war ein Priester in den 40er Jahren, im Bistum durch zahlreiche Ämter gut vernetzt und einflussreich. Der Subregens, Anfang 30, promovierte an der Universität und nahm zusätzlich noch die Tätigkeit im Priesterseminar wahr. Diesen beiden zur Seite stand der Spiritual, ein älterer Priester in den Endsechzigern. Er bekleidete eine sehr interessante Funktion: er war nicht Teil der Hausleitung, sondern für unsere spirituelle Entwicklung zuständig. Diese war im Bereich des PrivatPersönlichen angesiedelt und damit nicht in der Zuständigkeit der Hausleitung. Das Kirchenrecht unterschied hier sehr klar zwischen dem „forum internum“, das eben im Bereich des persönlichen Gewissens anzusiedeln ist und den Spiritual als geistliche Begleitung betrifft, und dem „forum externum“, das öffentlich ist und die Hausleitung als Dienstherrn betrifft. Beide Bereiche waren strikt getrennt. So war es der Hausleitung verboten, mit dem Spiritual über Dinge zu sprechen, die das „forum internum“ von Studenten betrafen. Eine durchaus sinnvolle Unterscheidung, die für die Seminaristen einen wichtigen Schutz darstellte.
Im Priesterseminar lebten auch einige Ordensschwestern, Franziskanerinnen aus dem Münsterland, die als gute Hausgeister unterwegs waren. Insbesondere Küche und Kapelle waren ihre Reviere, die beide nicht unwichtig für den Alltag des Priesterseminars waren. Daneben gab es noch mehrere Angestellte, die ebenfalls im Haus wohnten. Unter ihnen besaß der Hausmeister eine besondere Bedeutung. Auch so etwas lernte man in einem solchen Haus: es ist zwar wichtig, mit der Hausleitung gut klarzukommen. Im Alltag kann es aber noch wichtiger sein, mit der Küche und dem Hausmeister gut klarzukommen. Für manchen Seminaristen war dies aus einem alten klerikalen Standesdenken heraus unmöglich und sie kritisierten diese, so wörtlich, „Fraternisierung mit dem Dienstpersonal“. Dafür musste ich nicht lange warten, wenn etwas im Zimmer kaputt war, und wusste auch, wie man nach der Schließung der Küche noch an Nahrhaftes kam. Nicht immer ist Standesdünkel hilfreich. Diese Äußerung mit der „Fraternisierung“ hatte mich damals sehr geärgert. Dieses „Dienstpersonal“ war in dem konkreten Fall ein Hausmeister, der eine Familie hatte und sich viel absparen musste, um seinem Sohn eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Ein Mann, der im Leben stand und sich im Leben bewiesen hatte. Auf der anderen Seite stand ein Seminarist, der gerade sein Abitur und danach die Aufnahme in das Priesterseminar geschafft hatte. Und ansonsten in seinem Leben noch nicht viel bewiesen hatte. Dass sich so jemand bereits in den ersten Wochen auf einer höheren Stufe sah als jemand, der 30 Jahre älter ist und ihn als „Dienstpersonal“ bezeichnete, zu dem man sich nicht herablassen durfte, schien mir unglaublich arrogant. Mit dem Einzug in das Priesterseminar begann bei einigen Seminaristen leider ein gewisser Standesdünkel, der durch nichts zu rechtfertigen war als durch ein eigentlich längst verflossenes Kirchen und Priesterbild.
Die Tage im Priesterseminar waren gut durchstrukturiert. An den Abenden war gewöhnlich um 18:00 Uhr ein Vespergebet in der Kapelle, anschließend um 18:30 Uhr eine Messfeier. Danach wurde gemeinsam im Speisesaal gegessen. Am Montagabend folgte dann die sog. „Hausrunde“, in der die kleinen und großen Alltäglichkeiten besprochen wurden. Anschließend war dann der „Barabend“: ein lockerer Wochenauftakt in der hauseigenen Bar, wo gewöhnlich das getan wurde, was man auch sonst in Bars macht: man trinkt ein leckeres Bier und hat einen lustigen Abend.
Am Donnerstagabend war der sog. Spiritualsabend: der Unterkurs (die Seminaristen in der 1. Studienhälfte) und der Oberkurs (die Seminaristen in der 2. Studienhälfte) erhielten vom Spiritual einen Vortrag zu spirituellen Themen. Diese Vorträge waren nicht immer die neuesten und auch nicht immer die spannendsten. Aber vielleicht war das eigentliche Ziel dieser Vorträge ja eine eher meditative Einkehr. Im persönlichen Umgang war der Spiritual ein sehr angenehmer, gebildeter und herzlicher Mensch. Aber diese Vorträge waren nach mitunter langen UniTagen durchaus eine Herausforderung.
Nach dem Spiritualsvortrag war dann in der Hauskapelle die Komplet, das traditionelle Abendgebet der Kirche. Anschließend war der „Stille Abend“, der dem Gebet und der Meditation gewidmet sein sollte, gewöhnlich aber allein deshalb das Haus still machte, weil alle Seminaristen ausflogen, um irgendwo ein Bier zu trinken. Die äußere Form wurde aber eisern durchgehalten, was dazu führte, dass ein Seminarist, der sich im Hof vor dem Eingang des Priesterseminars den Fuß brach (also auswärts am Stillen Abend!), erst einmal in seine eigene Etage getragen wurde, bevor man den Notarzt informierte. Dass das Opfer später ausgerechnet Kirchenrechtler werden sollte, macht diese Geschichte noch einmal interessanter.
Etwa an jedem zweiten Wochenende war Programm im Priesterseminar. Das bedeutete, dass gewöhnlich auswärtige Referenten eingeladen wurden, mit denen am Samstag thematisch gearbeitet wurde: theologische und spirituelle Themen, aber auch Politik, Gesellschaft und Kunst standen auf dem Programm. Am Sonntag war dann nach dem Gottesdienst und dem Mittagessen Schluss. An den anderen beiden Wochenenden im Monat war bereits am Freitagnachmittag oder Samstagmittag Schluss („ganz freies“ bzw. „halb freies“ Wochenende).
Dieses Wochenprogramm klingt durchaus üppig. Das war es sicherlich auch, man muss aber berücksichtigen, dass andere Bistümer sehr viel ausufernder in ihren Seminaren verfahren sind. Zudem hatten wir im Bistum Essen das Glück, dass wir fast alle aus dem Ruhrgebiet und damit aus der näheren Umgebung kamen und so relativ schnell und auch mal zwischendurch nach Hause fahren konnten. In anderen Bistümern gab es oft größere Entfernungen und damit weniger Möglichkeiten, der Heimat einen Besuch abzustatten.
An den Wochentagen stand tagsüber natürlich die Universität im Vordergrund. Ein Studium der Theologie brauchte normalerweise fünf Jahre – wenn alles glatt lief. Haupthindernis in den ersten Semestern waren die alten Sprachen: Latein und Griechischkenntnisse waren Pflicht; wer beide Sprachen von der Schule mitbrachte, bekam als Belohnung die Aufgabe, auch noch Hebräisch zu lernen. Danach war die Phantasie der Studienordnung immerhin erschöpft, was für mich sehr erfreulich war: da ich in Mülheim auf einem humanistischen Gymnasium gewesen war, hatte ich bereits alle drei Sprachen vorzuweisen und konnte im ersten Semester dann aufstehen, wenn die anderen vom GriechischUnterricht zurückkamen. Insgesamt gab es an der RuhrUniversität 14 verschiedene Fächer innerhalb der Theologie: von der Kirchengeschichte zur Liturgie, vom Kirchenrecht zur Bibelwissenschaft, von der Dogmatik zur Philosophie. Natürlich hat das Hausprogramm durchaus zeitliche Ressourcen gebunden, die dann im Studium fehlten. Man hatte dennoch große Vorteile im Studium, weil man immer ältere Studenten griffbereit hatte, die einem mit Tipps und Prüfungsskripten aushelfen konnten. Ganz abgesehen von einer gut ausgestatteten Hausbibliothek, die einem viele lästige Gänge in die UniBibliothek abnahm.
Parallel zum Studium und zum Hausprogramm lief die persönliche Ausbildung: Sprecherziehung, Gesangsausbildung usw. Die Semesterferien verbrachte man gewöhnlich zu Hause, in meinem Fall bei den Eltern. Es sei denn, man musste in den Ferien ein Praktikum machen. Von diesen gab es im Laufe der Ausbildung verschiedene: ein Praktikum in einem Industriebetrieb (um das „normale“ Arbeitsleben kennenzulernen), das man im ersten Studienabschnitt absolvierte, sowie ein Krankenhaus, ein Gemeinde und ein Schulpraktikum, die später folgten.
Einmal im Jahr ging es für eine Woche ins Kloster zu den sog. „Exerzitien“. Diese waren keine Gemeinschaftsveranstaltungen, sondern jeder schaute individuell, zu welchem Orden oder zu welchem Kloster es einen hinzieht, um ein paar besinnliche Tage zu erleben. Ich habe mich durchgehend für BenediktinerKlöster entschieden. Wenn schon Kloster, dann das Original. Wie sah das Leben in einem solchen Kloster aus? Der Tagesablauf wurde von den Gebetszeiten strukturiert. In aller Frühe ging es los mit der Vigil und der Laudes, je nach Kloster zwischen 5:00 Uhr und 5:30 Uhr. Anschließend folgte eine Stillezeit in der Kirche, dann ging es zum Frühstück. Um 9:00 Uhr die Messe, um 12:00 Uhr die Mittagshore, dann das Mittagessen; um 17:30 Uhr folgte die Vesper, anschließend das Abendessen; um 20:00 Uhr die Komplet, anschließend Nachtruhe.
Ich muss gestehen, dass ich vorher nie begreifen konnte, wie man sich für ein derartiges Leben in einem Kloster entscheiden kann. Nachdem ich selbst zumindest für diese jeweils kurzen Zeitspannen immer wieder in einem Kloster gelebt habe, muss ich sagen, dass ich irgendwann zumindest nachvollziehen konnte, wenn sich jemand dafür entscheidet. Nicht, dass ich jemals ernsthaft für mich eine solche Alternative erwogen hätte, aber ich konnte verstehen, dass jemand sich auf einen solchen Weg begab. Viele Menschen blicken verstört auf eine klösterliche Lebensform, weil sie eigentlich allem widerspricht, was sie für ein Leben als unbedingt nötig und unverzichtbar halten: hohe Individualität und persönliche Freiheit. Die Aussicht, sich freiwillig in ein Gefängnis zu begeben, ist wenig verlockend. Zudem erscheint das, was diese Menschen da hinter den Klostermauern verrichten, völlig sinnlos: wie kann man im Beten den Sinn seines Lebens erkennen? Wäre es nicht sinnvoller, diese Menschen würden in der Welt etwas „machen“? Sich einsetzen gegen die Armut zum Beispiel? Die Antwort ist abhängig davon, worin man den Sinn seines Lebens sieht. Diese Menschen im Kloster sehen diesen Sinn in einer derart radikalen Art und Weise in Gott, dass sie eine Lebensform wählen, die sehr uneingeschränkt diesem Gott und der Suche nach ihm gewidmet ist. Diese Entscheidung ist legitim, auch wenn ich selbst sie in dieser Form nicht treffen könnte. Bei meinen Aufenthalten im Kloster habe ich diesem Leben dort durchaus etwas abgewinnen können: man kommt dort wirklich zur Ruhe. Nicht zufällig waren sehr oft Führungskräfte aus der Wirtschaft oder der Politik ebenfalls zu Gast im Kloster, um genau diese Ruhe zu suchen. Ich habe mich im Kloster jedes Mal sehr wohl gefühlt, war aber nach einer Woche auch wieder froh, wenn es heimwärts ging.
Es war eine reichhaltige und vielseitige Ausbildung, die man im Priesterseminar und an der Universität erhielt. Ich habe mich mit den meisten anderen Seminaristen gut verstanden, war aber trotzdem kein großer Freund des Seminarlebens, das ich oft als zu eng und zu durchstrukturiert empfand. Ich habe mich immer wieder gefragt, welchen Sinn es macht, klosterähnlich kaserniert und an ein Leben in einer Gemeinschaft herangeführt zu werden, wenn man später als priesterlicher Einzelkämpfer in die Welt geschickt wird.
Natürlich geht es bei dieser Form der Ausbildung auch um Formung. Legitimerweise. Denn es ist ja durchaus das Recht der Kirche, eine Personengruppe, die eine derart zentrale Aufgabe in der Kirche übernehmen soll, in der Ausbildung eng zu führen und im Sinne dieser späteren Aufgabe zu formen. Vor einigen hundert Jahren war das anders. Der katholische Klerus befand sich bildungstechnisch in einem grottenschlechten Zustand: faktisch gab es keine Ausbildung. Um als Geistlicher in einem Dorf als Pfarrer aktiv zu werden, reichte es, wenn man die Riten mehr oder weniger würdig hinbekam. Dass aus der lateinischen Formel der Messfeier „Hoc est enim corpus meum“ das Wort „Hokuspokus“ entstand, mag vor allem an den miserablen Latein und Lesekenntnissen vieler Geistlicher gelegen haben, die da irgendetwas Unverständliches und Phantasievolles vor sich hin genuschelt haben. Durch den großen Druck der Reformation und ihrer gut ausgebildeten Pfarrer musste die katholische Kirche reagieren und führte Ende des 16. Jahrhunderts die Priesterseminare als Ausbildungsstätten für den Klerus ein. Es sollte jedoch noch bis zum 19. Jahrhundert dauern, bis dieses Bildungssystem sich überall durchgesetzt hatte.
Vor diesem Hintergrund ist die Existenz eines Priesterseminars durchaus verständlich. Ob diese Art der Ausbildung heute noch zeitgemäß ist und ob ich persönlich daran Gefallen finden konnte, steht dabei auf einem anderen Blatt. Naturgemäß hatten vor allem ältere Seminaristen, die vorher schon etwas anderes studiert oder eine Berufsausbildung gemacht hatten, größere Probleme mit diesen Abläufen als die jungen Seminaristen, die frisch aus ihrem Elternhaus kamen und es eher gewöhnt waren, sich an vorgegebenen Abläufen orientieren zu müssen. Und das muss man in diesem Kontext noch einmal betonen: es geht in dieser Bildungsform nicht darum, aus den Seminaristen eigenständige und selbständige Köpfe zu machen.
Mit mir begannen sechs andere Seminaristen ihr Studium. Insgesamt lebten zu diesem Zeitpunkt etwa 2025 Seminaristen im Priesterseminar. Die Zahl sollte im Laufe der Jahre insgesamt stark abfallen, durch immer weniger Eintritte, aber auch durch Austritte, die nicht wie früher kompensiert werden konnten. Es hieß bereits zu Beginn des Studiums, dass etwa die Hälfte der Seminaristen durchkommt und zum Priester geweiht wird. Diese Schätzung hat sich auch zu meiner Seminarzeit bestätigt. Einige wurden gebeten, das Haus zu verlassen: Hauptgründe waren hier Probleme in der Persönlichkeitsstruktur oder mangelnde Studienleistungen. Die meisten gingen jedoch aus eigenem Antrieb, weil sie nicht zölibatär, sondern in einer Beziehung leben wollten, weil sie an entscheidenden Punkten Schwierigkeiten mit der kirchlichen Lehre hatten oder weil sie einfach merkten, dass der Priesterberuf nichts für sie ist.
Ich lebte mich in den ersten Monaten ein, besuchte die Vorlesungen und Seminare an der Universität und war bemüht, mich an das Leben im Priesterseminar zu gewöhnen. Es war nicht nur eine Herausforderung, in die neuen Strukturen des Seminars hineinzufinden, sondern auch, sich an das Zusammenleben mit so vielen, doch recht unterschiedlichen Menschen zu gewöhnen. Wir waren eine bunte Schar von jungen Männern, denen bewusst war, ihr späteres Leben als Einzelkämpfer zu fristen. Wenn eine solche Schar auf engem Raum zusammenleben muss, dann ist es nur natürlich, dass sich Reibereien und Konflikte ergeben. Ganz abgesehen von individuellen Angewohnheiten, die das Zusammenleben auf einer Etage zur Hölle machen können. Damit meine ich noch nicht mal die Klassiker wie Haare in der Dusche, das zu laute Hören von Musik oder den Abwasch der Kaffeetassen im Etagenraum, sondern durchaus schwerwiegende Dinge wie das Erlernen eines neuen Musikinstruments wie einem Dudelsack oder die Bekämpfung von Erkältungskrankheiten mit dem exzessiven Verzehr mehrerer Knoblauchknollen.
Eines schönen, sonnigen Tages betrat der Regens mit bedeutungsschwerer Miene den Speisesaal und teilte der versammelten Seminaristenschar mit, dass am Vormittag drei Herren das Haus verlassen haben und nicht mehr im Priesterseminar wohnen. Weitere Angaben machte er nicht. Natürlich kam schnell heraus, worum es ging: zwei Seminaristen hatten einen dritten sexuell erpresst. Als es herauskam, wurden jene beiden gefeuert; das Opfer der Erpressung zog es ebenfalls vor, das Haus zu verlassen.
Ich vermute mal, dass die alten Hasen unter den Seminaristen von dieser unappetitlichen Geschichte bereits vorher genug mitgekriegt und gesehen hatten. Für mich als Neuling, der noch blind und naiv über die Seminargänge tapperte, war diese Geschichte ein Schock. Derartiges war für mich absolut unvorstellbar in einem Priesterseminar oder in einem kirchlichen Umfeld gewesen. Ich konnte überhaupt nicht begreifen, wie Männer, die sich auf den Priesterberuf vorbereiten, etwas Derartiges tun konnten. Das sind Männer, die daran glauben, dass ihr Leben von Gott getragen ist, die es zur Lebensaufgabe machen wollen, dass ihr ganzes Dasein von Gott erfüllt ist … und dann machen die sowas? Es war für mich absolut unbegreiflich und ein großer Schock, der sich nicht nur auf die beiden bezog, sondern auch auf die Kirche. Auch sie hatte ein Stück weit ihre Unschuld verloren. Bis dahin hatte ich nicht geglaubt, dass solche Menschen überhaupt jahrelang in der Kirche funktionieren könnten. Zumindest deckte es sich nicht mit meinen Erfahrungen, die ich in meiner guten, alten St.BarbaraGemeinde gemacht hatte. Nun wusste ich: es geht. Und ich wusste auch, dass die Kirche sehr aufmerksam sein muss mit ihren eigenen Leuten.
Theologie
Ich war in der Schule ein stinkfauler Hund. In der Grundschule im heimischen Dümpten war ich der große Überflieger, der Bestnoten abstaubte, ohne sich irgendwie anstrengen zu müssen. Ich wechselte auf das OttoPankokGymnasium in MülheimMitte und stellte fest, dass die Noten zwar noch gut, aber nicht mehr berauschend waren. Ich hatte zwei Möglichkeiten: etwas fleißiger zu werden oder die Noten weiter absacken zu lassen. Ich entschied mich zielsicher für Letzteres und wurde einer der Faulsten in meiner Schulklasse. Der Grund war ganz einfach: es interessierte mich überhaupt nicht, was die mehr oder weniger bemühten Lehrer mir vermitteln wollten. Entsprechend sackten die Noten immer weiter ab. Mein Abitur mit 3,0 entsprach daher nicht gerade dem, was man sich erträumen würde, aber für das Bestehen und das gewünschte Studium reichte es.
Mit dieser in der Schule jahrelang erprobten Arbeitseinstellung blickte ich auf das anstehende Studium. Ich weiß noch, wie ich meinen alten Heimatpfarrer, Pastor Buschmann, vor dem Studium sorgenvoll fragte, ob das denn anstrengend sei und ob man viel tun müsse. Er beruhigte mich, und so konnte ich frohen Mutes starten. In dem sicheren Wissen, im Studium das zu tun, was nötig ist, und dann eben Priester zu werden.
Entgegen meiner eigenen Erwartung habe ich an der Universität jedoch die Rakete gezündet. In der Schule hatte es nur ein Fach gegeben, das mich wirklich interessiert hatte: Geschichte. Mit entsprechender Motivation setzte ich mich in die Vorlesung im Fach „Alte Kirchengeschichte“ bei Prof. Wilhelm Geerlings. Wie der Name dieses Fachs bereits verrät, ging es um die Frühgeschichte der Kirche, also um die ersten Jahrhunderte, in denen die Kirche sich und ihre Lehre geformt hat.
Thema in diesem Semester waren die ersten vier Konzilien. In der Frühzeit der Kirche stand man vor folgendem Problem: man hatte die jüdische Bibel und andere, jüngere Schriften, die etwas von Leben und Lehre Jesu erzählten. Aber wie kann und wie muss man sie verstehen? Die jüdische Bibel ist als Buch im Laufe von Jahrhunderten entstanden und dementsprechend vielschichtig und widersprüchlich. Die neueren Schriften, die seit Beginn des Christentums gesammelt wurden und die das Leben von Jesus und den frühen Christen erzählen, sind ebenfalls oft sehr vage und unpräzise: Was heißt es, dass er der Sohn Gottes ist? Ist er jetzt auch Gott oder ist er Mensch? Wie kann ein Gott am Kreuz sterben? Oder ist er da gar nicht gestorben? Was heißt dann Auferstehung? Was soll eigentlich der Heilige Geist sein, von dem immer wieder die Rede ist? Um diese Fragen rangen die Lehrer der alten Kirche viele hundert Jahre lang, ohne sich einigen zu können. Als das Christentum nicht mehr verfolgt wurde und im 4. Jahrhundert nach und nach zur Staatsreligion im römischen Reich wurde, konnte man endlich das tun, was vorher nicht möglich war: sich in großem Stil zusammensetzen, debattieren und Entscheidungen treffen. Im 4. und 5. Jahrhundert fanden dann vier allgemeine Konzilien statt, in denen all diese Fragen geklärt wurden: Nikaia 325, Konstantinopel 381, Ephesus 431 und Chalkedon 451. Auf diesen Konzilien wurde nach und nach beschlossen, was noch heute von den verschiedenen christlichen Kirchen, ob katholisch, evangelisch oder orthodox, als Grundlage der kirchlichen Lehre gilt und im Glaubensbekenntnis formuliert ist.
Wesentlich ging es bei diesen Konzilien um zwei Problemkreise: ob und wie gehören Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen? Und: ob und wie sind Gottheit und Menschheit in Christus zusammen zu denken? Die hart erkämpfte Antwort der Konzilien: Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden in der Dreifaltigkeit eine Dreiheit der Personen in der Einheit eines Wesens. Jesus Christus ist gleichzeitig Gott und Mensch; in seiner Person sind die beiden Naturen, so das Konzil von Chalkedon, „unvermischt und unveränderlich, ungetrennt und ungesondert“ vereint.
Ich hörte diese Aussagen in der Vorlesung und verstand kein Wort. Das ließ mir aber keine Ruhe. Denn schließlich war das ja die Grundlage! Ich wollte ja wissen, was Gott ist, ich wollte verstehen, was die Kirche da Grundlegendes über Gott definiert hat. Also versuchte ich diese Aussagen der Konzilien zu verstehen – als theologische, studentische Aufgabe, aber auch als spirituelle Aufgabe. Schließlich ging es um meinen Gott und von dem wollte ich ja etwas wissen.