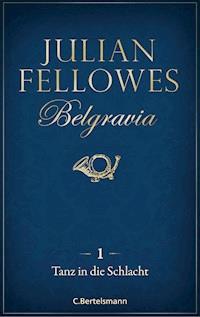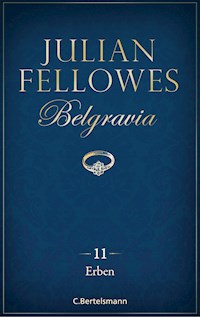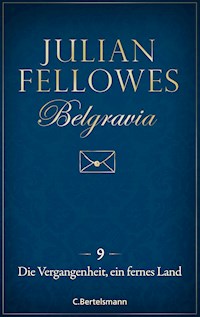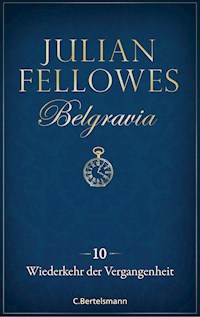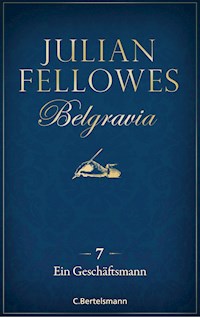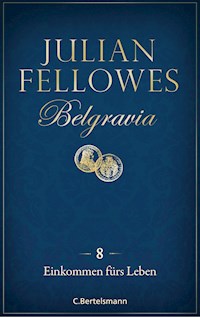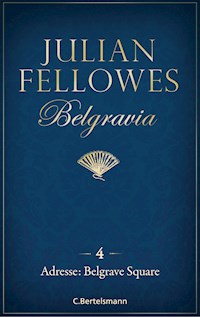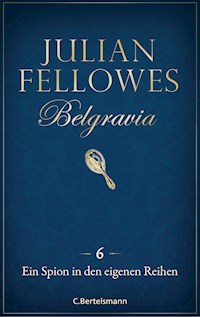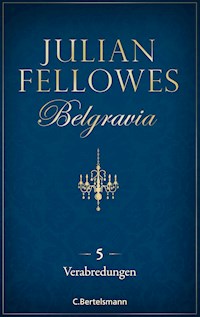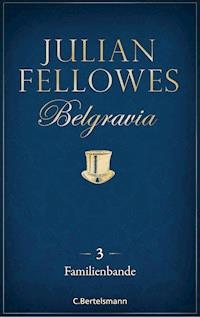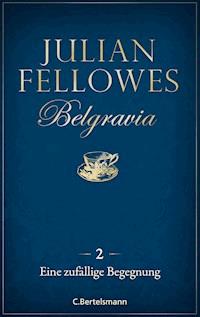9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erfolgsautor mit der großen Familiensaga nach »Downton Abbey«
»Belgravia« – mit seinem neuen Roman setzt der Schöpfer der Erfolgsserie »Downton Abbey« Julian Fellowes dem nobelsten Londoner Stadtteil ein großartiges Denkmal. Dabei entführt er seine Leser mitten ins 19. Jahrhundert, wo alter Hochadel, neureiche Unternehmer und korrupte Dienstboten aufeinandertreffen und die Liebe sich den Standesgrenzen widersetzt … Überaus spannend lässt Julian Fellowes in »Belgravia« eine versunkene Welt lebendig werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
London, 1841. James Trenchard ist ein ehrgeiziger Mann, der sich mit seinem Baugewerbe einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat. Vor 25 Jahren starb seine Tochter im Kindbett. Ihr Sohn Charles, Spross einer heimlichen Liaison mit einem Mann aus dem Hochadel, wurde in die Obhut eines Geistlichen gegeben und seine Herkunft vertuscht. Jetzt droht das Familiengeheimnis enthüllt zu werden. Einzig die beiden Großmütter Anne Trenchard und Lady Brockhurst können den Enkelsohn vor üblen Machenschaften bewahren. Trotz des unterschiedlichen gesellschaftlichen Standes müssen sie gemeinsam für den Enkel einstehen. Können sie das Geheimnis um Charles’ Herkunft lüften und alles zum Guten wenden? Und wird er die Frau heiraten können, die er liebt, obwohl sie einem anderen versprochen ist?
Autor
Julian Fellowes wurde 1949 in Ägypten geboren, wuchs in England auf und studierte in Cambridge. Er ist Schauspieler und preisgekrönter Autor von Romanen, Drehbüchern und Theaterstücken; für »Gosford Park« wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet, die Serie »Downton Abbey« hat ihn weltweit berühmt gemacht. 2009 wurde er in den Adelsstand erhoben. Julian Alexander Kitchener-Fellowes, Baron Fellowes of West Stafford, lebt mit seiner Frau Emma im Südwesten der englischen Grafschaft Dorset.
Auf Deutsch liegen außerdem seine Romane »Snobs« und »Eine Klasse für sich vor«.
Julian Fellowes
Belgravia
Roman
Aus dem Englischen von Maria Andreas
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Belgravia« im Verlag Weidenfeld & Nicolson, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., London.
Copyright © 2016 by Julian Fellowes
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Cornelia Niere, München Covermotiv: © Lee Avison , Philip Askew, Ilina Simeonova / Trevillion Images; Marc Owen/Arcangel
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20517-1 V004 www.cbertelsmann.de
Meiner Frau Emma gewidmet,ohne die nichts in meinem Lebenso ganz gelingen könnte
Tanz in die Schlacht
Die Vergangenheit – wir haben es schon oft gehört – ist ein fernes Land, dort gelten andere Regeln. Das mag zutreffen, ganz augenfällig sogar, was Sitten und Moral angeht, die Rolle der Frau, die Herrschaft der Aristokratie und Millionen Alltagsdinge. Anderes wiederum mutet uns sehr ähnlich an. Ehrgeiz, Neid, Zorn, Habgier, Güte, Selbstlosigkeit und vor allem anderen die Liebe haben Entscheidungen schon immer ebenso machtvoll mitbestimmt wie heute. Diese Geschichte handelt von Menschen, die vor zweihundert Jahren lebten, aber wonach sie sich sehnten, womit sie haderten, die Leidenschaften, die in ihren Herzen wüteten, das alles gleicht nur zu oft den Dramen, die wir in unserer Zeit, auf unsere Art durchleben …
Die Stadt wirkte nicht gerade wie kurz vor Kriegsausbruch, noch weniger wie die Hauptstadt eines Landes, das vor kaum drei Monaten einem Königreich entrissen und einem anderen einverleibt worden war. Im Juni 1815 schien Brüssel ein einziges Fest, die Menschen drängten sich vor den bunten Marktständen, und durch die breiten Avenuen rollten offene, in auffälligen Farben lackierte Kutschen, die ihre Fracht, hochnoble Damen und deren Töchter, zu dringlichen gesellschaftlichen Verpflichtungen beförderten. Niemand hätte vermutet, dass Napoleon Bonaparte auf dem Vormarsch war und jeden Augenblick am Rand der Stadt sein Lager aufschlagen konnte.
Das alles interessierte Sophia Trenchard wenig, als sie sich einen Weg durch die Menge bahnte, mit einer Entschlossenheit, die ihre achtzehn Jahre Lügen strafte. Wie jede wohlerzogene junge Frau, noch dazu, wenn sie sich im Ausland aufhielt, wurde sie von ihrer Zofe begleitet, Jane Croft, mit ihren zweiundzwanzig Jahren ihrer Herrschaft um vier Jahre voraus. Aber wenn man von einer der beiden Frauen behaupten konnte, dass sie die andere vor schmerzhaften Zusammenstößen schützte, dann von Sophia, die sichtlich bereit war, es mit allem aufzunehmen. Sie war hübsch, auf ihre blonde, blauäugige, klassisch englische Art sogar sehr hübsch, aber der überaus scharfe Schnitt ihres Mundes verriet, dass diese junge Dame keine Erlaubnis ihrer Frau Mama einholen würde, um sich in ein Abenteuer zu stürzen. »Ein bisschen Beeilung, bitte, sonst ist er schon beim Lunch, und unser Ausflug war umsonst.« Sie steckte in einer Lebensphase, die fast jeder Mensch durchmachen muss, wenn er die Kindheit hinter sich gelassen hat und in einem Gefühl scheinbarer Reife, unbehelligt von Erfahrungen, alles für möglich hält. So lange jedenfalls, bis er wirklich erwachsen wird und das Leben ihn mit Nachdruck eines Besseren belehrt.
»Ich gehe, so schnell ich kann, Miss«, murmelte Jane, und wie zum Beweis wurde sie von einem vorbeieilenden Husaren zur Seite gestoßen; der Mann blieb nicht einmal stehen, um zu sehen, ob er sie verletzt hatte. »Das ist ja wie auf dem Schlachtfeld hier.« Jane war keine Schönheit wie ihre junge Herrschaft, hatte aber ein lebhaftes, rotbackiges Gesicht mit robusten Zügen und hätte wohl besser aufs Land gepasst als in die Großstadt.
Auf ihre Art war sie sehr resolut, was ihre junge Herrschaft an ihr schätzte. »Nur keine Schwäche vortäuschen.« Sophia hatte ihr Ziel fast erreicht und bog von der Hauptstraße in einen Hof, der einst ein Viehmarkt gewesen sein mochte, nun aber von der Armee als Versorgungslager requiriert worden war. Von großen Wagen wurden Kisten und Säcke abgeladen und in die umgebenden Lagerhäuser geschafft; es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen von Offizieren aus jedem Regiment, die sich in Gruppen beratschlagten und zuweilen auch stritten. Die Ankunft einer aparten jungen Frau und ihrer Zofe blieb nicht unbemerkt; die Gespräche ebbten ab, verstummten fast. »Bitte lassen Sie sich nicht stören«, sagte Sophia und sah sich ruhig um. »Ich bin auf dem Weg zu meinem Vater, Mr Trenchard.«
Ein junger Mann trat vor. »Wissen Sie, wohin, Miss Trenchard?«
»Ja, vielen Dank.« Sie ging auf einen etwas imposanteren Eingang im Hauptgebäude zu und stieg, die aufgelöste Jane im Schlepptau, die Treppe zum ersten Stock hinauf. Hier traf sie auf weitere Offiziere, die offenbar darauf warteten, vorgelassen zu werden. Aber Sophia dachte gar nicht daran, sich in die Schlange einzureihen, sondern stieß gleich die Tür auf. »Sie bleiben inzwischen hier«, sagte sie zu Jane. Die trat ein paar Schritte zurück und hatte durchaus nichts dagegen, von den Männern neugierig beäugt zu werden.
Der Raum, den Sophia betrat, war groß, hell und ansprechend, eingerichtet mit einem stattlichen Schreibtisch aus poliertem Mahagoni und weiteren Möbeln im selben Stil, aber er diente dem Geschäft, nicht der Geselligkeit, man kam zur Arbeit her und nicht zum Vergnügen. In der Ecke musste sich ein Offizier in Galauniform die Belehrungen eines korpulenten Mannes Anfang vierzig gefallen lassen. Der kleine Dicke fuhr angesichts der Störung herum: »Wer zum Teufel platzt hier so einfach herein?« Doch beim Anblick seiner Tochter hob sich seine Laune sofort, und in seinem zornroten Gesicht leuchtete ein zärtliches Lächeln auf. »Ja?«, sagte er. Sophia warf einen Blick zu dem Offizier. Ihr Vater nickte. »Captain Cooper, Sie müssen mich entschuldigen.«
»Schön und gut, Trenchard …«
»Trenchard?«
»Mr Trenchard. Aber wir müssen das Mehl noch heute Abend haben. Ich musste meinem befehlshabenden Offizier versprechen, nicht ohne Mehl zurückzukehren.«
»Und ich verspreche Ihnen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, Captain.« Der Offizier war sichtlich verärgert, musste sich aber damit zufriedengeben, weil er nichts Besseres mehr erwarten konnte. Mit einem Nicken zog er sich zurück, und der Vater blieb mit seiner Tochter allein. »Hast du sie?« Seine Aufregung war mit Händen zu greifen, seine Begeisterung fast anrührend: Dieser beleibte Geschäftsmann mit dem schütteren Haar war plötzlich aufgekratzt wie ein kleines Kind an Heiligabend.
Sophia trieb die Spannung bis zum Äußersten; ganz langsam öffnete sie ihren Pompadour und zog behutsam ein paar weiße Karten hervor. »Ich habe drei.« Sie kostete ihren Triumph voll aus. »Eine für dich, eine für Mama und eine für mich.«
Er riss sie ihr geradezu aus der Hand. Nach einem Monat hungern und dürsten hätte er nicht gieriger sein können. Der Kupferdruck war von schlichter Eleganz:
Die Duchess of Richmond
lädt in ihr Palais
Rue de la Blanchisserie 23
Donnerstag, 15. Juni 1815
Kutschen ab drei Uhr Tanz ab zehn Uhr
Er starrte auf die Einladungen. »Vermutlich ist Lord Bellasis schon vorher geladen, zum Dinner?«
»Sie ist seine Tante.«
»Natürlich.«
»Es wird kein Dinner geben. Kein offizielles. Nur für die Familie und ein paar Leute, die bei ihnen zu Besuch sind.«
»Es heißt immer, dass es kein Dinner gibt, aber in der Regel gibt es doch eins.«
»Du hast doch nicht erwartet, dass du dazugebeten wirst?«
Er hatte davon geträumt, aber nicht damit gerechnet. »Nein. Nein. Ich freue mich sehr.«
»Edmund meint, irgendwann nach Mitternacht wird ein Souper serviert.«
»Edmund darfst du ihn nur vor mir nennen, vor niemandem sonst.« Doch seine fröhliche Laune war wiederhergestellt, die flüchtige Enttäuschung durch den Glanz des Bevorstehenden weggewischt. »Du musst gleich zu deiner Mutter zurück. Sie wird jede Minute für die Vorbereitungen brauchen.«
Sophia war zu jung und besaß zu viel unverdientes Selbstvertrauen, um zu erfassen, was sie da Ungeheuerliches erreicht hatte. Außerdem dachte sie praktischer als ihr Papa, der von der vornehmen Welt wie hypnotisiert war. »Es ist ohnehin zu spät, um neue Kleider nähen zu lassen.«
»Aber nicht zu spät, um alte aufzuputzen.«
»Mama wird nicht hingehen wollen.«
»Wird sie aber, weil sie muss.«
Sophia wandte sich zur Tür, doch dann fiel ihr noch etwas ein. »Wann sagen wir es ihr?« Sie sah ihren Vater eindringlich an. Die Frage überrumpelte ihn; er begann, mit den goldenen Schlüsselringen an seiner Uhrkette zu klimpern. Es war ein merkwürdiger Moment. Alles schien noch wie einen Augenblick zuvor, aber der Ton und der Inhalt des Gesprächs hatten sich verändert. Jedem Außenstehenden wäre klar gewesen, dass Vater und Tochter plötzlich von Gewichtigerem sprachen als von der Wahl der Garderobe für den Ball der Duchess.
Trenchard antwortete sehr bestimmt. »Noch nicht. Alles muss korrekt vonstatten gehen. Wir sollten auf ein Zeichen von ihm warten. Und jetzt fort mit dir. Schick diesen dummen Schwätzer wieder herein.« Seine Tochter tat wie geheißen und schlüpfte hinaus, aber noch nach ihrem Verschwinden hing James Trenchard seltsam unruhigen Gedanken nach. Dann ging die Tür auf, und Captain Cooper trat herein. Trenchard nickte ihm zu. Zeit, wieder zur Tagesordnung überzugehen.
Sophia hatte recht. Ihre Mutter wollte nicht auf den Ball gehen. »Wir sind nur gefragt worden, weil jemand abgesagt hat.«
»Was macht das schon?«
»Es ist einfach Unsinn.« Mrs Trenchard schüttelte den Kopf. »Wir werden dort keine Menschenseele kennen.«
»Papa wird Leute kennen.«
Es gab Momente, in denen Anne Trenchard sich über ihre Kinder ärgerte. Sie wussten so wenig vom Leben, und dann diese herablassende Art! Sie waren von klein auf nach Strich und Faden verwöhnt worden, ihr Vater hatte sie verhätschelt, bis sie beide ihre glücklichen Lebensumstände für selbstverständlich hielten und kaum einen Gedanken daran verschwendeten. Sie wussten nichts von dem Weg, den ihre Eltern gegangen waren, aber ihre Mutter erinnerte sich an jeden winzigen Schritt auf dem steinigen Pfad. »Er wird ein paar Offiziere kennen, die zu ihm ins Kontor kommen und Proviant ordern. Die werden nicht schlecht staunen, wenn sie den Ballsaal mit dem Mann teilen, der ihre Leute mit Brot und Bier beliefert.«
»Ich hoffe, vor Lord Bellasis wirst du nicht so reden.«
Mrs Trenchards Züge wurden ein wenig weicher. »Liebes«, sagte sie und nahm die Hand ihrer Tochter zwischen die ihren, »hüte dich vor Luftschlössern.«
Sophia riss ihre Hand los. »Du traust ihm natürlich keine ehrenhaften Absichten zu.«
»Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass Lord Bellasis ein ehrenhafter Mann ist. Und ganz gewiss sehr liebenswert.«
»Na also.«
»Aber er ist der älteste Sohn eines Earls, mein Kind, mit aller Verantwortung, die eine solche Position mit sich bringt. Er kann bei der Wahl seiner Frau nicht nur sein Herz sprechen lassen. Das nehme ich ihm nicht übel. Ihr seid beide jung und seht blendend aus, und ihr habt euren kleinen Flirt genossen, der keinem von euch geschadet hat. Bisher.« Dem letzten Wort gab sie besonderes Gewicht, ein klarer Hinweis, worauf sie hinauswollte. »Aber das muss aufhören, bevor schädliches Gerede aufkommt, sonst wirst du darunter zu leiden haben, Sophia, nicht er.«
»Und dass er uns Einladungen zu dem Ball seiner Tante verschafft hat, bedeutet für dich gar nichts?«
»Es bedeutet für mich nur, dass du ein reizendes Mädchen bist und er dir eine Freude machen möchte. In London wäre ihm das nicht gelungen, aber in Brüssel wirft der Krieg auf alles seine Schatten und setzt die normalen Regeln außer Kraft.«
Letztere Bemerkung brachte Sophia mehr auf als alles andere. »Du meinst, nach den normalen Regeln sind wir für die Freunde der Duchess keine akzeptable Gesellschaft?«
Auf ihre Art stand Mrs Trenchard ihrer Tochter an Charakterstärke nicht nach. »Genau das meine ich, und du weißt, dass es stimmt.«
»Papa wäre anderer Meinung.«
»Dein Vater hat erfolgreich einen weiten Weg zurückgelegt, weiter, als es sich die meisten Leute vorstellen können. Deshalb ist er blind für die natürlichen Grenzen, die seinem Aufstieg gesetzt sind. Sei zufrieden mit dem, was wir heute sind. Dein Vater hat es in der Welt weit gebracht. Darauf kannst du stolz sein.«
Die Tür ging auf, und Mrs Trenchards Zofe trat mit dem Kleid für den Abend ein. »Komme ich zu früh, Madam?«
»Nein, gar nicht, Ellis. Kommen Sie nur herein. Wir waren fertig, nicht wahr?«
»Wenn du meinst, Mama.« Sophia verließ das Zimmer, aber ihr hochgerecktes Kinn verkündete, dass sie sich noch lange nicht geschlagen gab.
Ellis schwieg nachdrücklich, während sie ihren Pflichten nachging, ein Zeichen, dass sie nur so brannte vor Neugier, worüber die beiden Frauen gestritten hatten. Doch Anne ließ sie ein paar Minuten zappeln; sie wartete, bis Ellis ihr Nachmittagskleid aufgeknöpft hatte und sie es von den Schultern gleiten lassen konnte.
Dann sagte sie: »Wir sind am Fünfzehnten zum Ball der Duchess von Richmond eingeladen.«
»Ist nicht wahr!« Mary Ellis war in der Regel mehr als geschickt darin, ihre Gefühle zu verbergen, aber diese Nachricht überrumpelte sie schlichtweg. Doch sie erholte sich rasch. »Das heißt, wir sollten eine Entscheidung über Ihre Garderobe treffen, Madam. Ich brauche Zeit, um sie herzurichten, wenn es denn so ist.«
»Wie wäre es mit dem seidenen Dunkelblauen? Ich habe es in dieser Saison nicht oft getragen. Vielleicht können Sie schwarze Spitze auftreiben, um den Halsausschnitt und die Ärmel zu garnieren.« Anne Trenchard war praktisch veranlagt, aber nicht gänzlich frei von Eitelkeit. Sie hatte sich ihre gute Figur bewahrt, und mit ihrem klaren Profil und dem kastanienbraunen Haar konnte sie durchaus als Schönheit gelten. Das wusste sie auch, ohne sich deshalb närrischen Illusionen hinzugeben.
Ellis kniete auf dem Boden und hielt ihrer Herrin ein strohfarbenes Abendkleid aus Taft hin, damit sie hineinsteigen konnte. »Und der Schmuck, Madam?«
»Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich werde wohl tragen, was ich habe.« Sie drehte sich um, damit die Zofe das Kleid im Rücken mit den vergoldeten Stiften schließen konnte.
Anne hatte klar und entschieden mit Sophia gesprochen, was sie nicht bereute. Sophia lebte wie ihr Vater in einer Traumwelt, und solche Träume konnten Unvorsichtige leicht in Schwierigkeiten bringen. Anne lächelte unwillkürlich. Sie hatte gesagt, dass James einen weiten Weg zurückgelegt hatte, aber manchmal zweifelte sie daran, ob selbst Sophia wusste, wie weit er tatsächlich gewesen war.
»Ich nehme an, Lord Bellasis hat die Einladung zum Ball arrangiert?« Ellis blickte vom Boden hoch, wo sie noch immer zu Anne Trenchards Füßen kauerte, um ihre Schuhe zu wechseln.
Anne ärgerte sich über die Frage. Warum sollte sich eine Zofe laut Gedanken darüber machen, wie ihre Herrschaften auf den Olymp der Gästeliste gelangt waren? Oder warum sie überhaupt irgendwo eingeladen wurden? Anne enthielt sich jeder Antwort und überging die Frage einfach. Aber sie begann tatsächlich über die Seltsamkeiten ihres Brüsseler Lebens nachzugrübeln. Seit der große Duke of Wellington auf James aufmerksam geworden war, hatte sich viel für die Trenchards verändert. Eines stand fest: Mochte noch so große Knappheit herrschen, mochten die Kämpfe noch so erbittert sein, die Landstriche noch so leer gefegt, James gelang es stets, irgendwo Nachschub aufzutreiben. Der Duke nannte ihn den »Zauberer«, und James schien tatsächlich einer zu sein. Aber der Erfolg hatte seine maßlosen Ambitionen, die unerreichbaren Gipfel der Gesellschaft doch zu erklimmen, nur noch weiter geschürt, sein Drang nach oben nahm obsessive Ausmaße an. James Trenchard, der Sohn eines Markthändlers, den zu heiraten Annes Vater ihr verboten hatte, empfand es als die natürlichste Sache der Welt, bei einer Duchess zu Gast zu sein. Anne hätte seine ehrgeizigen Wünsche gern lächerlich genannt, hätten sie nicht die unheimliche Eigenschaft besessen, sich zu erfüllen.
Anne hatte wesentlich mehr Bildung genossen als ihr Gatte, wie es sich für eine Lehrerstochter von selbst versteht, und als sie einander begegneten, stand sie schwindelerregend hoch über ihm, eine hervorragende Partie. Aber sie wusste nur zu gut, dass er sie inzwischen um Längen überholt hatte. Sie fragte sich sogar, wie lange sie mit seinem grandiosen Aufstieg noch Schritt halten könnte. Oder sollte sie sich, wenn die Kinder erwachsen wären, in ein schlichtes Cottage auf dem Land zurückziehen und ihm das Gipfelstürmen allein überlassen?
Ellis schloss aus dem Schweigen ihrer Herrschaft, dass sie etwas Unpassendes gesagt hatte, und suchte nach einer Bemerkung, mit der sie sich bei Anne Trenchard wieder einschmeicheln könnte, beschloss dann aber, den Mund zu halten und abzuwarten, bis der Sturm sich legte.
Die Tür ging auf, und James streckte den Kopf herein. »Sie hat es dir also gesagt, ja? Dass er es gedeichselt hat.«
Anna warf ihrer Zofe einen kurzen Blick zu. »Danke, Ellis. Wenn Sie in einer kleinen Weile wiederkommen möchten.«
Ellis zog sich zurück. James konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Du rüffelst mich, dass ich mich über meinen Stand erhebe, aber wie du deine Zofe rauswirfst, erinnert mich an die Duchess höchstpersönlich.«
Anne fuhr auf. »Das will ich doch nicht hoffen.«
»Warum nicht? Was hast du gegen die Duchess?«
»Ich habe nichts gegen sie, aus dem einfachen Grund, weil ich sie nicht kenne. Genauso wenig wie du.« Anne hatte das Bedürfnis, dieses absurde und gefährliche Geschwätz wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. »Deshalb sollten wir auch nicht so weit gehen, uns der armen Frau aufzudrängen und Platz in ihrem Ballsaal zu beanspruchen, der eigentlich ihren eigenen Bekannten zustünde.«
Aber James war zu aufgeregt, um sich zum Schweigen bringen zu lassen. »Das meinst du doch nicht wirklich so?«
»Doch, aber ich weiß, dass du nicht auf mich hören willst.«
Sie hatte recht. Es bestand keinerlei Aussicht, seine Freude zu dämpfen. »Was für ein Glücksfall für uns, Annie. Du weißt doch, dass der Duke da sein wird? Zwei Dukes sogar. Mein Feldherr und der Gemahl unserer Gastgeberin.«
»Anzunehmen.«
»Und regierende Fürsten.« Er hielt inne, platzte schier vor Begeisterung. »James Trenchard, dessen Karriere an einem Marktstand in Covent Garden angefangen hat, muss sich in Schale werfen, um mit einer Prinzessin zu tanzen.«
»Du wirst keine der Damen zum Tanz auffordern. Du würdest uns nur beide unsäglich blamieren.«
»Das werden wir sehen.«
»Das ist mein Ernst. Schlimm genug, dass du Sophia ermutigst.«
James runzelte die Stirn. »Du glaubst es zwar nicht, aber der Junge meint es ehrlich. Da bin ich mir ganz sicher.«
Anne schüttelte ungeduldig den Kopf. »Nichts bist du. Lord Bellasis glaubt vielleicht selbst, dass er es ehrlich meint, aber er ist außerhalb ihrer Reichweite. Er ist nicht sein eigener Herr, und es kann nichts Schickliches daraus werden.«
Von der Straße drang Getrappel hoch, und sie trat an eines der Fenster, die auf eine breite, belebte Durchgangsstraße hinausgingen. Unten marschierten ein paar Soldaten in scharlachroten Uniformen vorbei, die Sonne blitzte auf den goldenen Tressen. Wie seltsam, dachte Anne, überall Anzeichen nahender Kämpfe, und wir sprechen über einen Ball.
»Davon weiß ich nichts.« James gab seine Schwärmereien nicht so leicht auf.
Anne wandte sich wieder um. Ihr Mann machte ein Gesicht wie ein Vierjähriger, der sich in die Ecke gedrängt sieht. »Aber ich. Und wenn sie wegen dieses Unsinns Schaden nimmt, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich.«
»Kannst du gerne.«
»Und ich finde es unaussprechlich beschämend, dass du den jungen Mann dazu erpresst hast, seiner Tante Einladungen für uns abzubetteln.«
Jetzt hatte James genug. »Du wirst mir den Ball nicht vermiesen. Das lasse ich nicht zu.«
»Ich brauche dir den Ball gar nicht zu vermiesen. Das wird er schon ganz von alleine schaffen.«
Das bedeutete für James das Ende des Gesprächs. Er stürmte hinaus, um sich zum Dinner umzukleiden, und Anne klingelte nach Ellis.
Anne war mit sich unzufrieden. Sie stritt nicht gern mit ihrem Mann, aber die ganze Angelegenheit setzte ihr zu. Ihr Leben gefiel ihr, wie es war. Sie waren jetzt reich, hatten Erfolg und wurden in den Londoner Geschäftskreisen umworben. Trotzdem versteifte sich James darauf, alles zu verderben, weil er nicht genug bekommen konnte. Sie musste es sich gefallen lassen, durch eine endlose Reihe von Salons geschoben zu werden, wo sie weder gemocht noch geschätzt wurden. Sie sah sich gezwungen, mit Herren und Damen Konversation zu machen, von denen sie insgeheim – oder nicht so insgeheim – verachtet wurde. Dabei hätten sie in aller Behaglichkeit leben können, von ihresgleichen respektiert, wenn James es nur zuließe. Aber während ihr all das durch den Kopf ging, wusste sie zugleich, dass sie ihren Mann nicht bremsen konnte. Niemand konnte es. Sein Vorwärtsdrang lag ihm einfach im Blut.
Im Lauf der Jahre wurde so viel über den Ball der Duchess of Richmond geschrieben, bis ihn ein solcher Glanz, eine solche majestätische Pracht umwehten, wie man sie höchstens vom Krönungszeremoniell einer mittelalterlichen Königin kennt. Der Ball kehrt in jeder Art von Erzählliteratur wieder, und jede neue bildliche Darstellung des Abends ist grandioser als die vorige. Auf Henry O’Neills Gemälde von 1868 findet der Ball in einem weitläufigen Palais mit riesigen Marmorsäulen statt, in dem sich Hunderte von Gästen drängen, die vor Kummer und Entsetzen weinen, dabei aber mehr Glamour entfalten als eine Revuetruppe in der Drury Lane. Wie bei so vielen ikonenhaften Momenten der Geschichte verhielt es sich in Wirklichkeit ganz anders.
Die Richmonds waren zum Teil aus Ersparnisgründen nach Brüssel übersiedelt, um die Lebenshaltungskosten während einiger Auslandsjahre niedrig zu halten, zum Teil aber auch, um ihre Solidarität mit ihrem berühmten Freund zu bekunden, dem Duke of Wellington, der dort sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Richmond selbst, ein ehemaliger Offizier, sollte die Verteidigung Brüssels organisieren, falls es zum Schlimmsten käme und der Feind einmarschierte. Richmond nahm das Angebot an. Er wusste, dass es sich größtenteils um Verwaltungsarbeit handelte, aber die Aufgabe musste erledigt werden und würde ihm die Befriedigung verschaffen, an den Kriegsanstrengungen teilzunehmen und nicht nur als Zaungast in der Stadt zu sein. Davon tummelten sich hier genug.
Prachtvolle Palais gab es in Brüssel nur in beschränkter Zahl, die meisten waren schon vergeben, und so entschied man sich schließlich für ein Haus, in dem einst ein renommierter Kutschenbauer gewohnt hatte. Es lag in der Rue de la Blanchisserie, wörtlich übersetzt »Wäschereistraße«, was Wellington veranlasste, das neue Heim der Richmonds als »Waschhaus« zu titulieren, ein Scherz, über den sich die Duchess weniger amüsierte als ihr Gemahl. Zu dem Saal, den wir heute als den Showroom des Kutschenbauers bezeichnen würden, ein großer, scheunenartiger Bau links von der Eingangstür, gelangte man durch einen kleinen Raum, in dem einst mit den Kunden die Polsterung und andere Extrawünsche besprochen wurden; in den Memoiren der dritten Tochter der Richmonds, Lady Georgiana Lennox, stieg er allerdings zum Antichambre auf. Die Halle selbst, in der vormals die Kutschen ausgestellt wurden, war mit einer Tapete ausgekleidet, auf der sich Rosen an Gittern rankten, und wurde für durchaus ballsaaltauglich befunden.
Die Duchess of Richmond hatte ihre ganze Familie auf den Kontinent mitgebracht, und vor allem die Mädchen sehnten sich nach ein wenig Abwechslung, also wurde eine Gesellschaft geplant. Dann marschierte Napoleon, der im März aus seinem Exil auf Elba geflohen war, Anfang Juni von Paris los und stellte sich den Alliierten entgegen. Die Duchess fragte Wellington, ob es anginge, ihre Vergnügungspläne weiterzuverfolgen, und ihr wurde versichert, alles sei bestens. Es war sogar der ausdrückliche Wunsch des Duke, der Ball möge als Demonstration englischer Gelassenheit stattfinden, um allen vor Augen zu führen, dass sich selbst die Damen vom Vormarsch des französischen Kaisers nicht erschüttern ließen und ihre Belustigung deshalb nicht aufschieben wollten. Das war natürlich alles recht und gut, aber …
»Ich hoffe, das Ganze ist kein Fehler«, sagte die Duchess zum zwanzigsten Mal innerhalb einer Stunde und warf einen forschenden Blick in den Spiegel. Was sie darin sah, gefiel ihr ausnehmend gut: eine schöne Frau am Anfang der besten Jahre, in helle, cremefarbene Seide gekleidet und immer noch so attraktiv, dass sich die Köpfe nach ihr drehten. Ihre Diamanten waren erstklassig, auch wenn sie unter ihren Freundinnen eine Diskussion entfachten, ob die Originale im Zuge der Sparmaßnahmen nicht durch Strasskopien ersetzt worden waren.
»Jetzt ist es zu spät für solches Gerede.« Der Duke of Richmond fand die Lage fast amüsant: Sie hatten Brüssel als eine Art Flucht vor der Welt betrachtet, aber zu ihrer Überraschung war ihnen die Welt auf dem Fuße gefolgt. Und jetzt gab seine Frau eine Gesellschaft mit einer Gästeliste, die in London ihresgleichen gesucht hätte, während sich im selben Augenblick die Stadt gegen den Donner französischer Kanonen rüstete. »Das war ein exzellentes Dinner. Ich werde später beim Souper nichts mehr essen können.«
»Wirst du schon.«
»Ich höre eine Kutsche. Wir sollten nach unten gehen.« Der Duke war ein angenehmer Mensch, ein warmherziger, zärtlicher Vater, den seine Kinder anbeteten, und Persönlichkeit genug, um es mit einer der Töchter der notorischen Duchess of Gordon aufzunehmen, deren Eskapaden in ganz Schottland den Klatsch jahrelang nicht verstummen ließen. Er wusste durchaus, dass damals viele meinten, er hätte es sich mit seiner Wahl bequemer machen und dann auch ein bequemeres Leben führen können, doch alles in allem empfand er kein Bedauern. Seine Gemahlin war, daran gab es nichts zu rütteln, extravagant, zeichnete sich aber durch ein freundliches Naturell, durch Schönheit und durch Klugheit aus. Er war froh, dass er sich für sie entschieden hatte.
In Georgianas Antichambre, dem kleinen Salon, den man auf dem Weg zum Ballsaal durchqueren musste, waren erste Gäste eingetroffen. Die Floristen hatten sich mit den riesigen Blumenarrangements selbst übertroffen, zartrosa Rosen und weiße Lilien vor hohem Blattwerk in verschiedenen Grüntönen; darüber hinaus hatten sie von den Lilien sämtliche Staubblätter abgeknipst, um die Damen vor Blütenstaubflecken zu schützen. Die floralen Kunstwerke verliehen den Räumen des Kutschenbauers eine Pracht, die sie bei Tageslicht vermissen ließen, und die vielen Kronleuchter tauchten mit ihrem Kerzenschimmer alles in ein sanft schmeichelndes Licht.
Edmund, Neffe der Duchess und Viscount Bellasis, unterhielt sich mit Georgiana. Sie gingen gemeinsam zu den Eltern der jungen Dame hinüber, die ihre Mutter fragte: »Wer sind diese Leute, die einzuladen Edmund dich gezwungen hat? Warum kennen wir sie nicht?«
»Nach dem heutigen Abend wirst du sie kennen, Georgiana«, warf Lord Bellasis ein.
»Sehr mitteilsam bist du nicht gerade«, bemerkte Georgiana, zu ihrer Mutter gewandt.
Die Duchess hegte einen bestimmten Verdacht und bedauerte bereits ihre Großzügigkeit. »Ich hoffe, ich werde mir nicht den Zorn deiner Mutter zuziehen, Edmund.« Sie hatte Edmund die Einladungen bedenkenlos gegeben, aber nach kurzem Überlegen gelangte sie zu dem Schluss, dass sie tatsächlich mit dem allergrößten Zorn ihrer Schwester zu rechnen hatte.
Wie auf ein Stichwort ertönte die Stimme des Zeremonienmeisters: »Mr und Mrs Trenchard. Miss Sophia Trenchard.«
Der Duke sah zur Tür. »Du hast doch nicht etwa den Zauberer eingeladen?« Seine Gattin sah ihn verwirrt an. »Wellingtons obersten Proviantmeister. Was hat der denn hier zu suchen?«
Die Duchess wandte sich mit gestrenger Miene an ihren Neffen. »Den Proviantmeister des Duke of Wellington? Ich habe einen Essenslieferanten zu meinem Ball gebeten?«
Lord Bellasis ließ sich nicht so schnell ins Bockshorn jagen. »Meine liebe Tante, du hast einen der treuesten, tüchtigsten Helfer beim Kampf des Duke um den Sieg eingeladen. Ich würde meinen, jeder loyale Brite wäre stolz, Mr Trenchard in seinem Haus zu empfangen.«
»Du hast mich hereingelegt, Edmund. Ich mag es nicht, wenn man mich zum Narren macht.« Doch der junge Mann hatte sich bereits entfernt, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Die Duchess starrte ihren Gatten an.
Er amüsierte sich eher über ihre Empörung. »Schau mich nicht so an, meine Liebe. Du hast sie eingeladen, nicht ich. Und du musst zugeben, sie macht etwas her.«
Das zumindest stimmte. Sophia war schön wie nie zuvor.
Es fehlte die Zeit für einen weiteren Austausch, die Trenchards traten bereits heran. Anne sprach als Erste. »Zu gütig von Ihnen, Duchess.«
»Nichts zu danken, Mrs Trenchard. Ich höre, Sie haben meinen Neffen sehr liebenswürdig aufgenommen.«
»Die Gesellschaft von Lord Bellasis ist immer ein Vergnügen.« Anne hatte ihre Garderobe gut gewählt. In der blauen Seide war sie eine würdevolle Erscheinung, und Ellis hatte als Besatz eine edle Spitzenborte gefunden. Die Diamanten reichten vielleicht nicht an die meisten anderen im Saal heran, konnten sich aber durchaus sehen lassen.
Die Duchess war ein wenig besänftigt. »Es ist schwierig für die jungen Männer, so weit weg von zu Hause«, sagte sie einigermaßen freundlich.
James kämpfte die ganze Zeit gegen seine Überzeugung, dass die Duchess mit »Euer Gnaden« anzusprechen sei. Seine Frau hatte zwar als Erste das Wort ergriffen, und anscheinend hatte niemand Anstoß genommen, trotzdem war er nicht ganz sicher. Er öffnete schon den Mund …
»Also, wenn das nicht der Zauberer ist!« Richmond strahlte ihn ausgesprochen leutselig an. Falls er überrascht war, diesen wackeren Handelsmann in seinem Ballsaal vorzufinden, ließ er es sich nicht anmerken. »Erinnern Sie sich, dass wir gemeinsam Pläne geschmiedet haben, falls die Reservisten zu den Waffen gerufen werden?«
»Ich erinnere mich sehr gut, Euer – an den Ablaufplan, meine ich. Duke.« Das letzte Wort klappte nach, als hätte es mit dem vorangegangenen Gespräch nichts zu tun. James kam es vor wie ein Kieselstein, der plötzlich in einen stillen Teich geplumpst war. Ein paar heikle Momente lang schlugen die Wellen seines peinlichen Verhaltens über ihm zusammen. Doch Anne beruhigte ihn mit einem unmerklichen Lächeln und einem Nicken, zu seiner Erleichterung schien sich niemand daran zu stören.
Anne übernahm das Ruder. »Darf ich meine Tochter vorstellen, Sophia?« Sophia knickste vor der Duchess, die sie von Kopf bis Fuß musterte, als wolle sie eine Rehkeule fürs Abendessen kaufen, auch wenn ihr nichts ferner lag. Sie sah, dass das Mädchen hübsch und auf seine Weise recht anmutig war, aber ein Blick auf den Vater erinnerte sie nur zu deutlich daran, dass die Sache überhaupt nicht infrage kam. Ihr graute davor, dass ihre Schwester von diesem Abend erfahren und sie beschuldigen würde, die beiden zu ermutigen. Aber Edmund konnte doch ganz bestimmt keine ernsten Absichten haben? Er war ein vernünftiger Junge und hatte noch nie die geringsten Schwierigkeiten gemacht.
»Miss Trenchard, würden Sie mir erlauben, Sie in den Ballsaal zu begleiten?« Edmund bemühte sich, eine souveräne Höflichkeit an den Tag zu legen, doch seine Tante konnte er nicht täuschen, sie war viel zu welterfahren, um sich von seiner plumpen Darbietung von Nonchalance irreführen zu lassen. Im Gegenteil, ihr sank das Herz, als sie sah, wie das Mädchen den Arm durch den seinen schob und sie sich gemeinsam aufmachten, leise flüsternd, als wären sie einander längst zugeeignet.
»Major Thomas Harris.« Ein äußerst gut aussehender junger Mann verbeugte sich leicht in Richtung seiner Gastgeberin. Da rief Edmund:
»Harris! Dich habe ich hier nicht erwartet.«
»Na, ich muss doch auch ein bisschen Spaß haben«, sagte der junge Offizier und lächelte Sophia zu, die in ein Lachen ausbrach, als fühlten sich alle völlig ungezwungen und zusammengehörig. Dann schritten sie auf den Ballsaal zu, von Edmunds Tante bang beobachtet. Ein hübsches Paar, musste sie zugeben: Sophias blonde Schönheit unterstrich Edmunds dunkle Locken und seine markanten Züge, sein harter Mund zog sich über dem Kinngrübchen zu einem Lächeln auseinander. Die Duchess fing den Blick ihres Gatten auf. Beide wussten, dass die Situation drauf und dran war, außer Kontrolle zu geraten. Oder vielleicht längst außer Kontrolle geraten war.
»Mr James und Lady Frances Wedderburn-Webster«, verkündete der Zeremonienmeister, und Richmond trat vor, um die neuen Gäste zu begrüßen. »Lady Frances, Sie sehen wunderbar aus.« Er bemerkte den besorgten Blick, den seine Gemahlin dem jungen Liebespaar hinterherschickte. Es gab nichts, was die Richmonds tun konnten, um die Lage zu entschärfen. Er sah den Kummer im Gesicht seiner Frau und beugte sich zu ihr. »Ich werde später mit ihm reden. Er wird schon Vernunft annehmen. Wie immer.« Sie nickte. Das war das einzig Richtige. Das Problem später aus der Welt zu schaffen, wenn der Ball zu Ende und das Mädchen fort wäre. An der Tür entstand ein kleiner Tumult, und der Zeremonienmeister verkündete mit tönender Stimme: »Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Oranien-Nassau.« Ein freundlich wirkender junger Mann näherte sich den Gastgebern, und die Duchess versank mit kerzengeradem Rücken in einem tiefen Hofknicks.
Der Duke of Wellington erschien erst kurz vor Mitternacht, bewundernswert gelassen angesichts seiner Verspätung. Er ließ die Blicke durch den Ballsaal schweifen, und zu James Trenchards großer Freude kam er, sobald er ihn entdeckt hatte, zu ihm herüber. »Was führt den Zauberer heute Abend hierher?«
»Ihre Gnaden hat uns eingeladen.«
»Tatsächlich? Alle Achtung. Hat sich der Abend bislang als vergnüglich erwiesen?«
James nickte. »O ja, Euer Gnaden. Aber es wird viel vom Vorrücken Napoleons gesprochen.«
»Donner und Doria, tatsächlich? Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese bezaubernde Dame Mrs Trenchard ist?« Kein Zweifel, der Duke hatte sich perfekt im Griff.
Selbst Anne versagten die Nerven, als sie ihn mit »Duke« hätte anreden müssen. »Die Besonnenheit, die Euer Gnaden ausstrahlen, ist sehr beruhigend.«
»So soll es sein.« Er lachte leise und wandte sich an einen Offizier, der in der Nähe stand. »Ponsonby, haben Sie schon Bekanntschaft mit dem Zauberer geschlossen?«
»Gewiss, Duke. Ich habe schon eine Menge Zeit vor Mr Trenchards Kontor mit Warten verbracht, bis ich mich für die Belange meiner Männer einsetzen konnte.« Er sagte dies jedoch mit einem Schmunzeln.
»Mrs Trenchard, darf ich Ihnen Sir William Ponsonby vorstellen? Ponsonby, das ist die Gattin des Zauberers.«
Ponsonby verbeugte sich leicht. »Ich hoffe, dass er zu Ihnen freundlicher ist als zu mir.«
Auch Anne lächelte, aber bevor sie antworten konnte, trat Georgiana zu ihnen, Richmonds Tochter. »Der ganze Ballsaal brummt nur so von den Gerüchten, die herumschwirren.«
Wellington nickte vielsagend. »Das ist mir bewusst.«
»Aber treffen sie denn zu?« Gut sah sie aus, die junge Georgiana Lennox, und die Sorge in ihrem klaren, offenen Gesicht unterstrich nur den Ernst ihrer Frage und die Bedrohung, die über ihnen allen schwebte.
Als der Duke in die ihm zugewandten Augen sah, wurde seine Miene zum ersten Mal nahezu ernst. »Ich fürchte, so ist es, Lady Georgiana. Es sieht ganz danach aus, als brächen wir morgen auf.«
»Wie furchtbar.« Sie drehte sich um und sah den Paaren zu, die auf dem Parkett herumwirbelten; die meisten der jungen Männer, die mit ihren Tanzpartnerinnen plauderten und lachten, trugen Galauniform. Wie viele würden die kommenden Kämpfe überleben?
»Was für eine schwere Last Sie tragen müssen.« Auch Anne Trenchard betrachtete die Tanzenden. Sie seufzte. »Manche dieser jungen Männer werden in den nächsten Tagen fallen, was nicht einmal Sie verhindern können, wenn wir diesen Krieg gewinnen sollen. Ich beneide Sie nicht.«
Wenn Wellington von ihren Worten überrascht war, dann angenehm. Er hatte die Frau seines Proviantmeisters vor diesem Abend kaum zur Kenntnis genommen. Nicht jeder begriff, dass es hier nicht nur um Ruhm ging. »Ich danke Ihnen für diese aufmerksame Beobachtung, Madam.«
Da wurden sie von einem gewaltigen Getöse unterbrochen: Zwanzig Dudelsackpfeifer bliesen in ihre Instrumente, was das Zeug hielt, und die Tänzer flohen und räumten das Parkett für eine Truppe der Gordon Highlanders. Diesen Coup de théâtre hatte die Duchess inszeniert. Sie hatte sich die Einlage vom rangältesten Offizier erbeten, mit einem Hinweis auf ihr Gordon’sches Blut. Da die Highlanders ursprünglich vor zwanzig Jahren von ihrem verstorbenen Großvater gegründet worden waren, konnte sich der Kommandant ihrer Bitte schlecht widersetzen. Allerdings verschweigt die Geschichtsschreibung, was er wirklich davon hielt, dass er seine Männer für einen Auftritt als Hauptattraktion eines Balls hergeben musste, und das am Vorabend einer Schlacht, die über das Schicksal Europas entscheiden würde. Jedenfalls war ihre Vorführung für die anwesenden Schotten herzerwärmend und auch für ihre englischen Nachbarn noch einigermaßen unterhaltsam, doch die Nichtbriten verhehlten ihre Verwirrung nicht. Anne Trenchard beobachtete, wie der Prinz von Oranien-Nassau seinen Adjutanten fragend ansah und bei dem Lärm die Augen verdrehte. Doch dann begannen die Männer den Reel zu tanzen, und bald zogen die Leidenschaft und die Kraft ihres Tanzes auch die Zweifler in den Bann; die ganze Gesellschaft fing Feuer, bis selbst die konsternierten Prinzen aus dem alten Preußen sich mitreißen ließen, klatschten und jubelten.
Anne wandte sich an ihren Mann. »Es erscheint mir so grausam, dass sie in den Kampf ziehen müssen, noch bevor der Monat um ist.«
»Der Monat?« James lachte bitter auf. »Eher die Woche.«
Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da flog die Tür auf und ein junger Offizier, der sich nicht damit aufgehalten hatte, den Schmutz von seinen Stiefeln zu kratzen, hastete in den Ballsaal. Er sah sich suchend um, bis er seinen Befehlshaber gefunden hatte, den Prinzen von Oranien-Nassau. Mit einer Verbeugung hielt er ihm einen Umschlag entgegen, der sofort die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft auf sich zog. Der Prinz nickte, erhob sich und ging zum Duke of Wellington hinüber. Er präsentierte ihm die Nachricht, doch der Duke schob sie ungelesen in die Westentasche, während der Zeremonienmeister das Souper ankündigte.
Trotz aller unheilvollen Ahnungen musste Anne lächeln. »Seine Selbstbeherrschung ist bewundernswert. Die Nachricht ist vielleicht das Todesurteil für seine eigene Armee, aber er geht lieber ein Risiko ein, als sich das kleinste Zeichen von Besorgnis entschlüpfen zu lassen.«
James nickte. »Der lässt sich nicht so schnell erschüttern, das steht fest.« Dann sah er, wie seine Frau die Stirn runzelte. Im Gedränge, das sich auf den Speisesaal zuschob, hing Sophia immer noch am Arm des Viscount Bellasis.
Anne hatte zu kämpfen, um sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. »Sag ihr, sie soll das Souper mit uns einnehmen oder auf jeden Fall mit jemand anderem.«
James schüttelte den Kopf. »Sag du ihr das. Ich werde es nicht tun.«
Anne nickte und ging zu dem jungen Paar hinüber. »Sie dürfen sich von Sophia nicht ganz vereinnahmen lassen, Lord Bellasis. Sie haben so viele Freunde in diesem Raum, die sich freuen würden, das Neueste von Ihnen zu erfahren.«
Doch der junge Mann lächelte. »Keine Sorge, Mrs Trenchard. Ich bin, wo ich sein möchte.«
Annes Ton wurde bestimmter. Sie schlug mit ihrem zusammengefalteten Fächer gegen ihre linke Handfläche. »Das ist alles gut und schön, Mylord. Aber Sophia hat einen Ruf zu bewahren, und die Großzügigkeit Ihrer Aufmerksamkeiten könnte ihn gefährden.«
Sie hoffte, dass Sophia den Mund halten würde. Vergebens. »Mama, keine Sorge. Ich wünschte, du würdest mir ein wenig Vernunft zutrauen.«
»Und ich wünschte, ich könnte es.« Anne verlor die Geduld mit ihrer törichten, liebestrunkenen, ehrgeizigen Tochter. Aber sie merkte, dass einige der Paare zu ihnen herübersahen, und zog sich lieber zurück, als bei einem Streit mit ihrem Kind beobachtet zu werden.
Ein wenig gegen den Wunsch ihres Gatten wählte sie einen ruhigen Seitentisch, wo sie zwischen einigen Offizieren und deren Gattinnen saßen und die glanzvollere Gesellschaft in der Mitte beobachten konnte. Wellington saß zwischen Lady Georgiana Lennox und einem hinreißenden Geschöpf in mitternachtsblauer, tief dekolletierter, silbern bestickter Abendrobe. Erlesener Diamantschmuck verstand sich von selbst. Die Dame lachte mit Bedacht und zeigte dabei blendend weiße Zähne, dann warf sie dem Duke durch ihre dunklen Wimpern einen Seitenblick zu. Lady Georgiana konnte nicht verbergen, dass sie die Konkurrenz höchst lästig fand. »Wer ist die Dame rechts vom Duke?«, fragte Anne ihren Mann.
»Lady Frances Wedderburn-Webster.«
»Natürlich. Sie ist direkt hinter uns hereingekommen. Sie scheint sehr sicher, dass der Duke sich für sie interessiert.«
»Dazu hat sie auch allen Grund.« James zwinkerte Anne kurz zu, und sie betrachtete die Schöne mit noch größerer Neugier. Nicht zum ersten Mal wunderte sie sich darüber, wie der drohende Krieg, die Nähe des Todes das Potenzial des Lebens zu steigern schienen. Viele Paare in diesem Saal setzten ihren Ruf und sogar ihr künftiges Glück aufs Spiel, um noch ein paar Stunden zu genießen, bevor der Ruf zu den Waffen sie auseinanderriss.
Es gab Bewegung an der Tür, und Anne blickte hinüber. Der Bote, den sie vorhin schon gesehen hatten, war zurückgekehrt, immer noch in seinen schlammverspritzten Reitstiefeln; ein zweites Mal näherte er sich dem Prinzen von Oranien-Nassau. Sie unterhielten sich kurz, woraufhin der Prinz sich erhob und den Raum durchquerte, bis er vor Wellington stand. Er beugte sich herab und flüsterte ihm ins Ohr. Jetzt richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft auf ihn, die Konversation flaute ab. Wellington erhob sich. Er sprach kurz mit dem Duke of Richmond. Die beiden Männer schickten sich an, den Raum zu verlassen, als Wellington stehen blieb. Er blickte sich um und kam zum großen Staunen der Trenchards auf sie zu, was alle anderen Gäste an ihrem Tisch in helle Aufregung versetzte.
»Sie suche ich. Den Zauberer. Können Sie mit uns kommen?«
James sprang sofort auf und ließ sein Essen stehen. Zwischen den beiden hochgewachsenen Männern wirkte er wie ein dicker kleiner Hofnarr zwischen zwei Königen – was er im Grunde, musste Anne sich eingestehen, auch war.
Ihr Gegenüber am Tisch konnte seine Bewunderung nicht verbergen. »Ihr Gatte besitzt offensichtlich das Vertrauen des Duke, Madam.«
»So scheint es.« Doch dieses eine Mal war sie wirklich stolz auf ihn, ein schönes Gefühl.
Als sie die Tür von Richmonds Ankleidezimmer öffneten, war dort gerade ein Kammerdiener damit beschäftigt, das Nachthemd bereitzulegen. Der Mann sah erschrocken auf und blickte mitten ins Gesicht des obersten Kriegsherrn. »Können wir den Raum einen Moment für uns haben?«, fragte Wellington. Der Kammerdiener stieß etwas wie ein Röcheln aus und ergriff die Flucht. »Haben Sie eine anständige Karte von der Gegend?«
Richmond brummte bejahend, zog einen dicken Band aus einem Regal und schlug ihn auf der Seite auf, auf der Brüssel und die umgebende Landschaft dargestellt waren. Wellington machte seiner Wut, die er vorhin im Speisesaal so erfolgreich verborgen hatte, allmählich Luft. »Herrgott noch mal, Napoleon hat mich hereingelegt. Oranien-Nassau hat eine zweite Nachricht erhalten, diesmal vom Baron Rebecque. Bonaparte rückt auf der Straße von Charleroi nach Brüssel vor und kommt immer näher.« Er beugte sich über das Blatt. »Ich habe der Armee den Befehl erteilt, sich bei Quatre-Bras zu sammeln, aber dort werden wir ihn nicht aufhalten.«
»Vielleicht doch. Sie haben noch ein paar Stunden vor Anbruch des Tages.« Richmond glaubte seinen eigenen Worten genauso wenig wie der große Duke.
»Wenn das nicht gelingt, dann werde ich hier gegen ihn kämpfen müssen.«
James reckte den Hals und lugte zur Landkarte. Der Daumennagel des Duke ruhte auf einem kleinen Dorf namens Waterloo. Es kam James seltsam unwirklich vor, dass er, eine Minute nachdem er in einer unauffälligen Ecke still sein Souper verzehrt hatte, im Ankleidezimmer des Duke of Richmond stand, allein mit ihm und dem Oberbefehlshaber, mitten im Zentrum der Ereignisse, die ihrer aller Leben verändern würden.
Und dann sprach Wellington ihn auch noch an. »Ich werde Ihre Hilfe brauchen, Zauberer. Begreifen Sie? Wir werden erst bei Quatre-Bras sein und dann, fast sicher, bei …« Er hielt inne, um sich auf der Karte des Namens zu vergewissern. »… bei Waterloo. Komischer Name, um in die Unsterblichkeit einzugehen.«
»Wenn jemand den Namen unsterblich machen kann, dann Sie, Euer Gnaden.« In James’ eher schlichter Weltsicht konnte ein wenig Süßholzraspeln nicht schaden.
»Aber reicht Ihnen das an Information?« Wellington war kein Amateur, er verstand sein Handwerk durch und durch, und James bewunderte ihn dafür.
»Es reicht, keine Sorge. Wir werden nicht daran scheitern, dass es an Nachschub fehlt.«
Wellington sah ihn an. Er lächelte fast. »Sie sind ein gescheiter Kerl, Trenchard. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen Sie Ihre Talente gut nutzen. Ich glaube, Sie haben das Potenzial, es weit zu bringen.«
»Euer Gnaden sind sehr freundlich.«
»Aber Sie dürfen sich nicht vom Chichi der feinen Gesellschaft blenden lassen. Sie sollten es besser wissen, denn in Ihnen steckt viel mehr als in den meisten dieser Gecken im Ballsaal. Vergessen Sie das nicht.« Dann war es, als höre er eine innere Stimme, die ihm verkündete, dass die Stunde gekommen sei. »Genug. Wir müssen uns bereit machen.«
Als sie in den Saal zurückkehrten, war die Gesellschaft bereits in Aufruhr; man merkte sofort, dass die Nachricht um sich gegriffen hatte. In den von Blumen überquellenden, zu Beginn des Abends noch so bezaubernden und eleganten Räumen spielten sich herzzerreißende Abschiedsszenen ab. Mütter und junge Mädchen weinten vor aller Augen und umklammerten ihre Söhne und Brüder, ihre Gatten und Geliebten; alle ließen sie die Maske der Gelassenheit fallen. Zu James’ Verwunderung spielte die Musik weiter, und noch erstaunlicher fand er es, dass sich einige Paare dazu weiterdrehten – schwer begreiflich, wie sie das inmitten von all der Trauer und Bestürzung fertigbrachten.
Anne kam auf ihn zu, bevor er sie in der Menge ausfindig machen konnte. »Wir sollten gehen«, sagte er. »Ich muss sofort ins Depot. Ich setze dich und Sophia in die Kutsche und gehe zu Fuß.«
Sie nickte. »Ist das die entscheidende Schlacht?«
»Wer weiß? Ich glaube schon. Wir haben uns so viele Jahre bei jedem Scharmützel eingeredet, es sei die letzte Schlacht, doch diesmal glaube ich es wirklich. Wo ist Sophia?«
Sie fanden sie im Vorraum, in den Armen von Lord Bellasis weinend. Anne dankte dem Chaos und Gewühl ringsum, in dem die törichte Indiskretion der jungen Leute unterging. Bellasis flüsterte Sophia ins Ohr und übergab sie dann ihrer Mutter. »Geben Sie gut auf sie acht.«
»Das tue ich in der Regel«, konterte Anne, die sich über seine anmaßende Bemerkung ein wenig ärgerte. Aber ihr Ton prallte an seinem Abschiedsschmerz ab. Mit einem letzten Blick auf den Gegenstand seiner Liebe eilte er mit einer Gruppe Offizierskameraden hinaus. James hatte die Stolen und Umhänge geholt, dann wurden sie mit der hinausdrängenden Menge zur Tür geschoben. Die Duchess war nirgends zu sehen. Anne gab die Suche auf und beschloss, ihr am nächsten Morgen zu schreiben, obwohl sie ihrer Gastgeberin durchaus zutraute, dass sie sich in einem solchen Moment nicht viel um gesellschaftliche Formalitäten scherte.
Schließlich waren sie in der Eingangshalle und gelangten durch die offene Tür hinaus auf die Stufen, die zur Straße hinabführten. Auch hier herrschte Gedränge, aber weniger als im Haus. Einige Offiziere waren bereits aufs Pferd gestiegen. Im Durcheinander erspähte Anne Bellasis. Sein Bursche hatte ihm sein Ross gebracht und hielt es fest, während sein Herr aufsaß. Anne beobachtete kurz die Szene. Bellasis schien die Menge zu mustern, anscheinend suchte er nach jemandem, doch falls es Sophia war, entging sie seiner Aufmerksamkeit. Genau in diesem Moment hörte Anne, wie ihre Tochter hinter ihr scharf die Luft einsog. Sophia starrte auf die Gruppe der Soldaten vor ihnen. »Was ist denn, Liebes?« Anne kannte keinen der Männer. Doch Sophia schüttelte nur den Kopf, ob vor Kummer oder Entsetzen, war schwer zu erkennen. »Du weißt doch, dass er fort muss.« Anne legte den Arm um die Schultern ihrer Tochter.
»Das ist es nicht.« Sophia konnte den Blick nicht von einer Gruppe Uniformierter lösen, die sich zu entfernen begann. Sophia erschauerte, dann brach sie in ein Schluchzen aus, das ihrer tiefsten Seele zu entspringen schien.
»Liebes, du musst dich beherrschen.« Anne sah sich um und vergewisserte sich, dass es keine Zeugen gab. Ihre Tochter hatte keine Kontrolle mehr über sich und war Worten unzugänglich. Sie schlotterte, als hätte sie Schüttelfrost, der Schweiß brach ihr aus, Tränen rannen ihr über die Wangen. Da nahm Anne die Sache in die Hand. »Komm mit. Schnell. Wir müssen hier weg, bevor dich jemand erkennt.«
Gemeinsam zogen sie und ihr Mann das bebende Mädchen an den wartenden Kutschen entlang, bis sie ihre eigene fanden, und schoben Sophia hinein. James eilte davon, aber es dauerte eine weitere Stunde, bis sich der Stau der Kutschen auflöste und Anne und Sophia den Heimweg antreten konnten.
Am nächsten Tag verließ Sophia ihr Zimmer nicht, aber das spielte keine Rolle, weil ganz Brüssel wie auf Kohlen saß und niemand ihre Abwesenheit bemerkte. Würden Napoleons Truppen die Stadt überrennen? War jede junge Frau in Gefahr? Die Bürger waren hin und her gerissen. Sollten sie auf den Sieg hoffen und ihre Wertsachen vergraben, um sie vor den zurückkehrenden Truppen zu retten, oder würden sie eine Niederlage erleiden und müssten sich aus dem Staub machen? Anne verbrachte den größten Teil des Tages mit Grübeln und Beten. James war nicht nach Hause gekommen. Sein Adlatus kehrte zum Depot zurück und nahm Kleider zum Wechseln und einen Korb mit Essen mit, wobei Anne beinahe über ihren närrischen Einfall lächeln musste, dem obersten Proviantmeister Proviant zu schicken.
Dann sickerten Nachrichten über das Gefecht bei Quatre-Bras durch. Der Duke of Brunswick war gefallen, von einem Schuss ins Herz getroffen. Anne dachte an den dunklen, verwegen aussehenden Mann, den sie noch am Abend zuvor mit der Duchess hatte Walzer tanzen sehen. Solche Meldungen würde es noch viele geben, bis alles vorüber wäre. Sie sah sich im Salon ihrer gemieteten Villa um. Schön war es hier, zugegeben, ein wenig pompös für ihren Geschmack, nicht pompös genug für James, dunkle Möbel, weiße Vorhänge aus Seidenmoiré, mit üppig drapierten, fransenbesetzten Schabracken oben. Anne nahm ihre Stickerei auf und legte sie wieder beiseite. Wie konnte sie jetzt sticken, wenn wenige Meilen entfernt Männer, die sie kannte, um ihr Leben kämpften? Mit einem Buch erging es ihr nicht besser. Sie konnte nicht einmal so tun, als vertiefe sie sich in eine erdachte Geschichte, wenn so nah, dass sie den Kanonendonner hören konnte, die wirkliche Geschichte mit allen schrecklichen Grausamkeiten ihren Lauf nahm. Ihr Sohn Oliver kam herein und warf sich in einen Sessel. »Warum bist du nicht in der Schule?«
»Die haben uns heimgeschickt.« Anne nickte. Natürlich. Die Lehrer planten bestimmt ihre eigene Flucht. »Gibt’s was Neues von meinem Vater?«
»Nein, aber er ist nicht in Gefahr.«
»Warum ist Sophia im Bett?«
»Sie fühlt sich nicht gut.«
»Wegen Lord Bellasis?«
Anne sah ihn an. Woher wissen die jungen Leute diese Dinge? Ihr Sohn war sechzehn. Er hatte sich noch nie in Kreisen bewegt, die auch nur entfernt als feine Gesellschaft gelten konnten. »Natürlich nicht«, sagte sie. Doch der Junge lächelte nur.
Es wurde Dienstagmorgen, bis Anne ihren Mann wiedersah. Sie frühstückte in ihrem Salon, war allerdings schon fertig angezogen, als er die Tür öffnete. Er sah aus, als habe man ihn durch den Schmutz und Staub eines Schlachtfelds gezogen. Ihre Begrüßung fiel äußerst schlicht aus. »Gott sei Dank«, seufzte sie.
»Wir haben es geschafft. Napoleon ist auf der Flucht. Aber noch sind nicht alle in Sicherheit.«
»Das kann ich mir vorstellen. Die Armen.«
»Der Duke of Brunswick ist tot.«
»Das habe ich gehört.«
»Lord Hay, Sir William Ponsonby …«
»Ach.«
Anne dachte an den leise lächelnden Mann, der sie mit der Härte ihres Gatten aufgezogen hatte. »Wie traurig. Ich habe gehört, einige von ihnen sind noch in der Galauniform gestorben, die sie auf dem Ball getragen haben.«
»Richtig.«
»Wir sollten für sie beten. Weil wir an jenem Abend auf dem Ball waren, fühle ich mich den armen Kerlen auf gewisse Weise verbunden.«
»Wohl wahr. Aber es gibt ein weiteres Todesopfer, bei dem du dir die Verbundenheit nicht erst vorzustellen brauchst.« Anne sah ihn abwartend an. »Viscount Bellasis ist gefallen.«
»O nein!« Ihre Hand flog an ihr Gesicht. »Ist das sicher?« Ihr schien, ihr Magen geriete ins Schlingern. Warum eigentlich? Schwer zu sagen. Glaubte sie vielleicht, Sophia habe doch recht gehabt und nun sei die große Chance des Mädchens dahin? Nein. Sie wusste, das waren alles nur Illusionen gewesen, aber trotzdem … Wie furchtbar.
»Ich bin gestern hingefahren. Aufs Schlachtfeld. Grauenhafter Anblick.«
»Warum warst du überhaupt dort?«
»Geschäfte. Was könnte sonst schon der Grund für meine Unternehmungen sein?« Er bedauerte seinen galligen Ton. »Ich habe erfahren, dass Bellasis auf der Gefallenenliste steht, und habe darum gebeten, seinen Leichnam sehen zu dürfen. Er war es, also ja, es ist sicher. Wie geht es Sophia?«
»Seit dem Ball ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Zweifellos fürchtet sie sich vor genau der Nachricht, die wir ihr nun bringen müssen.« Anne seufzte. »Wir sollten es ihr wohl sagen, bevor sie es von anderen erfährt.«
»Das übernehme ich.« Anne war überrascht. So etwas gehörte normalerweise nicht zu den Dingen, für die James sich freiwillig meldete.
»Ich glaube, das ist meine Aufgabe als Mutter.«
»Nein. Ich sage es ihr. Du kannst nachher zu ihr. Wo ist sie denn?«
»Im Garten.«
Er verließ den Salon, und Anne ließ sich den Wortwechsel noch einmal durch den Kopf gehen. So würde Sophias Torheit also enden: nicht in einem Skandal, zum Glück, aber in tiefem Leid. Ihre Tochter hatte ihren Traum geträumt, und James hatte sie dabei ermutigt, aber jetzt zerfiel alles zu Staub. Sie würden nie erfahren, ob Sophia recht gehabt hatte, ob Bellasis ehrbare Pläne hatte oder ob sie selbst, Anne, der Wahrheit näher kam und ihre Tochter für Bellasis nur eine bezaubernde Puppe gewesen war, mit der er spielen wollte, solange sein Regiment sich in Brüssel aufhielt. Anne setzte sich auf die Bank am Fenster. Der Garten unter ihr war streng formal angelegt, ein Stil, der in den Niederlanden immer noch en vogue war, auch wenn die Engländer sich schon von ihm abgekehrt hatten. Sophia saß auf einer Bank am Kiesweg, ein ungeöffnetes Buch neben sich. Da kam ihr Vater aus dem Haus. James sprach schon, als er sich ihr näherte, setzte sich neben seine Tochter und nahm ihre Hand. Anne fragte sich, welche Worte er wählen würde. Sichtlich nahm er sich viel Zeit, behutsam redete er eine ganze Weile mit Sophia, bis sie plötzlich wie unter einem Schlag zusammenzuckte. Da nahm James sie in die Arme, und sie begann zu schluchzen. Zumindest war Anne zufrieden, dass ihr Mann Sophia die schreckliche Nachricht mit so viel liebevollem Zartgefühl beigebracht hatte, wie er es nur vermochte.
Später fragte sich Anne immer wieder, wie sie damals so sicher sein konnte, dass Sophias Geschichte damit zu Ende war. Aber wer, sagte sie sich dann, begriffe besser als sie, dass im Rückblick wie durch ein Prisma alles anders aussieht?
Sie stand auf. Es war an der Zeit, dass sie nun selbst hinunterging und ihre Tochter tröstete, die aus einem schönen Traum herausgerissen worden war, um in der grausamen Wirklichkeit zu erwachen.
Eine zufällige Begegnung
1841
Die Kutsche kam zum Halten. Es schien kaum ein Moment vergangen, seit Anne eingestiegen war. Eigentlich lohnte es nicht, den Wagen anspannen zu lassen, um vom Eaton Square zum Belgrave Square zu fahren, und wenn es nach Anne gegangen wäre, dann hätte sie den Weg zu Fuß zurückgelegt. Aber natürlich ging es in solchen Fällen nicht nach Anne. Nie. Ein weiterer Moment verstrich, dann war der Kutscher abgestiegen und öffnete den Schlag. Er streckte ihr den Arm entgegen, um ihr beim Aussteigen Halt zu geben. Anne blieb kurz stehen und atmete einmal tief durch. Das Haus, in dem sie erwartet wurde, gehörte zu den glanzvollen klassischen Bauten im Zuckerbäckerstil, die in Belgravia, das erst seit Kurzem so hieß, in den letzten zwanzig Jahren aus dem Boden gestampft worden waren. Ihre Architektur barg für Anne Trenchard wenig Geheimnisse, denn ihr Mann hatte das ganze letzte Vierteljahrhundert damit verbracht, an Plätzen, Prachtstraßen und Crescents solche Privatpalais zu errichten, standesgemäße Domizile für die Reichen im England des neunzehnten Jahrhunderts. Er arbeitete mit den Gebrüdern Cubitt zusammen und verdiente dabei ein Vermögen.
Zwei andere Damen wurden vor Anne ins Haus eingelassen, und der Lakai hielt erwartungsvoll die Tür auch für Anne auf, sodass ihr nichts übrig blieb, als die Stufen hochzusteigen und in die weitläufige Eingangshalle zu treten. Dort stand ein Dienstmädchen bereit, um ihr das Umschlagtuch abzunehmen; die Haube behielt Anne jedoch auf. Sie war es inzwischen gewöhnt, von Leuten eingeladen zu werden, die sie kaum kannte, und der heutige Nachmittag machte da keine Ausnahme. Der Schwiegervater ihrer Gastgeberin, der verstorbene Duke of Bedford, war ein Kunde der Cubitts gewesen, und James Trenchard hatte für ihn viele Arbeiten am Russell Square und am Tavistock Square ausgeführt. Heutzutage gab sich James natürlich gern als Gentleman, den es nur zufällig in die Geschäftsräume der Cubitts verschlagen hatte, und manchmal nahm man ihm das sogar ab. Er hatte erfolgreich Freundschaft oder zumindest freundliche Bekanntschaft mit dem Duke und dessen Sohn, Lord Tavistock, geschlossen. Dessen Gemahlin hingegen, Lady Tavistock, hatte sich stets als überlegene Gestalt im Hintergrund gehalten, führte sie doch als eine der Palastdamen der jungen Queen ein ganz anderes Leben. Anne hatte mit ihr in all den Jahren kaum mehr als ein paar höfliche Worte gewechselt, aber James bildete sich ein, dies genüge als Grundlage, um die Bekanntschaft fortzuführen. Der alte Duke starb zu gegebener Zeit, und als der neue Duke James’ Hilfe in Anspruch nehmen wollte, um den Londoner Besitz der Familie weiter auszubauen, hatte James einen dezenten Hinweis fallen lassen, dass Anne gern einmal den »Nachmittagstee« erleben würde, eine Neuerung der Duchess, über die so viel gesprochen wurde. Tatsächlich kam in Kürze eine Einladung.
Man konnte nicht behaupten, dass Anne Trenchard den gesellschaftlichen Alpinismus ihres Mannes missbilligte. Sie hatte sich daran gewöhnt. Sie sah, wie viel Vergnügen er daran hatte – oder zu haben glaubte –, und missgönnte ihm seine Träume nicht. Sie teilte sie einfach nicht mit ihm, genauso wenig wie in Brüssel vor fast dreißig Jahren. Sie war sich im Klaren darüber, dass die Damen, die sie in ihren Häusern empfingen, auf Anweisung ihrer Gatten handelten, die diese Anweisungen erteilten, weil James ihnen nützlich sein konnte. Nachdem sie ihm die kostbaren Einladungen zu Bällen, zum Lunch oder zum Dinner und nun zum neuartigen »Tee« überreicht hatten, nutzten sie seine Dankbarkeit zu ihren eigenen Zwecken. Anne erkannte – James leider nicht –, dass sie ihren Mann an der Kandare seines eigenen Snobismus führten. Ihr Mann hatte sich die Trense selbst in den Mund geschoben und die Zügel in die Hände von Männern gelegt, die sich nichts aus ihm machten, sondern nur auf die Profite aus waren, die er ihnen verschaffen konnte. Annes Aufgabe dabei war es, vier- bis fünfmal am Tag die Kleider zu wechseln, mit abweisenden Damen in großen Salons herumzusitzen und dann wieder nach Hause zu fahren. Sie hatte sich an dieses Leben gewöhnt. Die Lakaien und der ganze Prunk, der von Jahr zu Jahr zuzunehmen schien, machten sie inzwischen weder nervös, noch ließ sie sich davon beeindrucken. Sie betrachtete dieses Leben realistisch als das, was es war: der Ausdruck einer anderen Lebensart. Mit einem Seufzer erklomm sie in der Eingangshalle die große Treppe mit dem vergoldeten Handlauf, die sie unter einem lebensgroßen Porträt ihrer Gastgeberin in Regency-Toilette vorbeiführte, gemalt von Thomas Lawrence. Anne fragte sich, ob das Bild womöglich nur eine Kopie war, die die Londoner Besucher beeindrucken sollte, während das Original fröhlich und allen Blicken verborgen im ländlichen Herrensitz der Familie hing.
Als sie den oberen Treppenabsatz erreicht hatte, strebte sie auf einen weiteren großzügigen Salon zu, diesmal ausgeschlagen mit zartblauem Damast, mit einer hohen, freskenbemalten Decke und vergoldeten Türen. Eine große Schar von Damen saß auf Sesseln, Sofas und Ottomanen, balancierte Teller und Tassen und verlor häufig die Kontrolle über beides. Eine Handvoll Gentlemen, modisch auf der Höhe der Zeit und offensichtlich Geschöpfe des Müßiggangs, saß plaudernd dazwischen. Einer von ihnen blickte auf und nahm Annes Ankunft zur Kenntnis, doch Anne sah einen leeren Sessel am Rand der Gesellschaft und steuerte lieber diesen an. Ihr Weg führte sie an einer alten Dame vorbei, die gerade nach einem Teller Sandwiches tastete, der über ihren ausladenden Rock hinabzugleiten drohte; Anne fing ihn für sie auf. Die Unbekannte strahlte. »Gut gemacht.« Sie biss von ihrem Sandwich ab. »Nicht, dass ich einem leichten Imbiss mit Kuchen und Tee abgeneigt wäre, der die Zeit bis zum Dinner überbrückt. Aber warum können wir uns dazu nicht an einen Tisch setzen?«
Anne hatte ihren Sessel erreicht und hielt sich nach der relativ freundlichen Gesprächseröffnung ihrer Nachbarin auch für befugt, den Platz neben ihr einzunehmen. »Ich glaube, der Sinn des Ganzen ist es, nirgendwo festzusitzen. Wir können uns alle frei bewegen und uns unterhalten, mit wem wir möchten.«
»Nun, ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten.«
Ihre Gastgeberin eilte leicht besorgt herbei. »Mrs Trenchard, wie nett von Ihnen hereinzuschauen.« Das klang nicht so, als würde von Anne erwartet, sehr lange zu bleiben, was Anne durchaus recht war.