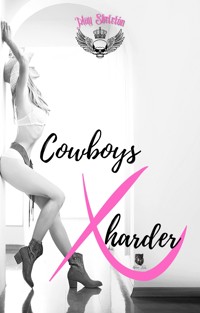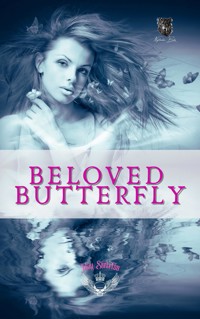
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nightwolve Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Lilly Ich wurde gebrochen - sagen sie! Ich habe die Hölle durchquert - sagen sie! Fakt ist... Ich kann mich nicht erinnern. Damon Ich muss sie beschützen - nicht mich in sie verlieben! Ich weiß, sie wollen sie zurück - und meine Lüge könnte ihr das Leben kosten. Familie bedeutet, für einander da zu sein. Familie bedeutet Liebe und Vertrauen. Hast du dich gefragt, was passiert, wenn diese Bedingungslosigkeit sich in Hass verwandelt? Ohne Erinnerung kannst du deinen Feind nicht erkennen. Ohne Erinnerung ist es schwer, der Lüge nicht zu erliegen. Ohne Erinnerung ist es unmöglich, am Leben zu bleiben. Die Wahrheit ist nur einen Flügelschlag entfernt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Beloved Butterfly
Für alle,
denen ein Flügelschlag
nie genug sein wird.
Impressum
Texte: Copyright May Skeletón
Cover: Franziska Göbke unter Verwendung von Bildlizenzen von Shutterstock.com und canva.com
Lektorat & Korrektorat: Nightwolve Books, Andreas MärzFranziska GöbkeGiekersgasse 1
99734 Nordhausen
Dieses Werk ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie Schauplätzen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle darin beschriebenen Vorkommnisse sind frei erfunden.
Der Inhalt dieses Buches ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Vervielfältigen und Weitergabe ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Der Abdruck des Textes, auch nur in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin.
Mehr Informationen und Kontakt unter:
Triggerwarnung
„Triggered“ und „getriggert“ bedeuten insbesondere, dass etwas eine starke emotionale Reaktion auslöst. Eine Folge vom „getriggert“ sein ist, dass eine Person nicht mehr rational denkt, sondern sehr emotional wird.
Es ist wichtig, dass du als Leser diesen Punkt NICHT geflissentlich überliest oder gar überschreitest!
Ich möchte dich als Leser bitten, meine Warnung zu beachten, die ich keinesfalls bis ins kleinste Detail ausformulieren kann.
Gewalt, Mobbing, Bulimie, gleichgeschlechtliche Liebe und Suizid bilden nur einen kleinen Teil dessen, den du lesen könntest. Wenn es im Vorfeld zu schweren traumatischen Erlebnissen gekommen ist, dann bitte ich dich, das Buch an dieser Stelle nicht weiterzulesen.
Solltest du in einer akuten Situation sein, dann hol dir bitte Hilfe. Es ist keine Schande und keine Schwäche. Im Leben gibt es Momente, in denen es dir nicht gutgehen darf.
Eine mögliche Anlaufstelle ist das Hilfetelefon: https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/mobbing.html
Bitte geh immer sorgsam mit dir und deiner Gesundheit um.
May Skeletón
Prolog
Lilly - in der Klinik
Wie viel Schmerz kann ein Mensch in seinem Leben ertragen, ohne daran zu zerbrechen? Welcher Kraft von außen bedarf es, um ein Herz in tausend Stücke zu zerfetzen?
Ich wurde gebrochen und meine Seele zerrissen. Geschlagen, gefoltert und zum Sterben zurückgelassen. Ich hatte nie eine Chance auf ein normales Leben. Konnte nie meinen Träumen nachjagen, glücklich sein oder gar Fehler machen.
Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Der Tod wollte mich nicht zu sich nehmen. Stattdessen wurde ich halb verhungert und dehydriert in diese Klinik geschafft. Jedenfalls gilt das für meinen ersten Aufenthalt, der inzwischen mehrere Jahre zurückliegt. Ich dachte, ich hätte meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Doch das kann niemand von uns. Wie sehr wir uns auch bemühen, eines Tages klopft sie an deiner Tür und fordert ihren Tribut.
Aus Angst verstecke ich mich hier, denn ich weiß, dass sie mich holen wollen. Sie glauben, ich würde sie verraten und das schmutzige Geheimnis lüften, welches sie begraben haben. Die Dinge, die sich in meinen Träumen widerspiegeln und mir die Luft zum Atmen rauben. Ich bin hier sicher, das rede ich mir ein. Ein Teil von mir zwingt mich jedoch zur Vorsicht.
Wie so oft wische ich mir die Tränen von der Wange und sehe aus dem kleinen Dachfenster meines Gefängnisses. Der kalte Winter hat seine Schatten abgeworfen und bietet dem Frühling Einzug. An den Beeten wachsen die ersten Schneeglöckchen und unzählige bunte Krokusse.
Ich mag Blumen – früher einmal. Als meine Welt noch in Ordnung zu sein schien.
Ein lauter Knall durchbricht die nächtliche Stille. Der Boden scheint zu vibrieren. Rauch drückt sich durch die Spalten meiner Zimmertür. Es dauert nicht lang und die Schwaden erschweren mir das Luftholen.
In Trance registriere ich, wie meine Tür aus den Angeln fliegt und ein Mann hineintritt. Er trägt eine Maske und hält akribisch Ausschau nach mir. Das weiß ich, denn als unsere Blicke sich treffen und unsere Augen sich fixieren, erkenne ich die Erleichterung. Meine Überlebensinstinkte rühren sich nicht. Wie angewurzelt bleibe ich inmitten des Raumes stehen und warte auf das Unvermeidliche. Er wird mich packen, mich mit sich nehmen, und beenden, was er angefangen hat.
1
Es musste einen Grund dafür geben, dass mich mein Job nicht mehr auszufüllen vermochte. Ich kannte den aktuellen Zustand, jedoch nicht die Gründe, die dazu führten. Nacht für Nacht lag ich wach und suchte nach einem Grashalm, an den ich mich klammern konnte. Es gab ihn nicht. Zumindest redete ich es mir ein.
Die Tage verbrachte ich schweigend an meinem Schreibtisch. Und nur wenn ich zu Einsätzen gerufen wurde, raffte ich meinen müden Körper auf. Schon vor Jahren hätte ich dieses Fleckchen Erde verlassen sollen, das sich mein Zuhause schimpfte. Ich seufzte und legte den Kopf in den Nacken. So, wie ich es mehrmals täglich tat. Dabei war ich nie der Typ für negative Gedanken. Niemand, der seinen Kopf in den Sand steckte. Es konnte nur am Umfeld liegen. Eindeutig! Die unzähligen Verbrechen, denen ich beruflich nachging, hatten ihre Spuren hinterlassen. Der Job hatte mir ein Privatleben unmöglich gemacht. Wer hielt es schon mit einem Mann aus, der vierundzwanzig Stunden am Tag seiner Arbeit verpflichtet war? Eine Frau oder gar Kinder rückten immer weiter in die Ferne, bis ich den Blick dafür verlor.
Natürlich besaß ich Freunde und die Möglichkeit, meinen Weg neu zu ebnen, doch wofür? Nicht um nach kurzer Zeit festzustellen, dass ich für meine Partnerin untragbar war. Was half es mir, des Polizeipräsidenten Liebling zu sein? Was half es mir, mehr Geld zu verdienen, als ich schlussendlich ausgeben konnte?
Und so drehten sich Gedanken im Kreis. Tagein – tagaus. Ich seufzte schwer, bevor ich mich erneut über die Akte beugte, die mir mein Kollege heute auf den Tisch gelegt hatte. Für gewöhnlich beschäftigte ich mich nicht mit Menschen, die noch am Leben waren. Insbesondere dann nicht, wenn die Beweislage so schwammig war wie in diesem Fall.
In der näheren Umgebung gab es eine Psychiatrie, die unter anderem mit zu meinem Revier zählte. Unter den Einheimischen als Hillbilly Ranch bekannt. Niemand der dort einen Fuß hineingesetzt hat, hatte ihn anschließend wieder hinaus bekommen. So sagt man! Ich wusste es besser. Aber in einer Kleinstadt wie Ferndale gab es eben Gerede. Beinahe so viel, wie täglich Brötchen gebacken wurden. Und wir sprachen über einige Brötchen. Doch genug von den Märchen. Immerhin hielt ich den spektakulärsten Fall des Jahrhunderts in den Händen. Ich lachte innerlich, aufgrund meines flachen Witzes auf und schüttelte den Kopf. Von der hiesigen geschlossenen Abteilung war in einer Nacht und Nebelaktion eine junge Frau entkommen. Nichts Spektakuläres, wäre nicht der Umstand, dass die Täter für diesen Fluchtversuch die halbe Klinik in Schutt und Asche gelegt hatten. Glücklicherweise kam niemand ernsthaft zu Schaden. Ein Grund mehr, weshalb diese Akte niemals auf meinem Tisch hätte landen dürfen.
Ich nahm den Hörer in die Hand und wählte auf der Kurzwahltaste meine Sekretärin. Madeleine, Mitte dreißig, eine recht ansehnliche Person, kam nur Sekunden später ins Zimmer spaziert. Sie trug stets perfekt abgestimmte Kleidervariationen inklusive der richtigen Schuhe. Selbst die Haare saßen vorbildlich. Diese Frau schien nichts aus der Ruhe zu bringen, nicht einmal meine oft hektische und mies gelaunte Art.
»Wie kann ich behilflich sein?« Ihr zuckersüßes Lächeln, bei dem Madeleine die Lippen nach außen spitzte, erinnerte mich an meine kleine Schwester. Süß und unschuldig, so als könnte sie niemals ein Wässerchen trüben. Einzig allein die Tatsache, dass meine Schwester seit Jahren im Drogensumpf gefangen war und ich krampfhaft versuchte, dass dieses Detail nicht an die Außenwelt gelangte. Vehement schüttelte ich meine Erinnerungen ab und konzentrierte mich auf das, weshalb ich sie hatte kommen lassen.
»Ich habe die Akte vom Lasedale vor mir. Seien Sie so nett und besorgen mir die Dokumente der dort verschwundenen Patientin. Falls die sich weigern, dann machen Sie denen unmissverständlich klar, dass ich auf ihre ärztliche Schweigepflicht scheiße.« Madeleine bekam große Augen, kam meiner Anweisung jedoch, ohne zu zögern, nach.
Bevor ich nicht wusste, um wen es sich bei dieser Frau handelte, so lange konnte ich schlecht nach einem Täter suchen. Fürs Erste wollte ich mich ein wenig in der Klinik umsehen und mir ein eigenes Bild über die Schäden machen. Für den lästigen Papierkrieg hatte ich ja jemanden gefunden.
2
Mein gellender Schrei hallte aus der alten Empfangshalle meines Elternhauses. Schmerz durchfuhr meinen Körper und fesselte mich an den Boden unter mir. Es tat weh, doch ich wusste, wie sehr ich es verdient hatte. Ich brauchte diese Schmerzen, denn ohne sie müsste ich sterben. Ohne sie wäre ich verloren. Warum wollte mein Herz das einfach nicht verstehen? Warum wehrte es sich so entschieden dagegen? Die unzähligen Tränen auf meiner Wange verrieten den Zwiespalt in meinem Inneren. Sie schrien »HALT«. Sie schrien »Stopp«. Und mein Kopf? Er stand davor und ließ es nicht mehr gewähren.
»Das reicht«, hörte ich eine Stimme aus weiter Ferne und wusste, dass es nun vorbei war. Ich spürte, wie mich zwei Arme packten und die Stufen nach oben trugen. Sie unterhielten sich. Sie sprachen über mich, doch meine Gedanken trugen mich zu weit weg, um sie richtig zu verstehen. Vielleicht wollte ich auch nicht wissen, was sie sagten. Meistens waren es schlimme Dinge.
»Wir müssen aufpassen, Kai. Die Leute im Dorf beginnen bereits Fragen zu stellen, was wir hier oben treiben. Du weißt, wie es in einer Kleinstadt ist.«
»Das bildest du dir ein. Sie haben nichts bemerkt. Es ist normal, dass sie Fragen stellen.« Nur spärlich bekam ich mit, wie sie sich weiter über die Klinik unterhielten und über die Tatsache, dass das Elternhaus wieder bewohnt war.
Da war es wieder. Das Gefühl der endlosen Tiefe, sobald sie davon sprachen. Sämtliche Erinnerungen drangen an die Oberfläche und durchbrachen die winzige Mauer meines Schutzes. Als hätte man einen Schalter umgelegt, begann ich loszuschreien. Nach wem oder nach was? Ich wusste es selbst nicht mehr. Es war egal, ob man mich hören würde. Denn niemand konnte mir helfen. Niemand.
***
Als ich erwachte, lag ich in meinem Bett. Die Arme und Beine waren an die Pfosten gebunden, sodass ich nicht in der Lage war, aufzustehen. Mit all dem Beruhigungsmittel in mir wäre es ohnehin unmöglich gewesen.
Im Haus war es totenstill. Kein Lichtschein drang in mein abgedunkeltes Zimmer. Panik stieg in mir auf, denn ich konnte nicht schlafen, sobald das Licht ausgeschaltet war. Das Kribbeln in meinem Bauch wuchs zu einer Welle, die unaufhaltsam ihre Bahnen zog. Ich brauchte mir nicht einreden, dass ich stärker war als meine Angst, denn das war ich nicht. Sie dominierte mich. Sie dominierte alles! Es half nichts, die Augen zu schließen. Selbst dann konnte ich die Fratzen um mein Bett tanzen sehen.
Zum zweiten Mal an diesem Tag hallte mein Schrei von den Wänden wider. Mit all meiner Kraft wehrte ich mich gegen die Fesseln und die Monster neben mir. Panik drohte mein Herz in tausend Teile springen zu lassen, wenn es das nicht längst schon wäre.
»Dann tu es«, spuckte ich der Dunkelheit entgegen. Sollte sie mich doch holen. Es gab nichts mehr, für das ich zu kämpfen bereit wäre. Nichts!
Die Tür wurde aufgerissen und knallte lautstark gegen die Wand. Ein greller Lichtstrahl traf in mein Gesicht und vertrieb die Dämonen, die bereit waren, mich mit ihnen zu nehmen.
»Du hast das Licht ausgemacht«, schrie ich. Nicht einmal. Nicht zweimal. Tausendfach.
Die Hände meiner Schwester berührten mein Gesicht. Ihre Worte drangen durch das Rauschen in meinen Ohren.
»Es tut mir leid, Lilly«, flüsterte sie in mein Ohr. »Es tut mir alles so unendlich leid.« Schmerz durchfuhr meinen Körper, bevor die Dunkelheit mich endgültig in Fesseln legte.
3
Die Sonne blendete mich und nahm mir augenblicklich die Sicht auf die Straße. Beherzt wich ich einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und atmete erleichtert auf, als ich in den kleinen Waldweg einbog, der mich zur Klinik führte. Hier draußen in der Wildnis bekam das Gebäude zusätzlich einen unheimlichen Charakter, den selbst die hellgrüne Fassade nicht auflockern konnte. Die alten gekreuzten Holzfenster mit den Gittern davor wirkten seltsam beklemmend auf mich. Und das von jemandem, der im Knast ein und aus ging.
Zum Haupttor führte ein schmaler Pfad, den ich unmöglich mit dem Wagen erreichen konnte. An der letzten Wendemöglichkeit parkte ich meinen alten Chevrolet ab und begann mit dem Aufstieg. Für den Monat März hatten wir angenehme fünfzehn Grad und selbst die Sonne ließ ihre Strahlen des Öfteren durch das Dickicht des Waldes glänzen. Einem Impuls folgend legte ich den Kopf in den Nacken und atmete tief die frische Luft ein.
»Mr. Hill, nehme ich an?« Die fremde Stimme löste mich sofort aus meiner Trance, die ich gern noch weiter genossen hätte. Ein Mann, etwa um die sechzig, mit lichtem, grauem Haar und einem schlichten Arztkittel stand mir gegenüber und sah mich erwartungsvoll an. In seinen Augen konnte ich erkennen, wie müde und abgekämpft er war. Offenbar musste er seit dem Vorfall mehr Überstunden leisten, als er vertragen konnte.
»Ja. Und mit wem habe ich die Ehre?«, wollte ich wissen und sah mich nebenbei ein wenig um. Von meiner derzeitigen Position war kein Mangel am Komplex zu erkennen. Fassade, Dach und Haupteingang wirkten intakt.
»Mein Name ist Professor Doktor Chamous. Ich arbeite seit mehr als zwanzig Jahren hier und leite die Psychiatrie in den letzten drei Jahren. Bitte lassen Sie sich gesagt sein, dass sowohl ich, als auch mein Personal Sie in allem unterstützen.« Letzteres hörte ich gern, doch ich wusste nur zu gut, dass es Grenzen gab. Über die ärztliche Schweigepflicht ging kaum ein Mediziner hinaus. Ganz gleich, wie schwerwiegend ein Fall auch sein mochte.
»Das höre ich gern. Es würde mir reichen, wenn Sie mir den Bereich zeigen könnten, in dem die Bombe gezündet wurde.« Aus der Akte heraus konnte ich mir bereits den vorläufigen Bericht der Spurensicherung sowie der Brandexperten zu Gemüte führen. Es handelte sich um eine Rohrbombe, die an das Alarmsystem gebunden wurde. Nach der Auslösung hatten die Täter eine Viertelstunde Zeit, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Gleichzeitig sorgte eine manipulierte Patientenvorrichtung dafür, dass das Personal zusätzlich abgelenkt worden war. Die Täter waren clever und wussten genau, was sie taten. Deshalb ging ich davon aus, dass sie berechnend und äußerst brutal waren.
»Sehr gern.« Der Professor wandte sich von mir ab und ging geradewegs in den Hofbereich. Der Blickwinkel gab preis, wie stark die Detonation gewirkt haben musste. Ein Drittel des Klinikums war förmlich dem Erdboden gleichgemacht. Selbst wenn die Aufräum- und Bauarbeiten schon wieder begonnen hätten, so blieb ein Bild der Zerstörung.
»Gab es vor dem Übergriff Auffälligkeiten? Hat einer Ihrer Angestellten etwas Ungewöhnliches feststellen können?« Inzwischen waren kaum mehr als achtundvierzig Stunden vergangen. Vielleicht erinnerte sich der ein oder andere noch an etwas, schoss es mir durch den Kopf. Aus Erfahrung wusste ich, dass viele erst nach einem traumatischen Ereignis eins und eins zusammenzählten. Sei es ein neuer Postbote oder ein anderer Wäschefahrer. Alle konnten maßgeblich tatverdächtig sein.
»Das ist es ja. In den letzten Tagen hatte es so viel geregnet, dass die Stadt die Zufahrtsstraße sperren ließ. Niemand ist rein- oder rausgekommen. Selbst die Mitarbeiter und auch meine Wenigkeit saßen hier oben fest.« Wenn dem so war, dann deutete es darauf hin, dass jemand mit Umgebungswissen zugange war. Ohne dies war es schlichtweg unmöglich, sich in den Wäldern zurechtzufinden. Ein Fakt, dem ich dringend nachgehen sollte.
»Wie sieht es mit der Verschwundenen aus? Was können Sie mir über die Person sagen?« Professor Chamous sah sich kurz um und atmete tief durch.
»Im Sinne meiner Patientin möchte ich das nicht hier draußen besprechen. Lassen Sie uns in mein Dienstzimmer gehen. Meine Sekretärin hat die Akte bereits hinterlegt, sodass Sie sich Ihr eigenes Bild machen können.«
Kopfnickend folgte ich ihm ins Innere. Ich konnte nicht leugnen, dass es mich brennend interessierte, wer diese Lilly war. Und vor allem, warum sie an einem Ort wie diesem lebte und nun spurlos verschwunden war.
4
Die Nacht war mit all ihren schwarzen Schatten verschwunden und erlaubten es mir, zum ersten Mal durchzuatmen. Über den Hügeln wanderte die Sonne an den Horizont und versprach einen wundervollen Tag. Die frische Märzluft bahnte sich den Weg durch mein Zimmer. Begleitet von unzähligen Frühlingsboten zauberte es mir ein Lächeln ins Gesicht. Ein sehnsüchtiges. Keines von denen, die fernab jeglicher Realität lagen. Dies war geschmückt mit Herz und Seele und sollte sofort gebrochen werden.
Die Tür zu meinem Zimmer wurde aufgerissen und ein Mann trat herein. In Momenten wie diesem, einem klaren Augenblick, in dem ich keinen Medikamenten ausgesetzt war, erkannte ich ihn. Und mit ihm all die schlimmen Erinnerungen, die er mir beschert hatte.
Ich war das Jüngste von vier Kindern. Allerdings auch die Quirligste. Meine Mutter nannte mich oft den Stromstoß in ihrem verkackten Leben. Ja, beschissen war es! Mit der Erziehung von drei Töchtern und einem Jungen war sie schlicht und ergreifend überfordert. Dazu kamen ihr ständiger Alkohol- und Drogenkonsum und die daraus resultierende Aggressivität. Ich war dem nie ausgesetzt, im Gegensatz zu meiner Schwester Susan. Als Älteste musste sie die Auswirkungen einstecken und erdulden. Mit der Zeit entwickelte sie daraus Hass gegenüber uns Jüngeren und ließ es uns regelmäßig spüren. Wenn sich Mutter wieder einmal die Birne zugedröhnt hatte und sie für uns verantwortlich war, bekamen wir ihr wahres Gesicht zu sehen. Mit Rohrstock, Gürtel oder Sachen, die ihr zufällig in die Hand fielen, prügelte sie auf uns ein.
Verstecken? Zwecklos!
Abhauen? Zwecklos!
Und als ihr Freund Kai mit den Jahren auch ein Teil dieses Kreislaufes wurde, waren wir nicht mehr sicher.
Die Bilder mussten aus meinem Kopf. Dringend! Wut und Angst bildeten eine gefährliche Mischung. Einen explosiven Cocktail in meinem Blut, der lediglich durch meine Angst Einhalt bekam.
»Was glotzt du mich so an?«, schrie mich Kai ohne erkennbaren Grund an. Panisch suchte ich nach einer Möglichkeit, um mich zu verstecken. Nur wo? Bis auf ein Bett, das seine besten Zeiten inzwischen hinter sich hatte, und einem Tisch mit zwei Stühlen war der Raum leer gefegt. Die Tapeten fielen beinah von den Wänden und entblößten hier und da große Flecke.
In meinem kindlichen Reflex lief ich zum Bett und versuchte, mich darunter zu verstecken. Wie blödsinnig meine Idee war, bemerkte ich, als Kai mein Bein zu fassen bekam und mich ruckartig wieder herauszog. Ich hatte keine Chance und würde sie nie erhalten. Er war zu stark für mich und er hatte nichts mehr zu verlieren. Genau das verriet der starre Blick aus seinen Augen.
»Du kannst froh darüber sein, dass wir größere Probleme haben als deine dämlichen Anfälle.« So abrupt, wie er mich angepackt hatte, ließ er mich los und stolzierte aus dem Zimmer. Wie hatte er das gemeint? Größere Probleme? Mit mir? Was war zwischen dem Abend in der Klinik und dem gestern passiert? Ich musste es dringend herausfinden! Selbst wenn das schwierig sein würde, denn meine Krankheit machte es mir unmöglich. Unmöglich, sobald ich mich in einem Anfall verlor. Teilweise konnte ich mich an tagelange Episoden nicht erinnern. Sie waren wortwörtlich im Nebel gefangen. Niemand konnte genau erklären, warum das so war. Andere Patienten, die ebenfalls an einer bipolaren Störung litten, wiesen diese Art von Reaktion nicht auf. Aus diesem Grund und eben wegen meiner Störung hatte ich mich jahrelang in Behandlung begeben.
»Warum hast du mich aus der Klinik geholt?«, fragte ich laut, obwohl niemand hier war.
»Können Sie mir sagen, was Sie hierhergeführt hat?« Der Arzt sieht mich direkt an. In seinem Blick kann ich erkennen, wie Mitgefühl, Neugierde und Ungeduld an ihm nagen. Er wirkt gestresst und reibt sich immer wieder die Stelle unter seinen Augen. Es macht mich wahnsinnig, angestarrt zu werden, sodass ich kurz davor bin, meinen Rückzug anzutreten. Ich tue es jedoch nicht.
»Ich bin mir nicht sicher, was genau ich hier möchte. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin«, stottere ich. Und seltsamerweise habe ich keine Ahnung, ob er mir helfen kann. Beziehungsweise wie ich ihm erklären könnte, was genau nicht mit mir stimmt.
Als er mich erneut ansieht, werden seine Züge weicher und lösen mich von meiner angespannten Körperhaltung.
»Sie müssen sich keine Gedanken machen. Vielleicht erzählen Sie mir einfach etwas von sich. Manchmal kommt der Rest dann von ganz allein.« Nachdenklich beiße ich mir auf die Unterlippe und suche nach einem Anfang. Nach einer Ecke, die ich anreißen konnte.
»Es fällt mir schwer, über meine Vergangenheit zu sprechen. Insbesondere deshalb, weil ich mich an viele Dinge einfach nicht erinnern kann. Letzteres ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich vergesse Situationen, Menschen, zeitweise sogar Tage. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, es ist eine gähnende Leere in meinem Kopf.« Dr. Chamous sieht mich an und hält mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn nach oben. Die Geste lässt ihn müder und älter aussehen, als er in Wirklichkeit ist.
»Hatten Sie kürzlich ein traumatisches Erlebnis? Einen Unfall oder eine Konfrontation? Es kann vieles Auslöser dafür sein, dass unser Gehirn Erinnerungen löscht. Meistens jedoch nur aus einem triftigen Grund.« In meinem Kopf suche ich bereits nach einer Antwort, noch bevor Dr. Chamous fertig ist. Dadurch erscheinen meine Worte wie aus der Pistole geschossen:
»Nichts, woran ich mich erinnern könnte.«
Ich hatte ihn nicht belogen, denn es herrschte buchstäblich Wüstenstimmung in meinem Hirn. Was hatte Dr. Chamous nicht alles probiert, um mir Informationen entlocken zu können. Er kämpfte vergebens. Mir konnte man nicht mehr helfen. Es gab keine Chance. Das musste ich einsehen. Ebenso wie die Tatsache, dass ich in etwas geraten war, dessen Ausmaß mir nicht bewusst zu sein schien.
5
Der Professor hatte Wort gehalten und mir ungehinderten Zugang zur Krankenakte der Entführten vorgelegt. Darin war auch ihre zuletzt gemeldete Adresse vermerkt. Seltsamerweise fand ich dazu nichts in meinen Unterlagen. Genau aus diesem Grund wollte ich schleunigst dorthin. Ich zückte mein Handy und übermittelte Madeleine mein weiteres Vorhaben. Was auch immer mich bei der Adresse erwarten würde, es musste einen Hintergrund geben, warum die Polizei keine Kenntnis davon hatte.
»Ich bedanke mich für Ihre Offenheit, Professor. Die Akte erhalten Sie nach der Überprüfung zurück.« Er unterbrach mich mit einer wilden Handbewegung.
»Kein Problem. Was mir mehr Sorgen macht, ist der Zustand der Frau. Sie war noch nicht lange Patientin und wir hatten kaum die Möglichkeit, uns ein richtiges Bild von ihr zu machen. Was ich Ihnen jedoch sagen kann, ist, dass Miss Whealer unter einer bipolaren Störung leidet, die mit massiven Erinnerungslücken und starken psychotischen Schüben einhergeht. Und ich vermute, dass es einen gravierenden Auslöser dafür gibt. Vermutlich werden Sie diesen im näheren Umfeld der Frau finden. Und vielleicht auch die Person, die für den Übergriff in meinem Haus verantwortlich ist.« Wollte der Professor damit andeuten, dass hier jemand etwas zu vertuschen versuchte? Es wurde höchste Zeit, mehr über diese Lilly herauszufinden.
»Ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen.« Und das hatte er. Immerhin besaß ich nun mehr Informationen und Ansätze als vor ein paar Stunden. Leider aber auch die Einsicht, dass mehr an diesem Fall dran war, als ich auf den ersten Blick erkennen konnte. Hier lag eindeutig etwas im Argen! Mir fiel der Fall ein, der sich vor etlichen Jahren nur fünfzig Kilometer von hier zugetragen hatte. Die kleine Casey Miller war mit fünf Jahren entführt und fast zwanzig Jahre im Keller eines Hofes gehalten worden. Nur durch Zufall wurde man auf den Mann aufmerksam und auf sein dunkles Geheimnis. Das Mädchen war auf jede erdenkliche Art gefoltert und gequält worden. Wenn der Professor also recht behalten würde, was war der Auslöser bei Lilly? Gab es jemanden, der der Frau so massiv zugesetzt hatte und nun seine Tat vertuschen wollte? Wurde sie vergewaltigt oder misshandelt? War sie Zeuge eines Mordes?
STOPP! Seit wann war ich jemand, der sich Spekulationen hingab? Ich blieb vor meinem Wagen stehen und atmete tief durch, bevor ich ins Innere stieg und zur Adresse in Lillys Unterlagen fuhr.
***
Der Geruch von Kot und Urin stieg mir unweigerlich in die Nase, nachdem ich die Containersiedlung am Rande der Lichtung betreten hatte. Früher gehörte es einem Gutsbesitzer aus Ferndale, der sie an Touristen vermietete. Heute gehörte es zu den schäbigsten Ecken und der Bürgermeister verleugnete deren Existenz und Zugehörigkeit. Hier sollte sie also leben? Unzählige Container reihten sich aneinander. Nicht fachgerecht waren Fenster hineingeschnitten, um zumindest etwas Tageslicht ins innere dringen zu lassen. Von der äußeren Hülle blätterte bereits die rote Lackfarbe ab und lag verstreut auf dem Boden drum herum.
Augenpaare folgten jedem meiner Schritte. Hier war man es nicht gewohnt, Besucher zu empfangen. Und noch weniger Bullen, wie ich einer war.
»Kennt jemand eine Lilly Whealer? Sie soll hier wohnen.« Lautes Gelächter ging durch die Runde. Hin und wieder sah ich ein Kopfschütteln, doch niemand antwortete mir.
»Sie ist verschwunden und es würde mir sehr helfen, wenn mir jemand ihren Container zeigen könnte.« Nichts.
»Gut. Dann muss ich wohl Verstärkung anrücken lassen.« Provozierend zog ich das Handy aus der Tasche und scrollte durch meine Liste. Drei, zwei eins.
»Ist gut, Mann! Ich zeig’s dir.« Ein Mann in meiner Nähe winkte mit den Fingern, dass ich ihm folgen sollte. Seine Klamotten waren zerrissen, dreckig und viel zu klein. Bedauerlich, wenn ein Mensch so leben musste, wie es Hunderte hier taten.
»Nimms nicht persönlich, Kleiner.« Ich nickte lediglich und folgte ihm zu einem abgelegenen Container.
»Was ist mit Lilly?«, wollte der Unbekannte wissen und rieb sich seinen verdreckten Bart. Dicke Schwielen prangten an seinen Fingern und was wusste ich noch alles. In der Siedlung gab es keinen Strom und kein fließend Wasser.
»Kannten Sie die Vermisste?«, stellte ich die Gegenfrage, denn über laufende Ermittlungen konnte ich ihm keine Auskünfte geben. Davon abgesehen wusste ich kaum etwas über Miss Whealer.
»Lilly gehört schon ’ne Weile zu uns. Keine Ahnung, seit wann, aber lange iss’s her. Aber sie war die Einzige von uns, die einen Job hatte. Frag mich, warum sie hier lebte.« Das war ja interessant! Warum war ich nicht im Besitz dieser Informationen? Sobald ich wieder im Revier war, würden Köpfe rollen. Das stand fest! Es gab nichts Schlimmeres als Unwissenheit.
»Sie scheinen mehr Dinge über die Frau zu wissen, als mir bekannt sind. Miss Whealer ist vermutlich entführt worden.« Bei der Erwähnung zuckte der Fremde zusammen und ich ebenfalls, denn ich hatte ihm doch verraten, warum ich auf der Suche nach ihr war.
Er wusste mehr, als er bereit war zuzugeben.
»Sie müssen versprechen, mich da rauszuhalten!« Ich nickte zustimmend. Es gab Möglichkeiten, einen Zeugen zu schützen. Oder besser gesagt eine Informationsquelle.
»Vor zwei oder drei Wochen. Ich weiß nimmer so genau! Da kam ein Mann hierher und suchte nach Lilly. Kein Bulle oder so. Aber er hat uns eine Heidenangst eingejagt und sogar den wilden Willy fast krankenhausreif geschlagen. Dann hat er Lillys Sachen durchsucht und ist wütend gefahren. Kurz danach ist sie dann auch verschwunden und seitdem nicht mehr hier gewesen.« Wieder kamen mir Dr. Chamous Worte in den Sinn. Hatte der Mann vielleicht etwas mit ihrem Verhalten und dem anschließenden Verschwinden zu tun?
»Ich danke Ihnen für die Offenheit. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde niemandem gegenüber erwähnen, dass Sie mir diese Informationen gegeben haben. Dennoch wird sich ein Team hier umsehen müssen. Lassen Sie die Leute arbeiten! Um so schneller sind die wieder verschwunden.