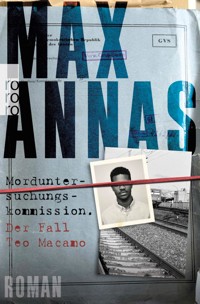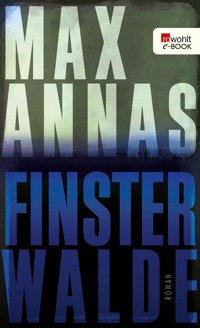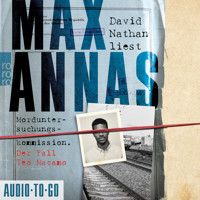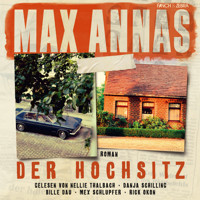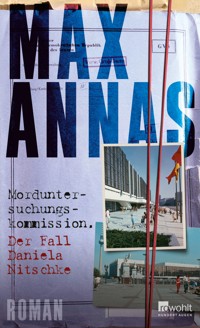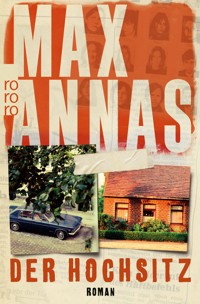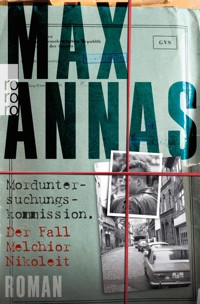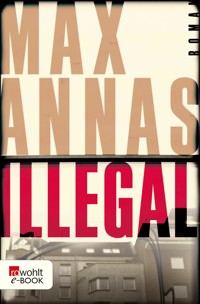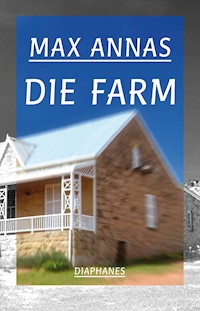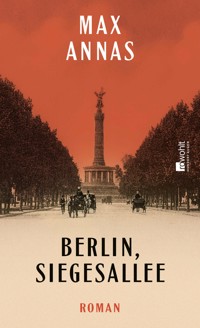
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Reich im Sommer 1914: Der Völkermord in Deutsch-Südwest liegt Jahre zurück, in den Kolonien herrscht Ruhe, und überhaupt lebt man in prächtigen Zeiten. Da lernen sich in Steglitz bei Berlin drei junge Männer kennen. Joseph Ayang, Sohn eines Kameruner Kolonialbeamten, will Theologie studieren. Friedrich Smith ist der im Reich geborene Sohn eines schwarzen Amerikaners. Ernst, der dritte, wurde von seinem Herrn aus Südwest mitgebracht. Die drei beschließen, dass etwas getan werden muss, um die Verbrechen in den Kolonien zu rächen: Sie bringen nachts Soldaten um, erst einen, dann zwei. Ohne Wirkung. Die Fabrikantentochter Florentine vom Baum hält es nicht aus in einer Gesellschaft, in der Frauen unfrei sind. Als sie über ihren Bruder die drei Männer kennenlernt, bietet sie ihnen ihre Hilfe an. Und die vier fassen einen ungeheuerlichen Plan: Der Kaiser soll sterben. Ein Roman darüber, was Menschen dazu treibt, Gewalt anzuwenden. Er spielt in einer Vergangenheit, deren Wirkungen wir heute noch spüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Ähnliche
Max Annas
Berlin, Siegesallee
Roman
Über dieses Buch
Das Reich im Sommer 1914: Der Völkermord in Deutsch-Südwest liegt Jahre zurück, in den Kolonien herrscht Ruhe, und überhaupt lebt man in prächtigen Zeiten. Da lernen sich in Steglitz bei Berlin drei junge Männer kennen. Joseph Ayang, Sohn eines Kameruner Kolonialbeamten, will Theologie studieren. Friedrich Smith ist der im Reich geborene Sohn eines schwarzen Amerikaners. Ernst, der dritte, wurde von seinem Herrn aus Südwest mitgebracht. Die drei beschließen, dass etwas getan werden muss, um die Verbrechen in den Kolonien zu rächen: Sie bringen nachts Soldaten um, erst einen, dann zwei. Ohne Wirkung.
Die Fabrikantentochter Florentine vom Baum hält es nicht aus in einer Gesellschaft, in der Frauen unfrei sind. Als sie über ihren Bruder die drei Männer kennenlernt, bietet sie ihnen ihre Hilfe an. Und die vier fassen einen ungeheuerlichen Plan: Der Kaiser soll sterben.
Ein Roman darüber, was Menschen dazu treibt, Gewalt anzuwenden. Er spielt in einer Vergangenheit, deren Wirkungen wir heute noch spüren.
Vita
Max Annas, geboren 1963, arbeitete lange als Journalist, lebte in Südafrika und wurde für seine Romane «Die Farm» (2014), «Die Mauer» (2016), «Finsterwalde» (2018) und «Morduntersuchungskommission» (2019) sowie zuletzt «Morduntersuchungskommission: Der Fall Melchior Nikoleit» (2020) fünfmal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Bei Rowohlt erschienen außerdem «Illegal» (2017) und «Der Hochsitz» (2021).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Siegesallee in Berlin, nach einer Postkarte von 1904
ISBN 978-3-644-01444-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1.
März 1914
Ohne diese eine Begegnung wäre das alles nicht geschehen.
Joseph hatte das recht schnell erkannt. Denn gibt es nicht diese Momente, in denen sich alles verändert? In den allermeisten Fällen spürt man dies freilich erst im Nachhinein, wenn nichts mehr rückgängig zu machen ist. Nur selten ist da etwas im Augenblick selbst zu spüren, in dem ein Ereignis oder eine Begegnung stattfindet.
Wie hier in diesem Moment.
Seien wir gerecht. Aus einer Kränkung erwächst mitunter Großes, das wusste auch Joseph. Diese Begegnung hatte nur stattfinden können, weil einem menschlichen Geschöpf Unrecht widerfuhr.
Und seien wir auch ehrlich. Die Begegnung, die Joseph für den Rest seines Lebens im Herzen tragen sollte, hätte später oder unter anderen Umständen geschehen können. Einen Tag oder zwei, vielleicht zwei Wochen oder gar drei, vier Monate später.
Möglicherweise mit vertauschten Rollen. Doch gleich unter welchen Umständen sie sich ereignet hätte, sie wären nicht aneinander vorbeigelaufen, ohne dem anderen mindestens eine stumme Bekundung des Respekts zu erweisen. In jenem Moment, in dem Joseph ihn zum ersten Mal erblickte, stand Friedrich Smith am Straßenrand, still wie eine Statue. Kaum nur hatte er wahrgenommen, wie dem Manne mitgespielt worden war. Auf seinem Spaziergang war er langsam näher gekommen, als der Omnibus gehalten hatte, um seine Passagiere aufzunehmen. Es hatte sich um eine kleine Ansammlung von Menschen gehandelt, die hinten auf die Plattform gestiegen war, um das Billett zu lösen. Und Friedrich Smith, den Joseph noch nicht kannte und den er auch nicht erkannte in diesem Moment, weil er ihn nur von hinten sah und also nur als einen außergewöhnlich gut gekleideten Herrn wahrnahm, war der Letzte von ihnen.
Weil es nicht weiter wichtig war zu beobachten, wie ein paar Leute, die es sich leisten konnten, den Omnibus bestiegen, wurde Joseph nur am Rande bewusst, was geschehen sein mochte, als Friedrich Smith wieder von der Plattform herunterstieg. Er war vielleicht noch 20 oder 25 Meter von der Haltestelle entfernt und nahm ohne echte Aufmerksamkeit wahr, wie sich Friedrich Smith wieder umwandte und dem Omnibus hinterherblickte.
Dabei stand er ganz still. Und das war es, was Joseph auffiel. Der Mann bewegte sich nicht.
Joseph passierte ihn und drehte sich in der Bewegung leicht nach hinten, als er erkannte, wie der Mann stoßweise ein- und ebenso heftig wieder ausatmete. Aber er sah noch mehr. Und deshalb hielt er mitten im Schritt inne und ging zu Friedrich Smith zurück, dessen Name Joseph immer noch nicht bekannt war.
Neben ihm angekommen, blieb er stehen und sah eine einzige Träne zwischen Nasenflügel und Wange kurz zögern und dann weiterlaufen und sich an der Oberlippe verteilen. Mit der bedächtigen Bewegung seiner Zunge fing Friedrich Smith sie auf. Ganz kurz nur war die Spur noch zu erkennen, auf der diese einsame Träne über die mittelbraune Haut gelaufen war, dann trocknete sie langsam. Friedrich Smith wandte sich Joseph zu und gab mit seinen Augen zu erkennen, dass er wusste, dass der andere genauso wusste.
Natürlich hatte Joseph schon selbst erlebt, was Smith gerade mitmachen musste. Und das mehr als einmal. Der Fahrkartenverkäufer hatte auch ihn schon aus dem Omnibus geworfen. So lange war er noch gar nicht in Deutschland, knapp sieben Monate waren es nun, aber er war schon viermal von der Plattform geschickt worden. Mal wortlos, mal lautstark.
«Joseph Ayang.» Er stellte sich vor, und Friedrich Smith tat es ihm gleich.
Und dann standen sie ein paar Minuten zusammen, ließen einen weiteren Omnibus passieren, ohne aufzuschauen oder gar zu versuchen, eine Fahrkarte zu kaufen. Sie sagten keinen weiteren Ton, spendeten sich trotzdem Trost im gemeinsamen Schweigen.
Irgendwann begann Friedrich Smith dann doch zu reden. Er arbeitete als Bote für ein Herrenoberbekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße, das sowohl Konfektionsware als auch Maßkleidung verkaufte, war nun auf dem Weg nach Schöneberg und hatte hier an der Potsdamer Straße umsteigen wollen, um in einer Schneiderei drei bestellte Anzüge abzuholen. Es war ein kleines Geschäft, auf das sich der Besitzer des Ladens, in dem er arbeitete, verließ, wenn er, was mitunter vorkam, mehr Aufträge hatte, als er allein zu bewältigen in der Lage war. Von dem Vorfall würde er natürlich nichts erzählen, betonte Friedrich Smith, als er die kleine Vorstellung beendet hatte.
Nicht, dass Joseph das nicht längst verstanden hatte. Dann erzählte er ihm von einem kleinen Gartenfest, das der Freund Theodor vom Baum am nächsten Tag, einem Samstag, zu veranstalten gedachte. Er fühlte sich heimisch genug im vom-Baum’schen Haushalt, um einen weiteren Gast mitzubringen, zumal einen, der so fein gekleidet war.
Friedrich Smith lächelte ernst und sagte: «Ganz gewiss werde ich kommen. Rechnen Sie bitte mit mir.»
2.
«Nun mach doch», sagte Theodor im Ausgang des Union-Lichtspieltheaters.
Florentine vom Baum sah ihren Bruder im Gegenlicht des späten Nachmittags. Auf dem Kurfürstendamm gingen Menschen auf und ab. Sie wünschte, es wäre schon Abend, weder wollte sie sehen, was sich draußen abspielte, noch von irgendjemandem gesehen werden.
Schon gar nicht gesehen werden.
Theodor kam ihr entgegen. «Was ist?», fragte er. «Du weinst ja.»
Florentine wischte sich durch die Augen. «Ich weine nicht.» Dann richtete sie den Rock und verließ mit ihrem Bruder das Foyer.
Mit einer Handbewegung stoppte Theodor eine Pferdedroschke. «Steglitz», sagte er nur. Florentine ließ sich von ihm auf die Sitzbank helfen und blickte ihn an, als er sich neben sie schwang. «Wir hätten auch eine Motordroschke nehmen können.»
«Sicherlich», sagte er. Nach einer kleinen Pause fuhr er fort. «Doch wer weiß, wie lange man sich noch für diese Art des Transports entscheiden kann. Bei all den Kraftdroschken, die es schon gibt in Berlin. Nenn es Nostalgie.»
Sie hatten den Asta-Nielsen-Film «Die Suffragette» geschaut. Einige von Florentines Freundinnen redeten schon darüber, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Der Film war für Jugendliche verboten, weil er zeigte, wie Asta Nielsen eine Bombe im Haus eines Politikers versteckte. Und aus anderen Gründen auch. Emilie, die eigentlich gar nicht Emilie hieß, sondern sich nur so nannte, weil sie nicht mehr Katharina gerufen werden wollte, wusste sogar, dass der Film in München die wichtigsten Szenen gar nicht zeigte. Sie waren einfach herausgenommen worden von den Behörden.
Vater hatte von ihrem Plan erfahren und Theodor mitgeschickt. Zuerst war sie empört gewesen, hatte es aber nicht gezeigt. Dann hatte sie die Vorteile dieser Entscheidung gesehen und sich gefügt. Sie war kurz vor ihrem einundzwanzigsten Geburtstag und somit gar nicht befugt, den Film zu sehen. Ihr Bruder hingegen, auch nur drei Jahre älter, aber mit einem markanten Vollbart ausgestattet, würde Florentine ohne weitere Probleme in den Kinosaal bringen.
«Wie bitte?», fragte sie zerstreut. Die Pferdedroschke war gerade auf die Konstanzer Straße abgebogen.
«Wo du nur wieder bist mit deinen Gedanken.» Theodor schüttelte den Kopf so heftig, dass sich der wilde Bart im Fahrtwind bewegte. «Und es ist doch alles gut ausgegangen, nicht wahr.»
Florentine musste den Bruder mit seltsamem Blick begegnet sein, denn er hob die Schultern und sagte: «Der Film. Der hatte doch ein schönes Ende.»
Im letzten Bild war Asta Nielsen von vier kleinen Kindern umgeben – und neben ihr stand der Politiker, den sie beinah mit der Bombe getötet hatte. Florentine war sich nicht ganz sicher, ob sie das Ende tatsächlich schön fand, wie Theodor es nannte. Sie war sich auch nicht sicher, ob sie vier Kinder haben wollte. Oder ob sie überhaupt welche bekommen wollte. Emilie hatte das in der vergangenen Woche einmal leise flüsternd erzählt. «Stell dir das nur einmal vor», hatte sie gesagt, als sie zum Tee zu Besuch war. Und dann hatte sie sich umgeblickt. Denn was es zu sagen gab, musste niemand mithören. «Stell dir vor, du könntest allein entscheiden.» Und bevor Florentine die Zeit gefunden hatte, nachzufragen, was sie damit meinte, hatte Emilie es schon erklärt. Und sie hatte, nicht zum ersten Mal, eine ganze Reihe von Ideen aufgezählt, über die sie schon lange nachgedacht hatte. Dass Frauen wählen durften, gehörte sowieso dazu. Jetzt redete sie zum ersten Mal auch über Kinder. «Stell dir also vor, dass du das selbst entscheidest, ob du welche haben willst oder nicht.»
«Aber dann will mich vielleicht niemand heiraten.» Florentine hatte gewusst, dass der Satz Emilie nicht gefallen würde. Sie bereute ihn auch umgehend. Dabei hatte sie doch schon tatsächlich zwei Angebote abgelehnt, hinter denen, wie sie vermutete, eher der Vater gestanden hatte als die beiden Herren, die um ihre Hand angehalten hatten.
Emilie, die von ihrer Familie nach wie vor Katharina genannt wurde, war aber auch mutig. Auf den dummen Satz antwortete sie erst gar nicht, sondern goss sich noch eine Tasse Tee ein. Sie hatte sich vor ein paar Monaten mit einem Mittel, das im Garten gegen Ungeziefer eingesetzt wurde, die Kopfhaut eingerieben, bis sie Blasen geworfen hatte. Der einzige Weg, die aufgetretene Krankheit zu kurieren, hatte darin bestanden, zunächst einmal das lange blonde Haar abzuschneiden. Und das war das Ziel der Operation gewesen. Die Kopfhaut war dann auch schnell wieder geheilt. Aber die Haare waren weg. Und seitdem wuchsen die Haare auf Emilies Kopf nicht mehr wirklich nach.
Florentine hatte den Eindruck, dass ihre Freundin es schaffte, mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Schere an ihre Frisur anzusetzen, die seit Längerem knapp unter dem Ohr endete.
«Mir hat nicht gefallen», sagte Florentine und blickte Theodor in die Augen, denn das war nun eine ernsthafte Diskussion, «dass die Suffragetten so …», sie musste überlegen, welches Wort ihr hier passend erschien, «so garstig sind. Sie wollen doch nur das Gute für die Frauen.»
Die kurz erhobene Hand, die lieblos Luft verdrängt in ihre Richtung, war etwas, das sie gut kannte von Theodor. Als er gerade lesen gelernt hatte, hatte er damit begonnen, so auf die kleine Schwester zu reagieren. Er wusste es besser. Wie hier und heute. «Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Florentine.»
Dann atmete er tief ein und überlegte, wie er fortfahren sollte. Sie versuchte erst gar nicht, ihn davon abzuhalten. Zu deutlich war die Einleitung gewesen. Auch das war ihr wohlbekannt. Es war eine Frage der Satzzeichen. Eine der gesprochenen Satzzeichen. Weniger schwerwiegend wäre gewesen, wenn er in einem Fluss gesagt hätte: «Das kannst du doch nicht ernst nehmen, Florentine.» Mit einem im Sprachverlauf ausgesprochenen Komma. Dann hätte er ohne längere Pause schnell weitergeredet, um eine alltägliche Argumentation auf alltägliche Weise hinter sich zu bringen.
Hier hatte Theodor aber einen Punkt gesprochen.
Punkt. Florentine. Punkt.
Es war tatsächlich eine Frage der Satzzeichen. Nach dem Satzende musste ihr Name dann umso deutlicher intoniert werden. Flo-Ren-Ti-Ne. Mit dem gezogenen und ins Laute wachsenden Vokal in der dritten Silbe. Das hatte er so gemacht, seit er zehn, elf Jahre alt war. Anderen gegenüber hatte er diese Angewohnheit abgelegt, er war allgemein aufgeschlossen und höflich, in ihrer Anwesenheit allerdings benahm er sich immer noch wie der Elfjährige. Jetzt holte Theodor tief Luft.
«Schau mal», sagte er. Auch das kannte sie. «Schau mal. Das ist Kintopp. Das kannst du doch beim besten Willen nicht als seriöse Kunst wahrnehmen. Nichts, aber auch gar nichts daran hat Bestand. Hast du gesehen, wer da so alles im Publikum saß? Na also. Für die einfachen Leute wird das gemacht. Und das ist nicht ganz ungefährlich, wenn ich das sagen darf.»
Die Pferdedroschke hielt vor der vom-Baum’schen Villa. Theodor bemerkte es kaum. «Vater ist übrigens auch der Meinung. Deshalb hat er mich ja gebeten, dich zu begleiten. Erstens kann man nie wissen, was passiert, wenn die Leute, die nicht über so viel Bildung verfügen wie wir, diesen aufwieglerischen Ideen ausgesetzt sind.»
«Aber …» Weiter kam sie nicht. Aufwieglerisch war doch gar nichts an dem Film, hatte Florentine sagen wollen. Schließlich waren die Suffragetten im Film als geradezu lachhaft verbissene Gestalten dargestellt worden, was sie als ungerecht empfand. Warum taten die Leute das, die so einen Film herstellten?
«Jetzt rede ich, liebe Schwester», sagte Theodor recht barsch. Man war angekommen, und der Droschkenkutscher drehte sich schon herum in Erwartung seiner Bezahlung. «Was wir da gesehen haben, ist ja nichts Natürliches in dem Sinne, dass dort nachvollziehbares menschliches Verhalten gezeigt wird. Diese Suffragetten, das wirst du nicht bestreiten, haben sich der Weibernatur ja geradezu krampfhaft entfremdet. Man findet immer wieder einmal eine, über deren Verhalten man sich nur wundern kann. Du kennst ja die Frau von dem Fabrikanten von Tötingen, man sieht sie nicht oft, aus guten Gründen, und bei ihr sagt man auch, dass sie immer wieder Phasen hat, in denen sie wirklich umnachtet erscheint. Aber was wir eben vorgeführt bekommen haben, geht ja weit darüber hinaus. Das war doch eine ganze …»
Theodor suchte nach dem passenden Begriff, worüber sich Florentine freute. Das kam immer häufiger vor, wenn er sie belehrte. Sie nahm es als ein gutes Zeichen, dass er sich dabei mehr und mehr anstrengen musste.
«… eine ganze Schar, nein, ich verbessere mich: eine Bande von Weibern, die sich so aufspielt. Und da frage ich dich: Warum sollten Frauen so handeln? Schon gar welche, deren Leben in einem gut situierten Milieu stattfindet. Siehst du, das entspricht nicht dem, was man erwarten kann. Und.»
Auch dies wieder eine Frage der Satzzeichen. Das und beinah gebellt, darauf Pause.
«Und!!!», wiederholte Theodor. «Und das ist das Wichtigste. Es liegt einfach nicht in der Natur der Frauen, sich so aufzulehnen. Du musst aus der Geschichte lernen. Wann wäre so etwas je geschehen? Siehst du. Wenn es natürlich wäre, dann hätte es längst und oft stattgefunden.»
Der Kutscher räusperte sich kaum hörbar, aber so, dass Theodor nicht umhinkam, es zu bemerken. Er zog eine Münze aus dem Jackett, reichte sie nach vorne, kletterte vom Wagen und bot Florentine die Hand. Sie stützte sich allerdings auf die Seitenwand der Droschke und sprang so hinab, dass sie mit beiden Füßen zugleich auf dem Boden ankam. Ohne den Bruder anzuschauen, dessen Augen sie freilich im Rücken spüren konnte, ging sie auf das Haus zu.
Beides hatte Florentine ausgiebig geprobt. Sowohl den lockeren Sprung von der Kutsche als auch den strengen Blick Theodors einfach zu ignorieren.
3.
Friedrich Smith spazierte betont langsam durch Steglitz. Er kannte diesen Teil Berlins nicht, obwohl er in der Stadt aufgewachsen war. Genau genommen war Steglitz, auch wenn man das nicht merkte, hinter der Stadtgrenze und gehörte bereits zum Landkreis Teltow. Aber er hatte schon manches Kleidungsstück als Lieferant überbracht und war so in vielen Quartieren unterwegs gewesen.
Nur hier eben nicht. Dabei sah es hier schon ganz städtisch aus. Sogar eine Straßenbahn fuhr gerade mit lautem Quietschen vorbei. Allerdings konnte man mit der Tram nicht durchfahren von Berlin aus, wo er im Herrenoberbekleidungsgeschäft Angermann arbeitete. Smith blieb stehen und drehte sich um die eigene Achse.
Er suchte die Villa der vom Baums. Dieser Kameruner war sich sicher gewesen, dass er ihn zu einem Gartenfest einladen konnte, ohne die Gastgeber konsultiert zu haben. Erstaunlich. Eine halbe Stunde nach ihm, hatte Joseph Ayang empfohlen, solle er dort ankommen. So bliebe ihm genügend Zeit, den neuen Gast anzukündigen. Hoffentlich war der Mann kein Aufschneider.
Smith jedenfalls war neugierig genug, der Einladung zu folgen. Es war aber auch eine bemerkenswerte Begegnung gewesen am vorigen Tag.
Weit konnte sein Weg nun nicht mehr sein. Die Villen hier in der Nähe des Botanischen Gartens standen in überschaubarem Abstand zueinander. Friedrich Smith hatte beeindruckendere Wohngebäude gesehen, die auf größere Grundstücke gebaut worden waren, doch das hier war schon, was er unter reich und vermögend verstand.
Da vorn beugte sich einer zu einem Beet hinab, das einen sattgrünen Rasen vom Trottoir trennte. Den konnte er ja fragen, wo die vom Baums lebten. Obwohl, dachte er, nun nahm er Stimmen wahr und Klavierklänge, eine Gesellschaft. Sicher musste er nur weitergehen und sich umsehen, dann würde er sein Ziel finden.
Kurz bevor er den Gärtner erreichte, erhob dieser sich und drehte sich herum, ganz so, als habe er den Blick auf seinen Rücken gespürt. Friedrich Smith sah einen so großen wie stämmigen schwarzen Mann, dessen Augen sich leicht weiteten, als er den Spaziergänger bemerkte. Smith mochte seinen Schritt kaum merklich verlangsamt haben, grüßte den Mann mit einem leisen Nicken und ging weiter auf die Geräusche zu, die umso lauter wurden, je näher er der benachbarten Villa kam.
Schon konnte er erste Gestalten erkennen, zwei junge Frauen, die nahe der Straße mit einem Glas in der Hand standen und in ein Gespräch vertieft waren, dahinter eine Gruppe älterer Herren, von denen einer drei andere mit erhobenem Zeigefinger belehrte. Aus einem Impuls heraus drehte Smith sich noch einmal um, bevor er die vom-Baum’sche Villa erreichte.
Der stämmige Gärtner hatte ihm hinterhergeblickt. So viel konnte er erkennen. Er blieb selbst auch stehen. Sie betrachteten einander einige Sekunden lang. Der andere in seiner blauen Schürze, grober baumwollener Stoff, feine weiße Streifen darin, kein Fleck darauf zu erkennen. Die Mütze passte farblich zur wollenen Hose, die der Jahreszeit nicht ganz angemessen schien, schließlich war es warm an diesem späten Märztag. Selbst dem weißen Hemd schien die Arbeit mit Dreck und Pflanzen nichts anhaben zu können. Es leuchtete beinah in der Nachmittagssonne.
Mit einem stummen Gruß, ein kurzes Nicken mit dem Kopf, verabschiedete sich Friedrich Smith vom Gärtner, dieser erwiderte die Geste. Dann wandte sich Smith um und ging gemächlichen Schrittes auf das Anwesen der Familie vom Baum zu.
Das Haus, auf das er blickte, war von seltsamem Geschmack. Fachwerk wie bei einem Bauernhaus, aber doch herrschaftlich anmutend. Der Lehmputz war von erdigem Braun und sah aus, als würde er regelmäßig gereinigt. Drei Stockwerke, gekrönt durch zwei unterschiedlich hohe Türmchen, ließen die Villa so hoch wie breit wirken, was der Umgebung geschuldet sein mochte, in der die Grundstücke eine gewisse Größe alle nicht überschritten. Wer Raum schaffen wollte, musste also in die Höhe bauen.
Einige Blicke waren schon auf ihn gerichtet, wie er einfach dort stand und darauf wartete, dass er auf das Grundstück gebeten wurde. Die der beiden Frauen zum Beispiel, die nah am Trottoir standen. Der gestikulierende ältere Herr starrte ihn ebenfalls an. So viel hatte er gelernt in seinem Leben: Auf ihn wartete niemand bei bürgerlichen Gesellschaften. Er sah aus, wie er aussah, war nicht von Adel und auch nicht von der Garde. Eine junge Frau stand an der Hausecke, die den Übergang zu einer größeren Rasenfläche markierte, wo, das schloss er aus dem Gewirr der Stimmen, weitere Gäste sich die Zeit vertrieben. Irgendwo spielte jemand auf einem Klavier, doch ob das aus dem Haus der vom Baums kam oder aus der Nachbarschaft, mochte er nicht zu sagen. Bach jedenfalls erkannte er. Die junge Frau starrte ihn unverwandt an, offener Blick, voller Neugier, und er wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. Sie trug erstaunlich kurzes Haar, gerade einmal schulterlang, dunkelblond, leicht gewellt, und machte schon einen Schritt auf ihn zu, als Friedrich Smith den Mann erkannte, der ihm an der Bushaltestelle wortlos beigestanden war. Begleitet wurde er von einem ungefähr Gleichaltrigen mit erstaunlich wildem Vollbart. Der Mann, der neben Joseph Ayang auf ihn zugeschritten kam, trug das Kinn so hoch, dass man ihn für den Gastgeber dieser Gesellschaft halten musste.
«Theodor», sagte Joseph Ayang, «darf ich Ihnen Herrn Friedrich Smith vorstellen.» Und dann: «Herr Smith, Theodor vom Baum ist der Gastgeber dieser kleinen Gesellschaft und ein sehr guter Freund. Nur wegen seiner Familie kann ich in Berlin sein.»
«Erfreut», sagte Theodor vom Baum mit breitem Lächeln über seinem mächtigen Bart. «Seien Sie willkommen.»
Friedrich Smith deutete eine Verbeugung an, reichte zuerst dem Gastgeber die Hand, dann Joseph Ayang und folgte den beiden in den Garten, der größer war, als er es erwartet hatte. Abgesehen von den älteren Herren, die er schon bemerkt hatte, waren die meisten Anwesenden in seinem und Theodor vom Baums Alter. Die Frauen in legerer, heller Nachmittagskleidung, die Herren im Alltagsanzug. So fiel er, das wurde ihm schnell klar, doppelt auf. In jedem Fall war er zu formal gekleidet mit Frack, Zylinder und Hemdbrust.
Eine Bedienstete näherte sich mit einem Tablett, auf dem eine Kanne, mehrere Tassen sowie Milch und Zucker zu sehen waren. Geübt goss sie mit einer Hand den dampfenden Tee ein, rührte alles zu einer hellbraunen Melange zusammen und reichte sie Smith.
Auf der Terrasse, hinter dem Haus gelegen, saßen andere Gäste in Korbstühlen. Einige von ihnen hielten Teller in der Hand, auf denen Napfkuchen lag. «Und das ist Mutter», hörte er eine Frau sagen. Die Hand auf der Schulter leitete ihn an, ins Hausinnere zu schauen, wo eine Frau am Flügel saß. Gewiss war es Bach, was sie spielte, aber er vermochte nicht zu sagen, um welches Stück es sich handelte. Nicht mit der Hand auf der Schulter.
«Ich übernehme unseren neuen Gast gerne», sagte die Stimme hinter der Hand. «Ich bin Florentine vom Baum», hörte er, als er sich herumdrehte und das Gesicht erkannte, dass ihn eben noch von der Hausecke aus voller Neugier betrachtet hatte.
«Mutter spielt, damit sie nicht reden muss», sagte Florentine. «So haben alle etwas von ihr. Finden Sie nicht?»
Friedrich Smith antwortete mit Verzögerung: «Sie spielt sehr gut.» Und dann, vielleicht, um die junge Frau zu beeindrucken: «Bach.»
«Sie mögen Bach?»
«Mehr als alles andere», sagte er, was beinah stimmte.
«Mutter spielt die Partita beinah täglich. Und heute schon zum zweiten Mal. Was machen Sie beruflich?»
Smith erzählte von seiner Anstellung bei Angermann, die er seit zweieinhalb Jahren innehatte. Er sagte, der Wahrheit entsprechend, dass er dort sehr zufrieden sei. Und er ließ sich sogar dazu hinreißen, zu erwähnen, dass er mit dem Gedanken spiele, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, eine Schneiderei, dass er dafür allerdings Geschäftspartner brauche, da er nicht über genügend Eigenkapital verfüge. Das war eine Untertreibung. Er besaß im Grunde genommen gar keins. «Smith & Partner», sagte er leise und lächelte Florentine an.
Die nickte und blickte in den Salon hinein. Ihre Mutter hatte die Partita beendet und starrte auf die Tasten. «Ich mache gar nichts», sagte Florentine. «Ich warte darauf, dass meine Eltern mir eine gute Partie vorschlagen und ich den Ärmsten dann wieder abblitzen lasse. Sie haben keinen guten Geschmack, wenn es um heiratswillige Herren geht. Meine Eltern, meine ich. Der letzte war wohlhabend und höflich, aber auch schon weit über vierzig Jahre alt. Vielleicht gehe ich in die Kolonien. Da gibt es sicher etwas für mich zu tun. Woher stammen Sie eigentlich?»
«Aus Berlin», antwortete Friedrich Smith. Und weil er mindestens genauso höflich war wie der heiratswillige Herr über vierzig, und weil er wusste, was Florentine als Nächstes fragen würde, woher er denn davor gekommen war, und weil er ihr diese Frage – und sich selbst die Antwort natürlich auch – ersparen wollte, sagte er: «Ich bin hier geboren.»
So konnte Florentine fragen: «In Berlin?» Und das, obwohl die Frage schon beantwortet war.
Und Smith sagte: «Mein Vater war hier Mitte der Achtzigerjahre. Sie haben von der Kongo-Konferenz gehört?»
Er sah, wie Florentine die Teile zusammenlegte und sich die nächste Frage entwickelte. Auch sie ersparte er ihr. «Mein Vater war Kammerdiener eines amerikanischen Delegierten auf der Konferenz. Und meine Mutter hat in dem Hotel gearbeitet, in dem die Delegation untergebracht war.»
Florentine hob zu sprechen an, wurde aber von Theodor und Joseph unterbrochen. «Vater wünscht uns zu sehen», sagte Theodor, woraufhin sich die Geschwister verabschiedeten. «Ich werde Sie ihm noch vorstellen», sagte Theodor im Gehen zu Smith.
«Fühlen Sie sich wohl hier?», fragte Joseph Ayang, als sie schon einige Momente schweigend beieinandergestanden und in den Salon geschaut hatten.
Eine alltägliche Frage, dachte Smith. Gestellt von einem, der immerhin dafür verantwortlich war, dass er hier stand und zusah, wie die Dame des Hauses ein neues Stück zu spielen ansetzte. Das er nicht sofort erkannte. War das Brahms? Es hatte etwas von dessen Gassenhauern.
Smith blickte dem Kameruner in die Augen und nickte. Worte waren nicht nötig.
«Noch Kuchen?», fragte die junge Frau im Hausmädchenkostüm, die eben noch Tee angereicht hatte. Sie nahmen sich beide. Joseph biss in das Stück. Friedrich brach eine Ecke ab und schob sie sich in den Mund. Dann erzählte er von der Begegnung auf dem Hinweg.
Joseph hatte gerade erneut abgebissen und kaute zu Ende, schluckte dann und nickte schon, bevor er begann zu reden. «Deutsch-Südwest», sagte er. «Er ist schon ein paar Jahre hier. Als Diener für besondere Aufgaben, wie man sich hier erzählt.»
«Was bedeutet das?», fragte Smith.
«Er arbeitet im Garten und serviert dem Herrn des Hauses.»
Smith war sich nun sicher, dass sie Brahms zu hören bekamen. Dessen eingängige Melodien waren nichts für ihn. Aber die Leute mochten es, das wusste er. «Und was hat der Hausherr in der Kolonie getrieben? Ist er Kaufmann? Militär?»
«Maler», sagte Joseph.
«Haben Sie je irgendetwas von ihm gesehen?»
«Nichts. Er soll in der Kolonie, in Deutsch-Südwest, Schlachtengemälde angefertigt haben.»
Mittlerweile standen so viele Leute um die Klavierspielerin herum, dass sie kaum noch zu sehen war. Brahms eben.
«Wie schon erwähnt, habe ich keines der Kunstwerke mit eigenen Augen gesehen», sagte Joseph und machte eine Pause, während deren sich Smith fragte, ob der akzentuiert ausgesprochene Begriff Kunstwerke in irgendeine Art von Spott getaucht war, «aber ich habe gehört, dass man darauf sieht, wie der Kaiser persönlich die Truppen im Felde gegen die Einheimischen anführt.» Joseph war immer leiser geworden, und Smith merkte kaum, dass der Student Deutsch nicht als Muttersprache gelernt hatte. Das h in Einheimischen hatte er komplett verschluckt. Sonst aber war er gut.
«Der Kaiser war nie in Deutsch-Südwest.» Smith antwortete noch leiser als Joseph. Das Gespräch drohte politisch zu werden, da schien ein wenig Vorsicht doch angemessen.
«Natürlich nicht. Auf einem Bild, aber das habe ich nur von Leuten, die behaupten, sie seien vom Künstler persönlich durch das Atelier geführt worden, auf einem Bild also soll er einen Affen auf der Schulter sitzen haben, während er in die Tiefen der Wüste blickt, das Heer im Rücken, die Eingeborenen auf der Flucht. Der Maler selbst, wie gesagt, das weiß ich nicht von ihm selbst, sondern von Leuten, die mir erzählt haben, sie seien im Nachbarhaus gewesen, also er selbst soll sich nicht ganz sicher sein, ob das Bild seiner Majestät gefallen könnte.»
Joseph blickte kurz zu Boden, dann biss er erneut vom Kuchen ab, sah Smith an und neigte den Kopf ganz leicht zur Seite.
Die Frau des Hauses hatte das Brahms-Stück inzwischen beendet. Die Umstehenden applaudierten höflich. «Ihre Majestät», sagte Smith, «hat eine eigenartige Auffassung von Kunst. Vielleicht mag er es doch. Ich für meinen Teil würde es gern sehen.»
«Man lernt nie aus», sagte Joseph. Er steckte sich das letzte Stück Kuchen in den Mund. «Der Mann aus Südwest», Joseph redete unpassenderweise mit vollem Mund, «heißt übrigens Ernst.»
«Ernst?», fragte Smith.
Joseph nickte, während er schluckte. «Ja, wirklich. Ernst.»
4.
«Diese Stadt», sagte der Hauptmann der Feldgendarmerie Spengler. «Diese Stadt», wiederholte er und tippte mit dem Zeigefinger nur ganz kurz das Ende seines Schnurrbartes an, «sie wächst uns über den Kopf. Und allen anderen auch. Das alles hat seine Grenzen. Ich denke, die Menschen werden irgendwann, und bald, hoffe ich, zur Vernunft kommen und sich noch einmal ganz genau überlegen, ob man so leben kann oder eben nicht.»
August Peterhardt stand mit durchgedrücktem Kreuz vor dem Schreibtisch des Hauptmanns. Er war hier, um zuzuhören, und nicht, um die Ausführungen des Vorgesetzten zu kommentieren. Das ergab sich allein aus dem Rangunterschied zwischen Hauptmann Spengler und ihm.
«Überlegen Sie doch mal, Leutnant», fuhr der Hauptmann fort. «Je mehr von denen an einem Ort zusammenleben, desto mehr Probleme gibt es. Und wissen Sie, wie Berlin in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist?»
Peterhardt war unsicher, ob diese Frage rhetorischer Natur war oder nicht. Er bereitete sich darauf vor, dem Hauptmann zu antworten. Der Mann war bekannt dafür, seine Umgebung teilhaben zu lassen an den klugen Gedanken, die er sich machte, während er an diesem Schreibtisch saß. Denn das war der Ort, an dem er die überwiegende Zeit seines Berufslebens verbrachte.
Das vor allem unterschied ihn von Peterhardt. Der hatte sich gerade erst abgewöhnt, was Hauptmann Spengler nun schon wieder tat. Mit den Fingern zum Bart zu gehen. Manche drehten ihn sogar vorsichtig nach, was riskant war, wenn man nicht gleichzeitig einen Blick in den Spiegel warf. Er selbst hatte ihn im letzten Jahr nach einigem Nachdenken abgenommen. Nicht dass es mit seinem Aussehen zu tun gehabt hatte. Er war wie alle Männer, denen Haare im Gesicht wuchsen, irgendwann mit der Frage konfrontiert gewesen, ob und wie er sein Barthaar zu zeigen gedachte. Da war die kaiserliche Mode die naheliegendste gewesen. Man bekannte sich zu Herrscher und Reich, zeigte damit, dass man einer von vielen war, und es tat, wenn man ganz ehrlich zu sich war, nicht weh.
Den Bart abzunehmen, war ein Akt, der natürlich bemerkt wurde. Peterhardt war es aber leid gewesen mit seinem starken Bartwuchs. Er kannte Kameraden, die sich zweimal täglich rasieren mussten, um auch am Nachmittag noch so gepflegt auszusehen, wie man es eben sein musste, wenn man einen Beruf hatte wie sie. Grundsätzlich war es ja auch nicht schwierig, sich hin und wieder mit dem Messer rund um den Bart zu fahren, um die gründliche Rasur des Morgens nachzuarbeiten. Aber bei ihm war es schon am frühen Mittag so weit. Es hatte Tage gegeben, da war er an einem Spiegel vorbeigekommen und hatte darin einen Mann gesehen, der den Eindruck vermittelte, deutlich weniger als gut gepflegt zu sein. Und gerade an den Rändern des Bartes, dort wo eine gewisse Akkuratesse absolut nötig war, hatte es dann eben oft gejuckt und war hin und wieder sogar wund geworden.
Und manchmal war man auch unterwegs in der Stadt, die der Hauptmann gerade mit seinem harten Urteil bedachte. Immer noch war sich Peterhardt nicht sicher, ob er die Stille des Raumes mit einer Antwort füllen sollte. Aber wenn man als Soldat eines lernte, dann war es, nicht zu handeln, wenn man nicht ausdrücklich dazu aufgefordert wurde.
War man denn in der Stadt unterwegs, dann war es nicht so einfach, den stark wachsenden Bart nachzurichten. Wenn man es denn schnell einmal tat, in der Dunkelheit eines Treppenhauses oder im Schatten einer Eiche, dann war die Gefahr groß, den Schnurrbart zu beschädigen. Und mit einem asymmetrischen Kaiser-Bart gesehen zu werden, konnte einem am Ende als Spott ausgelegt werden.
Hauptmann Spengler richtete endlich die runde Brille und brachte den Kopf in die nötige Distanz, um den vor ihm liegenden Zettel lesen zu können. Der Vortrag war also gottlob zu Ende.
Ohne den Bart war er dann schon scheel angeguckt worden. Die Entschuldigung, die er vorgebracht hatte, die immer wieder juckende Haut, die er am besten mit einem Rasierwasser im ganzen Gesicht zu bekämpfen wusste, war in den meisten Fällen als mehr oder weniger glaubwürdig akzeptiert worden. Sein Ruf war ja im Grunde genommen auch tadellos. Und die roten Pusteln, die hin und wieder auf seinem Gesicht aufgetaucht waren, hatten alle wahrgenommen. Trotzdem war es ihm bewusst, dass er sich damit ins Abseits gestellt hatte. Manche Beförderung würde an ihm vorübergehen in den kommenden Jahren. Es war, wie es war.
«Ich stelle Sie ab.» Endlich redete der Hauptmann wieder. «Zeitweise jedenfalls, und das ist nicht offiziell.» Er machte eine Pause und sagte dann: «Ein Schütze auf Urlaub. Im Wedding. Erstochen.» Nun blickte er auf. «Erstochen», wiederholte er und wies mit dem Zeigefinger auf Peterhardt. «Sie sind die Verbindung zwischen der Kriminalpolizei und uns. Sie begeben sich dorthin, jetzt, sofort. Und dann verfolgen Sie die Arbeit der Berliner Polizei, wann immer Sie die Zeit dafür finden.» Er nahm einen Zettel zur Hand und schrieb mit dem Füllfederhalter darauf. «Hier wenden Sie sich … aber das können Sie auch selbst lesen. Haben Sie diese Verbindungsarbeit schon einmal gemacht?»
Peterhardt schüttelte den Kopf und nahm den Zettel entgegen. Darauf war ein Name zu lesen und eine Zimmernummer. Er wusste, dass es sich um das Präsidium am Alexanderplatz handeln musste.
«Ja …», sagte Hauptmann Spengler. «Sie wissen auch, dass viele Polizisten von uns kommen. Und es sind zumeist jene, die es hier nicht weit gebracht haben. Entweder weil es ihnen an Ehrgeiz gefehlt hat oder an Intelligenz. Oder …» Er fasste sich schon wieder an den Bart. «Oder an beidem. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie denen auf die Finger gucken. Vorsichtig natürlich. Sie müssen das nicht merken. Und denken Sie selbst nach. Vergessen Sie eines nicht. Die Leute, mit denen Sie zu tun haben werden, haben ihre militärische Ausbildung schon lange vergessen. Sie hingegen werden verstehen, was einen jungen Soldaten in einen Konflikt treiben kann, der ihn letztendlich das Leben kostet.»
«Jawohl», sagte Peterhardt und deutete ein Nicken an.
«Eine Sache noch.» Der Hauptmann machte erneut eine Pause und knetete seine Hände. «Der Tote wurde schon vor vier Tagen aufgefunden. Dass wir nicht unverzüglich informiert worden sind, liegt an folgendem Umstand: Der Mann war komplett entkleidet. Er hat nicht einmal mehr seine Unterwäsche am Leib getragen. Stellen Sie sich das nur vor. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie herauszufinden versuchen, wer dafür verantwortlich ist.»
«Gewiss, Hauptmann.» Peterhardt wiederholte das leise Nicken.
«Abtreten.»
5.
«Er ist ein sehr zuvorkommender und höflicher Mann», sagte Adele von Schuld. «Und auch eher gut aussehend.»
Florentine fixierte sie mit den Augen, bis Adele zu Boden blickte. Sie wusste doch, was sie getan hatte. Oder etwa nicht?
Die fünf Freundinnen hatten sich im Salon getroffen. Wie immer. Zum Musizieren. Alle waren leidlich gut am Flügel. Florentine durch den Einfluss ihrer Mutter, die in früheren Jahren in kleinem Kreis auf der Bühne gespielt hatte. Aber auch Adele hatte das Talent und die Zähigkeit, sich durch ein kompliziertes Stück zu arbeiten und es dann vor der Familie aufzuführen. Emilie, die mit bürgerlichem Namen Katharina von Burgmer hieß, und ihr Vater war ganz besonders stolz auf den erst im letzten Jahr verliehenen Adelstitel, er handelte mit tropischen Früchten und belieferte sogar den Hof, war ein außerordentliches Talent am Cello, das sie mit vollem körperlichen Einsatz zu spielen pflegte. Emilies heimliche Leidenschaft war das Rollenspiel, das sie in ihrer Gruppe manches Mal vorführte. Dabei stellte sie stets nur Männer dar, zur großen Belustigung der anderen. Sie hatte sich über die Jahre einen erstaunlichen Fundus an Kleidung und Verkleidungen zugelegt.
Walburga Schlüterhahn war die jüngste der fünf Frauen, mit neunzehn, und die einzige, deren Familie noch nicht vom Kaiser in den Adelsstand versetzt worden war. Das lag vor allem daran, dass die Fabrik ihres Vaters nichts herstellte, was im Deutschen Reich von nationaler Bedeutung oder gar als kriegswichtig betrachtet wurde. Er produzierte Grammophone und Schellackschallplatten, auch solche mit Unterhaltungsmusik. Auf der Violine war Walburga talentiert, aber ihr fehlte der Wille, sich zu vervollkommnen. Beim Musizieren in ihrem kleinen Kreis stockte sie mitunter und wirkte dann enttäuscht über ihr eigenes Unvermögen.
Gitti von Braunberg war vielleicht die talentierteste von allen. Sie spielte Klavier und Violine und hatte darüber hinaus eine ausgebildete Stimme, die sie allerdings nicht immer vorzuführen geneigt war. Bei ihr war es tatsächlich so, dass die Eltern, allen voran der Reifenfabrikant Klausdieter von Braunberg, die Tochter sehr gern als Künstlerin auf den Bühnen der Stadt sehen wollten. Nun betrachtete sich Gitti allerdings mehr als Dichterin, ihre romantischen Verse wurden während der Zusammenkünfte gern gehört. Vor allem, wenn sie neben ihren niedergeschriebenen Gedichten auch jene vortrug, die sie nur memoriert hatte und die auf gar keinen Fall irgendjemand außerhalb ihres Kreises zu hören bekommen durfte. In diesen Stücken bewies sie eine doch außerordentliche Kenntnis der männlichen Anatomie, und Florentine war immer wieder aufs Neue verwundert darüber, woher diese Kenntnisse stammen mochten. Schließlich war Gitti wie sie alle unverheiratet. Jetzt hatten sie natürlich dieses Problem mit Adele. Sie war die Erste, die dem Werben eines Mannes nachzugeben schien.
«Was meinst du mit eher gut aussehend?» Florentine empfand diese Entwicklung als ernst zu nehmende Bedrohung für ihre Treffen. Diese hatten sich, obwohl offiziell als Runde für Übung und Kulturerziehung eingeführt, Bruder Theodor redete in der Sache gern von den musizierenden Mädchen, still und heimlich als eine Möglichkeit etabliert, mehr und mehr Außermusikalisches zu besprechen, und das meinte eben nicht nur jene Männer, die um die Hand einer von ihnen anhielten, wie in dem heutigen Fall.
«Er trägt keinen Bart», sagte Adele. Das war etwas, das sie tatsächlich ausgiebig diskutiert hatten. Es war ja nicht nur völlig unverständlich, warum Männer den hässlichen Bart des Monarchen zu kopieren suchten, den sie alle verachteten und zugleich auch ein wenig fürchteten. Sie hatten auch alle schon gesehen, zum Beispiel in einem der modernen Filme im Lichtspielhaus, dass sich, die meisten Eltern taten das eher nicht oder vielleicht nur hinter verschlossener Tür, dass sich also Mann und Frau küssten. Florentine hatte noch keine Haltung entwickelt zu dieser Art körperlicher Nähe, aber ein gezwirbelter Bart, der während der Prozedur an ihren Ohren kitzelte, erhöhte ihre Neugier, es auszuprobieren, nicht.
«Als ob das ausreichte.» Emilie zeigte ihren grimmigsten Gesichtsausdruck. «Welche Position in Papas Fabrik hat er denn inne? Hat er den Militärdienst hinter sich? Und war er schon in den Kolonien?»