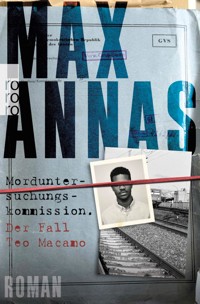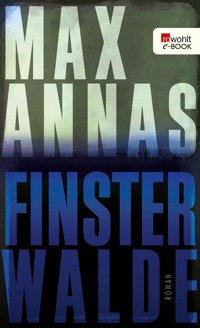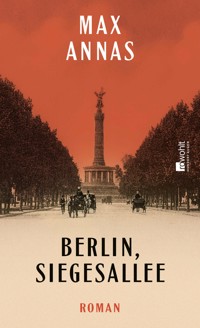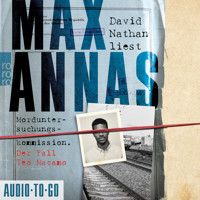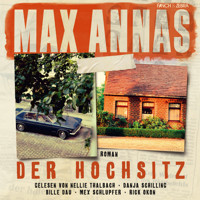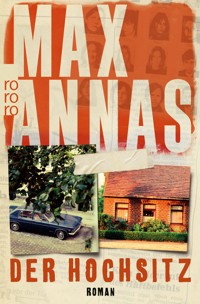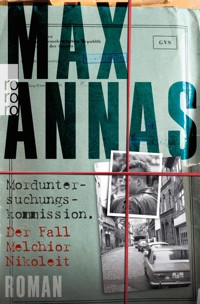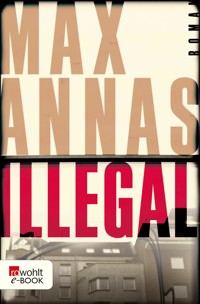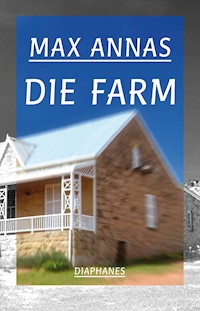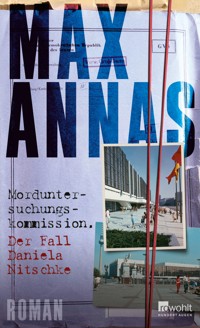
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Morduntersuchungskommission-Krimireihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Berlin, Hauptstadt der DDR, 1987. Die Stadt ist von einer Unruhe erfasst, die sich kaum noch kontrollieren lässt. Da werden an einem Tag zwei Leichen gefunden, und nur die tote Frau war Republikbürgerin. Oberleutnant Otto Castorp bekommt es daher gleich mit den Kollegen von der Staatssicherheit zu tun. Der Tod des Westbesuchers verweist auf politische Hintergründe. Und auf fremde Geheimdienste. Die Spur führt nach Südafrika. Und dann ist da noch Erika Fichte. Ihr Chef, verantwortlich für die Unterstützung des ANC durch die DDR: spurlos verschwunden. Erika macht sich auf die Suche. In diesem Roman geht es um Verrat, um das Ende der Systeme – den Ostblock, den Westen, die Apartheid – und um Freiheit. Wobei Freiheit für jeden etwas anderes bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
Max Annas
Morduntersuchungskommission: Der Fall Daniela Nitschke
Der Fall Daniela Nitschke
Roman
Über dieses Buch
Berlin, Hauptstadt der DDR, 1987. Die Stadt ist von einer Unruhe erfasst, die sich kaum noch kontrollieren lässt. Da werden an einem Tag zwei Leichen gefunden, und nur die tote Frau war Republikbürgerin. Oberleutnant Otto Castorp bekommt es daher gleich mit den Kollegen von der Staatssicherheit zu tun. Der Tod des Westbesuchers verweist auf politische Hintergründe. Und auf fremde Geheimdienste. Die Spur führt nach Südafrika.
Und dann ist da noch Erika Fichte. Ihr Chef, verantwortlich für die Unterstützung des ANC durch die DDR: spurlos verschwunden. Erika macht sich auf die Suche.
In diesem Roman geht es um Verrat, um das Ende der Systeme – des Ostblocks, des Westens, der Apartheid – und um Freiheit. Wobei Freiheit für jeden etwas anderes bedeutet.
Vita
Max Annas, geboren 1963, arbeitete lange als Journalist, lebte in Südafrika und wurde für seine Romane Die Farm (2014), Die Mauer (2016), Finsterwalde (2018) und Morduntersuchungskommission (2019) sowie zuletzt Morduntersuchungskommission: Der Fall Melchior Nikoleit (2020) fünfmal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Bei Rowohlt erschienen außerdem Illegal (2017) und Der Hochsitz (2021).
Dem so netten und so schlauen Buchhändler Peter Peukert gewidmet, der uns mit 49 Jahren viel zu früh abhandengekommen ist.
Erster Teil
1
Auf der Bühne trage ich immer eine Sonnenbrille. Schon seit Jahren. Und auf jeden Fall, seit ich mir eine richtig gute leisten kann.
Das hat damit zu tun, dass ich das grelle Licht in den Augen nicht vertrage. Es schadet der Konzentration beim Spielen, sich immer wieder so zu platzieren, dass man nicht geblendet wird. Und Konzentration ist das Allerwichtigste in meinem Beruf.
Das ist der eine Grund.
Der andere ist, dass ich gern ins Publikum schaue. Ich sehe gern, wie sich die Leute verhalten. Die, die ganz fokussiert sind, jeden neuen Ton antizipieren. Die anderen, die einfach trinken und bei denen man nicht so genau weiß, wo sie gerade mit ihren Gedanken sind. Dann die, die quatschen und sich nicht um die Musik scheren. Ja klar, die gibt es auch. Und dann die, die gehen und kommen, die auch woanders sein könnten.
Warum verlassen sie den Raum? Den Saal. Die Bar. Gerade jetzt. Gerade in der Minute, in der ich mein Solo spiele.
Oder warum kommen sie erst jetzt? Sie könnten den besten Teil des Abends schon verpasst haben. Geht ihnen denn das nicht durch den Kopf?
Wenn ich sie mir so anschaue, dann müssen sie das nicht unbedingt mitkriegen. Auch, weil es eine Frage der Sicherheit ist. Meiner eigenen Sicherheit. Wie Sie selbst gleich sehen werden.
An dem Abend, diesem ganz speziellen Abend, rettet die Sonnenbrille mir das Leben. Das ist einfach so.
Und einem anderen wird sie es nehmen. Nicht die Sonnenbrille selbst, sie ist nur ein Objekt, ein Mittel eher, sondern die Beobachtung, die ich von der Bühne aus mache. Und die ohne die Sonnenbrille nicht hätte geschehen können. Das Licht ist nämlich wirklich recht grell für eine kleine Bar mit Bühne. Und ohne die Sonnenbrille hätte ich die Augen die ganze Zeit beinah geschlossen gehalten.
So aber sehe ich den Mann, der durch die Tür kommt und sich umschaut, als suche er jemanden. Dann, nach einem längeren Moment, geht er an die Theke und bestellt einen Drink.
So weit nichts Besonderes. Aber ich kenne den Mann.
Oder besser: Ich bin ihm schon einmal begegnet.
Und das ist gar nicht lange her.
Gerade verpasse ich beinahe den Einsatz, als Francks Posaune leiser wird. Denn mir fällt ein, wo ich den Mann schon einmal gesehen habe. Und wann.
Unauffällige Frisur, das Haar lose nach hinten gekämmt, Jeansjacke und Hemd, die dunkle Hose kann ich in dem Licht kaum ausmachen. Aber den Rest, den kenne ich.
Kurz konzentriere ich mich auf meinen Beitrag. Bass-Solo mit eingeworfenen Tupfern von Piano und Schlagzeug. Als ich das Stück wieder für die anderen öffne, weiß ich es. Ich hatte etwas zu Hause vergessen, am Nachmittag, nur ein paar Stunden ist das her, drehte mich um und ging wieder auf die Haustür zu. Da stand er ganz unbeteiligt und blickte in irgendein Parterrefenster. Es war keine wichtige Begegnung für mich. Wir haben uns nicht in die Augen gesehen, wir haben einander kaum bemerkt. Oder besser: Ich habe ihn kaum bemerkt.
Und trotzdem. Irgendetwas ist hängen geblieben.
Der Mann trinkt ein Bier. Langsam, Schluck für Schluck. Dabei betrachtet er unbeteiligt die Bühne. Er fällt hier nicht auf. Die meisten Leute im Publikum sind weiße Männer. Sogar in seinem Alter. Irgendetwas zwischen dreißig und vierzig. Und doch ist da etwas, das ist anders an ihm. In einem dünnen Lichtstrahl, der von irgendwo über der Theke auf ihn fällt, sehe ich deutlich die rötlich bronzene Gesichtshaut.
Der Mann ist nicht von hier. Er ist weiß, aber er lebt nicht in Deutschland.
Die Weißen in Deutschland sind bleich. Manchmal holen sie sich einen Sonnenbrand. Dann sind sie rosa oder rot wie ein ungebratenes Steak. Aber ihre Haut hat nie diese bronzene Tönung.
Dieser Mann hat sie. Das bedeutet, dass er in einem anderen Klima lebt. Und dass er mit ziemlicher Sicherheit dort aufgewachsen ist.
Und jetzt fällt es mir wieder ein. Das, was ich am Nachmittag wahrgenommen habe. Das eine kleine Detail. Es war nicht wichtig. Nicht in jenem Moment. Ich habe nur sein Profil gesehen. Kein Grund anzunehmen, dass ich dem Mann in der Jeansjacke noch einmal begegnen würde. Aber mir fiel doch auf, dass die Haut unter der Nase deutlich heller war als der Rest des Gesichts.
Denn da, wo die Haut weißer war, fahler, da war bis vor Kurzem noch ein Schnurrbart gewesen. Und ich erinnere mich an noch etwas. Die Hose, die er trug, hatte noch den Schlag der 70er-Jahre.
Wir beenden das Stück gerade mit einem gemeinsamen Ausklang.
Ich zupfe ein paarmal an der tiefsten Saite, lasse sie schwingen und denke an Südafrika. Dort ist der Mann in der Jeansjacke aufgewachsen, ich bin mir sicher. Und den typisch burischen Schnurrbart hat er sich abgenommen. Mit dem würde er hier im Jazzclub auffallen.
In den Applaus hinein spricht Gordon ins Mikrofon. «On Bass Billy Ndlovu», sagt er.
Billy Ndlovu, das bin ich.
Jazzmusiker.
Bassist.
Südafrikaner im West-Berliner Exil.
2
«Das ist der Viel Collins jetzt», sagte Holger Manz.
Sogar Otto kannte den Sänger von Genesis. Phil, dachte er, Phil mit kurzem I. Er machte sich nicht wirklich was aus Musik, aber das wusste sogar er. Dafür musste man nicht mal Westradio hören. Was gerade von jenseits der Mauer kam, hörte sich allerdings so spannend an wie ein tropfender Wasserhahn. Dass die Leute deswegen in Scharen angelaufen kamen, konnte er nicht verstehen.
Nun, ein wenig, vielleicht, konnte er die Leute doch verstehen. Es gab eine ganze Menge Konzerte im Osten in diesem Jahr. Viele Weststars kamen wegen des Stadtjubiläums auch und gerade zu ihnen. 750 Jahre Berlin. In West-Berlin waren schon alle gewesen. Aber bei ihnen eben nicht. Dieser Collins auch nicht. Und auch David Bowie nicht, der gleich noch auftreten sollte. Den hätte er sich auch selbst angehört. Wenn, ja wenn sie nicht im Westen gespielt hätten. Auf der anderen Seite der Mauer.
Holger und er standen an der Ecke Unter den Linden und Friedrichstraße. Immer noch zogen Leute an ihnen vorbei in Richtung Brandenburger Tor. Dort warteten schon eine ganze Reihe von Kollegen auf sie. Uniformierte Kollegen. Aber natürlich auch andere.
Schon während die Bühne am Reichstag in den letzten Tagen aufgebaut worden war, hatten Kundschafter betont, dass etliche der gigantischen Lautsprecher in ihre Richtung aufgestellt worden waren, Richtung Osten. Und deshalb hatten sie nun den Salat. Da standen also Tausende von ihren jungen Leuten, die meisten waren kaum über fünfundzwanzig, und gafften in Richtung Westen. Viel zu sehen gab es nicht. Da stand die Mauer, das Brandenburger Tor. Und die uniformierten Einsatzkräfte wussten nicht, was sie tun sollten.
Holger und er wussten es auch nicht. Aber sicher gab es gleich einen Einsatzbefehl. Niemand konnte ein Interesse daran haben, dass aus der Menge heraus irgendwelche dummen Sachen passierten.
Direkt an der Grenze. Das musste man sich einmal vorstellen.
Holger zog sich in einen Hauseingang zurück und legte den Kopf schief. Er hatte das Funkgerät in der Jacke und zuckte beim leisesten Geräusch. Dann trat er wieder einen Schritt vor. Im Licht einer Straßenlaterne war der helle Schnurrbart deutlich zu sehen, der sein Gesicht dominierte. Otto hatte so einen im letzten Jahr auch einmal ausprobiert. Holgers Bart stand nicht weit vor, die Haare waren höchstens vier oder fünf Millimeter lang. Damit es so aussah und vor allem so akkurat blieb, musste man den jeden Tag penibel schneiden. Ihm war das zu viel gewesen. Der Bart hatte ihm sowieso nicht gestanden.
Auch Holger stand er nicht. Sie hatten beide eine ziemlich hohe Stirn, was bedeutete, dass ihnen die Haare auf dem Kopf ausgingen. Holger hatte den kümmerlichen Rest als Kranz rund um den Kopf behalten und trug dazu den Bart. So sah er mindestens zehn Jahre älter aus als die 38, die er war. Otto hatte die Haare, die ihm geblieben waren, ganz kurz schneiden lassen. Er fand beim Blick in den Spiegel, dass er jetzt aussah wie 45. Aber manche Dinge konnte man sich nicht aussuchen. Er wäre ja auch gern fünf Zentimeter größer.
Das Funkgerät knackte jetzt wirklich. Holger drehte sich wieder in den Hauseingang.
Die Ansage war nicht zu verstehen, weil zur gleichen Zeit eine Gruppe junger Frauen hinter ihnen plappernd vorbeizog. Eine von ihnen redete laut über irgendetwas, was sie im Radio gehört hatte. Ganz sicher im Westradio.
«Also.» Holger lehnte sich zu ihm hinüber. «Da passieren jetzt hässliche Sachen. Überall Provokateure. Wir werden gebraucht.» Er ging mit schnellen Schritten voran. Bald schon hatten sie die Frauengruppe überholt. Otto sah auch andere Einsatzkräfte in Zivil auf die Grenze zulaufen. Hinter ihnen wurde es leiser. Er drehte sich kurz um und bemerkte, dass die Frauen stehen geblieben waren. Sie ahnten, dass es gleich Schwierigkeiten geben würde.
Holger war schon im Laufschritt. Sie hatten nur noch zweihundert Meter bis zu dem Auflauf.
Otto blieb stehen und horchte. Verstand die Worte der Sprechchöre und hörte doch noch einmal genauer hin. Aber klar, er verstand die Parole schon.
«Die Mauer muss weg.»
Und noch einmal: «Die Mauer muss weg.»
Drüben wurde gerade ein Lied beendet. Vor dem Reichstag gab es Applaus.
«Die Mauer muss weg.» Das waren ganz schön viele Leute. Etliche hundert? Wahrscheinlich sogar mehr als tausend.
Holger blieb schon stehen. «Die haben das im Griff.»
In der Tat. Die uniformierten Kräfte hatten ihre Schlagstöcke gut im Griff und hieben auf die Leute ein.
Otto hatte dafür kein Verständnis. So etwas musste doch nicht sein. Warum mussten die denn auch so provozieren? Die wussten doch, was sie erwartete. Da wurden auch schon die Ersten aus der Gruppe abgeführt. Klar, so erreichte man doch nichts.
Holger war schon einige Schritte voraus. Otto musste sich beeilen, um ihn nicht zu verlieren. Je näher sie dem Brandenburger Tor kamen, desto voller wurde es auf der breiten Straße.
Otto sah, wie der Kollege endlich stehen blieb. Da vorn warteten noch andere aus ihrer Morduntersuchungskommission. Eingeteilt, um das Schlimmste zu verhindern.
3
Holberg war kein schöner Mann. Aber er war ihr Mann.
Und jetzt gerade vermisste sie ihn. Wie so oft zu dieser Tageszeit.
Zu dieser Nachtzeit.
Erika Fichte stand am offenen Fenster ihrer Wohnung in der dreizehnten Etage und blickte hinab auf die Spree und die S-Bahn-Haltestelle Jannowitzbrücke. Gerade hatte sie die zweite Flasche Moselriesling aus dem Intershop geöffnet.
Ein Glas noch. Es war doch kein Verbrechen, sich nach etwas Wärme zu sehnen. Nach Sex. Zum Teufel, nach dem eigenen Mann, auch wenn sie nicht verheiratet waren. Ein Streifenwagen fuhr mit Blaulicht über den Holzmarkt. Diese Sache an der Mauer. Der Westen gab keine Ruhe. Zuerst stachelten sie die Leute an, und dann berichteten sie darüber, als hätten sie nichts damit zu tun. So würde es auch dieses Mal sein.
Ein einziges Glas noch. Sie ließ den Wein langsam aus der Flasche laufen.
Ganz klar, sie hatte gewusst, worauf sie sich eingelassen hatte mit Holberg. Beide hatten sie es gewusst. Das hieß aber nicht, dass es einfach war.
Die Einsamkeit.
Die Angst.
Angst war immer im Spiel. Erika dachte an Angola. Seit die Kubaner dort waren, war alles leichter. Sie war überzeugt, dass sie das südafrikanische Gesindel vertreiben würden. Dieses Jahr war entscheidend. Verlor der Apartheid-Staat Angola, verlor er sein Gesicht. Vor allem an der Heimatfront. Alle wüssten es dann. Auch diese Imperialisten waren besiegbar.
Wo bist du gerade, Holberg? Hoffentlich nicht dort, wo geschossen wird. Bitte sei vorsichtig.
Als das Glas leer war, klingelte das Telefon. Der Blick zur Uhr. Es war nach halb zwölf. 22 Minuten bis Mitternacht. Konnte das Holberg sein?
Erika lief die paar Schritte bis zur Kommode.
«Ja?» Leise. Unsicher.
Lautes Atmen auf der anderen Seite.
«Holberg?»
«Nein.» Die tiefe Stimme von Major Diewitz.
«Ist was mit Holberg?» Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
«Nein nein nein.»
Erika wurde schnell ruhiger. Es wird Momente geben, sagte Holberg manchmal, da ist es kompliziert.
«Fichte», sagte Major Diewitz, «du musst vorbeikommen. Jetzt.»
«Jetzt sofort?»
«Ja.»
«Ins Büro?»
«Ja.»
«Was ist passiert?»
«Ich kann es dir nicht so genau sagen. Und ohnehin eher hier als am Telefon.»
«Aber nichts mit Holberg.»
«Nein. Versprochen.»
«Ich hab schon ein Glas Wein …»
«Wir haben alle …» Diewitz stockte.
«Wer ist wir?»
«Egal. Wir werden uns zu zweit treffen. Kannst du in zwanzig Minuten hier sein?»
4
«Hey, wassup?», fragt Gordon. Wir sind backstage, es ist eng, alle schwitzen noch. Und alle nehmen sich von den Schnittchen und vom Bier.
Franck, Posaunist aus Genf, der wegen der Aufnahmen für den Soundtrack zu einem Avantgardefilm in West-Berlin ist. Gordon, Pianist aus Philadelphia, der einen Liebhaber hier hat und, wann immer es möglich ist, in die Stadt kommt. Mein bra Dennis aus East London, mit dem ich aufgewachsen bin im Township, mein bester Freund, der Drummer.
Gordon guckt mich an. «Hey, wassup?»
Ich nehme mir ein Bier aus dem Kühlschrank und setze mich auf den Sessel in der Ecke. Winke ab, bin überraschend ausgelaugt. Ich bin immer platt nach dem Gig. Den Bass zu spielen ist eine extreme, eine sehr physische Sache. Und ich spiele den Bass auf eine Art, die den ganzen Körper fordert. Meinen – und den des Instruments.
Aber das ist es nicht. Mein Zustand hat einen anderen Grund. Ich schließe die Augen, um mich an den Buren zu erinnern. Ich bin mir sicher, dass er Bure ist. Ach was … ich weiß es.
Was soll ich sagen?
Und wem?
Dennis schüttet sich Bier in den Schlund. Keinen Tropfen Alkohol vor dem Gig, aber dafür ordentlich danach.
Dennis würde mich verstehen. Wir teilen alles. Fast alles. Wir sind damals zusammen aus Südafrika nach Europa geflohen. Es war der einzige Weg zu entkommen. Der Jazz.
Aber Dennis weiß nur ganz grob, was ich mache. Eigentlich weiß er so gut wie alles über mich. Aber davon habe ich selbst ihm fast nichts erzählt. Was er nicht weiß … das kann er nicht verraten. Und darum geht es. Selbst wenn der Bure mit der gezogenen Waffe vor ihm stehen würde, könnte Dennis nichts erzählen, was die nicht schon wissen. Klar, Dennis hat sich schon ein paarmal gewundert, dass ich verschwunden bin, ohne etwas zu erklären. Nach einem Gig. Während eines Frühstücks. Direkt nach der Ankunft auf einem Bahnhof irgendwo in der Welt. Und deshalb kann er sich Dinge denken. Ich verberge sie ja auch nicht direkt vor ihm.
Natürlich denkt er sich seinen Teil.
Aber er weiß es nicht.
Außerdem ist er mein Gast. Unser Gast. Meine Frau Christine und ich haben das Kinderzimmer für ihn freigeräumt.
Er ist einfach zu nah an allem dran. Ihn werde ich nicht behelligen.
Gordon ist ein guter Freund. Ich spiele seit mehr als fünfzehn Jahren immer wieder mit ihm zusammen. Er ist auf drei meiner Alben dabei, ich auf einem von ihm. Aber wir haben nie Dinge geteilt, die über Musik hinausgehen. Klar ist er auf der richtigen Seite, politisch. Er ist in den 50er-Jahren in Atlanta aufgewachsen und hat alles gesehen, wirklich alles. Diese andere und doch so ähnliche Art von Apartheid. Und wenn er wütend ist, dann hört man das. Aber das ist er immer seltener. Mittlerweile redet er mehr von Spiritualität als davon, sich zu bewaffnen. Aber weder die Apartheid noch die Ungerechtigkeit in den USA kann man durch Meditieren besiegen. Er wäre die falsche Wahl.
Trevor aus London, der Altsaxofonist, der wegen Aufnahmen für ein Album in der Stadt ist, steht noch an der Theke. Ich will gar nicht wissen, was er sich da besorgt. Gleich ist er zu bedröhnt, um mir überhaupt zuzuhören. Mit niemandem habe ich so oft gespielt, auf Bühnen und in Studios, so viel diskutiert. Trevor erklärt jeden Aufstand, unterstützt jeden bewaffneten Anschlag, kann mit seinem Marxismus auch politische Systeme analysieren, die er noch nicht von innen gesehen hat. Und er ist schon fast überall gewesen. Aber er macht das alles von der Theke aus. Das macht es nicht schlecht. Ich habe viel von ihm gelernt. Und es gibt fast keine Hilfe, um die ich ihn nicht bitten würde. Aber zwei Dinge kommen nicht infrage. Mein Neugeborenes hätte ich ihm nicht in die Hände gelegt – er würde es versehentlich fallen lassen. Zum Glück ist Mary jetzt schon vier Jahre alt. Aber ich würde auch heute noch mein Kind nicht in seine Obhut geben. Und das hier … dafür ist er auch nicht der Richtige.
Bleibt Franck.
Mit Franck habe ich schon ganze Nächte hindurch diskutiert. Für ihn ist alles, was er tut, die politische Konsequenz aus irgendetwas. Nach London ist er 1970 gekommen, weil er nicht mehr in so einer weißen Umgebung wie der Schweiz leben und spielen wollte. Free Jazz hat er gemacht, weil man die Welt mit Kunst korrigieren kann. Und jetzt wird er Jazz nicht mehr lange spielen, da bin ich mir sicher. Er interessiert sich nun für andere Formen. Je weniger Töne man macht, desto besser, hat er einmal gesagt. Den Lärm aus der Welt nehmen. Was auch immer …
Er würde es verstehen.
Er würde es verstehen und gleich irgendwelche Vorschläge machen, wie ich es verbessern sollte.
Aber auch ihm habe ich nie erzählt, was ich mache.
Franck, denke ich.
Franck.
Wer sonst?
5
Holger hatte sich neben Kurt Popczyk und Karl Schade gestellt. Beide waren auch Mitglieder der zweiten Morduntersuchungskommission in Berlin. Popczyk zündete sich eine Zigarette an und hielt die Packung offen für die anderen hin. Alle nahmen sich. «Wir werden hier nicht gebraucht», sagte er, richtete seine Brille und fuhr mit dem Finger über den Scheitel im dunkelbraunen Haar. Das machte er mehrere Male in der Stunde. «Um die Ecke …» Er wies mit dem Daumen hinter sich. «Um die Ecke warten noch ein paar Kollegen.» So betont ruhig, wie er den Satz sagte, konnte das nur bedeuten, dass, wo genau auch immer um die Ecke war, noch weit mehr als nur eine Handvoll Einsatzkräfte warteten.
«Dumm», sagte Schade. Er war wie immer kurzatmig. «Die vom Westfernsehen kriegen jetzt schon, was sie brauchen.» Otto kannte ihn aus dem Kriminalistikstudium. Damals war er ein dünner Hering gewesen. Heute hatte er Mühe, die Treppen hochzukommen, so dick war er. Dabei aß er kaum etwas. Was auch immer das für ein Problem war, das er hatte. Bald würde er nur noch am Schreibtisch sitzen. Dabei hatte er genau davor Angst, wollte genau das vermeiden.
«Es geht los.» Holger zeigte auf ein Gerangel, das unweit von ihnen stattfand.
«Sollen wir helfen?», fragte Schade und schnippte die Zigarette weg. Er streckte die Schultern und keuchte dabei.
«Nee, lass.» Popczyk strich sich den Blouson glatt. «Ich sag doch, wir werden nicht gebraucht.»
Eine weitere Gruppe Volkspolizisten in Uniform rannte an ihnen vorbei und stieß mitten in die Zivilisten. Sie schwangen die Stöcke mit viel Energie. Das Gebrüll war entsprechend groß. Eine Frau stieß einen sehr hohen Schrei aus. Sie hatte ebenfalls ordentlich Energie, und der Ton wollte und wollte nicht enden. Otto schluckte, um den Druck auf den Ohren zu verringern, dann legte er vorsichtig die Zeigefinger auf die Ohrknorpel und drückte sanft zu.
Das war genau diese Frequenz. Der Schrei ging über in das Schleifen von Metall auf Metall. Das Zerren, das ihn an den letzten Arbeitstag in Thüringen erinnerte. Der umgebaute W50 von Michael Nikoleit, der die Straßensperre durchbrach, zwei seiner Kollegen tötete und einen schwer verletzte.
Es brauchte nicht viel, um das Geräusch zwischen seinen Ohren wiederzubeleben. Nur eine kleine Erinnerung. Nur den hohen Schrei einer Frau.
«Ist was?», fragte Holger.
«Was?» Otto beugte sich zu ihm hinüber.
Holger zeigte auf seine eigenen Ohren und dann auf eines von Otto.
Otto schüttelte den Kopf. «Nix. Vielleicht krieg ich eine Erkältung.»
Vor ihnen wurden zwei junge Männer von einem Pulk uniformierter Volkspolizisten abgeführt. Einer blutete an der Stirn.
Wildes Rufen und Schreien lag immer noch über der Szene. Viele Heys und Neins und Auas und Aahs. Im Hintergrund hörten sie aber auch deutlich ein vielstimmiges «Die Mauer muss weg».
«Sie haben es verdient», sagte Popczyk.
«Wer darum bettelt», sagte Schade.
Sie drückten sich nebeneinander an eine Hauswand. Kein Grund, im Weg herumzustehen. Holger Manz stupste Otto an und zeigte ins Gewimmel vor ihnen.
Otto musste schon genau hinsehen, um Bremmer zu entdecken. Franz-Josef Bremmer, ihr Kraftfahrer, wegen seiner Größe immer gut im Bild, der mit der Faust auf irgendjemanden eindrosch. Aus ihrer Perspektive war nicht zu erkennen, wen es da erwischte, aber Bremmer hatte erkennbar Freude an der Aufgabe. Wenn er dort herumhieb, dann war der Rest ihrer Morduntersuchungskommission vielleicht auch nicht weit. Im Bezirk Gera waren sie zu fünft gewesen, hier hatte ihre MUK neun Mitglieder. Das war immerhin eine Metropole. Otto blickte über den Tumult hinweg, sah aber keine weiteren seiner Kollegen.
Er spürte, wie ihn Holger am Ärmel zog. Kurz darauf standen sie in der Glinkastraße. Hier verstand man wenigstens sein eigenes Wort. Holger hörte ins Funkgerät hinein und nickte, als könne das woanders jemand sehen. Dann wandte er sich an die kleine Gruppe. «Wir können abbrechen. Die Genossen haben alles unter Kontrolle. Die erste MUK bleibt noch, die dürfen noch zugucken, wir haben ab sofort Bereitschaft. Wer sagt es den anderen?» Holger drehte sich kurz um. Otto dachte daran, dass Franz-Josef Bremmer wahrscheinlich immer noch dabei war, Nasenbeine zu brechen.
6
Erika Fichte stellte den Wartburg vor der Zentrale in Lichtenberg ab. Sie fühlte sich erstaunlich klar im Kopf für die fünf oder sechs Gläser Weißwein, die sie getrunken hatte. Aber sie war auch erleichtert, dass es nichts mit Holberg war, weswegen sie nun hier erwartet wurde.
Wenn Diewitz die Wahrheit sagte. Aber warum nicht? Wenn Holberg etwas zugestoßen wäre, dann hätte er vor ihrer Tür gestanden. So schätzte sie ihren Vorgesetzten jedenfalls ein.
Nicken an der Pforte. Der Major hatte Bescheid gegeben. Im vierten Stock stand sowohl die Tür zu ihrem Vorzimmer offen als auch die zum Büro von Diewitz. Erika stellte ihre Handtasche auf ihrem Schreibtisch ab, ohne stehen zu bleiben, und sah, wie Diewitz zwei Gläser mit Wodka füllte.
«Setz dich.»
Er schob ihr ein Glas zu, hob seines an und trank es in einem Zug aus. Warum eigentlich nicht? Sie machte es ihm nach.
«Wolle ist weg», sagte der Major.
«Wie weg?»
«Weg eben.»
«Seit wann?»
Der Major hob beide Hände leicht an. «Freitag ist er nicht mehr zum Dienst erschienen.»
«Freitag? Das sind vier Tage. Herzinfarkt bei einer Geliebten in West-Berlin.»
«Hat er nicht nötig.»
«Stimmt. Beim Spaziergang im Thüringer Wald abgerutscht. Hals gebrochen.»
«Das hätten Leute mitgekriegt.»
«Mit einem Geldkoffer über die bulgarisch-türkische Grenze.»
«Tja …»
«Was? Wirklich?»
«Ich weiß es nicht.»
«Aber ist es so was?»
«Fichte, was hast du für ein Verhältnis zu Wolle?»
«Gar keins.»
«Hat er dich …»
«Andauernd. Aber ich habe das nicht als Kompliment aufgefasst. Er steigt allen Frauen unter 50 nach. Sagen wir: unter 45.»
«Könnte darin der Schlüssel liegen?»
«Aber was ist denn passiert?»
«Ich weiß es nicht. Wir …» Diewitz machte eine lange Pause. «… wissen es nicht.»
«Wer ist wir?»
«Ach. Das ganze Haus. Die Spezialkommission.»
«Die auch?»
«Die auch. Der Chef weiß Bescheid, und Mischa Wolf auch. Alle eigentlich.»
«Aber was wissen die denn?»
«Dass Friedrich Wolle verschwunden ist.»
«In der DDR verschwindet niemand.»
«Ja, das habe ich auch immer wieder gesagt.»
Diewitz bemühte sich um die Gläser. Sie tranken. Der Major zündete sich eine Zigarette an und hielt ihr die Schachtel hin. Erika schüttelte den Kopf.
«Aber gib mir noch davon.» Mit dem Kopf wies sie auf die Flasche. Sie nahm das Glas, nachdem Diewitz es gefüllt hatte, blickte hinein, nahm einen kleinen Schluck, beließ ihn eine Sekunde zu lang auf der Zunge, bis es anfing zu brennen, und sah dem Major dann in die Augen.
«Und warum wollten Sie jetzt mich hier haben?»
«Du musst ihn suchen.»
«Ich? Ich bin doch nur die Sekretärin. Ihre Sekretärin.» Erika leerte das Glas und stellte es vor sich. Sie sollte aufhören zu trinken, auch wenn die Absurdität der Unterhaltung dringend nach Alkohol verlangte. Aber irgendwann musste sie auch wieder nach Hause fahren.
«Guck mal, Fichte. Die Spezialkommission behandelt das wie einen ganz normalen Vermisstenfall, einen dringenden natürlich. Die werden bei seiner Frau anfangen und dann die anderen Frauen fragen. Dich werden sie auch fragen, bald sogar. Alle kennen schließlich seinen Ruf. Also … Dich werden sie ja nicht nur als Frau fragen, sondern auch wegen der Arbeit. Dann werden sie sich angucken, womit er beschäftigt war. Und, glaub mir, sie werden das gründlich machen. Aber was die machen können, hat natürlich seine Grenzen. Polizeiarbeit, auch die politische der Spezialkommission, ist immer eine technische Sache. Du hingegen hast einen eminent politischen Blick.»
Trotz des Alkohols in ihrem Kopf erkannte Erika einen Speichellecker, wenn sie einen sah. Wusste Diewitz eigentlich, wie sie ihn nannten, wenn er allen auf die Nerven ging? Der Witz. Weil er keinen Humor hatte. Natürlich nur unter den Sekretärinnen. Und nur, wenn keiner der Vorgesetzten in der Nähe war. Eben aber hatte der Witz kurz gefunkelt in den Augen, als er sie gelobt hatte. Eminent politischer Blick.
Scheiß drauf. Den hatte sie ja auch.
Sie wartete. Der Major würde es schon erklären.
«Ich will … Wir wollen, dass du dir die Vorgänge ansiehst, mit denen Wolle befasst war. Einen nach dem anderen.»
«Warum ich? Es gibt doch Leute, die Wolle besser kennen.»
«Eben. Darum geht es ja nicht. Wir brauchen ein paar Augen, die das Ganze von außen erfassen, aber trotzdem kein Problem haben zu verstehen, worum es geht.» Der Witz wartete, wie sie das Lob aufnahm. Sie wusste selbst, dass sie nicht blöd war.
«Und da ist noch etwas», fuhr er fort. «Ich kann mich nicht nach außen wenden für so eine Aufgabe, denn das hauen sie mir um die Ohren. Dann kriege ich zu hören, dass die Spezialkommission das alles im Griff hat. Wer ich denke, dass ich bin, nicht in die Strukturen zu vertrauen … bla, bla, bla. Das verstehst du doch, oder?»
Sie nickte kurz.
«Und genauso wenig kann ich im Haus nach Hilfe fragen. Man borgt sich ja nicht einfach einmal einen Agenten.» Er öffnete die Hände und blickte über sie hinweg. «Da bleibst nur du.»
Erika schwieg ein paar Sekunden. «Hat der noch was anderes gemacht als Südafrika?»
«Da hat er schon mal mitgeredet. Aber in erster Linie kümmert er sich um die Ausbildung von Südafrikanern hier. Und um ein paar andere Sachen, die damit in Zusammenhang stehen.»
«Waffen.»
«Waffen zum Beispiel. Aber das ist nicht alles. Wir drucken ja für den ANC das internationale Magazin. Es gibt Kommunikationstechnik. Alles Mögliche. Der entscheidet auch schon mal Sachen allein. Keine Waffenverkäufe. Nichts Strategisches. Das macht keiner allein. Aber der ist schon mittendrin.»
«Hat der ANC Geld, um Waffen zu kaufen?»
«Na ja, eigentlich nicht. Meistens erhalten die alles einfach so. Solidarität.»
Erika beugte sich nach vorn und schüttete sich noch einmal nach. «Wonach suche ich?»
«Ich weiß es nicht.»
«Gucke ich nur in die Akten?»
«Wenn du mit jemandem reden willst, dann tust du das auch.»
«Dann sage ich: Hallo, ich bin Erika Fichte, wissen Sie, ob Friedrich Wolle tatsächlich die Ladung AK-47 an die progressiven Kräfte weitergeleitet hat oder ob er sie nicht vielmehr an den Klassenfeind verkauft hat?»
Diewitz sagte dazu nichts.
«Meinen Sie so was?»
«Wirklich, Fichte, wir wissen es nicht. Wolle ist weg, und wenn er nicht beim Pilzesammeln zusammengebrochen ist, dann haben wir ein Problem. Das Problem sollst du identifizieren.»
«Und wenn mir etwas auffällt?»
«Dann kommst du zu mir.»
«Dann komme ich zu Ihnen. Klar. Und wann fange ich an?»
«Sofort.»
«Sofort.»
«Gott, ja, du gehst nach Hause, schläfst dich aus. Und wenn du morgen früh hier ankommst, dann beginnst du mit der Arbeit.»
Sie stand auf und ging zur Tür. Dort drehte sie sich noch einmal um. «Ist das …» Sie überlegte, welches Wort sie benutzen wollte.
«Wenn ich dich bitte, das zu tun, dann ist das auch gedeckt. Und wenn es ein Problem geben sollte …»
«Dann komme ich zu Ihnen, Major. Schon klar.»
Sie verließ das Zimmer, öffnete die Tür aber noch einmal, bevor sie sie schloss. «Sein Büro?», fragte sie.
«Haben die Genossen von der Spezialkommission ausgeräumt. Niemand geht ja im Moment davon aus, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Und schon gar nicht im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Aber irgendwo müssen die ja ansetzen.»
Als Erika darüber nachdachte, ob das die Antwort war, die sie erwartet hatte, fuhr Diewitz fort: «Aber sieh es dir an. Setz dich in seinen Stuhl und denk nach.»
Sie nickte, schloss die Tür, nahm die Handtasche von ihrem Schreibtisch und war schon fast aus dem Vorzimmer heraus, als sie sich noch einmal umdrehte. Sie klopfte gar nicht erst und behielt die Klinke in der Hand. «Im Ernst. Denken Sie, dass da irgendetwas faul ist?»
Diewitz richtete sich in seinem Stuhl auf. «Ich weiß es nicht.»
7
«Sehr, sehr gut.» Lucky Manzini imitiert heftiges Klatschen, als ich zum Tisch komme. «Ihr seid die Besten», sagt er, als ich mich setze. Dennis blickt verlegen zur Decke. Der Weiße neben ihm schlägt die Hände dreimal hart gegeneinander und nickt bestätigend. Zwei weitere Männer kommen mit Stühlen hinzu. Beide habe ich von der Bühne aus nicht bemerkt. Der eine ist Bobby Segal, ein hoher ANC-Vertreter, ein kompakter kleiner Kerl, dessen Hass auf das Regime in Südafrika legendär ist. Ich mag ihn sehr. Er macht eine Bemerkung in Winstons Richtung.
Winston Ngozi arbeitet in unserer Botschaft in Ost-Berlin. Die DDR hat keine diplomatischen Verbindungen nach Pretoria, dafür aber mit dem ANC. Die Bewegung teilt sich in Ost-Berlin ein Haus mit anderen Befreiungsbewegungen. Mitunter taucht Winston bei unseren Konzerten auf.
Die Bar ist voll. Seitdem wir von der Bühne gegangen sind, haben sich noch neue Gäste eingefunden. Leute sitzen an den Tischen, es gibt kaum einen freien Stuhl. Vor der Bar herrscht dichtes Gedränge. Meinen Verfolger sehe ich nicht. Aber das heißt nicht, dass er nicht mehr in der Bar ist. Es heißt nur, dass ich ihn in dem Gedränge nicht entdecke.
Der Weiße, der bei Lucky Manzini am Tisch gesessen hat, heller Sommeranzug, frisch rasiert, hält mir die Hand hin. «André Swart», sagt er. «Bin nur kurz aus London hier.» Der singende Ton, der das südafrikanische Englisch oft ausmacht. Für eine Sekunde habe ich Mühe, nicht zu grinsen. Wir haben uns eben schon kurz getroffen. Swart hat mir einen Umschlag in die Hand gedrückt. Will er nicht, dass Lucky Manzini davon erfährt?
«Ich bin schon lange Fan eurer Musik», sagt Swart und versucht, zur gleichen Zeit Dennis und mich anzublicken. «Ihr repräsentiert das Beste an unserer südafrikanischen Kultur.»
Swart ist eine ziemlich große Nummer. Nicht ganz so groß wie Segal. Aber er hat in London mit Oliver Tambo und Thabo Mbeki und der ganzen ANC-Führung zu tun. Er hat einmal als Rechtsanwalt praktiziert, in Südafrika, wo Dennis und ich aufgewachsen sind. Also, natürlich sind wir nicht gemeinsam mit Swart aufgewachsen. Er in der weißen Stadt und wir im Township. Außerdem ist er ein paar Jahre älter als wir. Seit vor ein paar Jahren in der sambischen Hauptstadt Lusaka ein Mordanschlag auf ihn verübt wurde, lebt er nicht mehr in Afrika.
«Südafrikanische Kultur ist afrikanische Kultur», sagt Manzini, sieht mir in die Augen und wartet auf Bestätigung. Was soll ich sagen? Wir spielen Jazz und denken überhaupt nicht entlang dieser Linie. Aber er ist der Jüngste hier, und er muss allein deshalb schon so reden. Swart nimmt den Ball auf.
«In allererster Linie natürlich», sagt er. «Das ist ja auch eine Frage der Mehrheitsverhältnisse, die wir anerkennen müssen.» Er sagt nicht, wie er das Wir definiert.
Manzini hebt sein Bierglas und grinst. Swart ist ihm auf den Leim gegangen und fährt fort: «Aber es gibt so viel mehr. Ihr müsst Breyten Breytenbach lesen. Ein echter Dichter.»
«Er schreibt auf Afrikaans», sagt Dennis leise, während Segal grinst und Winston sein leeres Bierglas betrachtet.
«Leider …», sagt Swart jetzt und steht zur gleichen Zeit auf. «Leider muss ich auch gleich wieder weg.» Er blickt alle in der Runde kurz an, zuletzt mich. «Wir sind ja alle nicht freiwillig hier.»
Ich warte auf einen Kommentar von ihm, der den letzten Satz in einen lustigen Kontext stellt. Aber der kommt nicht. Stattdessen gibt er zuerst Dennis und dann mir die Hand, klopft Manzini kurz auf die Schulter, ohne ihm in die Augen zu sehen, nickt Segal und Winston zu und schiebt sich langsam zum Ausgang. Während ich ihm mit den Augen folge, versuche ich erneut, den Mann ohne Schnurrbart zu finden. Aber er scheint die Bar tatsächlich verlassen zu haben.
«Wisst ihr, was wirklich absurd ist?», fragt Manzini. Er klopft sich den schwarzen Anzug ab, den er immer trägt, gleich ob Sommer oder Winter.
Weder Dennis noch ich würdigen die rhetorische Frage einer Antwort. Segal schaut höflich interessiert drein, Winston ist immer noch mit dem leeren Glas beschäftigt. Als Manzini fortfahren will, kommt Franck zum Tisch. Er klopft dreimal auf das Holz, sagt «Bis morgen», hält meinen Blick eine auffällige Sekunde zu lange und winkt dann Gordon zu, der am Tresen steht, auf einen Drink wartet und ihn nicht sehen kann. «Morgen», sagt er noch einmal und ist dann weg.
Manzini blickt ihm hinterher. Dann schaut er mich fragend an, als wolle er den Blick erklärt haben, den wir ausgetauscht haben, wiederholt aber seine Frage von eben. «Also: Was ist absurd?» Er lässt kaum eine Pause und sagt: «Er heißt Swart, und ich bin es.»
Dennis zeigt seine Zähne, und ich hab den Witz auch schon mal gehört. Die beiden mögen sich offensichtlich nicht. Das ist auch nicht nötig. Wir sind im selben Kampf vereint, gegen das verdammte Apartheid-Regime, aber dafür müssen wir uns nicht gegenseitig auch noch nett finden.
«Was gibt’s für Swart in Berlin zu tun?», fragt Dennis. Er betont keines der Worte, fast uninteressiert. Vielleicht will er nur eine andere Stimmung an den Tisch bringen. Oder er möchte es wissen. Egal, was wir tun, niemand erzählt allen alles. Dennis ahnt mehr, als er es weiß, dass ich manchmal einen Umschlag von Berlin nach London bringe. Oder von Stockholm nach Amsterdam. Oder von Paris nach New York. Meistens hängt es von den Gigs ab, die ich habe, manchmal aber auch von den Nachrichten, die überbracht werden müssen. Dennis weiß auch, dass ich ihm nicht alles erzähle. Auf gar keinen Fall will ich, dass er weiß, was ich Franck eben mitgegeben habe. Und was ich ihm alles erklären musste. Und sowieso darf Lucky Manzini nicht wissen, dass Franck an meiner Stelle morgen früh nach Ost-Berlin geht, mit dem Umschlag, den Swart mir gegeben hat.
«Ach», antwortet Manzini. «Es geht doch immer nur um dasselbe. Wir bereiten den nächsten Schlag vor gegen unsere Freunde von der Nasionale Party.» Er spricht den Afrikaans-Namen der Nats betont langsam aus, Silbe für Silbe. «Jede einzelne Kugel zählt», sagt er. «Aber eine Kugel allein ist natürlich nicht genug. Einen nehmen wir noch, oder?» Er hebt den Blick und öffnet die Hände. «Daran arbeiten wir alle. Daran, dass eine Kugel zur anderen kommt.»
Segal nickt gelangweilt. Winston steht auf, um sich das nächste Bier zu holen.
8
Wie oft lag Otto wach in der neuen Wohnung am Platz der Vereinten Nationen. Seit dem Umzug aus Jena hatte er keine Nacht mehr durchgeschlafen. Auch jetzt sah er die Phosphorziffern auf dem Wecker.
3 Uhr 48. Das war die schlechteste Zeit. Zwischen drei und fünf Uhr lag er einfach wach. Da konnte er nichts machen. Umso schlimmer im späteren Frühjahr und im Sommer, wenn es schon hell war.
Sie hatten ihm Urlaub gegeben nach der Katastrophe bei Meiningen. Dann hatten sie ihn zu den Ärzten geschickt und in Kur. Nebenbei waren Kollegen aus verschiedenen Dezernaten und von der Spezialkommission des MfS damit beschäftigt herauszufinden, was wirklich an diesem Abend geschehen war. Am Ende jedenfalls waren Heinz Thiel, der Leiter der Morduntersuchungskommission Gera, und Konnie Krumbach tot und Günter Cierpinski schwer verletzt. Nur Rolf Reim und er hatten den Abend unversehrt überstanden. Körperlich jedenfalls.
Auch Michael Nikoleit und seine Frau waren gestorben an jenem Abend. Und Otto hatte immer wieder behauptet, im nebligen Abenddunkel nicht genau gesehen zu haben, in welcher Situation Rolf den Nikoleit erschossen hatte. Die Frau war schon tot, nachdem der Lkw von der Straße abgekommen war.
Natürlich hatte er es ganz genau gesehen. Rolf hatte den Nikoleit mit einem Kopfschuss gerichtet. Und Otto hatte ihm zu spät in den Arm gegriffen. Nicht, dass der Nikoleit nicht alles Böse verdient gehabt hatte. Er war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Mörder seines eigenes Sohnes. Und dass er seine Tochter missbraucht hatte, war auch naheliegend gewesen. Und dann hatte er Ottos und Rolfs Genossen in der Morduntersuchungskommission auf dem Gewissen. So einen hätte nicht einmal der Westen freigekauft.
In jedem Fall gab es die Morduntersuchungskommission des Bezirks Gera seit diesem Abend nicht mehr. Sie war umgehend aufgelöst worden. Günter ging in Rente. Er konnte von Glück reden, dass er sich noch selbstständig bewegen konnte nach den Verletzungen, die er davongetragen hatte. Rolf wurde zur Branduntersuchungskommission nach Dresden versetzt, eine Maßnahme, die Otto klammheimlich freute, und, dachte er, machen wir uns nichts vor, obwohl er den Kollegen nicht belastet hatte, mit keinem Wort, sahen alle diese Versetzung als Degradierung.
Und Otto war also Teil der relativ neuen zweiten Morduntersuchungskommission in Berlin geworden, die es erst seit 1984 gab. Die eine MUK wurde der vielen Verbrechen einfach nicht mehr Herr. Das musste man sich vorstellen. So eine große Stadt.
Jetzt war er hellwach. Otto lauschte in die Wohnung hinein, die er als Polizist mit ein wenig Vorzugsbehandlung bekommen hatte. Jedes Geräusch, das er produzierte, wurde durch die Leere der vielen Zimmer verdoppelt und verdreifacht. Und, das war ganz eigentümlich, selbst die Stille, also die Abwesenheit von Geräuschen, klang ganz anders, als er es kannte. Selbst das Nichts um ihn herum hatte einen hohlen Klang. Wenn er beginnen würde, Möbel zu kaufen, dann würde sich das ändern. Mit irgendetwas für das Wohnzimmer sollte er anfangen. Sessel dazu, ein Sofa. Was man so in die Wohnung stellte.
Eigentlich war sie zu groß für einen alleinstehenden Mann. Er verstand das als Hinweis darauf, dass von ihm erwartet wurde, eine Familie zu gründen.
Noch eine.
Wirklich?
Birgit und er hatten sich getrennt, kurz nach den Ereignissen bei Meiningen. Birgit hatte es nicht so deutlich gesagt, aber als sie zu ihrem Vorgesetzten aus dem Kombinat in die Altbauwohnung gezogen war, mit den Kindern, da hatte Otto sich schon bestätigt gefühlt. Natürlich hatte sie die ganze Zeit über eine Affäre mit dem gehabt. Er hatte es doch gewusst.
Sie hatten ihm eine Auszeit verordnet nach Meiningen. Und dann die Versetzung. «Gute Kriminalpolizisten werden gebraucht», hatte ein Oberstleutnant zu ihm gesagt. Und ein bisschen Distanz zu Birgit und den Kindern, hatte er noch angemerkt, täte wohl allen gut.
So sicher war sich Otto da nicht. Er vermisste die Kinder. Und Birgit irgendwie auch. Sie war ja schon eine gute Ehefrau und Mutter gewesen. Manche Dinge waren ihm erst spät klar geworden. Aber sie hatte tatsächlich eine Gabe, all diese Dinge zu organisieren, die in der Familie wichtig waren.
Ihm ging das irgendwie ab.
Und für ihn war sie auch immer da gewesen.
Eine neue Familie gründen. Das war doch kein Plan. So etwas … so etwas geschah eben.
Wenn man jung war.
Und er war nicht mehr jung, sondern schon fast vierzig.
Otto drehte sich auf die Seite. Obwohl es so unglaublich leise war, spürte er den Hall, den die Leere in der Wohnung produzierte, körperlich. Fast erschien es ihm, als könne er das hören, was ja im Grunde genommen nicht da war und damit gar nicht wahrnehmbar.
Das Klingeln des Telefons erschreckte ihn im ersten Moment des neuen Schlafs. Otto brauchte ein paar Sekunden, um sich zurechtzufinden.
Er selbst. Das Bett. Das Telefon.
«Ja?»
«Es geht los.» Das war die Stimme von Holger.
«Wo?»
Holger nannte ihm eine Adresse in Friedrichshain.
9
Erika Fichte war kurz nach sieben Uhr in der Dokumentationsabteilung. Sie fand die Regale blind, schließlich war sie hier zu Hause.
Natürlich lagen die Dinge anders heute. Sie hatte einen Auftrag ihres Vorgesetzten. Sollte sich umsehen, auch innerhalb der Akten, das war der Unterschied, und nicht wie sonst einfach Ordner holen und sie ihm auf den Tisch legen.
Ein Auftrag also.
Gut. Als Sekretärin war sie es gewohnt auszuführen, was ihr aufgetragen worden war.
Trotzdem fühlte sie sich unsicher. Und deshalb war sie so früh hier. Sie wollte nicht, dass irgendjemand sie sah. So, wie sie sich an diesem besonderen Morgen benahm.
Hier, vor ihr, standen die Regalreihen, in denen unter anderem Friedrich Wolles Arbeit dokumentiert war. Vorgänge. Transaktionen. Sie ließ die Augen über die erste Reihe schweifen. Sieben Meter? Vielleicht acht. Vier Ebenen übereinander. Das Gleiche auf der anderen Seite und dann auch noch einmal gegenüber. Machte mehr als zwanzig Meter mal vier. Alles, was sich um Südafrika drehte, die Nachbarländer, den Kampf gegen die Apartheid und wie sie ihn von Berlin aus unterstützten. Aber was genau dort zu finden war, wusste sie nicht.
Natürlich kannte sie die politischen Rahmenbedingungen. Nicht nur aus ihrem eigenen Beruf, sondern auch aus den vielen Gesprächen mit Holberg. Die DDR war ein alter Verbündeter des ANC. Vor allem des SACP, der kommunistischen Partei in dem Bündnis unter der Leitung des ANC. Waffenlieferungen, politische Schulungen, militärisches Training. Was immer gebraucht wurde, auf die DDR war Verlass.
Keine Minute hatte sie in der Nacht geschlafen. Erika mochte ihre Arbeit, sie war stolz darauf, Teil eines Systems zu sein, das half, ein Regime wie jenes in Südafrika entschlossen zu bekämpfen. Und wenn sie ehrlich zu sich war, dann war ihr die Rolle, die sie hatte, auch lieb. Ein Rad in der Maschine, das war sie. Sie half dabei mit, die Bewegung des Rades in Schwung zu halten. Sowohl den eigenen Apparat, der ja unterhalten werden wollte, als auch die politische Bewegung, Anti-Apartheid, denn so nannten sie es woanders in der Welt. Oder in Südafrika: The Struggle.
Und jetzt wollte der Witz, dass sie ganz andere Dinge tat. Sie holte blind einen Aktenordner hervor, löste den Klemmbügel und schlug einen Packen Blätter zurück. In einem Absatz auf dem Blatt entdeckte sie den Namen des Städtchens Teterow. Dort war das militärische Ausbildungszentrum für die Südafrikaner. Sie blätterte eine Seite weiter. Es ging in englischer Sprache um die Dauer von Aufenthalten für Kämpfer. Unterzeichnet war das Dokument von Alexander Rombach, der vor ihr und auch vor Friedrich Wolle in der Abteilung gearbeitet hatte. Er war bei einem Helikopterabsturz in Algerien ums Leben gekommen. Das Datum neben der Unterschrift war verblichen, aber sie erkannte die Jahreszahl. 1977. Sie stellte die Akte zurück.
Ein paar Meter weiter. Eine weitere Akte, willkürlich aus dem Regal gezogen. Aufs Geratewohl fuhr Erika mit dem Finger hinein. Schreibmaschinenschrift mit unregelmäßigen Buchstaben, unterschiedlich deutlich im Anschlag, manche rissen aus der Reihe aus. Es ging um Handfeuerwaffen, um Lieferwege und um jemanden, der sie 1982 irgendwo in Empfang nehmen sollte. Gezeichnet war das nicht von Wolle, für sie also nicht von Interesse.
Oder?
Wahrscheinlich war es nicht.
Aber was war es denn, wonach sie suchte? Vorgänge, an denen der Genosse Wolle beteiligt war und die … ja, das war die Frage, die genau was offenlegten?
Sie stellte die Akte zurück und nahm eine vom darunter liegenden Regalboden. Ohne den Bügel zu lösen, schlug sie ein paar Blätter um und entdeckte sofort Wolles Namen im Briefkopf. In dem kurzen Schreiben bat er einen Genossen in der Handwaffenproduktion, einen Liefertermin zu bestätigen. Es ging um eine Fertigstellung im April 1984. Die Unterschrift Wolles war deutlich zu erkennen. Der Kugelschreiber hatte eine leicht schmierende Parallelspur neben der Schriftlinie gezogen.
Auch diese Akte stellte Erika wieder weg. Es war schon nach 8 Uhr. Gleich würden andere Leute kommen. Sie war froh um die kurze Zeit, die sie allein hier gewesen war, aber sie wusste kein bisschen mehr über ihren Auftrag als vorher. Was konnte sie nur herausfinden über Wolles Vorgänge und seine Arbeit?
Und was hatte das möglicherweise mit seinem Verschwinden zu tun?
War er tatsächlich verschwunden? Wie verschwand man überhaupt? Sein Auto kommt von der Straße ab, landet in der Spree, und er ertrinkt. Kaum vorstellbar. Die Spree war in Berlin zu gut bewacht. Er bricht zusammen, irgendwo, krank oder tot, und wird morgen gefunden. Nicht ganz unmöglich. Aber auch nicht so naheliegend. Aber weder die eine noch die andere Geschichte hatte mit irgendetwas zu tun, das sie hier im Archiv finden würde.
Dann kam ihr noch eine andere Version in den Sinn. Wie konnte man daran nicht denken? Der Witz hatte nicht davon gesprochen, sie hatte nicht danach gefragt. Aber wenn sie ehrlich war, musste sie sich das jetzt eingestehen.
Was, wenn er in den Westen gegangen wäre? Einfach so. Es war ja möglich. Und solche wie uns nahmen die gern.
Ja, was, wenn er das getan hätte? Aber warum? Wolle war ihr stets als aufrechter Kämpfer für die richtige Sache erschienen.
Würde sie dazu etwas in den Akten finden? Einen Verrat?
Und wenn ja. Was würde sie damit machen? Irgendwo waren Schritte zu hören. Jemand kam schnell näher. Und ihr war plötzlich eiskalt.
Billy: Was würdest du damit machen?
Dennis: Weiß nicht. Einen Wagen kaufen.
Billy: Für hier? Also … Für London, meine ich?
Dennis: Nein. Eher einen Wagen für den Township. Einen Mercedes.
Billy: Einen Mercedes.
Dennis: Ja. Wie Bra Dickie einen hat.
Billy: Bra Dickie ist ein Verbrecher.
Dennis: Aber er fährt einen guten Wagen.
Billy: Bra Dickie ist ein Mörder.
Dennis: Der Wagen …
Billy: Und er ist ein Agent der Buren.
Dennis: Das weiß man nicht so genau. Und da kann der Wagen nichts für.
Billy: Darüber reden die Leute schon, seit ich ein kleiner Junge war. Darüber, dass er für die Buren arbeitet. Und außerdem lebst du nicht mehr im Township.
Dennis: Schon. Na gut, vielleicht war das gerade auch mehr so eine theoretische Überlegung. Ich habe das Geld ja auch gar nicht.
10
Otto war der Letzte, der in Friedrichshain ankam. Eine Toreinfahrt, die verwaschenen Buchstaben darüber verwiesen auf eine Kohlenhandlung, die dort vielleicht vor dem Krieg gewesen war, und im zweiten Hinterhof fand er die anderen. Im Gegenlicht sah er die Konturen von Holger, Popczyk und Heinz Wehrmann.
Wehrmann, der Leiter der zweiten Morduntersuchungskommission in Berlin, beugte sich nach vorn, betrachtete etwas, das Otto nicht erkennen konnte. Oder irgendwen. Zuerst hatte Otto es schon kurios gefunden, dass sein neuer Chef denselben Vornamen hatte wie der alte, der verstorbene Heinz Thiel in Gera. Erst dann hatte ihm Popczyk erzählt, dass die Leiter der Morduntersuchungskommissionen in Rostock, Magdeburg und Karl-Marx-Stadt ebenfalls Heinz mit Vornamen hießen. So etwas kriegte man ja normalerweise gar nicht mit. Das stand ja nicht im ND.
Und damit nicht genug. Auch Heinz Thiels Nachfolger in Gera trug denselben Vornamen. Das hatte sich erst vor ein paar Wochen ergeben, dass die endgültig neu geordnet worden war. Die MUK in Gera war nach den Ereignissen bei Meiningen vor zwei Jahren zunächst provisorisch unterhalten worden. Und der neue Leiter hieß eben Heinz wie dessen Vorgänger.
Wehrmann, narbiges Gesicht, das schwarze Haar unfrisiert, groß mit schmalen Schultern, richtete sich auf und drehte sich um, als Otto den Auffindungsort erreichte. Er wies mit dem Kopf auf eine Außentreppe, die in den Keller führte. Auf den Stufen lag ein Mann auf dem Bauch, Kopf nach unten. Die Rückansicht gab einiges preis. Jeans, Jackett, dunkelblonde Haare bis auf die Schultern, kein Grau darin. Die Adidas-Schuhe, mehr schwarz als weiß, hatte er nicht in der DDR erworben. Auch das Etikett auf der Hose war Otto fremd. Und am Arm hatte er eine Digitaluhr, wenn er das richtig erkannte. Die frühe Helligkeit beleuchtete mehrere Rinnsale aus Blut, alle getrocknet.
«Kalt», sagte Popczyk.
«Recht kalt.» Holger.
«Die Kriminaltechnik ist unterwegs.» Wehrmann. «Aber ich habe auch schon die Genossen von der Spezialkommission informiert.»
«Ein Bürger der Bundesrepublik», sagte Otto und betrachtete den bröckelnden Putz an den Wänden über ihm. Ein paar Leute guckten aus den Fenstern. Eine Frau hatte eine Tasse in der Hand und sah ihm gelangweilt in die Augen.
«Ein Ausländer jedenfalls.» Popczyk.
«Den nehmen sie uns weg», sagte Holger, «wenn er ein Ausländer ist.»
Ein toter Ausländer war ein Fall für die Spezialkommission. Ganz automatisch. Dass der Schutzpolizist, der als Erster am Auffindungsort gewesen war, aber auch nicht sofort reagiert hatte.
«So klar ist es nicht», sagte Wehrmann. «Uhr und Schuhe können auch Geschenke der Verwandtschaft sein.»
«Das glaubst du selber nicht.» Otto hörte Autotüren schlagen. «Da kommen sie schon. Ich wette, dass die Spezialkommission schneller ist als die Kriminaltechnik.»
Zwei hochgewachsene Männer in den Vierzigern standen Sekunden darauf in der Durchfahrt, beide in blauen Anzügen, einer mit, der andere ohne Schnurrbart. Sie nickten beide in die Runde, ohne sich vorzustellen. Die stellten sich nie vor. «Gut, dass ihr das so schnell durchgegeben habt», sagte der ohne Bart und ging langsam auf Wehrmann zu. «Wir wissen auch schon, um wen es sich handelt.»
«Es gibt da noch etwas anderes …» Der Zweite, der mit Bart, hob den Zeigefinger. «Wann habt ihr zuletzt Funkkontakt gehabt?»
«Jetzt sagt uns aber erst mal, wer das hier ist.» Popczyk wies mit dem Kopf auf die Kellertreppe. «Schließlich sind wir dafür früh aufgestanden.»
«Musiker», sagte der mit Bart. «Kommt aus der Schweiz.»
«Und der ist gestern Abend nicht wieder in den Westen zurück?» Das war die einzige Erklärung, dachte Otto.
«Das ist komplizierter», sagte der ohne Bart. «Der ist eben erst hier rübergekommen.»
Woher sie das wussten, fragte sich Otto.
«Und?» Das war der andere wieder. «Seid ihr auf dem neuesten Stand?»
«Gerade eben mit der Zentrale geredet», sagte Wehrmann. «Gibt’s was Neues?»
«Noch einen Fall», sagte der ohne Bart. Er stand mittlerweile am Gitter über der Kellertreppe und starrte auf die Leiche. «Ein paar Straßen weiter nur. Sie ist gefallen.»
«Tief», ergänzte der mit Bart. «Sie ist tief gefallen.»
11
Der allererste Reflex nach dem Aufstehen: Anrufen.
Dabei … Es wird schon alles in Ordnung sein. Trotzdem muss ich mich zwingen, zuerst einmal die Dinge zu tun, die man morgens eben tut, wenn man gerade das Bett verlassen hat. Pinkeln, nach Mary sehen, Kaffee machen, den Tisch fürs Frühstück decken. Und bei jedem Handgriff habe ich das Gefühl, dass ich mich doch zuerst um Franck kümmern sollte. Wenigstens kurz anrufen und seinen Schlaf stören, von dem er ganz sicher zu wenig gehabt hat.
Noch das Porridge für die Kleine aufsetzen und daran denken, dass ich eigentlich Franck anrufen muss.
Dann auch noch Brötchen holen gehen, was ich nur mache, wenn wir Gäste haben. Aber Dennis ist ja bei uns. Ich ziehe mich an und krame Geld hervor, bleibe an der Wohnungstür stehen.
Zuerst doch anrufen.
Christine schleppt sich schlaftrunken ins Badezimmer, wirft mir einen Handkuss zu. Ich stehe im Flur am Telefon und höre es auf der anderen Seite klingeln. Geh schon ran.
«Pension Schäfer», höre ich endlich eine Stimme, aber nicht die, die ich erwartet habe.
«Ich habe Franck Gregorieff angerufen», sage ich. «Auf Zimmer … ich weiß nicht, welche Nummer.»
«Nummer 35», sagt die Frau mit der jungen Stimme. «Aber der Herr Gregorieff ist nicht in seinem Zimmer.»
«Beim Frühstück?»
«Äh.» Ich kann geradezu hören, wie sie überlegt. Sagt sie, dass sie nicht sagen darf, was sie mir gleich sagen wird? «Der Schlüssel hängt hier», höre ich sie. «Und seit ich meinen Dienst angetreten habe, hat den keiner in der Hand gehabt. Das war um 6.»
Ich überlege, was das zu bedeuten hat. Franck sollte längst wieder in seinem Zimmer sein.
«Sind Sie noch dran?»
«Klar», sage ich. «Und Sie sind sicher, dass er nicht doch im Zimmer ist?»
«Schon», sagt sie.
Ich bedanke mich und rufe die Durchwahl zu Francks Zimmer sofort wieder an. Nach sieben- oder achtmaligem Klingeln höre ich die Stimme der jungen Frau erneut und lege auf.
«Was ist?» Christine steht hinter mir und legt ihren Kopf an meine Schulter.
«Mama», kommt es aus dem Schlafzimmer, wo Mary in einem Extrabett liegt, weil wir Dennis ihr Zimmer gegeben haben. Christine folgt ihrer Stimme. In der Tür dreht sie sich um und guckt fragend.
Was ist los? Franck ist nach der Übergabe in Ost-Berlin in Ruhe frühstücken gegangen. Aber warum nicht in der Pension? Da kriegt er das Essen umsonst. So viel Geld hat er auch nicht.
Franck ist zu einer Freundin gegangen. Hat er eine? Und das hier in Berlin? Und eine, bei der er zu solch einer Zeit auftauchen kann?
Franck hat jemanden getroffen. Aber wen? Am frühen Morgen. Er war die meiste Zeit der Nacht wach und muss jetzt erst einmal schlafen.
Franck ist zu einem der anderen Musiker gegangen. So ein Quatsch. Gordon ist bei seinem Freund. Dennis ist bei mir. Und Trevor … Die beiden haben sich viel zu erzählen, aber Trevor schläft seinen Rausch aus, wie jeden Morgen. Unter zwei Promille tut er es nicht.