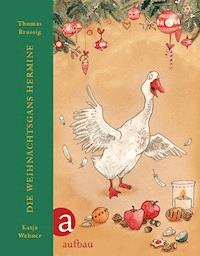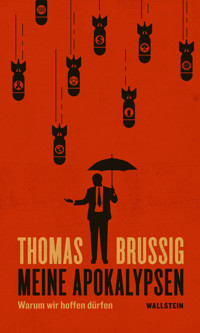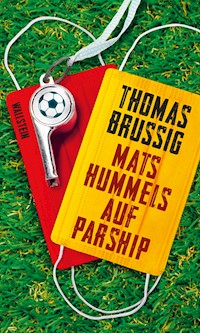8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Kein Sex, keine Drugs, aber jede Menge Rock'n'Roll – Der neue Roman von Thomas Brussig Ostberlin 1989. In einem Keller probt Die Seuche, eine Band, die Großes vorhat. Ihr einziger Fan ist zugleich ihr Manager. Äppstiehn tut, was er kann – und das ist nicht viel. Die Seuche spielt bei Familienfesten und Geburtstagsfeiern und lässt sich in Autoschiebereien am Rande der Prager Botschaft verwickeln. Doch gegen die Wende ist sogar Äppstiehn machtlos. Plötzlich spielt Musik keine Rolle mehr. Aber geht das überhaupt? Thomas Brussigs warmherzige Hommage an die Musik einer Zeit erzählt mit Witz und Leichtigkeit davon, wie es ist, wenn etwas zu Ende geht und gleichzeitig etwas beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Thomas Brussig
Beste Absichten
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
I
Am Sonntag, dem 12. September 1976, schien über Zschopau die Sonne. Ein Spätsommertag, wie geschaffen für einen Spaziergang oder einen Ausflug in die nähere Umgebung am Fuße des Erzgebirges. Im Zschopauer Stadion, das in Wahrheit nur ein Sportplatz war, fanden die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften statt. Obwohl solche Wettkämpfe kaum Publikum haben, hatten sich an diesem Tag etwa zweihundert Zuschauer in einer Stadionkurve eingefunden. Der Kugelstoßer Rolf Oesterreich wolle, so hieß es, den Weltrekord brechen, der bei genau 22,00 Metern stand.
Oesterreich war ein Ausnahmeathlet. Anders als alle anderen Weltklasse-Kugelstoßer kam er nicht als Hüne daher. Wegen seiner 1,80 Meter blieb ihm ein »Sportclub« mit den hervorragenden Trainings- und Dopingmöglichkeiten verwehrt. Doch als Autodidakt hatte er sich binnen eines Jahres eine Technik aufgedrückt, die auf der ganzen Welt lediglich zwei Athleten beherrschten – die Drehstoßtechnik. Da Oesterreich zu keinem der beiden einen Kontakt herstellen konnte, half ihm nur seine Intuition und die Fotosequenz eines Sportfotografen. Bei den Trainern des DDR-Spitzensports war die Drehstoßtechnik verpönt, weil sie als so anspruchsvoll galt, dass ein Kugelstoßwettbewerb in Drehstoßtechnik einer Lotterie glich: Kleinste Fehler wirkten sich verheerend auf die Weite aus. Diese Streuung beleidigte offenbar eine Mentalität, die von Plan und Planerfüllung lebte.
Zu den Olympischen Spielen in Montreal wurde Rolf Oesterreich nicht mitgenommen, obwohl er zuvor mit 21,45 Metern eine Weite gestoßen hatte, die Weltklasse war. Sie lag auch deutlich über der Weite, mit der in Montreal die Goldmedaille gewonnen wurde, nämlich 21,05 Meter. Da der Olympiasieger allerdings Udo Beyer hieß und aus Potsdam kam, musste niemand der DDR-Sportoberen das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben.
Die Bezirksmeisterschaft in Zschopau war keine sieben Wochen danach. Dass Oesterreich in einer eigenen Liga antrat, wurde schon beim Einstoßen klar. Die Kugeln der Athleten hinterließen nach ihrer Landung kleine Mulden, und diese Mulden ballten sich bei zwölf, dreizehn Metern. Es gab ein weiteres, viel kleineres Nest an Mulden, das deutlich dahinter lag. Und das stammte allein von Rolf Oesterreichs Kugel.
Der Wettkampf begann. Beim ersten Versuch spürte Oesterreich eine Berührung seiner Schuhsohle mit der Oberkante des Balkens, und weil sich daraus nur ein ungültiger Versuch entwickeln konnte, nahm Oesterreich die Kraft aus dem Stoß. Dennoch landete die Kugel weit hinter dem letzten der Kreidebögen, und die Kampfrichter konnten der Versuchung nicht widerstehen, auch diesen ungültigen Versuch zu vermessen. Es war irgendwas um einundzwanzigeinhalb Meter, was bedeutete, dass Oesterreich auch mit gezügelter Kraft weiter gestoßen hatte als der Olympiasieger.
Das allgemeine Interesse war Rolf Oesterreich spätestens jetzt sicher, und seinen zweiten Versuch sah jeder, der im Stadion war: Zuschauer, Sportler, Kampfrichter und Trainer. Jeder schaute in die Kurve, wo das Kugelstoßen stattfand. Der Mann im Ring spulte den für das Auge ungewohnten, aber doch raffinierten Bewegungsablauf ab, den er nicht nur auf dem Sportplatz Tausende Male geübt hatte, sondern auch an einsamen Bushaltestellen oder in unbeobachteten Tordurchfahrten. Jeder im Stadion spürte, dass jetzt etwas geschieht, was von einer Magie ist, wie sie nur der Sport bereithält. Nach einer Kraftexplosion, begleitet von einem Schrei, flog die Kugel. Sie flog länger, als je eine Kugel in der Luft war, und sie landete bei 22,11 Meter. Der Versuch war gültig. Jubel brandete auf, und am lautesten jubelte Rolf Oesterreich. Der erträumte Weltrekord war Wirklichkeit. Doch er wurde behandelt, als hätte es ihn nie gegeben.
Schon bei der Siegerehrung sagte der Stadionsprecher bloß, dass Rolf Oesterreich »mit einer sehr guten Weite« gesiegt habe, und als Rolf Oesterreich am Abend in einem Zwickauer Biergarten bei der Schilderung seines Weltrekords als Lügner und Großmaul dastand, weil die Sportnachrichten nichts darüber gebracht hatten, wurde ihm bewusst, dass er keinen Beweis hatte. Die Presse verschwieg Oesterreichs Leistung, und die Sportfunktionäre unterließen es, seine Weite beim Weltverband als Rekord einzureichen. Stattdessen tauchten haltlose Gerüchte von einer angeblich regelwidrigen Kugel auf – obwohl die Kugel den Zschopauer Kampfrichtern am Vormittag des Wettkampftages vorgelegt und nach der üblichen Prüfung für den Wettkampf freigegeben worden war, weil sie dem Reglement entsprochen hatte.
Zudem wurde Rolf Oesterreich nun ganz aus dem Wettkampfbetrieb gedrängt. Schon die gesamte Saison über waren ihm Startgenehmigungen für jene Wettkämpfe versagt worden, bei denen er die Kugelstoßer der privilegierten Sportclubs hätte besiegen können. Oesterreich spürte, dass er den Schikanen auf Dauer nicht würde standhalten können. Hatte er, der Autodidakt, überhaupt Verbündete? Rolf Oesterreich fühlte sich stark genug, es mit einer 7,25 kg schweren Eisenkugel aufzunehmen – aber nicht mit einem Staat. Als ihm bei einem der Sportclubs, die ihn als Athleten nicht haben wollten oder durften, eine Trainerstelle angeboten wurde, griff er zu – wohl wissend, dass damit seine Laufbahn als aktiver Sportler naturgemäß zu Ende war.
Rolf Oesterreichs Wettkampfhistorie in der Drehstoßtechnik verzeichnet nur vier Wettkämpfe mit insgesamt fünf gültigen Versuchen, wovon kein einziger unter 20 Metern lag. Ein Athlet, der in seinen so raren Auftritten durchweg so hochkarätige Ergebnisse erzielte, ist in der Sportgeschichte vermutlich ohne Beispiel. Obendrein war Oesterreich ein sauberer Athlet in einer dopingverseuchten Disziplin. (In den vierzig Jahren nach dem 12. September 1976 hat es wohl nur einen einzigen sauberen Athleten gegeben, der weiter als jene 22,11 Meter stieß.)
Nach der Wende forderte Rolf Oesterreich, dass die 22,11 Meter Eingang in die offiziellen Statistiken finden. Doch er scheiterte an bürokratischen Vorbehalten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes DLV, und jeden Abend um 22.11 Uhr erinnert die Digitaluhr Rolf Oesterreich an den Weltrekord, der ihm gestohlen wurde.
Nur weil die Geschichte des Kugelstoßers Rolf Oesterreich als gesichert gilt, habe ich den Mut, die Geschichte einer großen Band zu erzählen, die völlig unbekannt geblieben ist. Wenn es möglich ist, dass jemand einen Weltrekord erzielte, der vor der Welt verborgen blieb, dann ist es auch möglich, dass es eine große Band gab, die niemand kannte. Ich hatte mit dieser Band zu tun, genauer: Ich habe sie auf dem Gewissen.
Musik
Sie wollten mich wohl wieder einberufen. Der Vorwand, unter dem ich ins Wehrkreiskommando am Rosenthaler Platz bestellt wurde, klang harmlos, »Aktualisierung Ihrer Unterlagen«, doch dann machten sie ihre Bemerkungen und maßen mich mit Blicken. Ich hatte schon »gedient«, aber wenn es ihnen einfiel, konnten sie mich wieder holen. Sie blätterten in meiner Akte, und ein Hauptmann fragte mich gelangweilt, ob ich am 5.3.66 geboren sei. Vermutlich wollte er prüfen, ob meine Armeereflexe wiederaufleben und ich »Jawohl, Genosse Hauptmann« antworte, doch ich gab »Wenns da steht, wirds wohl so sein« zur Antwort, auch wenn das ja nun erst recht ein Grund sein könnte, mich zu ziehen, um mir wieder »Manieren beizubringen«. Der Hauptmann ließ sich noch mehr Dinge bestätigen, die in meiner Akte standen, und vielleicht spielten sie nur mit mir, weil jeder 22-Jährige, der schon »gedient« hatte, auf eine erneute Einberufung so versessen war wie auf die Krätze.
Hinterher analysierte ich in Gedanken jede Geste, an die ich mich erinnern konnte, und versuchte, Hinweise und Signale herauszulesen, doch ich fühlte mich nur umso ohnmächtiger. Denn ich wusste weder, was sie mit mir vorhatten, noch, ob sie überhaupt etwas mit mir vorhatten.
Ich war, vom Wehrkreiskommando am Rosenthaler Platz kommend, die Pieck und die Borsig entlanggegangen. Du konntest damals, wenn du dich auskanntest, den Weg abkürzen, indem du über die Hinterhöfe gingst. Toreinfahrten und Haustüren waren immer offen, hatten anstelle von Schlössern nur ausgefressene, wurmstichige Krater im Holz, und wer durch so eine Toreinfahrt in den ersten und dann in den zweiten Hinterhof ging, konnte feststellen, dass es zwischen den Grundstücken keine Mauern und Zäune gab, und falls doch, fehlten oft Bretter in den Zäunen, oder der Maschendraht war niedergetrampelt. Manchmal standen auch Kellertüren offen, und dann war vielleicht der Kellergang die Verbindung zwischen den Höfen, wenn oben zu war. Diese Schleichwege hatte ich, seitdem ich dreizehn war, auf einem Stadtplan eingetragen, mit einem Bleistift der Härte 5H, und ich hatte dazu ein eigenes Bezeichnungssystem entwickelt, das nur ich verstand und aus dem hervorging, bei welchen Hausnummern einer Straße ein Durchgang existierte und ob dieser ober- oder unterirdisch war. Die ersten Erkundungen fanden um den Hackeschen Markt herum statt, und über die Jahre erweiterte ich meinen Radius. Entsprechend sah die Karte aus, die ich immer bei mir hatte: Das Bleistiftgekritzel war um den Hackeschen Markt am dichtesten und entwirrte sich, je weiter es von diesem Zentrum entfernt war, bis es ganz ausdünnte – oder in Vierteln, in die es mich gelegentlich verschlug, inselweise anzutreffen war. Den Begriff »Stadtindianer« kannte ich als Dreizehnjähriger noch nicht – aber er beschrieb exakt das, was ich sein wollte. Ich ging diese von mir entdeckten Wege, wann immer es sich anbot, oder ich erkundete neue. Als ich aus dem Wehrkreiskommando kam, wollte ich schauen, ob die Schleichwege meiner Karte noch aktuell waren, und kürzte über die Hinterhöfe ab. Das heißt, ich ging in einen Hinterhof, kam in der Parallelstraße wieder raus und ging dort bis zu einem Hauseingang, über den ich zur wiederum nächsten Parallelstraße kommen würde, und so weiter.
Ich war schon in der Tieck, als ich aus einem Keller Musik hörte. Es war live, die Probe einer Band, und es war nicht zu verstehen, ob der Gesang englisch oder deutsch war, obwohl der Sänger immer nur ein und dieselbe Zeile sang. Es war ein schneller, schroffer Song, das Schlagzeug knallte, und der Gitarrist langte ordentlich hin.
Auf der Chausseestraße rumpelte gerade eine Straßenbahn der Linie 46 vorüber. Der Himmel war grau, seit Tagen schon, eine Krähe saß auf einer Mauer, Schneematsch lag überall, und das Pflaster war so schief, dass die Autos am Straßenrand wirkten, als hätten sie auf einer Seite platte Reifen. »Ohne Musik ist das alles nicht auszuhalten« – dieser Satz war mir in den letzten Jahren immer wieder in den Sinn gekommen. Um die Gedanken an das Wehrkreiskommando aus dem Kopf zu kriegen, ging ich in den Keller.
Wenn ich mich lauter Musik aussetze, gerate ich binnen Sekunden in einen anderen Zustand, insbesondere das Gefühl der allgemeinen Bedeutungslosigkeit ist weg. Die Band – sie waren zu fünft – hatte mich zwar bemerkt, nahm aber keinerlei Notiz von mir. Sie waren alle in meinem Alter, nur der Bassist war etwa zehn Jahre älter. Der Gitarrist war ein drahtig-bewegliches Kerlchen mit braunen Augen und einem schönheitspreisverdächtigen Gesicht, sanft und ebenmäßig. Nofretete, wiedergeboren als Mann, das war der Gitarrist. Auch der Keyboarder war eine verdammte Schönheit, allerdings war er ein Typ, wie man ihn in einer Kellerband niemals vermuten würde; er sah aus wie ein Schwiegersohn, hatte ein helles, offenes Gesicht, kurze blonde Haare und sehr feine, schon spinnenartige Finger. Das Gesicht des Bassisten hingegen war von einem Dickicht aus Barthaaren überwachsen, Lippen und Nasenlöcher waren kaum zu sehen. Auch seine Wimpern und Augenbrauen schienen zu wuchern, und obendrein spielte er mit geschlossenen Augen, wobei er nach einem nicht durchschaubaren System seinen Oberkörper hin und her drehte, knickte und ruckte. Der Schlagzeuger saß in einem schwarzen Turnhemd und schwarzen Jeans auf seinem Hocker, und er hatte eine schwarze Wuschelfrisur und engstehende Augen, die ihm die heimtückische Anmutung des schlauen Urfins aus dem Kinderbuch von Alexander Wolkow verliehen, und auf seiner Haut hatte sich ein Schweißfilm gebildet. Doch im Zentrum stand eine Frau, so schön, dass ich sie beschreiben müsste, aber ich versuchs erst gar nicht. Wäre sie eine Indianerin, hätte sie Kleine Kastanie heißen können, und mir war unklar, wieso sich die Band in ihrer Gegenwart nicht pausenlos verspielte. Sie war die Sängerin der meisten Songs; nur zufällig hatte es sich ergeben, dass sie nicht sang, als ich gerade kam. Sie hatte eine akustische Gitarre umgehängt, so groß und sperrig wie eine Schublade. Eine Glühbirne an der Decke spendete Licht, das harte Schatten warf. Die Wände waren geweißt, was die Schatten umso schärfer machte, und ein paar Bahnheizkörper standen herum. Sie schafften es aber kaum, den Raum zu erwärmen. Abgesehen vom Schlagzeuger trug die gesamte Band Rollkragenpullover.
Ich verstand jetzt auch, was der Sänger die ganze Zeit sang, nämlich »Unterm Radar, unterm Radar, wir fliegen, fliegen unterm Radar«. Deutsch also. Er schlug dazu in die Saiten, und manchmal packte er das Mikrofon, als müsste er darum kämpfen. Wenn er sang, flog auch immer etwas Spucke; aus nächster Nähe betrachtet, ist Rockmusik richtig Arbeit. Man glaubt, die Energie kommt aus den Lautsprecherboxen und Verstärkern. Aber das stimmt nicht. Die Energie kommt aus den Menschen und ihrer Wut.
Nach dem Titel begannen sie gleich den nächsten. Schwere Gitarren spielten einen sturen, monotonen Rhythmus und bauten, unterstützt durch ein waberndes Keyboard, eine düstere Maschinerie von einem Song auf. Dann setzten die Instrumente aus, nur Bass und Schlagzeug spielten, als die Sängerin ihren Einsatz hatte. Sie hatte eine weiche, unglaublich klare Stimme, was einen hammermäßigen Kontrast zur bisherigen Grobheit dieses Songs bildete. Um die Sängerin nicht die ganze Zeit über anzuglotzen, konzentrierte ich mich auf die Hände des Keyboarders. Wie kommt man nur zu so langen Fingern? War das die Organspende eines expressionistischen Stummfilmwesens?
Der Keyboarder hatte wohl das Sagen, denn er war derjenige, der Songs unterbrach, wenn etwas nicht hinhaute, woraufhin gefeilt wurde, bis es besser wurde oder zumindest anders. Da er die Bandmitglieder mit Namen ansprach, bekam ich schnell mit, dass der Schlagzeuger Micha hieß, der Gitarrist André und der Bassist Rainer. Die Sängerin sprach er allerdings nie mit ihrem Namen an, und sein Name fiel auch nie.
Beim dritten oder vierten Song hörte der Keyboarder wieder mittendrin auf zu spielen und sagte: »Hier fehlt irgendwie ne Farbe. So was wie …«
»Saxophon?«, schlug der Gitarrist vor.
»Nee.«
»Mundharmonika?«, fragte der Gitarrist.
»Mundharmonika wär gut«, sagte der Keyboarder. »Aber kann ja keiner. – Oder du vielleicht?«
Die Frage ging an mich, und ich dachte, Mann, wenn ich jetzt Ja sage, bin ich in ner Band, mache Musik, was mit Abstand das Aufregendste war, was man in diesem Land machen konnte. Aber leider konnte ich weder Mundharmonika noch ein anderes Instrument.
Der Gitarrist sagte: »Ich kanns ja nach Mundharmonika klingen lassen.« Sie spielten die Stelle noch mal, und ich fand mich wieder umdröhnt von Musik, so bedeutsam wie eine Religion oder die Geburt einer Galaxie. Alles andere war dagegen blass und profan.
Ich dachte an das Wehrkreiskommando, die Neonröhren dort und ihre gerippten Verkleidungen, an die billigen Türen und Klinken, an die teigigen Gesichter der Offiziere und an deren Uniformen, von denen ich bei der bloßen Vorstellung, sie anzuziehen, Pickel bekam. Das Wehrkreiskommando war eine einzige Zumutung, ein Tempel des Lächerlichen. Aber in diesem Keller hatte ich etwas gefunden, das ich nicht mehr hergeben, nicht mehr loslassen wollte. Natürlich hatte ich schon oft Musik gehört, von Platten, vom Band oder live, auch lauter als in diesem Keller – und trotzdem war der Keller neu. Es war der zweite Song gewesen, der mit Gitarrenklängen begonnen hatte, zu denen sich erst Schlagzeug, dann Bass und Keyboard gesellt hatten, und jedes dieser Instrumente hatte den Song bedeutender und düsterer gemacht, und mir war wie in einer Hexenküche zumute gewesen, wie in Frankensteins Labor, und als die Sängerin dann mit ihrem Gesang anfing, wusste ich, dass ich hier etwas erlebte, das ich nie zuvor erlebt hatte. Was ich vom Leben wissen wollte, hatte mit Freiheit zu tun und damit, dass niemand Gewalt über dich hat, und ich wusste, dass ich mich dieser Musik aussetzen muss, um dem näherzukommen.
Wenn allerdings die Musiker zu spielen aufhörten und zu reden begannen, war alles Großartige wie weggepustet. Nur wenn sie spielten, waren sie etwas Besonderes. Tatsächlich war es in den folgenden Wochen und Monaten für mich unbegreiflich, dass diese Menschen, die gemeinsam etwas so Schönes herstellten, jenseits der Musik überhaupt nichts Besonderes waren.
Am Ende der Probe steckten sich die Musiker Zigaretten an, und als sie aufgeraucht hatten, griffen sie zu Jacken, Mänteln, Schals und Mützen, während der Schlagzeuger eine Schaumgummimatratze ausrollte und Anstalten machte, im Keller zu übernachten. Weil ich verwundert guckte, sagte er: »Hast du vielleicht nen Probenraum zum Abschließen? Unsern kriegt man in zwei Minuten auf.« Er blickte sich um: Schlagzeug, Keyboard, Gitarren, Verstärker, Kabel und Boxen. »Wär schade drum.«
Die Kellertür war ein aus Latten gezimmertes Teil, mehr Lücken als Holz; sozusagen eine »symbolische« Tür. Eine Decke verhängte den Blick nach innen.
»Ich denk mal nach«, sagte ich, aber ich wusste, dass ich nicht helfen konnte. Die Bandmitglieder gingen, einer nach dem anderen, und ließen uns beide zurück. Über dem Lichtschalter stand: »When the music is over, turn out the light!«
Aus Verlegenheit widmete ich mich einer herabhängenden Ecke der Decke, um sie wieder an ihrem Nagel zu befestigen. Micha sagte: »Du bist son Ordentlicher, wa?« Und dann fragte er mich unvermittelt: »Kannst du mit Geld umgehen? Siehst nämlich so aus.«
Ich wusste weder, was »mit Geld umgehen können« bedeutet noch wie jemand aussieht, der mit Geld umgehen kann. »Wie meinstn das?«, fragte ich.
»Wir suchen noch unseren Brian Epstein.«
Vor zwei Stunden wurde ich gefragt, ob ich Mundharmonika spiele, jetzt, ob ich Manager werden will. Mein Weg schien unausweichlich in die Musikszene zu führen.
»Habt ihr eigentlich nen Namen?«, fragte ich.
»Und ob.« Er machte es spannend, sagte dann aber mit maximaler Beiläufigkeit »Die Seuche« und überließ es mir, sich auszumalen, was es bedeutet, eine Band namens Die Seuche zu managen. Ich hörte mich schon in Kulturhäusern anrufen: »Wollt ihr Die Seuche haben?« Oder: »Ich hab Die Seuche, und die war noch nie in Zwickau. Kommen wir ins Geschäft?« Ich stellte mir ihre erste Platte vor – »AUSBRUCH!« Die Seuche war wirklich ein geiler Bandname.
Ich arbeitete damals als Portier im Hotel Metropol, und als ich am nächsten Tag sah, wie im Keller eine Metalltür ausgewechselt wurde, trug ich die alte Tür nach Feierabend einfach weg. Einfach im Sinne von einfach niemanden vorher fragen; das Wegtragen der Tür war das Gegenteil von einfach. Nach hundert Metern merkte ich, dass ich mir zu viel zugetraut hatte, stellte die Tür an eine Hauswand und vertraute darauf, dass sie in einer halben Stunde noch dastehen würde. Ich lief zum Probenraum, wo ich um zehn vor fünf nur Micha und den Keyboarder traf, die eine rauchten. Micha begrüßte mich mit »Hi Äppstiehn!« Als ich von einer »Panzertür« sprach, sagte der Keyboarder, er könne das mit seinem Barkas erledigen, und wir beide gingen los.
Der Keyboarder hieß Sebastian, und den Barkas hatte er, weil er Kurierfahrer für den Magistrat war. »Du wirst unser Manager?«, sagte er, als er den Wagen startete. »Find ich gut.«
Die Tür war noch da. Sebastian fuhr rückwärts an die Hauswand, und als wir die Tür in den Barkas wuchten wollten, tropfte auf einmal Blut aus seiner Nase. Sebastian legte den Kopf in den Nacken und sagte leise »Scheiße, Scheiße, Scheiße«, immer wieder »Scheiße, Scheiße, Scheiße«.
Das Nasenbluten hörte zwar auf, doch die Tür musste ich allein in den Wagen hieven. »Das Ding wolltest du bis in den Probenkeller schleppen?«, sagte Sebastian, als er den Wagen startete. »Bist du Popeye? Oder Obelix?«
Die Tür knirschte bei jeder Positionsveränderung, und bei der Fahrt über das Kopfsteinpflaster machte sie einen Lärm, dass ich glaubte, gleich werde der Boden durchbrechen. Ich war ständig Zeuge, wenn nicht sogar Beteiligter, wenn Dinge kaputtgingen. Am Morgen erst war mir beim Einfüllen von heißem Tee ein Saftkrug gesprungen, und als ich auf der Arbeit etwas zu unterschreiben hatte, hielt ich, nachdem ich auf den Kuli gedrückt hatte, seine Einzelteile in der Hand. Als ich in der letzten Woche meinen Briefkasten öffnen wollte und der klemmte, griff ich durch den Briefschlitz, um die Tür aufzuziehen – doch stattdessen riss ich die gesamte Briefkasten-Zeile aus der Wand, weil die Latte, auf die die Briefkästen geschraubt waren, nur lose im Putz verdübelt war. Es gab einen Heidenlärm, als das Blech zu Boden krachte. Ein ähnliches Geräusch erwartete ich auch auf der Fahrt im Barkas, wenn die Stahltür durch den Boden brechen würde und aufs Pflaster fällt. Doch der Boden hielt bis zum Probenkeller. Sebastian sagte: »Den Einbau macht Rainer, der ist tagsüber Hausmeister.«
»Die Hausmeister, die ich kenne, erzählen mir immer, was sie alles nicht können«, sagte ich. »Und die können garantiert auch keine Tür einbauen.« Die Briefkästen standen seit dem Tag, als ich sie aus der Wand riss, auf dem Boden des Hausflurs. Einmal begegnete ich der Briefträgerin bei ihrer Arbeit; es sah aus, als würde sie einen Dackel füttern.
»Rainer ist da nicht anders«, sagte Sebastian. »Der geht nur ans Telefon, wenn du es zweimal klingeln lässt, dann auflegst und gleich wieder anrufst.«
Ich fragte mich, warum so umständlich?, und Sebastian schien meinen Gedanken zu erraten: »Um die Anrufer auszusortieren, die wegen dem üblichen Hausmeisterkram anrufen, verstopftes Scheißhaus und so.«
Der Rest der Band war inzwischen da, Micha kam uns entgegen, und als ich mit ihm die Tür runtertrug, angeführt von Sebastian, kam ich mir vor, als ob ich gerade ein schräges Ritual absolviere, das mich zu einem Bandmitglied macht. »Ne echte Panzertür«, sagte Micha. »Hat Äppstiehn organisiert.«
Nachdem ich noch ein-, zweimal Äppstiehn genannt wurde und nicht protestierte, war der Name durchgesetzt, und niemand fragte mich nach meinem tatsächlichen Namen. Und wenn sie mich schon Äppstiehn nannten, dann konnte ich auch ihr Manager sein. Vermutlich wollten sie es so. Warum sonst sollten sie mich Äppstiehn nennen?
Bei der nächsten Probe war die neue Tür schon eingesetzt, und obwohl der Mörtel noch frisch war, konnte Die Seuche etwas machen, was sie sonst nie nach der Probe tat, nämlich in die Kneipe gehen. Wenn alle in der Kneipe sitzen und einer die Instrumente hütet, glaubt der, dass jetzt sein Rausschmiss beschlossen wird. Eine Band kann nur geschlossen in die Kneipe gehen, lernte ich.
Kneipen waren nie mein Ding, weil ich so trinkfest war wie ein Achtjähriger. Bevor ich am späteren Abend volltrunken unter den Tisch rutschen würde, wollte ich zuvor noch mit etwas punkten und brachte mein Faible für Schleichwege ins Spiel, indem ich Die Seuche über Hinterhöfe in die Pieck zur »Torquelle« führte, wofür ich als »Wesen mit karthographischen Neigungen« bespöttelt wurde. Über Details, die ich mir ersparen will, landete Die Seuche bei der Frage nach der Entstehung von Maulwurfshügeln. Sie war sich darin einig, es mit einem Rätsel, wenn nicht sogar mit einem Mysterium zu tun zu haben: Da Maulwürfe die Erde nicht vor sich herschieben können, »denn da ist ja schon Erde, und wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein, hatten wir in Physik« (»Da hatten wir in Bio aber genau das Gegenteil!«), müssen sie die Erde wohl hinter sich lassen – und würden damit den Gang, den sie eben erst gebuddelt haben, gleich wieder zuschütten, anstatt oberirdisch einen Maulwurfshügel zu errichten. »Vielleicht sind es ja zwei Maulwürfe?«, sagte die Sängerin und »Warum nicht gleich ne Band?« der Gitarrist. Bis zur »Torquelle« wurde das Rätsel nicht gelöst.
In der Kneipe waren kaum Leute, und als die erste Runde Bier kam, sagte André: »So, jetzt können wir ja auspacken mit unseren Erlebnissen in den Kellernächten. Ich hab meine Geschichten schön für mich behalten.«
»Was denn für Geschichten?«, fragte Sebastian. »Gib mal ein Beispiel.«
»Einmal bin ich eingepennt, die Taschenlampe ist mir weggerollt, und wie ich aufwache, denke ich, eh, hat hier die Wildschweinsaison begonnen? Da rennen ja Frischlinge durch den Keller! Jäger, stoß ins Horn! Waren aber bloß die Schatten von den Ratten.«
Kein Wort davon ist wahr, dachte ich.