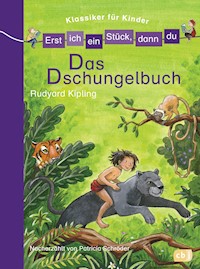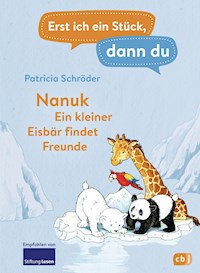5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Beste Freundin, blöde Kuh
- Sprache: Deutsch
Miri ist angenervt von ihrer neuen Freundin Junia, die alles besser weiß. Außerdem hat sie Stress mit Cobi, der urplötzlich mit einer anderen rumhängt. Wie soll Miri das nur aushalten? Als ihre Mutter einen Schulwechsel organisiert, brennen bei Miri sämtliche Sicherungen durch. Sie haut ab - und merkt, wie sehr sie ihre ex-beste Freundin Joey immer noch vermisst. Ob die beiden noch eine letzte Chance bekommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Patricia Schröder
Beste Freundin, blöde Kuh!
Eine wie keine
Patricia Schröder, 1960 geboren, lebt mit Mann, zwei Kindern und einer Handvoll Tieren an der Nordsee. Sie studierte Produktdesign und arbeitet seit einigen Jahren als freie Autorin. Zuerst schrieb sie satirische Beiträge für den Funk, später Texte für Anthologien, bevor sie ihre Liebe fürs Kinder- und Jugendbuch entdeckte. Inzwischen sind bereits viele Kinder- und Jugendromane bei Arena veröffentlicht. Mehr über die Autorin unter www.patricia-schroeder.de.
Veröffentlicht als E-Book 2010 © Arena Verlag GmbH, Würzburg 2007 Alle Rechte vorbehalten Einbandillustration: Kirsten Straßmann Vignetten: Betina Gotzen-Beek ISBN 978-3-401-80102-5
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 1
Puh! So eine Hitze!«, stöhnt Joey und schaut mich mit tränenerfüllten Augen an. »Das hält ja kein Mensch aus.« Ich liege neben ihr in der prallen Sonne auf dem Asphalt und rühre mit den Händen in einer Pfütze herum. »Die Brühe hier ist auch schon pisswarm«, murmele ich voller Unbehagen und sehe aus den Augenwinkeln, wie sich Joeys Gesicht zu einer verzweifelten Fratze verzerrt. Plötzlich fängt sie richtig an zu heulen. »Du bist schuld!«, schreit sie, bäumt sich einmal auf und lässt ihr Gesicht anschließend in die Pfütze sinken. Vollkommen reglos liegt sie da, lang ausgestreckt und ihre dunklen Haare schwimmen auf dem Wasser. Daneben steigen kleine Blubberblasen auf. »Joey, nein!«, rufe ich. »Du darfst das nicht tun!« »Hey«, ertönt eine sanfte Stimme neben mir. Ich spüre eine warme Hand auf meiner Schulter und springe auf. »W-wo bin ich?«, stammele ich. »W-was ist mit Joey?« »Keine Ahnung«, sagt die Stimme. Völlig perplex starre ich ihn Junias Gesicht, das vom fahlen Licht, welches der Mond in mein Zimmerfenster wirft, nur schwach beleuchtet ist. »Was machst du hier?«, frage ich verwundert. »Ich war aufm Klo«, erwidert Junia. »Da hab ich dich reden gehört.« »Hä?«, mache ich. »Du hast unten bei euch aufm Klo gehört, wie ich hier oben in meinem Zimmer rede?« »Nein, ich war bei euch, weil Mama . . .« Junia verdreht die Augen. »Muss ich dir das so haargenau erklären?« Ich schüttele den Kopf. »Willst du dich zu mir legen?«, frage ich. Junia grinst. »Klar«, sagt sie, schlüpft unter meine Decke und kuschelt sich an mich. »Du hast von Joey geträumt«, sagt sie. »Muss irgendwas Schreckliches gewesen sein.« »Allerdings«, sage ich und seufze leise. »Sie wollte sich in einer Pfütze ertränken.« »Nee, ne?« »Doch. Sie hat einfach ihr Gesicht hineinfallen lassen: Irgendwann wäre sie tot gewesen.« »Glaubst du ehrlich, dass sie sich was antut?«, fragt Junia leise. »Weiß nicht«, murmele ich und drücke meine neue Schwesterfreundin an mich. Nachdem meine Eltern sich getrennt haben, sind Mama und ich zu ihrer Freundin Sabine und deren Tochter Junia ins Haus gezogen. Anfangs konnte ich Junia überhaupt nicht ausstehen. Eine Zeit lang dachte ich sogar, dass sie mir Cobi ausspannen will. Die beiden gehen nämlich in dieselbe Schule und mögen sich total gern. Irgendjemand hat das gewusst und mir heimlich Briefchen zugesteckt, in denen stand, dass Cobi mich betrügt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich rausbekommen habe, dass meine ehemals beste Freundin Joana Baske dahintersteckte. Sie ist nämlich auch in Cobi verliebt. Genau genommen, ist daran unsere Freundschaft zerbrochen. Ich habe zwar noch eine ganze Weile versucht, alles zu retten, ich wollte für Joey sogar auf Cobi verzichten, aber sie hat sich total zickig aufgeführt und so getan, als ob ich das schlimmste Verbrechen der Welt begangen hätte. Doch allmählich ist Joey wohl klar geworden, dass Cobi nur mich mag und sie sowieso keine Chance bei ihm hat. Als ich mich dann auch noch mit Junia angefreundet habe, sind bei ihr sämtliche Sicherungen durchgeknallt und sie hat mir diese Briefchen geschrieben, um uns alle auseinanderzubringen. Das ist zumindest Doreens Überzeugung. Doreen geht in meine Klasse und ist ebenfalls eine Freundin von mir. Sie ist die treueste Seele, die man sich nur vorstellen kann, aber irgendwie habe ich bisher einfach kein Beste-Freundin-Gefühl für sie entwickeln können. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, und manchmal plagt mich deswegen auch das schlechte Gewissen. Junia meint ja, dass ich nichts dafür kann und es völlig ausreicht, wenn ich Doreen mag und zu ihr stehe und all das, aber mir ist irgendwie unwohl bei der Sache und deshalb hoffe ich, dass ich niemals in eine Situation gerate, in der ich mich zwischen Junia und Doreen entscheiden muss. »Na ja, ich kenn Joey ja nicht«, meint Junia nachdenklich. »Und bloß von ein-oder zweimal sehen kann man schließlich nicht einen ganzen Menschen beurteilen.« »Aber du hast dir trotzdem eine Meinung gebildet?«, glaube ich, aus ihrer Formulierung herauszuhören. »Hm, also nicht direkt«, druckst Junia herum. »Allerdings glaube ich, dass Joey zu allem fähig ist.« »Sogar sich umzubringen?«, frage ich entsetzt. »Juni, wenn sie das tut, werde ich meines Lebens nicht mehr froh.« »Ach Miri, das ist doch alles Quatsch«, versucht Junia, mich aufzumuntern. »Es gehört schon eine ganze Menge Unglück dazu, bis jemand so weit ist, dass er sich das Leben nimmt. Ich hätte jedenfalls einen Riesenschiss davor. Nein, nein«, fährt sie mit Bestimmtheit fort. »Ich glaube, dass Joey auch zu großer Treue und Freundschaft fähig ist.« »Danke«, sage ich und drücke ihr einen Kuss auf die Wange. »Du bist wirklich die beste Schwesternfreundin auf der ganzen Welt. Dass du so etwas über Joey sagst!« »Wieso denn nicht?«, erwidert Junia. »Sie hat mir doch nichts getan.« Das stimmt. Junia hat nur mitbekommen, dass Joey ziemlich zickig sein kann, die Gemeinheiten, die sie sich mir gegenüber geleistet hat, kennt Junia jedoch nur vom Erzählen. Und anders als Doreen ist sie nicht so krass und endgültig in ihrem Urteil. Doreen kann Joey inzwischen nicht mehr ausstehen, was das Ganze für mich nicht unbedingt leichter macht. Denn Tatsache ist, dass Joey mir trotz allem einfach nicht aus dem Kopf geht. Erstens sehe ich sie jeden Tag in der Schule und zweitens denke ich immer noch sehr oft an früher, als wir noch Haus an Haus in der Knippgartenstraße wohnten, wo unsere Betten in dieselbe Richtung zeigten. Damals besaßen wir haargenau die gleichen Klamotten, Bücher, Schreibtischlampen und Bambusrollos und schwärmten beide für Take That. Auch jetzt besitzen wir immer noch jede ein braunes Rosettenmeerschweinchen. Sie heißen Angelo und sehen einander zum Verwechseln ähnlich. Das heißt, eigentlich weiß ich nicht so genau, ob Joey ihren Angelo immer noch hat. Vor einigen Wochen hat sie versucht, ihn zu verkaufen. Natürlich nur, um mir wehzutun. Zum Glück wollte ihn keiner haben. Und als Joey dann gemerkt hat, dass ich auch ohne sie glücklich bin, hat sie auf unserer Einweihungsparty die große Heulund Versöhnungsnummer abgezogen und versucht, mir ihren Angelo zu schenken. Doch das habe ich abgelehnt und ihr richtig den Marsch geblasen, was einerseits ziemlich gutgetan hat, andererseits aber mein Herz immer noch ganz schön schwer macht. – Seufz. »He«, wispert Junia in mein Ohr. »Was ist los?« »Wieso?« »Weil du nichts sagst.« »Ach so ...Naja, du hältst mich bestimmt für total bescheuert«, murmele ich. »Aber ich glaube, irgendwie mag ich Joey immer noch. Zumindest ein bisschen.« »Klar, magst du sie noch«, sagt Junia zu meiner großen Überraschung. »Wie kommst du denn darauf?«, rufe ich. Junia grinst. »Na, ist doch wohl logisch.« »Gar nicht«, sage ich. »Aber hallo«, entgegnet Junia und kichert leise. »Du bist nämlich die allergrößte Immerundewigmögerin, die ich jemals getroffen habe.« »Und du...«, sage ich, ...du bist die riesengrößte Fürallesundjedeneinherzhaberin, die ich kenne.« Ich sehe in Junias große funkelnde Augen und plötzlich könnte ich losquieken vor Glück. »Mann, bin ich froh, dass ich dich kennengelernt habe!«, stoße ich hervor und werfe meine Arme um sie. »Und ich erst«, sagt Junia leise, während sie mich sanft an sich drückt.
Als ich am nächsten Morgen die Augen aufschlage, ist Junia verschwunden. Gähnend sehe ich zum Fenster hinüber. Die Blätter des Ahornbaums sind bereits rotbraun gefärbt. Aber der Himmel leuchtet strahlend blau durch die Zweige. Die Sonne scheint und die Herbstferien stehen vor der Tür. Apropos Ferien! Mit einem Ruck schlage ich die Bettdecke zurück und stürze nach unten in Sabines und Junias Küche, wo wir meistens zusammen frühstücken. »Wie spät ist es?«, frage ich. »Zu spät«, sagt meine Mutter, die im Bademantel am Tisch sitzt. Sie deutet auf ihre Tasse. »Hast du noch einen Schluck Kaffee für mich, Sabine?« »Aber natürlich.« Junias Mutter, die dunkelblonde Haare und ebenso große nussbraune Augen wie ihre Tochter hat, beugt sich zur Anrichte hinüber und angelt nach der Kaffeekanne. »Wieso zu spät?«, frage ich erschrocken. Mama zuckt die Schultern. »Ich nehme an, weil du verschlafen hast.« Verschlafen? – »Und wieso hat mich keiner geweckt?«, rufe ich empört. »Mamaaa!« »Ja, hier«, sagt meine Mutter gelassen. Sie nimmt Sabine den Becher ab und zwinkert mir zu. Verdattert schaue ich von einer zur anderen, schließlich zwicke ich mich in den Arm, um ganz sicher zu sein, dass ich nicht schon wieder träume. »Aber ich muss zur Schule!«, rufe ich. Meine Mutter nickt. »Das sollst du ja auch. Aber jetzt setzt du dich erst einmal hin und frühstückst richtig.« Sie schenkt mir frisch gepressten Orangensaft ein und deutet auf die Müslipackung. »Das oder lieber einen Toast?«
»Wie spät ist es denn nun?«, frage ich, während ich mich auf meinen Stuhl plumpsen lasse. »Und wo ist Junia?« Sabine, die bereits fix und fertig angezogen ist, wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Es ist jetzt genau acht Uhr dreiundzwanzig«, verkündet sie und strahlt mich fröhlich an. »Und Junia ist natürlich längst in der Schule.« »Ach ja?«, blöke ich los und springe gleich wieder auf. »Ich glaube, euch hat heute Nacht ein Vampir gebissen!« »Wohl kaum«, meint Mama und rührt ein wenig Zucker in ihren Kaffee. »Oder hast du schon mal einen Menschen, der zum Vampir geworden ist, im hellen Sonnenschein am Frühstückstisch sitzen sehen?«, erkundigt sie sich bei Sabine. »Nein«, meint Junias Mutter kopfschüttelnd. Sie streicht ihre Haare zurück und betastet ihren Hals. »Bisswunden habe ich auch keine. – Du?« »Och, ihr seid blöd!«, fauche ich. »Dann gehe ich heute eben gar nicht in die Schule. Und du, Mama, schreibst mir eine Entschuldigung.« »Kommt überhaupt nicht infrage«, sagt meine Mutter streng. Oh Mann! Mama war ja schon immer ein bisschen launisch, aber einen solch rasanten Stimmungswechsel habe ich bei ihr bisher noch nicht erlebt. »Aber die ersten beiden Stunden verpasse ich doch sowieso«, starte ich einen letzten Versuch.
»Hm«, macht sie und tauscht einen nachdenklichen Blick mit ihrer Freundin Sabine. »Tut sie das?« Sabine kräuselt die Lippen. »Nö«, meint sie schließlich. »Ich glaube nicht.« »Ach du!«, rufe ich. »Du hast doch überhaupt keinen Einblick in meine Unterrichtsstunden.« »Doch«, erwidert sie und deutet zum Kühlschrank, an dessen Tür sowohl Junias als auch mein Stundenplan prangen. »Gewissermaßen schon.« »Na dann«, sage ich, springe abermals auf, hechte zum Kühlschrank und tippe auf den Dienstag, »dann siehst du es ja schwarz auf weiß: erste Stunde Englisch, zweite Biologie.« »Jaha«, sagt Sabine. »Auf deinem Gymnasium schon. Auf der Hegelgesamtschule hast du die ersten beiden Stunden frei. Allerdings nur du und auch nur heute.« Wie bitte? Was? Ich glaub, ich hab’n Knick im Trommelfell! Oder warum verstehe ich sonst immer Hegelschule? »Wir fanden es nämlich ziemlich blöd, dass Junia und du immer zu so unterschiedlichen Zeiten hier seid«, sagt Mama. »...und wir nur dreimal in der Woche zusammen zu Mittag essen können«, fährt Sabine fort. »Außerdem wünscht Junia sich so sehr, dass du in ihre Klasse kommst«, fügt meine Mutter hinzu. »Und Cobi ist bestimmt auch nicht böse, wenn du auf dieselbe Schule gehst wie er.« »Aber . . .«, stammele ich und gucke völlig perplex von einer zur anderen. »Seid ihr eigentlich vollkommen wahnsinnig geworden?« »Nö«, sagt Mama, »zumindest nicht vollkommen.« »Höchstens ein bisschen«, meint Sabine. Und während die beiden Damen sich einen abschmunzeln, kriege ich allmählich die Krise. »Wie könnt ihr einfach so etwas entscheiden, ohne mich zu fragen?«, brülle ich. »Haben wir nicht«, behauptet meine Mutter. »Das wüsst ich aber«, stoße ich hervor. »Moment mal«, sagt sie, hebt ihr butterbeschmiertes Messer und guckt mich aus ernsten Augen an. »Gefragt haben wir dich zugegebenermaßen nicht«, gesteht sie mir schließlich zu. »Aber wir haben auch nichts entschieden. Genau das sollst du nämlich selber tun.« »A-ber . . .«, stottere ich, doch Sabine lässt mich gar nicht mehr zu Wort kommen. »Und weil du dich ohne Frage und ohne groß zu überlegen«, betont sie, »gegen einen Schulwechsel aussprechen würdest, haben deine Mutter und ich beschlossen, dass du dir vor deiner Entscheidung Junias Schule erst einmal ansiehst.« »Aha«, sage ich so langsam kapierend, worauf sie hinauswill. »Und das mache ich dann also heute von der dritten bis zur sechsten Stunde.« »Nicht nur heute«, eröffnet Mama mir mit einem gnädigen, aber dennoch bestimmten Lächeln, »sondern für den ganzen Rest der Woche.«
Natürlich ist Doreen, die ich kurz nach der zweiten Stunde auf dem Handy erwische, alles andere als begeistert. »Du willst die Schule wechseln?«, brüllt sie mich an. »Bist du verrückt?« »Nein«, sage ich nüchtern, denn schließlich war es nicht meine Idee, aber das scheint für Doreen keine Rolle zu spielen. »Wenn du das machst . . .«, stößt sie hervor. »Was dann?« »Dann . . . dann . . . dann . . .«, stammelt Doreen. Ihre Stimme klingt schrecklich weinerlich. ». . . sehe ich dich bestimmt nie wieder«, stößt sie schließlich leise hervor. »So ein Quatsch«, sage ich. »Wir sind doch Freundinnen. Außerdem hast du noch Saskia.« »Das ist nicht das Gleiche«, schnieft Doreen. »Jetzt heul nicht gleich«, sage ich. »Ich hab mich doch noch gar nicht entschieden.« »Ach«, sagt Doreen. Dann ist sie weg, hat einfach die Verbindung gekappt. Verwundert starre ich auf den Telefonhörer. So kenne ich Doreen gar nicht. Nicht, dass sie nicht aufbrausend sein könnte, doch, doch, das kann sie weiß Gott. Doreen kann sich sogar ganz furchtbar aufregen und schrecklich unüberlegte Dinge tun. Nein, ich hätte nur einfach nicht gedacht, dass meine Neuigkeiten sie dermaßen umhauen und sie gleich zu weinen anfängt. Nachdenklich stecke ich das Funkteil in die Ladestation zurück.
»Los, Miriam«, reißt meine Mutter mich aus der Welt der Träume. »Beeil dich bitte ein bisschen.« »Ach, auf einmal«, brumme ich und ziehe meine Sneakers unter dem Schuhschrank hervor. »Jetzt tu nicht so, du weißt genau, wie spät es ist«, erwidert sie ungerührt. »Nicht ich wollte dieses Experiment, sondern Sabine und du haben es angeleiert«, stelle ich klar, während ich in meine Jacke schlüpfe. »Dabei weiß ich jetzt schon, wie ich mich entscheiden werde.« »Tatsächlich«, sagt Mama halbwegs belustigt, halbwegs genervt. »Ja, allein schon wegen Doreen muss ich auf meinem alten Gymmi bleiben.« »Das ist nicht dein Ernst«, sagt meine Mutter, öffnet die Haustür und lässt mich zuerst hinaustreten. Ihr Blick fällt auf meine Sneakers. »Willst du dir nicht die Schnürsenkel zubinden?« »Nein«, sage ich, wende mich ab und laufe zielstrebig auf das Tor zu. »Und wenn du stolperst?« Dann stolpere ich eben, denke ich und sage: »Dann fall ich eben hin. Pech gehabt.« »Herrgott noch mal, Miriam, was ist denn los mit dir?« Meine Mutter hat mich inzwischen eingeholt und hält mich jetzt an der Schulter fest. »Bindest du dir jetzt bitte die Schuhe zu«, sagt sie, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Von mir aus«, murre ich. »Aber wenn wir zu spät kommen, ist es deine Schuld.« Mama stöhnt leise. Ich stelle meine Tasche ab und zerre an den Schuhbändern herum. »Was habe ich dir getan?«, will meine Mutter wissen. »Nichts.« Außer, dass sie mich seit dem Aufstehen wie ein kleines Kind behandelt. Aber das würde sie wahrscheinlich rundweg abstreiten und so erspare ich mir einen entsprechenden Kommentar. »Und warum hast du dann so eine extrem miese Laune?«, bohrt sie weiter. »Einfach so«, sage ich, ziehe die Schnürsenkel noch einmal richtig stramm, schnappe mir meine Tasche und laufe weiter. Meine Mutter seufzt und eilt mir hinterher, hält jetzt aber zum Glück ihren Mund, sodass ich in Ruhe weiter über Doreen nachgrübeln kann. Doch blöderweise schweifen meine Gedanken immer wieder ab und ich sehe Joey vor mir. Joey, wie sie lacht. Joey, wie sie zickt. Joey. Joey. Joey. Und als nach einer knappen Viertelstunde Fußweg das Gebäude der Hegelschule vor uns auftaucht, ist mir eines so klar wie nur was: Nicht Doreen hält mich davon ab, die Schule zu wechseln, sondern Joey. Verdammt, verdammt! Aber die Wahrheit ist doch: Mit Doreen kann ich mich auch nachmittags und am Wochenende treffen, so oft und so lange ich will. Joey jedoch werde ich dann womöglich nie mehr wiedersehen. Allein schon der Gedanke daran treibt mir die Tränen in die Augen. Und das wiederum ist mir so peinlich, dass ich am liebsten auf der Stelle kehrtmachen und mich in den einsamsten Winkel der Stadt verkriechen würde. »So«, sagt meine Mutter. »Da wären wir. Und behaupte bloß nicht, dass das Schulgelände hässlich ist.« Nein, das werde ich ganz sicher nicht tun. Und zwar einfach deshalb, weil es schlicht und ergreifend eine Lüge wäre. Die Hegelgesamtschule ist nämlich ein richtiges Schmuckstück. Sie besteht aus einem alten Haupt-und drei modernen Nebengebäuden, die in einem hügeligen Gelände verteilt und von viel Grün umgeben sind. Daneben gibt es einen großen Rasenplatz mit Fußballtoren, eine Tischtennisecke, einen Teich mit Brücke, eine Riesenschaukel und viele verwinkelte Ecken, in die man sich zurückziehen kann. »Da hat die Pausenaufsicht ja gar keinen Überblick«, brumme ich eher zufrieden darüber, doch noch etwas Negatives gefunden zu haben. »Wenn ich also demnächst von ein paar gemeinen Zehntklässlern überfallen, vergewaltigt und zum Drogenmissbrauch gezwungen werde, ist das ganz allein deine Schuld.« »Okay«, sagt Mama fröhlich. »Ich werde mir gleich heute Nachmittag im Copy-Shop ein T-Shirt mit dem Schriftzug Ich bin schuld bedrucken lassen. Und das trage ich dann so oft du willst.« »Du bist blöd«, sage ich und ziehe vorsichtshalber den Kopf ein.
Doch sie beachtet meine Beleidigung überhaupt nicht, sondern ruft: »Guck mal, dahinten ist Junia!«, und fängt sofort wie eine Geisteskranke an zu winken. Junia winkt zurück und kommt freudestrahlend auf uns zugelaufen. »Hey«, sagt sie und zwickt mich zur Begrüßung in die Seite. »Gib’s zu, du hast es gewusst«, zische ich ihr ins Ohr. »Ja, tue ich«, sagt sie. »Vielen Dank für deine Verschwiegenheit«, brumme ich. »Och, nix zu danken«, meint Junia und grinst frech. In diesem Moment entdecke ich Cobi, der mit einem Ball unter dem Arm, drei weiteren Typen und zwei Mädchen auf die Fußballwiese zuläuft. »Und er?«, murmele ich. »Hat er es auch gewusst?« »Cobi?« Sie hebt die Schultern. »Keine Ahnung.« »Cobi!«, rufe ich und will zu ihm rüberstürzen, aber meine Mutter hält mich am Arm zurück. »Hier geblieben!«, sagt sie energisch. »Dein erster Weg auf diesem Gelände führt dich ins Sekretariat. Nur deshalb hattest du heute ausnahmsweise die ersten beiden Stunden frei. Und dort wartet dann auch dein neuer Klassenlehrer auf dich.« »Mein neuer Klassenlehrer?«, wiederhole ich. »Du meinst, mein Probeklassenlehrer!« »Von mir aus«, sagt Mama. »Nenn es, wie du magst. Hauptsache, wir kriegen diesen Vormittag einigermaßen stressfrei herum.«
Mein neuer Probeklassenlehrer sieht ziemlich cool aus. Er ist noch sehr jung, allerhöchstens fünfundzwanzig, trägt ein wild gemustertes Hemd und verwaschene Jeans und hat kurze dunkelblonde Haare und kugelrunde Schokoladenaugen. »Hallo Miriam«, begrüßt er mich per Handschlag. »Ich bin Markus Röpke und ich freu mich, dass du dir unsere Schule mal angucken willst.« »Ja«, sage ich und gucke ihn an und spüre, wie mir ganz warm zwischen den Ohren wird. »Junia hat mir gar nichts über Sie erzählt.« »Nun ja«, meint er und grinst verschmitzt, »bewerten wir das mal eher als positiv.« Recht hat er. Gequatscht wird eigentlich immer nur über die blöden Lehrer, allerdings auch über die besonders tollen. Daraus würde resultieren, dass Markus Röpke eher angenehmer Durchschnitt ist und ich mich keinesfalls von seinem Hemd oder seinen Schokoladenaugen irritieren lassen muss. »W-was unterrichten Sie denn?«, stammele ich. »Englisch und Geschichte.« »Oh«, sage ich und denke sofort an Mr Quentin, und dass der nun mal leider der beste Englischlehrer der Welt ist und somit ein Schulwechsel völlig außer Debatte steht. »Ich hoffe, du magst diese Fächer«, meint Herr Röpke augenzwinkernd. »Oh ja, natürlich . . . Eigentlich schon«, sage ich.
Irgendwie komme ich mir unendlich blöde vor und deshalb sehe ich zu meiner Mutter, damit sie checkt, dass sie auch mal was sagen könnte. Aber leider checkt sie es nicht, sondern guckt Herrn Röpke nur an, als ob er die Hypnotisierschlange Kah aus dem Dschungelbuch wäre. »Also, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du zu uns kämst«, meint mein Probeklassenlehrer. Es klingt fast ein wenig sülzig und außerdem guckt er auch mehr meine Mutter dabei an als mich. So ein Blödmann! Fehlt nur noch, dass er sie ebenfalls in seinen Unterricht einlädt. Und siehe da – er tut es tatsächlich. Und was macht Mama? Sie lächelt und nickt und sagt total höflich: »Vielen Dank. Das ist aber nett von Ihnen. Heute habe ich nur leider schon etwas vor. Ein andermal vielleicht.«
Kapitel 2
Warum hast du das gemacht?«, fahre ich meine Mutter an, als wir fünf Minuten später auf dem Weg zu meinem neuen Probeklassenraum sind. »Eltern gehören nicht in die Schulstunde.« »Das sehe ich anders«, entgegnet sie. »Eltern sollten sich auch ein Bild von den Lehrern und ihren Unterrichtsmethoden machen dürfen.« »Meinst du, dass ich davon eine bessere Note bekomme?« »Natürlich nicht«, sagt meine Mutter empört. »Ich möchte dir einfach bei deiner Entscheidung eine Hilfe sein können. Falls du eine brauchst.« »Brauch ich nicht«, brumme ich, während ich meinen Blick über die Bilder und die Glasvitrinen in den Gängen streifen lasse. Im Kunstunterricht scheinen sie zumindest ausgefallenere Sachen zu machen als wir. »Ich will bei Mr Quentin bleiben.« »Ach, Miriam, jetzt sei doch nicht albern«, erwidert Mama. »Im nächsten Jahr hast du ihn sowieso nicht mehr. Dann bekommst du in Englisch und den übrigen Fächern andere Lehrer.«
Das weiß ich selbst, aber bis es so weit ist, dauert es noch fast ein Dreivierteljahr, eine halbe Ewigkeit also. Ich verzichte allerdings darauf, meine Mutter darauf hinzuweisen, in letzter Zeit weiß sie ohnehin alles besser. Zum Glück wartet vor der Klasse bereits Junia auf mich, sodass ich meine Gedanken nicht mehr länger mit diesem unleidigen Thema belasten muss. »Und?«, fragt sie. »Wie findest du ihn, den Markus Röpke.« »Ganz gut«, sage ich vorsichtig. »Ist er eigentlich auch«, sagt sie. »Manchmal allerdings . . .« »Was?«, frage ich. »Ach, na ja«, meint Junia abwinkend. »Er hat halt seine Macken, so wie andere Lehrer auch.« »Und was für welche sind das?«, erkundige ich mich. »Er schleimt sich gerne bei den Müttern ein«, sagt Junia. Das kann ich nur bestätigen, denke ich und gehe an ihr vorbei in den Klassenraum. »Wo sitzt du überhaupt?« Junia zeigt auf die dritte Reihe. »Dort ganz außen.« Aha. »Und daneben?« Sie stupst mir ihren Hüftknochen in die Seite und grinst. »Du natürlich.« »Gut«, sage ich, steuere auf meinen neuen Platz zu und lasse mich auf den Stuhl sinken. »Und wer saß vorher hier?«
»Ich«, sagt eine Stimme hinter mir. Ich drehe mich um, kann aber niemanden entdecken. »Tobi«, sagt Junia. »Allerdings hat er sich mehr unter dem Tisch aufgehalten als darüber.« »Aha«, sage ich. »Und wieso?« »Weil ich später Schuhdesigner werde«, sagt die Stimme. »Wozu soll ich mich da groß mit höherer Gehirnkunst abgeben?« »Vielleicht weil du sonst sitzen bleibst«, sagt Junia genervt. »Im übernächsten Jahr womöglich von der Schule fliegst und dann weder dein Abi noch dein Fachabi machen kannst. Um Designer werden zu können, musst du studieren.« »Ach, Quatsch«, erwidert Tobi unter dem Tisch. »Ich muss gar nichts.« Junia lässt sich neben mich fallen, verschränkt die Arme über der Brust und guckt finster vor sich hin. »Es gibt Sachen, von denen man irgendwann mal bereut, dass man sie versäumt hat«, sagt sie und ich weiß sofort, wen sie meint, nämlich ihren Vater. Der ist an Krebs gestorben, und obwohl Sabine und Junia sich lange genug damit auseinandergesetzt haben, hat Junia immer das Gefühl, vielleicht doch einmal zu wenig mit ihm ins Eisstadion gegangen zu sein oder mit ihm geredet zu haben. »Lass ihn doch«, wispere ich ihr zu. »Nee, tu ich nicht!«, faucht sie mich an. He, Moment mal, was soll das? Ich habe ihr doch gar nichts getan! Und plötzlich klickert es in meinen Gehirnzellen. »Kann es sein, dass du ihn magst?«, frage ich leise. »Quatsch, wieso?« »Ich mein ja nur . . .«, sage ich und sehe sie erwartungsvoll an. »Dann mein mal schön«, sagt Junia. »Klar, mag sie mich«, sagt Tobis Stimme plötzlich direkt neben meinem Knie. Ich fahre zusammen. »Sag mal, spinnst du!« »Nee, ich such was«, erwidert er und schiebt seine Hand nacheinander in die Ablagen unter Junias und meinem Tisch. »Und was?«, frage ich, während ich auf seine glatten schwarzen Haare starre.