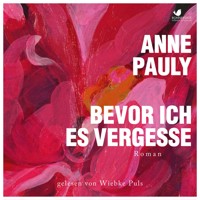17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Lieblingsbuch des französischen Buchhandels - ausgezeichnet mit dem französischen Publikumspreis als »Bestes Buch des Jahres«. Eine warmherzige Vater-Tochter-Geschichte über das Abschiednehmen und den Versuch einer späten Versöhnung. »Wunderschön.« Le Monde des livres
»Die Reusen einholen« - das wären die Worte ihres Vaters gewesen, denkt Anne, als sie im Krankenhaus von Poissy steht und mit ihrem Bruder die Habseligkeiten des Verstorbenen zusammenpackt. Während sie sich um die Formalitäten kümmert, die Beerdigung organisiert, das Elternhaus ausräumt, muss sie sich den widersprüchlichen Gefühlen stellen, die sie mit ihrem Vater verbindet. Diesem zwiespältigen und scheinbar unbezwingbaren Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, ein Autodidakt war, auf seine Art ein Punk, ein leidenschaftlicher Anhänger orientalischer Philosophien, aber auch ein Alkoholiker und gewalttätiger Mann, der seine Familie in einen ständigen »Bürgerkrieg« verwickelt hat. Erst als ein Brief von einer Jugendfreundin des Vaters eintrifft, beginnt sie zu verstehen, wie zerbrechlich sein Leben in Wahrheit war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Ähnliche
Zum Buch
»Anne Pauly erzählt von einem Leben, das fortgeflogen ist wie ein Vogel.« Annie Ernaux
Eine warmherzige Vater-Tochter-Geschichte über das Abschiednehmen und den Versuch einer späten Versöhnung. »Wunderschön.« Le Monde des livres
»Die Reusen einholen« – das wären die Worte ihres Vaters gewesen, denkt Anne, als sie im Krankenhaus von Poissy steht und mit ihrem Bruder die Habseligkeiten des Verstorbenen zusammenpackt. Während sie sich um die Formalitäten kümmert, die Beerdigung organisiert, das Elternhaus ausräumt, muss sie sich den widersprüchlichen Gefühlen stellen, die sie mit ihrem Vater verbindet. Diesem zwiespältigen und scheinbar unbezwingbaren Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, ein Autodidakt war, auf seine Art ein Punk, ein leidenschaftlicher Anhänger orientalischer Philosophien, aber auch ein Alkoholiker und gewalttätiger Mann, der seine Familie in einen ständigen »Bürgerkrieg« verwickelt hat. Erst als ein Brief von einer Jugendfreundin des Vaters eintrifft, beginnt sie zu verstehen, wie zerbrechlich sein Leben in Wahrheit war.
Zur Autorin
Anne Pauly, 1974 geboren, ist Schriftstellerin und Journalistin. Ihr Debüt »Bevor ich es vergesse« war für alle wichtigen literarischen Preise in Frankreich nominiert und wurde mit dem Prix du Livre Inter als »Bestes Buch des Jahres« ausgezeichnet.
Amelie Thoma übersetzt Literatur aus dem Französischen und Italienischen, u. a. Texte von Leïla Slimani, Marc Levy, Joël Dicker, Françoise Sagan und Simone de Beauvoir.
Anne Pauly
Bevor ich es vergesse
Roman
Aus dem Französischen von Amelie Thoma
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Avant que j’oublie«
bei Éditions Verdier, Paris & Lagrasse.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019 Éditions Verdier
Copyright © der deutschen Ausgabe 2024
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © Deborah Jane Barton / Bridgeman Images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-27550-1V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
An dem Abend, als mein Vater starb, fanden mein Bruder und ich uns im Auto wieder, weil es spät war, fast elf Uhr, und weil es nichts anderes mehr zu tun gab, als heimzufahren, nach dem ersten Schock, nachdem wir den bitteren Tee der Krankenschwester getrunken und widerwillig die Zuckerstückchen geschluckt hatten, die sie uns gab, damit wir es verkraften. Letztendlich, mit oder ohne Zucker, hatten wir es ganz gut verkraftet, ganz schön gut sogar, verrückt, eigentlich, wie gut wir es verkrafteten, unglaublich, wenn mir das einer gesagt hätte. Wir hatten die Schränke ausgeräumt, die Beinprothese, die beigefarbene Weste, die T-Shirts und Unterhosen in zwei große Leclerc-Tüten gepackt, die grüne Fleecedecke voller Suppen- und Blutflecken zusammengefaltet, das Taschenkruzifix, das mit einem Schnürsenkel an ein Medaillon der Heiligen Jungfrau Maria, an eine tibetanische Gebetskette und einen kleinen Buddha aus Horn geknotet war, in die Medikamentenschachtel gestopft – eine mit kleinen Bretonen in traditionellen Kostümen bemalte Zuckerdose.
Aus dem Nachttisch hatten wir Senftütchen geholt, ein Aprikosenkompott, eine Schachtel Hit-Kekse, wird schon wieder, eine Plastikpinzette, einen Wochenspeiseplan auf dem er versucht hatte, irgendetwas zu notieren, Kreuzworträtsel der Schwierigkeitsstufe 4, seine kleine Bibel, eine Haiku-Sammlung, sein Buch über Gandhi, sein abgeschabtes bordeauxrotes Kunstlederbrillenetui, drei Druckbleistifte, einer davon uralt, einen Radierer, acht bunte Haushaltsgummis, eine zusammengeflickte Brille, zwei Asthmasprays, zwei Küchenrollen, sein Portemonnaie und das Karteikärtchen, auf dem er seine Krankenhausbuchhaltung führte (Fernseher, Zimmer 18 €, 70 €, Telefon 12 €, Anne Geldautomat 60 €). Im Bad hatte ich mit präzisen Gesten den elektrischen Rasierer voller Bartstoppeln, die Bic-Rasierklingen samt Rasiercreme und die Flasche Lavendel-Eau-de-Cologne von Bien-Être, mit dem ich immer sein Taschentuch tränken sollte, in seinen dunkelgrünen Kulturbeutel gepackt, dazu das Frotteehandtuch und die Seife, die im noch feuchten Waschlappen steckte.
Mein Bruder hatte den Rollstuhl aufgeklappt, die Ersatzprothese, die Krücken, den kleinen Tischventilator, den wir ein paar Stunden zuvor bei Darty gekauft hatten – anscheinend wird einem heiß, wenn der Tod naht –, und die Leclerc-Tüten daraufgelegt und ungewöhnlich sanft zu mir gesagt: Ich geh runter zum Auto und komm dann wieder hoch. Ein praktischer Typ, mein Bruder. Und so fand ich mich allein mit ihm wieder, meinem gefallenen Helden, meiner einbeinigen Kanaille, meinem misanthropischen König, dem alten Knochen, während es draußen langsam dunkel wurde. Nein, während es draußen, live vor der siebten Etage des Krankenhauses von Poissy – tadaaa! … welche eine Pracht, überwältigend schön: die Lichter der Stadt und der orange leuchtende Himmel der Banlieue. Er liebte sie, die Sonnenuntergänge. Er rief uns immer, damit wir kamen, um sie zu betrachten.
Die Krankenschwestern hatten seine Augen geschlossen, sein Gesicht in eine Kinnbinde gezwängt, ihm ein blassgrünes, sweatshirtartiges Kittelchen übergezogen. Das war traurig und komisch zugleich, er hätte gelacht über dieses kurze grüne Krankenhaushemd, das kaum seine Knie bedeckte. Ich habe seinen bläulich roten Fuß angesehen, puh!, der Arme, seinen fusseligen Kinnbart und sein schönes, abwesendes Gesicht. Während ich seine Hand hielt, die in meiner langsam kalt wurde, wünschte ich mir von ganzem Herzen, niemals seinen Duft zu vergessen und wie weich seine trockene Haut war. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich nicht begriffen hatte, dass er tatsächlich im Sterben lag, habe ihn geküsst und dann laut gesagt, Ciao, ich liebe dich, bis später, gib kurz Bescheid, wenn du angekommen bist. Ich bin in den lino-neon Flur rausgegangen, eine Pflegerin ist vorbeigeschlappt, und mein Bruder kam zurück. Wir sind noch ein letztes Mal rein, zur Sicherheit. Dann haben wir die Reusen eingeholt, wie er immer sagte. Das Leben, diese Angelpartie.
Im Spiegel des Aufzugs unsere Erwachsenenvisagen, ziemlich mitgenommen. Gevatter Tod lässt grüßen. Und obendrein die Mehr-als-Gewissheit, so nebeneinander, jeder mit seinem Päckchen Genen, dass wir unbestreitbar die Kinder des Verstorbenen sind. Wir haben noch einer Schwangeren Guten Abend gesagt, einem Assistenzarzt zugelächelt: großstädtisch, höflich, würdevoll trauernd. Wir haben schweigend die ausgestorbene Eingangshalle durchquert, die Glastür nach draußen, das Auto erreicht – ooink, ooink – und dann die ebenfalls ausgestorbene Autobahn genommen. Am Abend vor Allerheiligen, Mondschein, klarer Himmel, unwirkliche Fahrt.
Als der Wagen startete, ging die CD im Autoradio genau da weiter, wo sie aufgehört hatte. Ein Mixtape, das ich extra für meinen musikbesessenen Bruder zusammengestellt hatte, als Erinnerung an unsere trashige, aber musikalische Kindheit. Auch hier nicht viele Worte oder Blicke, nur Tränen, die liefen und die man mit dem Handrücken wegwischte. Die Stücke folgten nahtlos aufeinander wie lauter Wiegenlieder. Doch dann plötzlich, kurz vor Porcheville, kam »Eloise« von Barry Ryan, eine Liebeserklärung, ein Flehen, ein melodramatischer, triumphaler, grandioser Song, Eloise, You know I’m on my knees. Ein etwas kitschiges Stück, das später für den französischen Titelsong der Serie Hart aber herzlich kopiert wurde. Es beginnt mit einem ausklingenden irren Lachen, so ein Lachen wie nach einem richtig guten Witz, das abebbt, wenn man wieder ernst werden muss, dann legen die Geigen, Bläser und Pauken los. Es war absurd, so viel Pomp, Pathos und ironische Hoffnung gleich nach all dem Schweigen und dem Nichts. Es war bizarr, so viel aufgeblasene Inszenierung nach diesem flüchtigen, schlichten Moment, an dem das Leben sich unbemerkt davonmacht. Guter Witz, wirklich der Brüller. Unsere wilden Träume, unsere hochtrabenden Hoffnungen, und dann zu guter Letzt der Herzinfarkt und das Leben danach, das Plastikbein und die Sauerstoffmasken. Das war zu viel für einen einzigen Tag, also habe ich endlich geweint. Dicke Kullertränen, laute Schluchzer. Mein Bruder hat mir freundlich den Nacken getätschelt, und dann haben wir losgelacht. Letztendlich war dieses Lied eine ziemlich genaue Versinnbildlichung dessen, was wir immer mit unseren Eltern erlebt hatten: Liebe, Schreie, Dramen, Verzweiflung, aber nie ohne Trompeten und Geigen im Hintergrund. Am nächsten und den folgenden Tagen sind wir genau denselben Weg wieder gefahren, morgens in aller Frühe und am Abend, um den Papierkram zu besorgen. Jedes Mal großartige Himmel, Wolken in allen Farben und Sonnenuntergänge, wie ich sie selten gesehen hatte. Offensichtlich war er gut angekommen.
Dann waren die üblichen Formalitäten zu erledigen. Es begann gleich mit einem Streit im Bestattungshaus Lecreux & Söhne, 27600 Gaillon, weil mein Bruder fand, die Särge seien zu teuer. Während man uns den »Mazarin«, den »Parisien«, den »Richelieu« und den »Sully« oder den »Turenne« präsentierte, Griffe und wasserdichte Ausschalung inklusive, gefolgt von zeitgemäßeren, umwelt- und familienfreundlichen Modellen, bissen wir die Zähne zusammen. Während eine gewisse Jacqueline M. sich in einer tristen und blumigen Broschüre lobend über den harmonischen Ablauf der Zeremonie äußerte, vergingen wir im Elend. Das ist organisierte Kriminalität, professionelle Halsabschneiderei, aber ich, Monsieur, falle nicht rein auf Ihre kranke Gewinnspanne und Ihre beschissenen Tricks, hatte mein Bruder zu Herrn Lecreux junior gesagt, der natürlich eine gewisse Marge einkalkuliert hatte, um an der Sache auch ein wenig zu verdienen, was normal erschien, aber doch etwas taktlos, angesichts dessen, was uns gerade widerfahren war. Im Grunde fand ich dieses Kistengeschäft genauso schamlos wie mein Bruder, doch in diesem schweren Moment brachte es nicht mehr viel, sich aufzuregen, weil der Tod ja in Wahrheit schon durch war. Mein Bruder, der Spätzünder, und seine verhinderten Revolutionen.
Aber mit seinem dunkelgrünen Fleecepulli und den Schülerbermudas hat er immer weiter aufgedreht, und ich habe schnell die säuerlichen Ausdünstungen seiner Aggressivität gewittert. Ein vertrauter Luftstrom, eine generelle Verdüsterung der Kulisse, und dann der Weltuntergang. Da ich Magenschmerzen bekam, hat sich der Überlebens-Unterwerfungs-Modus von ganz allein eingeschaltet. Während ich die Broschüre knetete und auf meine Füße starrte, sagte ich ihm ganz leise, als braves Weichspüler-Konzentrat-Aprilfrische-Mädchen, beruhige dich, Jean-François, du brauchst diesen Herrn nicht zu beschimpfen, der uns hier am Abend vor einem Feiertag empfängt. Aber Jean-François ist ein als Wanderführer verkleideter Despot, ein Alphamännchen, das Peter Pan spielt, ein verkappter Attila. Also hält man besser den Ball flach, sonst greift er an, und auf deinem niedergewalzten Ego wächst kein Gras mehr. Er hat mir seinen berühmten »Verzieh dich«-Blick zugeworfen und nach einer zynischen Grimasse à la »Weißt du, an wen du mich gerade erinnerst?« den Totengräber weiter angeschrien, und ich hab besser die Klappe gehalten.
Während er mit geweiteten Nasenflügeln und aufgeblasenen Worten an der Satinpolsterung herumnörgelte, kamen mir die Erinnerungen wieder hoch. Ich sah Papa mit einem Messer in der Hand, riesig und sturzbetrunken, rund um den Tisch hinter Mama herlaufen und dabei schreien: Lepelleux, hör auf, in die Seide zu furzen, und kümmer dich lieber um deinen Haushalt, anstatt dich dem Pfarrer an den Hals zu werfen. Man kann es nicht leugnen: Besoffen war er wirklich eloquent, auch wenn in Wahrheit niemand Seidenunterwäsche hatte oder sich dem Pfarrer an den Hals warf. Es stimmt schon, großherzig und freigebig, wie sie war, hatte sich meine Mutter, verspätete Wohltätigkeitsdame im Jeanshosenrock, in die Gemeindearbeit gestürzt, die eigentlich gar nicht zu ihr passte, um seinen Alkohol-, Wut- und Eifersuchtsexzessen zu entkommen. Hier sind wir jetzt also gelandet, so sind die Loyalitäten verteilt, dachte ich mir, den Kopf in den Händen vergraben. Wer hielt heute das Messer, und wer furzte in die Seide? Ich wollte nicht unbedingt die Schlossherrin heraushängen lassen noch den hinterbliebenen Sohn kränken, aber trotzdem, helle Eiche erschien mir etwas passender für die letzte Reise. Kiefer, das hatte so was von Obstkiste, Barbecue, die Reste vom Markt. Nach einem Leben in einem zusammengeschusterten Haus, mit Holzklötzen als Beinen für die Betten konnte ein wenig Komfort nicht schaden, schon gar nicht einem Toten. Außerdem, bei seiner Statur brauchten wir schon was Solides, um ihn zur Grube zu bringen. »Ich weiß, das würdest du gern, aber wir werden ihn nicht in eine Pappkiste stecken«, habe ich schließlich zitternd vor dem ungläubigen Geschäftsmann entschieden. »Wir nehmen den ›Senanque‹ für 1956 Euro. Das Geld haben wir.« Gleich nach diesem kühnen Moment hatte ich Lust, mich unter dem Tisch zu Füßen dieses Herrn zusammenzurollen und alles zu vergessen.
Es folgte Schweigen. Jean-François hatte nichts mehr zu sagen. Mit ungezwungener Miene haben wir Herrn Lecreux junior, der schwer durchs Textverarbeitungsprogramm ruderte, Tab, Apfel-S, die Todesanzeige diktiert, die Vornamen buchstabiert und uns bemüht, niemanden in der Liste derer, die man als Zeugen dieses Schiffbruchs erwähnen musste, auszulassen. Wir haben Dokumente abgezeichnet, einen Vertrag unterschrieben. Am Schluss war eine Anzahlung zu leisten. Der Minotaurus hat sich in seinem Stuhl noch einmal aufgerichtet, um hinzuzufügen: Bis ich mich nicht vom Niveau Ihrer Leistungen überzeugen konnte, bekommen Sie von mir keinen Sou, Monsieur. Herr Lecreux hat einen verzweifelten Blick in meine Richtung geworfen. Ich habe einen Scheck herausgeholt, absurd lange gebraucht, um ihn auszufüllen, weil ich mir das Lachen über das Niveau Ihrer Leistungen verkneifen musste. Wir sind aufgestanden, haben ein höfliches Lächeln aufgesetzt, ich habe dem guten Mann so herzlich wie möglich die Hand gedrückt. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Aber ich bitte Sie, seinen Vater zu verlieren, das ist keine Kleinigkeit.
Beim Hinausgehen, ding-dong, habe ich tief die frische, finstere Luft eingeatmet, die durch die Rue du Général-de-Gaulle strömte. Ich hatte das Gefühl, aus dem Gefängnis zu kommen. Wir sind schweigend zum Auto gelaufen, und ich habe schließlich ein »Was hat dich denn geritten?« gewagt, nicht ohne instinktiv meinen inneren Schutzschirm aufzuspannen. Da hat er alles auf einmal ausgespuckt, mit einem Vokabular, das direkt aus Grimms Wörterbuch stammte: Wie ich mich erdreisten könne, seiner Ansicht bezüglich des Begräbnisses vorzugreifen, warum ich seinen Seelenschmerz ignoriere, dann noch meine unerquickliche Neigung, alles übereilen zu müssen, aber auch mein heimliches Einvernehmen mit dem Verstorbenen, ganz zu schweigen von dem Komplott, das die internationalen Mächte gegen ihn schmiedeten. Ehe er den Wagen startete, schloss er mit einem: Nur dass du es weißt, Anne, ich lasse mir von dir nichts vorschreiben! Küsschen von der liebevollen Familie und der christlichen Jugend. Bestattungsinstitut – check.
Sobald wir den voraussichtlichen Beerdigungstermin hatten, mussten wir den Gedenkgottesdienst organisieren. Absurderweise wusste ich sofort, was zu tun war. Am folgenden Montag bin ich frühnachmittags aus dem eiskalten, leeren Esszimmer geflohen, in dem mein Bruder gerade die Liste der Adressen, an die wir eine Todesanzeige schicken mussten, fertigstellte, und bin, ohne zu überlegen, zum Pfarrer von Düsterhausen gegangen, André Barraté, einem Jugendfreund des Verstorbenen. André Barraté, Sohn eines Gemüsegärtners, hatte den Ruf Gottes eines Morgens im September 1965 vernommen, auf dem Acker, wo er mit seinem Bruder Kartoffeln erntete. Zwischen zwei Missionen in Mayotte oder in Afrika schaute er regelmäßig bei meinen Eltern vorbei. Ich kannte ihn schon immer, und es beruhigte mich, mit ihm zu tun zu haben.
Es war lausekalt, und meine von den Tränen gebeizten Wangen brannten. In meinen dicken Mantel gehüllt, passierte ich den Wasserturm, das kürzlich verkaufte Haus der Bordes und die letzte belebte Bastion vor dem Nichts der Grand-Rue: die Apotheke Papot, in Lachs und Grün, beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ich hatte gedacht, ich würde weit fortgehen, um Wunder zu vollbringen, und nie mehr in die Grand-Rue von Carrières-sous-Poissy zurückkehren, doch da war ich wieder, mit dem Gefühl, im Grunde gar nie weg gewesen zu sein. Das erinnerte mich an einen Film von Steve Buscemi, Lonesome Jim: Ein Typ verlässt seine Heimat Indiana, um sein Glück in New York zu suchen. Zehn Jahre lang macht er seiner Familie weis, er hätte einen super Job in der Kommunikationsbranche, während er in Wahrheit als Hundesitter für reiche Yuppies arbeitet. Als er wegen eines Bruders im Koma nach Hause fährt, verliebt er sich in die hübsche Krankenschwester, die er jeden Tag am Bett des Patienten trifft, und entscheidet sich schließlich dafür dazubleiben, um anstelle seines Bruders die Leitung des Familienbetriebs zu übernehmen und Basketballtrainer zu werden. Zu guter Letzt beglückwünscht er sich dazu, dass er seinen Illusionen nicht auf den Leim gegangen ist, und fühlt sich endlich genau am richtigen Platz in diesem Nirgendwo, vor dem er zuvor geflohen war. Angst.
Vor dem Pfarrhaus der Église Saint-Joseph, einer armseligen Kleinstadtkirche mit beigefarbenem Rauputz und einem von deprimierenden Gräserrabatten aufgepeppten Parkplatz, holte ich tief Luft und trat, ohne zu klingeln, ein wie bei einer etwas schwerhörigen alten Tante. Unter dem Vordach habe ich an eine schmale Glastüre geklopft, und André kam, um mir zu öffnen. Der alte Mann mit Trifokalbrille und handgestricktem blasslila Pullover hat mich nicht erkannt und auch mein »Guten Tag, ich bin Anne, die Tochter von Jean-Pierre Pauly, er ist vorgestern gestorben« nicht verstanden. Er hat mich gebeten, hereinzukommen und Platz zu nehmen, was ich tat. Dann hat er sich neben mich gesetzt, die geöffneten Handflächen auf seine Knie gelegt und einfach gesagt: »Erhöre unsere Gebete, o Herr, denn unser Freund ist von uns gegangen. Du hast ihn zu Dir gerufen, und wir geben ihn in Deine Hände. Mögest Du ihn aufnehmen in Dein Reich.« Dann hat er sich ein wenig verwirrt zu mir umgewandt: »Wer, hast du gesagt, ist gestorben?« – »Mein Vater, Jean-Pierre Pauly.« – »Ach ja? Ach wirklich? Jean-Pierre ist von uns gegangen? Wann ist das denn passiert?« – »Vor zwei Tagen.« Da ist in seinen Augen ein kleines Männchen auf eine Leiter gestiegen, um das Licht anzuknipsen. »Ach, dann bist du Anne. Ich hatte deine Mutter Françoise wahnsinnig gern, eine gütige, unglaublich liebenswürdige Frau. Das ist traurig. Armer Jean-Pierre. Und woran ist er gestorben?« – »Sein Herz ist stehen geblieben, er hatte Krebs.« – »Ach ja, stimmt. Das ist traurig für ihn. Ich habe ihn besucht, so oft ich konnte. Wenn ich an deine Mutter denke, so eine tapfere Frau … Nun gut. Und du, Anne, bist du verheiratet? Du hast bestimmt Kinder?«
Es war nicht das erste Mal, dass er mir diese Frage stellte. Zu Besuch bei meinen Eltern hatte er, sicherlich getäuscht von meinen hellblauen Blusen und der äußerlichen Ähnlichkeit mit meiner Heiligen von einer Mutter, schon mehrmals versucht, mich zu rekrutieren, weil er junge tatkräftige Leute wie mich brauchte, um die Messe zu beleben und der Kirche ein neues Gesicht zu verleihen, und diese Frage war Teil des Bewerbungsgesprächs. Ich hatte jedoch jedes Mal höflich abgelehnt mit der Begründung, dass ich inzwischen in Paris lebe und sehr beschäftigt sei. Normalerweise belächelte ich die Verblendung der alten Kirche in puncto moderner Welt und ihre Überzeugung, dass, ob sie wollten oder nicht, ein unverrückbarer Glaube in den Herzen ihrer Täuflinge glomm, doch diesmal machte es mich traurig. Inwiefern brachte der Umstand, dass man verheiratet war und Kinder hatte, Extrapunkte bei der großen Abrechnung, die der Tod uns auftischt? Gab es dann Nachlass auf den Schmerz? Einen Moment war ich versucht, ihm zu erwidern: »Nein, Pater, ich trinke viel zu viel, um die Verantwortung für kleine Kinder zu übernehmen, und obendrein fluche ich wie ein Droschkenkutscher« oder: »Nein, Pater, ich habe gesehen, wie meine Mutter sich abgerackert hat und mies behandelt wurde, also habe ich mit neun Jahren beschlossen, niemals so ein Leben zu führen« oder vielleicht: »Nein, Pater, ich bin eine fette, kinderlose Lesbe, weil mir das Patriarchat nicht gestattet, eine Familie zu gründen, mit wem ich will.« Doch der arme Mann, der allein, mit seinen Psalmen als einziger Gesellschaft, in dieser Kirche lebte, konnte nichts dafür, und unter den gegebenen Umständen das Patriarchat niederzureißen, erschien mir vollkommen zwecklos.
In Wahrheit war mir das Patriarchat unter den gegebenen Umständen schnurz. In diesem kleinen Holzflur, in den sich durch ein uraltes Fenster das goldene Licht des Spätnachmittags ergoss, war mir die Männerherrschaft scheißegal. Daher habe ich bloß den Kopf geschüttelt, und er hat gesagt: Beten wir für Jean-Pierre. Allein mit meiner Kindheit, betäubt vom Kummer und ohne andere soziale Verpflichtung, als einem alten Mann mit schwachem Gedächtnis das Stichwort zu geben, habe ich mit ihm ein Ave-Maria gebetet. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Anschließend haben wir einen Moment geschwiegen und sind dann ohne weitere Überleitung hoch in sein Büro gegangen, um zu sehen, wo im bereits übervollen Terminkalender der kommenden Woche man die Begräbnisfeier noch unterbringen könnte. Tote noch und nöcher, Sturköpfe, die lieber an Allerheiligen den Löffel abgaben, als einen weiteren Winter vor den Dokus von France 5, der Pflegerin und dem Essenstablett auszuharren. Kurz habe ich gedacht, André würde es auch erwischen, so geschwächt wirkte er, wie er mir da auf der Treppe vorausging. Er klammerte sich ans Geländer und hievte sich mit Ach und Uff auf die nächste Stufe. Ich hielt jedes Mal die Luft an – was macht man, wenn ein Pfarrer stirbt? Wem sagt man Bescheid? –, doch schließlich sind wir heil oben angekommen. Wir haben seine Wohnung durchquert, diese Küche vor allem, die ich seit jeher kannte, so zentral war die Gemeinde im Leben meiner Mutter gewesen. Alles darin war ebenso antik und klapprig wie der alte Mann, der nun auf dem Wachstischtuch mit beigefarbenen Blumen einen eleganten, in schwarzes Kunstleder gebundenen Kalender aufschlug. Die Woche war schon fast sold out, und wir haben uns auf eine Lücke am folgenden Mittwoch um 15 Uhr geeinigt. Dann haben wir für den übernächsten Tag um 13 Uhr noch ein weiteres Treffen zur »Vorbereitung« vereinbart.