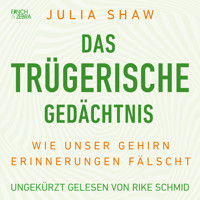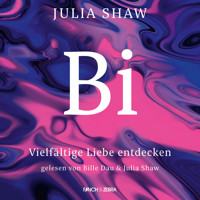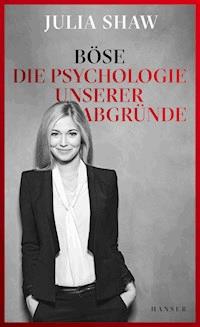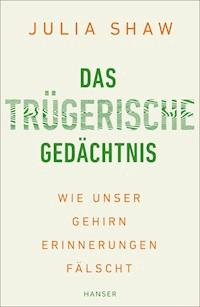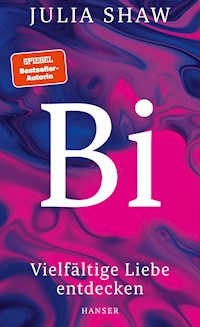
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Ich möchte die vielfältige Welt der Bisexualität aus dem Schatten holen.“ – Julia Shaw eröffnet neue Wege, über die eigene sexuelle Identität nachzudenken und sie zu finden.
Viele Menschen fühlen sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen. Und trotzdem bekennt sich kaum jemand dazu. Julia Shaw widmet sich in ihrem neuen Buch der größten sexuellen Minderheit – bisexuellen Menschen. Sie macht Bisexualität in Geschichte, Kultur und Wissenschaft sichtbar und zeigt anhand ihrer eigenen Identitätssuche, warum Bisexualität nach wie vor gesellschaftlich im Schatten steht. Dabei geht sie von Fragen aus, die sie selbst bewegen: Woher kommt unser Verständnis von Bisexualität? Warum ist es nach wie vor so schwer, sich zu outen? Julia Shaw beantwortet die Frage, wie sexuelle Identität entsteht, neu. Und sie zeigt, warum vielfältige Liebe endlich mehr Raum erhalten muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Ich möchte die vielfältige Welt der Bisexualität aus dem Schatten holen.« — Julia Shaw eröffnet neue Wege, über die eigene sexuelle Identität nachzudenken und sie zu finden.Viele Menschen fühlen sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen. Und trotzdem bekennt sich kaum jemand dazu. Julia Shaw widmet sich in ihrem neuen Buch der größten sexuellen Minderheit — bisexuellen Menschen. Sie macht Bisexualität in Geschichte, Kultur und Wissenschaft sichtbar und zeigt anhand ihrer eigenen Identitätssuche, warum Bisexualität nach wie vor gesellschaftlich im Schatten steht. Dabei geht sie von Fragen aus, die sie selbst bewegen: Woher kommt unser Verständnis von Bisexualität? Warum ist es nach wie vor so schwer, sich zu outen? Julia Shaw beantwortet die Frage, wie sexuelle Identität entsteht, neu. Und sie zeigt, warum vielfältige Liebe endlich mehr Raum erhalten muss.
Julia Shaw
Bi
Vielfältige Liebe entdecken
Aus dem Englischen von Sabine Reinhardus
Hanser
Sexuelle Freiheit ist etwas Wunderbares und Fragiles.
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Julia Shaw
Impressum
Inhalt
Einführung
: Ich will mehr
1
Die Option Bi
Die Erfindung der Bisexualität
Unverblümte Fragen
Das Klein-Raster
Mittelweg
2
Unsere Geschichte
Wir sind hier, wir sind queer!
Das obszöne Buch
Sexuell Invertierte
Der enthauptete Engel
Ein unerwünschter Gast
3
Nur Säugetiere
So geboren?
Schwule Giraffen
Darwinsches Paradoxon
Wid(d)erstand
Hinter Gittern
Komm spiel mit mir
4
Heimlich Bisexuell
Sich outen
Familiengeheimnisse
Arbeite daran
Verwirrt
Biversität
Warum gerade wir?
Freiheit
5
Unsichtbar
Sehe ich bi aus?
Unsere eigenen Räume
Perversion
Parasozial
Sexy, aber tödlich
6
Alles ist politisch
Wo Liebe ein Verbrechen ist
Sexualität vor Gericht
Ihr werdet mich nicht ändern
Schlupflöcher
No-promo-homo
Politische Machtzentren
7
Freie Liebe
Cherry Chapstick
Alle lieben Dreier
Obligatorische Monogamie
Kettenreaktion
Gewandelte Intimität
Schlussfolgerung
: Bidentität
Stadium 1: Einsamkeit
Stadium 2: Euphorie
Stadium 3: Enttäuschung
Stadium 4: Trauern
Stadium 5: Wut
Stadium 6: Frieden
Dank
Anmerkungen
1 Die Option Bi
2 Unsere Geschichte
3 Nur Säugetiere
4 Heimlich bisexuell
5 Unsichtbar
6 Alles ist politisch
7 Freie Liebe
Schlussfolgerung: Bidentität
Register
Einführung
Ich will mehr
Ich bin bisexuell und spüre schon seit Längerem, dass ich mehr will. Es war mir ein echtes Bedürfnis, mich, gestützt auf ein solides geschichtliches und wissenschaftliches Fundament, auf die Suche nach der Repräsentation von Bisexualität in Politik und Popkultur zu machen und ganz allgemein die Frage zu beantworten: Wo sind eigentlich all die bisexuellen Menschen?
Als ich mit der Suche begann, stieß ich zunächst auf eine derart beklemmende Leere, dass ich mich fragte, ob mein Wunsch, mehr herauszufinden, nicht einfach nur Zeitverschwendung war. Doch als ich allmählich vertrauter mit der Sprache der Queer-Forschung wurde, erschloss sich mir auch die Welt der bisexuellen Forschung. Mir wurde klar, welche großartige Forschungsarbeit bereits auf diesem Feld geleistet wurde — die der Öffentlichkeit bisher leider größtenteils unbekannt geblieben ist. Das möchte ich mit diesem Buch ändern und die kunterbunte Welt der bisexuellen Wissenschaft aus dem Schatten treten lassen.
Ich möchte außerdem dazu beitragen, dass Bi-Identitäten und Bi-Lebensläufe in Zukunft nicht mehr als pervers angesehen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir nicht nur lernen, Bisexualität besser zu verstehen, sondern auch Heterosexualität zu hinterfragen. Bisexualität ist nicht mysteriös, nicht bedrohlich, nicht performativ … und auch nicht cool, woke oder transzendental. Sie ist ein völlig normaler Teil der menschlichen Sexualität. Auch jetzt noch, im 21. Jahrhundert, gehen wir generell davon aus, dass jemand heterosexuell ist — jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils. Dieser Tunnelblick, der Heterosexualität als Sonne unseres sexuellen Universums zentriert, blendet zugleich die Erforschung anderer Sexualitäten aus. Ich glaube zwar nicht, dass jeder bi ist, wie es oft halb im Scherz behauptet wird, aber meiner Meinung nach ist es längst überfällig, dass wir unsere Sicht auf die Welt queeren, indem wir unsere Annahmen über Sex und Sexualität infrage stellen.
Einige werden jetzt sagen, dass wir diesen Punkt schon längst erreicht haben und aus dem sexuellen Tiefschlaf erwacht sind. So lehnte ein Verleger das Exposé zu diesem Buch mit der Begründung ab: »Diese Diskussion haben wir doch schon geführt.« Mit wir war hier das ganze Land gemeint. Ich kann nur schwer beschreiben, welche Wut das in mir ausgelöst hat. Und ich war nicht etwa deswegen so aufgebracht, weil dieser Verlag überhaupt noch nie ein Buch über Bisexualität herausgebracht hat. Nein, es war vielmehr die Erkenntnis, dass viele Menschen dieser Behauptung zustimmen würden; Menschen, die der Ansicht sind, dass ausreichend viel über das Thema gesprochen wurde, weil mehr Rechte und Schutz für diese Gruppe erstritten wurden oder weil in den sozialen Medien mehr positive LGBT+-Posts stehen oder weil sie zum ersten Mal jemand kennengelernt haben, der offen bi ist. Aber wie könnten Gespräche über Identität, Liebe und Sex jemals abgeschlossen sein? Diese Themen beschäftigen uns doch schließlich ständig.
Wir müssen außerdem damit aufhören, Bisexualität zu dramatisieren, denn es gibt kein Drama. Generell wird missverstanden oder absichtlich falsch konstruiert, dass Bisexuelle dazu beitragen, eine strikte Gender-Binarität zu verstärken. Das trifft weder historisch zu noch stimmt es heute. Die meisten bisexuellen Aktivisten definieren Bisexualität als die Anziehung zu mehr als einem Geschlecht. Diese Definition schließt übrigens transsexuelle und nicht-binäre Menschen ein.
Ich verwende in diesem Buch durchgängig den Begriff bisexuell, nicht etwa, weil ich finde, dass jeder ihn benutzen sollte, sondern weil er die umfassendste Bedeutung und die längste Geschichte hat und insgesamt am bekanntesten ist. Ich hoffe, dass ich auf diesen Seiten unsere gesamte sexuelle Familie vereinen kann, unabhängig von persönlichen Vorlieben, was Begrifflichkeiten angeht, ob es nun bisexuell, plurisexuell, pansexuell, omnisexuell, polysexuell, fluide, ohne Label oder irgendeine andere Bezeichnung sein mag.
In den meisten Themen, die das Buch anschneidet, geht es nicht ausschließlich um Bisexualität, sondern um die grundlegenden Konstrukte menschlicher Sexualität, um Liebe und Beziehungen. Wer Sie auch sein mögen, ich hoffe, dieses Buch kann dazu beitragen, Ihre Gedanken zu diesem Thema zu bereichern und zu erweitern.
Im Rahmen meines Bestrebens, Bisexualität besser zu verstehen, kam ich auf verschiedene Weise mit der akademischen bisexuellen Community in Kontakt. Ich gründete eine bisexuelle Forschungsgruppe, die sich regelmäßig traf, leitete eine internationale Bisexualitäts-Forschungskonferenz mit über 485 Teilnehmer*innen und 70 Forscher*innen, die ihre Arbeit vorstellten, und absolvierte den Masterstudiengang in Queer History. Obwohl ich bereits in Psychologie promoviert hatte, war ich, um dorthin zu kommen, wo ich hinwollte, auf die Hilfe von Wissenschaftler*innen und Dozent*innen angewiesen, die mich auf diesem Weg begleitet und mich mit großer Geduld und Umsicht an die Informationen in diesem Buch herangeführt haben. Inzwischen weiß ich, dass das Thema Bisexualität sehr viel mehr Forschung, Geschichte und wissenschaftliche Arbeiten hervorgebracht hat, als sich je in einem einzigen Buch unterbringen lässt. Obwohl dieses Buch also, unweigerlich, unvollständig ist, hoffe ich, dass es den unglaublichen Forscher*innen und Aktivist*innen, die ihr Leben dem Verständnis und Schutz Bisexueller widmen, gerecht wird.
Ich gehe in diesem Buch der Frage nach, wie Bisexualität definiert und erforscht wurde, decke die überraschend lange und wichtige Geschichte der Bisexualität auf und erfahre vieles über einige berühmte Bi-Aktivist*innen und Gelehrte, die jeder kennen sollte. Ich begebe mich, bildlich gesprochen, auf eine Safari und werfe einen Blick auf verhaltensmäßig bisexuelle Tiere und versuche herauszufinden, ob es ein Bi-Gen gibt. Ich untersuche, warum es nach wie vor immer noch vielerorts als irgendwie unangemessen empfunden wird, über Bisexualität zu sprechen — auch am Arbeitsplatz —, und welche psychischen und physischen Folgen es haben kann, wenn man seine Bisexualität verbirgt. Ich lerne die verheerende Realität der Kriminalisierung und Menschenrechtsverletzungen kennen, mit der so viele Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind, und mache mir Gedanken darüber, wie wir unsere Wut nutzen können, um eine bisexuelle Revolution anzustoßen. Im Anschluss versuche ich herauszufinden, wie eine bisexuelle Person typischerweise aussieht (und ob das überhaupt ein Thema ist), ob es Bi-Sichtbarkeit auf dem Bildschirm gibt, und unternehme eine Erkundungstour durch die bunte Welt der bisexuellen Communitys. Im letzten Kapitel stürze ich mich in eines der erotischsten Themen des Buches, die Dreiecksbeziehung, und nehme die Forschung zu dem ebenso amüsanten wie heiklen Thema der einvernehmlichen Nicht-Monogamie in den Blick.
Aus welchem Grund auch immer Sie zu diesem Buch gegriffen haben mögen, das ganz eindeutig und unmissverständlich bi ist: Ich hoffe, Sie sind, genau wie ich, hier gelandet, weil Sie mehr wollen — mehr Wissen über die Geschichte, Kultur und Wissenschaft der Bisexualität.
1
Die Option Bi
Der Verdacht, Bisexualität sei nur ein Trend, besteht seit 50 Jahren. Die US-Zeitschrift Newsweek behauptete es sogar gleich zweimal und veröffentlichte im Jahr 1974 ebenso dreister — wie fälschlicherweise einen Artikel mit dem Titel: »Bisexual Chic: Anyone Goes«.1 1995, zwei Jahrzehnte später, brachte sie eine Titelgeschichte mit der Überschrift heraus: »Bisexualität. Nicht homosexuell. Nicht hetero: Eine neue sexuelle Identität entsteht«.2 Neu, schon wieder??
Über beide Artikel hat man sich in bisexuellen Foren lustig gemacht, besonders über das Titelbild von 1995. Es zeigt vor dem strahlend weißen Lettering der Zeitschrift das Bild einer Frau in einem übergroßen schwarzen Anzug, mit Kurzhaarschnitt und verschränkten Armen. Ihr Gesichtsausdruck signalisiert eine gewisse Vorsicht, während im Hintergrund zwei Männer in schlabberigen grauen T-Shirts zu sehen sind, die emotionslos in die Kamera blicken. Das Foto ist so seltsam und so übertrieben Neunzigerjahre, dass es schon beinahe satirisch wirkt.
Der Artikel selbst verkündet unter anderem, dass »Bisexualität der heimliche Joker unserer Kultur« sei, suggeriert, es gebe eine »unabhängige bisexuelle Bewegung«, und überlässt es dann einem Fünfzehnjährigen, mit dem Mythos des hypersexuellen Bisexuellen aufzuräumen, nur um dies gleich darauf wieder mit dem reichlich bizarren Zitat »Ein Bisexueller … hat auch nicht mehr Sex als der Kapitän eines Football-Teams« zu entkräften. Wenn denn die Aussicht auf jede Menge Sex tatsächlich einen Anreiz für Kapitäne in (amerikanischen) Football-Teams darstellen sollte, will der Junge vermutlich deutlich machen, dass sein Verhalten zwar promiskuitiv, aber nicht sexuell exzessiv sei. Der Artikel bringt Polyamorie, Promiskuität und fluide Geschlechtlichkeit auf verschiedene Weise mit Bisexualität in Verbindung. Er greift außerdem die Idee, Bisexualität sei auf dem Vormarsch, mit dem Satz »viele Student*innen, vor allem Frauen, sprechen von einer neuen sexuellen ›Fluidität‹ auf dem Campus« auf und führt folgendes Zitat einer bisexuellen Person an: »Hier geht es nicht mehr um ein Wir-gegen-die-anderen. Wir werden einfach immer mehr und mehr.«
Ich finde es erstaunlich, dass dieser Artikel ebenso gut in der heutigen Zeit hätte geschrieben werden können, mit den exakt gleichen falschen Vorstellungen, dem leicht bedrohlichen Gefühl einer bevorstehenden Veränderung, dem angedeuteten Optimismus. Gerade die Vorstellung, dass es mehr und mehr Bisexuelle gibt, hat bis heute nichts von ihrer Popularität eingebüßt. Aber trifft sie auch zu? Bevor ich versuche, diese Frage zu beantworten, muss ich definieren, was Bisexualität ist. Um zu erkunden, woher der Begriff stammt, gehen wir zurück in die Vergangenheit und widmen uns drei Männern mit ähnlich klingenden Nachnamen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich Bisexualität als ein wissenschaftliches, grundlegendes Konzept etablierte: Richard Krafft-Ebing, Alfred Kinsey und Fritz Klein.
Die Erfindung der Bisexualität
Vielleicht überrascht es Sie, dass der Begriff »bisexuell« beinahe ebenso alt ist wie der Begriff »heterosexuell«. In seinem Buch The Invention of Heterosexuality3 argumentiert der Pionier der homosexuellen Geschichte und Aktivist Jonathan Ned Katz, dass »die Idee der Heterosexualität eine moderne Erfindung ist und auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht«. Der Begriff wurde erstmals 1869 in einem anonymen Pamphlet verwendet, und als Autor ermittelte man später Karl-Maria Kertbeny.4
Kertbeny führte ein abenteuerliches Leben. Er hielt sich in vielen europäischen Großstädten auf, verkehrte mit Berühmtheiten wie George Sand und den Gebrüdern Grimm, verbarg sich, auf der Flucht vor der Polizei, vorübergehend im Botanischen Garten von Leipzig, war aber auch Polizeispitzel und ging, wegen einer Reihe gescheiterter Versuche, als Journalist zu arbeiten, im Schuldgefängnis aus und ein.5
In Briefen, Pamphleten und Büchern äußerte er sich zu den Sodomie-Gesetzen, die aus seiner Sicht gegen die Menschenrechte verstießen, und postulierte, dass einvernehmliche sexuelle Handlungen im privaten Bereich nicht unter das Strafrecht fallen sollten. In seinen Schriften erkannte Kertbeny, der wahrscheinlich selbst schwul war, die Notwendigkeit, sexuelle Normen zu benennen und zu definieren, um dann erklären zu können, inwiefern gleichgeschlechtliche Wünsche und sexuelle Verhaltensweisen dazu im Gegensatz stehen. Aus diesem Grund hat er die Begriffe heterosexuell und bisexuell geprägt. Mit anderen Worten: Ein Aktivist für die Rechte der Homosexuellen hat sozusagen nebenbei das Wort heterosexuell erschaffen.
Etymologisch geht Kertbenys Begriff heterosexuell auf das griechische Wort hetero zurück, was so viel besagt wie »der andere«, während homos »gleich« bedeutet; beide sind mit dem lateinischen Wort sexus gekoppelt. Schon bald darauf wurde der Begriff Bi oder Zwei verwendet, um Menschen zu bezeichnen, die sowohl homo- als auch heterosexuelle Neigungen hatten. Forscher*innen, die sich mit Bisexualität befassen, sprechen häufig davon, dass »bi« in Bisexualität zwei bedeute, aber diese zwei seien nicht Männer und Frauen, sondern gleich und anders.
Bevor der Begriff bisexuell zur Beschreibung menschlicher Sexualität herangezogen wurde, wurde er in der Regel auf hermaphroditische Lebewesen und Pflanzen mit sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtsorganen angewendet. Auch heute wird der Begriff bisexuell in der Botanik, Entomologie und Zoologie so benutzt. Rosen sind ein Beispiel für eine bekannte bisexuelle Pflanze.
Im Englischen tauchte der Begriff bisexuell im Sinne einer sexuellen Anziehung zu Menschen multipler Gender wahrscheinlich erstmals im Jahr 1892 auf, als der amerikanische Neurologe Charles Gilbert Chaddock die Psychopathia Sexualis übersetzte. Autor dieses außerordentlich einflussreichen Werkes war der deutsche Psychiater Richard von Krafft-Ebing; er schildert darin unter anderem die, aus seiner Sicht, sexuellen Störungen männlicher Häftlinge.6 Das Buch war für den klinisch-forensischen Bereich bestimmt und absichtlich in einer schwierigen Sprache und teilweise sogar auf Latein geschrieben, damit Laien es nicht verstehen konnten. Es spielte eine wichtige und kontroverse Rolle in der damaligen Diskussion unter Psychiatern, die zu verstehen suchten, warum Menschen homosexuelle Wünsche haben.
Weshalb gab es diese Begriffe nicht schon früher? Wie die Sexualhistorikerin Hanne Blank argumentiert, dachten die Menschen in den englischsprachigen Ländern vorher nicht über Sexualität als eine Form der Identität nach.7 Dass Menschen sich »durch die Art der Liebe oder des sexuellen Verlangens, die sie erlebten, voneinander unterscheiden«, wurde nicht in Betracht gezogen. Obwohl es durchaus Begriffe gab, die das sexuelle Verhalten des Menschen beschrieben, sah man Sex im Allgemeinen als etwas an, das Menschen taten, nicht aber als Teil ihres Wesens.
Als Sexualität jedoch zu einem ausgesprochen politischen Teil der Identität eines Menschen wurde, war es Akademiker*innen und der Öffentlichkeit ein Anliegen, die Bedeutung dieser neuen sexuellen Bezeichnungen genauer zu definieren; besondere Schwierigkeiten bereitete dabei vor allem der Begriff der Bisexualität. Und es ist nach wie vor ein Problem, dass mit Bisexualität sehr viele unterschiedliche Inhalte gemeint sein können. Wissenschaftler*innen, die etwa auf dem Gebiet der Psychologie forschen, entscheiden sich heute daher häufig für eine »operationale« Definition. Wären Sie als Forscher*in beispielsweise der Ansicht, die Bezeichnung bisexuell würde zu selten benutzt, könnten Sie einen Fragebogen zum Thema sexuelle Anziehung entwickeln. Teilnehmende, die einen bestimmten Wert überschreiten, würden Sie dann, im Rahmen Ihrer Untersuchungen, als bisexuell bezeichnen, auch wenn die Betreffenden selbst sich nicht so bezeichnen. Entscheidend ist hier, klare Aussagen zu treffen, wie Sie objektiv Bisexualität definieren. Erst dann können andere Forscher*innen sich dazu positionieren — ob sie mit Ihrer Definition einverstanden sind oder nicht — und Ihre Untersuchung mit einer anderen Stichprobe wiederholen. Nicht alle operationalen Definitionen gehen von gleichen Voraussetzungen aus, und einige Queer-Wissenschaftler*innen zögern denn auch, Sexualität mittels objektiver Messungen zu definieren.
Der Grund dafür wurde mir im Jahr 2020 klar, als in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift ein Artikel über bisexuelle Männer erschien.8 Darin wurde Bisexualität operational als Erektion bei »homosexuellen« und »heterosexuellen« Pornos definiert und der Erektionsgrad der Probanden mit einem sogenannten Plethysmografen, eine Art mechanischer Manschette, die um den Penis geschoben wird, gemessen. Die Forscher beobachteten den Erregungszustand der Männer, während diese sich ausgewähltes pornografisches Material ansahen. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Situation — in einem Versuchslabor zu sitzen und pornografisches Material zu betrachten, das Sie nicht mal selbst ausgewählt haben, und dabei dieses Objekt um die Genitalien geschnallt zu haben — na, sagen wir mal, irgendwie unnatürlich ist. Die Forscher waren jedoch zufrieden, denn die Untersuchung ergab, dass Männer, die sich selbst als bisexuell bezeichneten, von jeder Art Porno, homosexuell und heterosexuell, erregt wurden. Damit, so die Forscher, sei endlich bewiesen, dass es bisexuelle Männer gebe.
Dieser Artikel hat eine Menge Leute sehr wütend gemacht, mich eingeschlossen. Gemeinsam mit den beiden Bisexualitäts-Forschern Jacob Engelberg und Samuel Lawton veröffentlichte ich im Jahr 2021 eine vernichtende Kritik des Artikels.9 Wir argumentierten, Bisexualität werde innerhalb der meisten akademischen Disziplinen, die Sexualität erforschen, als Identität betrachtet, die keine bestimmte physiologische Reaktion voraussetze. In diesem Sinne ist Sexualität auch in den (Anti-)Diskriminierungs-Gesetzen anderer Länder definiert, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, Deutschland und die Vereinigten Staaten. Sexuelle Identität als solche kann und sollte niemals auf diese Art gemessen werden.
Schlimmer noch: Die Geschichte hat uns bereits gezeigt, dass Situationen, in denen man davon ausging, Sexualität ließe sich irgendwie physiologisch messen, meist zu Katastrophen geführt haben. Gerade unter repressiven Regimes wurde immer wieder versucht, »Beweise« für vermeintlich »abwegige« sexuelle Vorlieben zu finden und homosexuelles Verhalten zu verfolgen und auszumerzen. Eine Studie, die behauptet, dass sich bisexuelle Männer mit dem Penisplethysmografen herausfiltern ließen, legitimiert dessen Verwendung und liefert eine Rezeptur, um gegen queere Männer vorzugehen. Aufgrund hoher Fehlerquoten und erheblicher theoretischer Mängel können derartige Instrumente sowohl heterosexuelle als auch queere Männer ins Gefängnis bringen oder noch Schlimmeres bewirken. Tatsächlich wurde der Penisplethysmograf einige Jahrzehnte lang eingesetzt, um eine Reihe von Gewalttaten gegen Männer zu begehen, die man für queer hielt; letztlich führte das zu Bedenken, dieses Gerät stelle eine Verletzung der Menschenrechte dar.10
Die genitale Vermessung von Erregungszuständen als Beweis der Sexualität eines Menschen anzusehen zeugt von einem derart oberflächlichen Verständnis des Konzeptes von Sexualität, dass es schier unbegreiflich ist, wie diese Studie überhaupt je veröffentlicht werden konnte. Glücklicherweise wird die Methode nur selten angewandt. Die meisten Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass Sexualität von subjektiven Faktoren abhängt. Sie ziehen es vor, Probanden nach ihrem Verhalten, ihren Gedanken und ihrer Identität zu befragen, statt ihnen invasive Messinstrumente anzulegen.
Unverblümte Fragen
Haben Sie schon einmal einen Sex-Test im Netz ausgefüllt? Falls ja, handelte es sich dabei vermutlich um die digitale Version eines Fragebogens, der vor mehr als 50 Jahren entwickelt wurde: die sogenannte Kinsey-Skala.
Im Jahr 2011 sichtete die Historikerin Donna Drucker »29 englische, französische, deutsche, spanische und norwegische Sex-Tests auf Foren, Blogs und anderen Seiten im Netz«.11 Alle Tests waren Online-Versionen der Kinsey-Skala, und Drucker stellte fest, dass sie ein »sehr effizientes Werkzeug darstellten, um das Verständnis von Sexualität, Selbsteinschätzung und das Mitgefühl für sexuell anders Orientierte zu vertiefen«. Sie fand auch heraus, dass es Menschen ein »Gefühl der Macht und der Kontrolle darüber verleiht, ihren Platz in der Welt der Sexualität zu wählen«. Die Online-Skalen halfen vielen, wenn auch nicht allen, die komplexe Welt ihres eigenen Verhaltens, ihre Wünsche und ihrer Identitätsentwicklung besser zu verstehen. Tatsächlich handelte es sich bei allen Tests, die Drucker untersuchte, um Online-Versionen der ursprünglichen Kinsey-Skala. Sie ist wohl die bekannteste Sexualitäts-Skala, die je entwickelt wurde.
Wie der Historiker und Sexologe Vern Bullough — er hat sich ebenfalls mit der Biografie Kinseys befasst — schreibt, war Alfred Kinsey Biologe; er hatte in Harvard promoviert und machte sich in den Dreißigerjahren zunächst durch Arbeiten über Insekten, insbesondere Gallwespen, einen Namen.12 Bullough bezeichnet Kinseys Interessenverschiebung von asexuellen Gallwespen hin zu sexuellen Menschen als einen glücklichen Zufall. Zum einen lag es an den damaligen Fördermitteln für Sexualitäts-Forschung, die enorm aufgestockt worden waren, und zum anderen an einem Seminar über Heirat und Ehe, das Kinsey damals gab. Letzteres sollte sein Interesse an menschlicher Sexualität nachhaltig fördern, weil er den Mangel an Forschung in Bezug auf das Thema als äußerst frustrierend empfand. Die Sterne standen günstig, und so geriet er unversehens in den Bereich der Sexualforschung, der ihn später weltberühmt machen sollte.
Das wohl Bemerkenswerteste an Kinsey ist seine systematische, auf Taxonomie beruhende Arbeitsweise. Ob Gallwespe oder Mensch, ihm ging es letztlich vor allem darum, die Welt zu klassifizieren und sie wissenschaftlich zu beschreiben. Als Folge davon weigerte er sich, seine Untersuchungen unter moralischen oder politischen Gesichtspunkten zu betrachten. In seinen Berichten schrieb er stattdessen ausführlich über den »säugetierähnlichen Hintergrund« des Menschen und verknüpfte seine Ideen mit biologischen Konzepten.13 Damit unterschied er sich grundlegend von einigen seiner Kollegen, die Kinseys Herangehensweise als Affront betrachteten. Und um seinen Kritikern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, waren etliche seiner frühen Ansätze denn auch tatsächlich ein wenig … unverblümt.
Er war beispielsweise dafür bekannt, dass er seinen Student*innen die Frage zu stellen pflegte, wann sie zum ersten Mal Sex gehabt hatten, wie oft sie Sex hatten und mit wie vielen Partner*innen. Gerüchten seines damaligen Kollegiums zufolge befragte er seine Studentinnen auch nach der Länge ihrer Klitoris, und zwar nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung. Hätte mich ein Professor nach der Vorlesung beiseitegenommen und mir diese Frage gestellt, wäre ich bestimmt auch schockiert gewesen und hätte mich wahrscheinlich offiziell über ihn beschwert. Glücklicherweise war Kinsey jedoch gut mit dem Präsidenten der Universität befreundet. Infolgedessen flog er nicht hochkant hinaus, sondern erhielt ein weniger gewichtiges Lehrdeputat und wurde gebeten, in Zukunft von anstößigen Fragen in der besseren Gesellschaft abzusehen und sie stattdessen in einem strukturierten Forschungsumfeld zu stellen. So kam es, dass er die berühmten Kinsey-Studien in Angriff nahm.
Kinsey selbst führte Interviews mit über 8000 Teilnehmer*innen durch und bildete daneben seine Assistent*innen aus, die ihrerseits mehr als 10.000 Personen befragten. Kinsey war felsenfest davon überzeugt, dass Menschen in Bezug auf ihre sexuellen Aktivitäten nicht immer die Wahrheit sagten; Lügen ließen sich seiner Meinung nach nur in persönlichen Interviews durch den Hinweis auf widersprüchliche Antworten aufdecken. Waren die Befragten nicht in der Lage, diese Widersprüche zu klären, wurden ihre Antworten verworfen.
Seine berühmtesten Studien führte Kinsey in den Vierziger- und Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts durch und maß mittels der Kinsey-Skala Sexualität von 0 bis 6 (inklusive Dezimalstellen), und zwar von ausschließlich heterosexuellem bis zu ausschließlich homosexuellem Verhalten und Neigung. Seine unauffällig aussehende Skala bildete jeweils den Abschluss des Interviews. Hier ist sie.
Abb. 1: Heterosexuell-homosexuelle Messskala
Es wird hervorgehoben, dass jede Zahl »auf psychologischen Reaktionen und konkreten Erfahrungen« basiert. Erklärt werden muss vielleicht der Begriff »gelegentlich«, den Kinsey bei homosexuellem oder heterosexuellem Verhalten verwendet: Meiner Ansicht nach bedeutet das, jemand hat, hauptsächlich aus Neugier, zufällige oder ungeplante sexuelle Erfahrungen gemacht oder ist einfach total auf eine andere Person abgefahren. Beachten Sie auch, dass sich fünf der sieben Kategorien, ohne dass sie explizit so benannt würden, dem bisexuellen Universum zurechnen lassen.
Im Kontext der Studie entschied letztlich der Interviewer, an welchem Punkt der Skala der Proband einzuordnen war, die Selbsteinschätzung des Befragten wurde jedoch gleichfalls berücksichtigt. Das erscheint mir vernünftig. Freunde sagen mir vielleicht, sie seien — um Kinseys Begriff zu benutzen — ausschließlich heterosexuell, aber da ich ihren sexuellen und emotionalen Hintergrund gut kenne, würde ich sie vielleicht eher unter 1 oder 2 auf der Kinsey-Skala einordnen. Ich übersetze gewissermaßen die Bezeichnung, unter der sie sich selbst sehen (ausschließlich heterosexuell), in das, was ihre Bezeichnung im Kontext anderer Personen mit ähnlichem Verhalten bedeutet.
Im Unterschied zu den Gepflogenheiten der damaligen Forschung, die jeden, der nicht heterosexuell war, sofort als pathologisch einstufte, stellt die Kinsey-Skala alle Zahlenwerte als gleich gut und gesund dar. Ob jemand nun den Wert 0, 1.5, 3.2 oder 6 erreichte, hatte nicht die Konsequenz, dass Kinsey den Betreffenden als mehr oder weniger abweichend von der Norm klassifizierte. Kinsey führte eine Kategorie »X« für alle ein, die keine sexuellen Bedürfnisse hatten oder kein sexuelles Verhalten an den Tag legten (kleiner Gruß an unsere asexuellen Freund*innen). Nach einer langen Vorgeschichte wertender Bezeichnungen war das eine willkommene Neuerung. Kinsey wollte Sexualität lediglich beschreiben und nicht bewerten.
Das zeigt sich auch in seinen damaligen Artikeln. In einem 1941 veröffentlichten Text griff Kinsey andere Wissenschaftler offen wegen ihrer Annahmen und ihres inhärent wertenden Sprachgebrauchs an.14 In einer weiteren kritischen Stellungnahme zerpflückte Kinsey eine Untersuchung, die zu dem Schluss gekommen war, der Hormonspiegel von Hetero- und Homosexuellen unterscheide sich deutlich voneinander. In einer besonders gelungenen Passage formuliert er: »Grundlegender als jeder andere Irrtum, den diese Analyse hervorgebracht hat … ist die Annahme, dass Homosexualität und Heterosexualität zwei einander ausschließende Phänomene seien und sich auf fundamental und, zumindest in einigen Fällen, inhärent unterschiedliche Individualtypen zurückführen ließen.« Mit anderen Worten hielt er den Gedanken für lächerlich, dass Menschen entweder homosexuell oder heterosexuell sind. Diese heterosexuell-homosexuelle Binarität beschreibt — in Kinseys Worten — mitnichten das »tatsächliche menschliche Verhalten«, stattdessen »ist das Bild einer endlosen Intergradation zwischen allen denkbaren Kombinationen von Homosexualität und Heterosexualität zutreffender«.
Kinsey entwickelte diese Ideen auf Grundlage seiner eigenen Forschung. In Das sexuelle Verhalten des Mannes schreibt Kinsey, über die Hälfte der von ihm befragten Männer habe von gleichgeschlechtlichen Wünschen oder Erfahrungen berichtet und liege damit auf der Skala irgendwo zwischen 1 und 6. 1953 veröffentliche Kinsey Das sexuelle Verhalten der Frau und stellte fest, dass 11 bis 20 Prozent der von ihm befragten unverheirateten und 8 bis 10 Prozent der verheirateten Frauen zumindest gleichgeschlechtliche Wünsche oder Erfahrungen in den Jahren zwischen 20 und 35 Jahren aufwiesen. Infolgedessen wurden auch sie zwischen 1 und 6 auf der Kinsey-Skala eingestuft.
Entsprechend verwirft er in einem 1941 veröffentlichten Aufsatz die strikte Einteilung in heterosexuelle und homosexuelle Menschen: »Homosexualität ist kein so seltenes Phänomen, wie allgemein angenommen wird … Jede Verwendung von sogenannten Normalen als Kontrollgruppe … sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass mindestens ein Viertel oder die Hälfte dieser ›Normalen‹ tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens homosexuelle Erfahrungen gemacht haben könnten … und zugleich muss berücksichtigt werden, dass es nur wenige ›Homosexuelle‹ gibt, die nicht zumindest sporadisch und in den meisten Fällen sogar häufig heterosexuelle Erfahrungen gemacht haben.« Diese Arbeit und Kinseys darauffolgende Untersuchungen über die menschliche Sexualität haben das Denken der Menschen über Bisexualität nachhaltig beeinflusst. Sie wirken bis heute nach und manifestieren sich, wenn jemand sagt: Sind wir denn nicht alle ein bisschen bi?
Kinsey stellte also die sexuellen Normen auf den Kopf und war der Ansicht, nicht Heterosexualität, sondern Bisexualität sei der Standard. Der Gender- und Kulturwissenschaftlerin Jennifer Germon zufolge interpretierte »Kinsey Bisexualität als grundlegende Norm, aus der sich Monosexualität ableitet«.15 Sein Ansatz hat die Diskussion über Sexualität verändert, und die Bedeutung dieser Verschiebung blieb nicht unbemerkt. Als er die Skala selbst entwickelte, bezeichnete sogar Kinsey persönlich sie in einem Brief an einen Kollegen durchaus unbescheiden als »das vielleicht wichtigste Instrument zu Weiterentwicklung unseres heterosexuell-homosexuellen Bildes«.16 Sehen wir ihm den Mangel an Bescheidenheit nach — denn schließlich hatte er ja recht. Wie der Autor der Online-Kinsey-Skala 2011 schrieb: »Mehr als 60 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Skala in Das sexuelle Verhalten des Mannes (1948) ist diese von 0 bis 6 reichende Skala immer noch ein wirkungsvolles und beliebtes Instrument, um festzuhalten, wie sich aus dem Verhalten, den Wünschen und der Selbstwahrnehmung einer Person die Marker ihrer sexuellen Identität ableiten lassen.«17
Kinsey ist daher in vielerlei Hinsicht der Großvater aller späteren Tests. Während von seiner einfachen Skala unzweifelhaft eine gewisse Schönheit ausgeht, halten viele sie mittlerweile für etwas unterkomplex, wenn es um Sexualität geht. Um dieses Problem zu beheben und dem vielschichtigen Thema der menschlichen sexuellen Erfahrung gerechter zu werden, wurde schließlich eine neue Messung entwickelt.
Das Klein-Raster
In den Sechzigerjahren gab ein bisexueller Mann namens Fritz Klein eines Tages eine Anzeige in der Village Voice auf. Der Sitz dieser alternativen Zeitung lag damals nur wenige Schritte vom berühmten Stonewall Inn entfernt, eine Schwulenbar in der New Yorker Christopher Street. Kleins Anzeige richtete sich an alle, die sich für das Thema Bisexualität interessierten, und er schlug darin ein gemeinsames Treffen vor.18
Klein praktizierte als selbstständiger Psychiater und hatte sich auf sexuelle Orientierung und Beziehungsprobleme spezialisiert. Er wollte mehr über Bisexualität erfahren. Wie er sich später in einem Interview erinnerte: »Jede Woche kamen bisexuelle Patienten in meine Praxis, und wir diskutierten ihre eigene Bisexualität und über Bisexualität im Allgemeinen … Diese wöchentlichen Treffen entwickelten sich bald zu einer Selbsthilfegruppe mit rund 15—20 regelmäßigen Teilnehmern.« In dieser Zeit schrieb Klein auch sein bekanntestes Buch The Bisexual Option (Die Option Bi) und stellte darin das Klein-Raster vor.19
Regina Reinhardt, einer damaligen Kollegin Kleins, zufolge, »war zu diesem Zeitpunkt, als Dr. Fritz KleinThe Bisexual Option verfasste, weder in der New York Public Library noch dem Index Medicus irgendein Verweis auf Literatur zum Thema Bisexualität zu finden«.20 Schlimmer noch, schreibt sie weiter, »die wenigen Beiträge zu diesem Thema bestritten weitgehend, dass es überhaupt Bisexuelle gab.« Reinhardt, selbst Therapeutin, schrieb 1993, sie empfehle das Buch Patient*innen, die sich im Unklaren über ihre sexuelle Orientierung waren, damit sie, wenn sie erneut eine Therapie begannen, »wissen, dass sie nicht alleine sind, und deutlichere Fragen in Bezug auf sich selbst stellen«.
Die Kinsey-Skala wurde entwickelt, um sexuelles Verhalten zu Forschungszwecken zu klassifizieren. Das Klein-Raster verfolgte einen anderen Ansatz: Es war für Psycholog*innen und deren Patient*innen gedacht und sollte dazu beitragen, Gespräche über Sexualität zu strukturieren. Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen sind die beiden Instrumente daher recht unterschiedlich. Am auffälligsten ist wohl die größere Komplexität des Klein-Rasters. Hier stellen wir es so vor, wie es in Kleins The Bisexual Option erschien (wobei ein winziger Druckfehler korrigiert wurde).
Abb. 2: Kleins Raster der Sexuellen Orientierung
Mithilfe des Rasters können wir unterschiedliche Aspekte der Sexualität genauer erfassen und betrachten, als viele dies sonst — wenn überhaupt — zu tun pflegen. Der erste Punkt (den ich bearbeite, um Ihnen zu zeigen, wie es funktioniert), die Variable A, ist die sexuelle Anziehung. In der Vergangenheit habe ich mich gleicherweise zu Männern und Frauen hingezogen gefühlt, also ordne ich mich hier unter 4 ein. Gegenwärtig fühle ich mich etwas stärker zu Frauen hingezogen, daher wähle ich die 5. Angenommen, es wäre mein Ideal, mich zu allen Geschlechtern gleich hingezogen zu fühlen, würde ich mich bei dieser Variablen unter 4 einordnen.
Ich möchte gern, dass Sie sich jetzt etwas Zeit nehmen und dieses Raster ausfüllen. Es wird Ihnen helfen, auf komplexere Weise über Ihre Sexualität nachzudenken. Hier noch ein paar Tipps:
Die Variablen A und B, sexuelle Anziehung und sexuelles Verhalten, sind aus folgendem Grund aufgeschlüsselt: Sie fühlen sich vielleicht von einem Geschlecht angezogen, hatten aber immer nur sexuellen Kontakt mit einem anderen. Es gibt viele Gründe, warum wir mit Menschen, von denen wir uns nicht angezogen fühlen, Sex haben, nicht zuletzt spielen gesellschaftliche Erwartungen, Gesetze oder Religion dabei eine Rolle. Die Variable C, sexuelle Fantasien, unterscheidet sich von Anziehung. Ihre sexuellen Fantasien sind womöglich viel bi- oder homosexueller als Ihr Verhalten oder die Menschen, von denen Sie sich angezogen fühlen. Das kann sich in den Pornos widerspiegeln, die Sie ansehen, oder den Vorstellungen, zu denen Sie masturbieren.
Variable D, emotionale Vorliebe, fragt danach, wen Sie lieben oder zu wem Sie sich hingezogen fühlen. Diese Variable trägt der Tatsache Rechnung, dass emotionale und sexuelle Anziehung, oder Liebe und Sex, nicht notwendig zusammenhängen. Natürlich können sie auch miteinander verbunden sein, aber das muss nicht sein.
Variable E, soziale Vorliebe, stellt die Frage, mit welchem Geschlecht Sie am liebsten zusammen sind. Vielleicht führt Sie das zu weitergehenden Fragen, etwa warum Sie vielleicht Ihre Zeit bevorzugt mit einem Geschlecht oder dem anderen verbringen oder mit allen Geschlechtern unterschiedslos gern zusammen sind.
Die Variable F Hetero-/Homosexueller Lebensstil ist vielleicht die beste Frage, die ich mir nie gestellt habe, bevor ich dieses Raster entdeckte. Laut Klein wird hier danach gefragt, »bis zu welchem Grad eine Person in einem heterosexuellen Umfeld lebt. Hat er oder sie bisexuelle oder homosexuelle Freunde, geht in homosexuelle Bars oder Clubs und so weiter?« Hier geht es um das soziale Umfeld, das Sie beeinflusst und umgekehrt. Falls Sie nur mit Heterosexuellen zusammen sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie auch sich selbst als heterosexuell sehen. Wenn Sie hingegen queer sind und sich in einer rein heterosexuellen sozialen Gruppe bewegen, fühlen Sie sich möglicherweise isoliert und haben niemanden, mit dem Sie reden oder Ihre sexuellen Interessen teilen können. So oder so ist es meiner Meinung nach aufschlussreich, darüber nachzudenken, mit welchen sozialen Gruppen man zusammen ist und welche Bedeutung das in Bezug auf die eigene sexuelle Identität und Ausdrucksmöglichkeit hat.
Schließlich die Variable G, Selbstidentifizierung. Genau wie Kinseys Skala wird Sexualität zwischen ausschließlich homosexuell und ausschließlich heterosexuell eingeordnet. Mir persönlich gefällt daran, dass mich diese Frage erstmals dazu veranlasst hat, über meine »ideale« Selbstidentifizierung nachzudenken. Nie zuvor hatte ich meine Sexualität als etwas betrachtet, das ich wählen konnte, und daher kam es mir auch nicht in den Sinn, darüber nachzudenken, was ich eigentlich sein wollte. Mir hat die Fragestellung dabei geholfen, meine Ideale und meine Wirklichkeit in Übereinstimmung miteinander zu bringen.
Stimmen Ihre Erfahrungen oder Fantasien und Gedanken mit dem überein, was Sie als »ideal« bezeichnen würden, oder weichen sie stark davon ab? Entspricht Ihr Verhalten in der Vergangenheit Ihrem Verhalten, das Sie sich für die Zukunft wünschen? Stimmen Ihre Selbstidentifikation und Ihr Verhalten überein? Derartige Fragen können Ihnen dabei helfen, das zu erkennen, was Sie in sexueller Hinsicht unglücklich macht und nicht befriedigt.
Für Bisexualität verwendete Klein den Begriff »gesunde Bisexuelle« wenn deren Verhalten, Identität und andere Faktoren miteinander im Einklang waren. Dennoch suchten ihn viele seiner Patient*innen auf, weil sie sich Sorgen wegen ihres Verhaltens oder ihrer Fantasien machten, das Gefühl hatten, sich selbst nicht richtig zu kennen, oder beunruhigt waren, etwas wäre mit ihnen nicht in Ordnung. Viele dieser Gefühle der Unzulänglichkeit, der Scham oder Unzufriedenheit beruhten vor allem auf dem Konflikt zwischen der heterosexuellen Identität einer Person und ihrem bisexuellen Verhalten. Da heterosexuelle Werte in Gesellschaften überall auf der Welt allgegenwärtig sind, sehen sich viele mit diesem Problem konfrontiert. Diese Personen bezeichnet Klein als »verwirrte« Bisexuelle. In einem späteren Kapitel, wenn wir über mentale Gesundheit diskutieren, werden wir uns mit diesem Thema gesondert beschäftigen.
Die Definition von Bisexualität war und ist Gegenstand von Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Im Jahr 2009 sichtete der bekannte Sexualforscher David Halperin die bisexuelle Literatur und stellte fest, dass der Begriff Bisexualität »nach wie vor umstritten« ist.21 Die ständigen Kontroversen haben manche*n zu der Forderung veranlasst, gänzlich auf sexuelle Labels zu verzichten. Darauf erwidert Halperin: »Eine andere Lösung beziehungsweise Nichtlösung könnte darin bestehen, in dieser Dauerkrise der Definition von Bisexualität ein nützliches Mittel zu sehen, das die übergreifende Krise der heutigen sexuellen Definitionen unterstreicht, und sie gewissermaßen als Zeugnis einer Welt zu betrachten, in der unsere Sexualkonzepte nicht dazu taugen, die gesamte deskriptive und analytische Arbeit zu übernehmen, die wir von ihnen erwarten.« Mit anderen Worten: Es ist zwar für die Mehrheit von uns nicht praktikabel, gänzlich auf Labels zu verzichten, aber wir sollten ihnen auch keine allzu große Macht oder Aussagekraft zuschreiben.
Die Diskussion steht im Kontext einer größeren, manchmal als »label wars« bezeichneten Debatte. Das bösartigste Argument lautet, dass Bisexualität trans-exklusiv sei und somit die Gender-Binarität verstärke. Das hat einige Leute dazu veranlasst, den Begriff bisexuell zu verwerfen und sich als pansexuell zu bezeichnen. Aber ist da eigentlich was dran? Unterscheiden sich diejenigen, die sich als pansexuell bezeichnen, von denjenigen, die sich als bisexuell definieren? Eine 2017 veröffentliche Studie der Psychologin Corey Flanders und Kollegen22 stellte fest, dass eine kleine Stichprobe von 18 bis 30 Jahre alten Befragten, die sich einem der beiden Begriffe zuordneten, Bisexualität als Oberbegriff betrachteten, der alle »nichtmonosexuellen Menschen und Identitäten umfasste«. Bemerkenswerterweise befürworten bisexuelle Menschen Gender-Binarität ebenso wenig wie pansexuelle Menschen — bi- und pansexuelle Menschen definierten ihre Sexualität auf dieselbe Weise.
Das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen. Ich bezeichne mich selbst als bisexuell, aber nicht etwa, weil ich denke, ich könnte mich ausschließlich von Männern oder Frauen angezogen fühlen oder mich in sie verlieben. Ich fühle mich zu einer Person hingezogen, ohne dass ihre Genderidentität eine Rolle spielt. Die amerikanische bisexuelle Aktivistin Robyn Ochs hat das, wie ich finde, einmal sehr gut formuliert, als sie 2009 feststellte: »Bisexualität ist das Potenzial, sich gefühlsmäßig und/oder sexuell zu Menschen nicht nur einer [Genderidentität] hingezogen zu fühlen, nicht unbedingt gleichzeitig, nicht unbedingt auf dieselbe Weise und nicht unbedingt im gleichen Maße.«23 In einer Umfrage mit 20 Bisexualitätsforscher*innen, die ich 2021 durchgeführt habe, stellte sich heraus, dass die beliebteste Definition von Bisexualität war: »Fühlt sich von multiplen Genderidentitäten angezogen«, gefolgt von Robyn Ochs’ Definition.
Ich verwende bisexuell oder bi als Oberbegriff, der alle einschließt, die sich als bisexuell, pansexuell, plurisexuell, polysexuell, sexuell fluide und bi-neugierig identifizieren oder eine fragende Haltung dazu einnehmen. Manchmal greife ich auch auf den Ausdruck verhaltensmäßig bisexuell zurück, wenn ich Menschen beschreiben möchte, die sexuelle oder emotionale Beziehungen mit Menschen unterschiedlicher Genderidentitäten haben, sich selbst jedoch nicht als bisexuell identifizieren oder deren sexuelle Identität unbekannt ist.
Ich bin zuversichtlich, dass Sie inzwischen verstanden haben, warum die Antwort auf die Frage Was ist eigentlich Bisexualität? ziemlich vielschichtig und die Frage Wie viele Menschen sind bisexuell? entsprechend schwierig zu beantworten ist. Aber schwierige Fragen haben Forscher*innen noch nie von der Suche nach Antworten abgehalten.
Mittelweg
Wie viele Menschen identifizieren sich heute Ihrer Ansicht nach als bisexuell? Je nachdem, an wen man die Frage richtet und wie die Befragten ihre Zeit verbringen, erhält man wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten. Ich muss mir regelmäßig vor Augen halten, dass weniger Menschen bi sind, als ich intuitiv annehme. Aufgrund der Art und Weise, wie ich in den sozialen Medien vernetzt bin, vergesse ich manchmal, dass Bisexualität keineswegs der Standard ist. Wir alle leben in Blasen, und meine ist nun mal die wunderbare Bi-Blase.
In vielen Ländern — insbesondere denjenigen, in denen Homosexualität kriminalisiert wird — ist es sehr schwierig genaue oder regelmäßige Schätzungen von LGBT+-Gruppen zu erhalten. Und an spezifische Informationen über Bisexualität zu kommen ist sogar noch schwieriger. Dennoch gibt es einige Studien, die wir uns ansehen können. In einer Zusammenfassung von elf Studien, die zwischen den Jahren 2004 und 2010 durchgeführt wurden, mit Stichproben aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien und Norwegen, bezeichneten sich 0,5 bis 3,1 Prozent der Teilnehmer*innen als bisexuell.24 Die Zusammenfassung ergab, dass unter Erwachsenen, die sich als LGBT+ identifizieren, Bisexuelle eine leichte Mehrheit bilden. Außerdem wurde festgestellt, dass bei Weitem mehr Teilnehmer*innen zumindest eine gewisse gleichgeschlechtliche Anziehung bestätigten, nämlich zwischen 1,8 und 11 Prozent in allen Studien. Dies ist eine der wenigen Studien, die uns ein Gefühl für den internationalen Vergleich vermitteln.
Andere Studien geben Aufschluss darüber, inwieweit die Anzahl der Personen, die sich als bisexuell identifizieren, im Lauf der Zeit zugenommen hat. Das Office for National Statistics(Behörde für Nationale Statistik) im Vereinigten Königreich schätzte 2017, dass 2,3 Prozent der 16 bis 24 Jahre alten Bevölkerung sich selbst als bisexuell bezeichnen, während eine nationale Studie des Center for Disease Control and Prevention (eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums) aus dem Jahr 2016 diesen Anteil innerhalb der weiblichen Bevölkerung auf 5,5 Prozent bezifferte und innerhalb der männlichen Bevölkerung auf 2 Prozent. Beide Erhebungen ermittelten, dass Gruppen, die sich als bisexuell identifizierten, zunahmen und in der jüngsten Altersgruppe der Anteil von Personen, die sich als bisexuell bezeichnen, höher ist als der Anteil derjenigen, die sich als schwul oder lesbisch bezeichnen. Diese Ergebnisse stimmen auch mit Forschungen überein, die feststellten, dass sich heute mehr junge weibliche People of Colour als bisexuell bezeichnen als früher.25 Diese Studien erfassen jedoch nur Personen, die sich als bisexuell identifizieren.
Studien haben dieses Manko zu beheben versucht, indem bei Umfragen Menschen im Vereinigten Königreich mittels der Kinsey-Skala und einer Reihe von Anschlussfragen nach ihrer Sexualität befragt wurden. Es ist eine schlaue Idee, mit dieser Skala zu arbeiten, denn wenn wir Personen direkt befragen, ob sie bi- oder homosexuell sind, sagen viele Nein, weil sie sich entweder als heterosexuell identifizieren oder weil sie ihre Identität außerhalb dieser Bezeichnungen verorten (beispielsweise pansexuell, fluid oder ohne Bezeichnung).
Laut den Autor*innen einer 2015 von YouGov (britisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut) veröffentlichten Studie »betrachten die Menschen ihre Sexualität mit jeder Generation als weniger festgelegt. Das Ergebnis der 18- bis 24-Jährigen sticht hier besonders heraus, denn 43 Prozent von ihnen ordnen sich selbst im nicht-binären Bereich zwischen 1 und 5 ein …, der von Kinsey als bisexuell in unterschiedlichen Abstufungen klassifiziert wird.«26 Halten wir fest, dass der Begriff nicht-binär hier nicht vollständig homo- oder heterosexuell bedeutet und keine Beschreibung von Menschen mit nicht-binärer Genderidentität ist. Der Wandel hin zu weniger festgeschriebenen Konzepten der Sexualität zeigt sich auch in der darauffolgenden Studie von YouGov aus dem Jahr 2019.27 Hier wurden Personen befragt, die sich selbst als bisexuell identifizierten. In der Zusammenfassung heißt es: »Als wir die 18 bis 24 Jahre alten Teilnehmer*innen fragten, was ihre Sexualität am besten beschreibe, äußerte 2015 nur einer von 50 (2 Prozent), er sei bisexuell. Unsere neuen Daten zeigen, dass inzwischen einer von sechs (16 Prozent) diese Option wählt — es handelt sich also um eine achtfache Zunahme.« Die Autorin fährt fort: »Mehr Personen als je zuvor identifizieren sich selbst als irgendwo zwischen den Extremen des sexuellen Spektrums liegend.«
Diese Umfrage von YouGov wurde auch in Deutschland,28 Israel29 und den Vereinigten Staaten30 durchgeführt. In allen drei Ländern bezeichnete sich mindestens ein Drittel der jungen Altersgruppe als weder ausschließlich homo- noch heterosexuell und ist damit irgendwo auf dem bisexuellen Spektrum angesiedelt. In allen drei Ländern war es weitaus wahrscheinlicher, dass die jüngeren Befragten und nicht die älteren sich im bisexuellen Spektrum bewegten und sich auch explizit als bisexuell identifizierten. Darüber hinaus bestritten einige der Personen, die sich in einem sexuellen Spektrum einstuften, in allen drei Ländern, dass ein derartiges Spektrum überhaupt existiere.
Ich finde gerade diesen letzten Aspekt besonders aufschlussreich. In ihrer Zusammenfassung der Ergebnisse von 2015 schreiben die Forscher*innen, dass »Menschen generationsübergreifend die Vorstellung akzeptieren, sexuelle Orientierung sei eher ein Kontinuum und keine binäre Entscheidung«, denn 60 Prozent der heterosexuellen und 73 Prozent der homosexuellen Teilnehmer*innen ihrer Studie befürworteten die Vorstellung, dass Sexualität nicht binär sei. Obwohl die meisten der 1632 Studienteilnehmer*innen der Feststellung »Sexualität ist eine Skala — es ist möglich, sich irgendwo in der Nähe der Mitte zu befinden« zustimmten, wählten zwölf Prozent der Heterosexuellen und sieben Prozent der Homosexuellen die Option »Ich weiß nicht«. Außerdem gab es noch eine dritte Wahlmöglichkeit: »Ein Mittelweg existiert nicht — man ist entweder heterosexuell oder homosexuell.« Ich weiß schon, eigentlich sollte mich das nicht schockieren, aber vergebens. Die Studie stellte fest, dass mindestens ein Fünftel der Befragten in beiden Gruppen nicht glaubte, dass Bisexualität existiere: 28 Prozent der Heterosexuellen und 20 Prozent der Homosexuellen waren der Ansicht, es gebe keinen solchen »Mittelweg« die Sexualität betreffend.
Noch erstaunlicher finde ich allerdings, dass eine beträchtliche Minderheit dieser Teilnehmer*innen selbst weder ausschließlich homosexuell noch heterosexuell war. 11 Prozent derjenigen, die sich auf der Kinsey-Skala