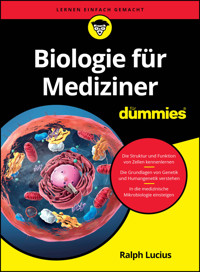
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Was die Menschenwelt im Innersten zusammenhält – und darüber hinaus
Die Biologieveranstaltung steht an und Sie sind noch auf der Suche nach begleitender Lektüre? Dann ist dieses Buch das richtige für Sie. Der Autor beginnt im Kleinen und erklärt Ihnen den Aufbau einer eukaryotischen Zelle, den Zellzyklus, den Zelltod und die Zellkommunikation. Danach erläutert er die Grundlagen von Genetik und Humangenetik und führt Sie in die medizinische Mikrobiologie sowie die Parasitologie ein. Dabei orientiert er sich am Gegenstandskatalog des IMPP, ohne sich in ein starres Korsett zwängen zu lassen. So ist dieses Buch Ihr freundlicher, lehrreicher Begleiter durch ein spannendes Fach.
Sie erfahren
- Wie Struktur und Funktion von Zellen zusammenhängen
- Was es mit den Organellen auf sich hat
- Was hinter Mutationen steckt
- Was es über Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten zu wissen gibt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Biologie für Mediziner für Dummies
Schummelseite
AUFBAU DER ZELLE
Zellorganell/Zellstruktur
Aufbau
Aufgaben
Spezielles
Zellkern
Doppelmembran mit Kernporen und Kernlamina,
Erbsubstanz DNA in Form des Chromatins/der Chromosomen
Nukleolus
Träger der Erbsubstanz,
»Kommandozentrale«
Aufbau der Ribosomen,
»Ribosomenfabrik«
Kernim- und -export (»Importine, Exportine«)
Endoplasmatisches Retikulum (ER)
Raues ER
Glattes ER
Netzförmiges System membranumhüllter Schläuche, Röhren und Säckchen
An der Außenseite mit Ribosomen
Keine Ribosomen
Transportsystem für Proteine und andere Stoffe in der Zelle, Bildungsort neuer Membranteile
Proteinbiosynthese und -faltung, überwiegend Proteine für die »Exportindustrie«
Lipid-, Steroidsynthese
Sonderform: sarkoplasmatisches Retikulum in der Muskulatur (Kalziumspeicher)
Golgi-Apparat
Stapel flacher, membranumgrenzter Reaktionsräume (Dictyosomen), in der Peripherie Golgi-Vesikel
Zentrale Verteilerstation (Sortierung, Verpackung und Modifizierung von Proteinen), Abgabe in Golgi-Vesikeln
Aufnahme (Cis-)Seite und Abgabe (Trans-)Seite,
Mannose-6-Phosphat-Markierung für lysosomale Proteine
Mitochondrien
Doppelmembran:
Innere und äußere Membran, dazwischen intermembranöser Raum, innen Matrixraum
»Kraftwerke« der Zelle, u. a. ATP-Synthese
Endosymbionten-theorie,
Porine in der äußeren Membran, eigene DNA (mtDNA)!, teilungsfähig
Lysosomen
Membranumgrenzte, unregelmäßig geformte Vesikel mit Verdauungsenzymen (»Saure Hydrolasen«)
Abbau von aufgenommenen Biomolekülen, Abbau von zelleigenen Bestandteilen (Autophagie)
pH von 4,5 - 5 im Inneren, Lysosomale Speichererkrankungen bei Enzymdefekten, Telolysosomen
Peroxisomen
Meist rundlich-kugelige, membranumgrenzte kleine Organellen
Abbau zellulärer Metabolite (z.B. Fettsäuren, Ethanol) durch Oxidasen und Katalasen
Leitenzym: Katalase
Besonders zahlreich in Leberzellen
Zytoskelett:
Mikrofilamente
Intermediärfila-mente
Mikrotubuli
Dreidimensionales Netzwerk aus Proteinfilamenten oder Röhren
Stabilisierung der Zellform,
Zellbewegung (Aktin),
Transportschienen für Organellen und Aufbau der Mitosespindel (Mikrotubuli)
Tumordiagnostik (Intermediärfilamente)
Zellteilungsgifte
Ribosomen
Ohne Membran, aus zwei Untereinheiten aus RNA und Proteinen,
an das rER perlschnurartig gebunden als Polyribosomen
Als freie Ribosomen in kleinen Gruppen im Zytoplasma
Proteinbiosynthese am rER überwiegend für den Export
Synthese zelleigener Proteine
Eukaryoten: 80S-Ribobomen (aus 60S + 40S Untereinheiten)
Prokaryoten: 70S-Ribosomen (aus 50S + 30S Untereinheiten)
Plasma-, Zellmembran
Phospholipid-Doppelschicht, darin eingelagert Proteine mit unterschiedlichen Funktionen, Cholesterin
Barriere (selektive Permeabilität, Abgrenzung zum Extrazellularraum),
Ionenpumpen,
Kanal- und Transportproteine,
Rezeptorfunktion
»fluid mosaic model«
Fusionsmöglichkeiten (Endo-, Exozytose)
Zytoplasma
Besteht zu 80 – 85 % aus Wasser, zu 10 – 15 % aus Proteinen, zu 2 – 4 % aus Lipiden, wenig Kohlenhydraten (ca. 1 %), etwas DNA (0,4 %), RNA 0,7 % sowie kleinen organischen und anorganischen Molekülen
Grundsubstanz der Zelle, Reaktionsraum für verschiedene Stoffwechselprozesse, Transportfunktion
pH-Wert ca. 7,4
Konsistenz wechselnd zwischen Gel- und Sol-Zustand
MIKROBIOLOGIE
Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Mikroorganismen (ohne Parasiten)
Merkmal/Eigenschaft
Viren
Bakterien
Pilze
Spezielles
Größe
20 – 150, selten bis 400 nm
Meist 1 – 10 μm
Einzellige Hefen 5 – 10 μm, Schimmelpilze u. a. bis zu einigen Zentimetern
Viren lichtmikroskopisch nicht erkennbar
Genom
DNA oder RNA
DNA (meist zirkulär), Plasmide
DNA
Besitz von Zellorganellen
nein
nein
Ja (Eukaryoten!)
Vermehrung
Innerhalb einer Wirtszelle (obligat intrazellulär)
Durch Zweiteilung
Überwiegend ungeschlechtlich über Sporen, durch Sprossung, selten geschlechtlich
Zellhülle/Abgrenzung
Manchmal Lipidhülle, Proteinhülle als Kapsid
Zellwand
(Mureinsacculus aus Proteoglycanen)
Zellwand aus Cellulose, Chitin, Glucanen u. a.
Bakterien ohne Zellwand: Mykoplasmen, Ureoplasmen
Zellkern
nein
Kernäquivalent Nukleoid
Ja
Ribosomen
nein
70S
80S (Eukaryoten)
Organisationsform
subzellulär
Einzeller
Ein- und Vielzeller
EINTEILUNG NACH DEM GRAM-FÄRBEVERHALTEN UND DER BAKTERIENFORM
Gram +
Gram –
Kokken
Stäbchen
Diplokokken
Stäbchen
Staphylokokken, Katalase +
Clostridien
Neisseria
Enterobakterien (E. coli, Klebsiellen, Salmonellen, Shigellen, Yersinien u. a.)
Streptokokken, Katalase -
Listerien
Kokkoide Stäbchen (Pasteurellen, Haemophilus, Brucellen, Bordetellen)
Corynebakterien
Weitere Stäbchen (Vibrionen, Helicobacter, Pseudomonaden, Campylobacter u. a.)
Bacillus
Actinomyces
Nocardia
ATYPISCHES GRAM-FÄRBEVERHALTEN:
Intrazellulär: Rickettsien, Chlamydien
Spirochäten: Treponema, Borrelien, Leptospira
Zellwandlose Bakterien: Mykoplasmen
PARASITOLOGIE
Parasitische Protozoen (einzellige Parasiten)
Merkmal
Besonderheiten
Größe
1 – 150 μm
Genom
DNA, weil Eukaryota
Organellen
Vorhanden
Teilweise spezielle Organellen, die anderen Eukaryoten fehlen, aber auch sekundärer Verlust von Organellen
Ernährung
Heterotroph (Aufnahme von Nährstoffen durch die Zellmembran)
Lebensform
Frei lebend, im Blut, im Gewebe, intrazellulär
Dauerstadien (Zysten, Oozysten)
Infektionswege
Vielfältig: über kontaminierte Nahrung/Wasser, Insektenstiche, Geschlechtsverkehr
Circa 40 Arten sind humanpathogen (z. B. Malaria, Chagas-Krankheit, Toxoplasmose, Schlafkrankheit, Amöbenruhr)
Diagnose
Mikroskopisch durch Blut-, Stuhl-, Vaginalsekret oder Gewebeuntersuchung (Giemsa-Färbung)
Immunologische und molekulargenetische Untersuchungen
Schnell, günstig
Aufwendig und teuer
Therapie
Prävention
Häufig Metronidazol oder Tinidazol
Hygiene, Moskitonetze
Bei Malaria aufgrund von Resistenzen gegen Chloroquin Artemisinin-Kombitherapie
Vermehrung
Einige Formen mit Generationswechsel, manche durch Zwei- oder Vielteilung
PARASITISCHE WÜRMER (HELMINTHEN)
Zur Erinnerung: Man unterscheidet Saugwürmer (Trematoden), Bandwürmer (Cestoden), Rund-, Fadenwürmer (Nematoden)
Merkmal
Besonderheiten
Größe
2 – 3 mm bis 10 m (oder mehr)
Zwergfadenwurm, Fuchsbandwurm wenige Millimeter, Rinder-, Schweine-, Fischbandwurm mehrere Meter groß
Ernährung
Aufnahme von Nährstoffen durch die Körperoberfläche
Aufnahme von Nährstoffen über den Darm
Bandwürmer
Saug- und Rundwürmer
Lebensform
im Blut, im Darm (intestinal) und anderen Organen, im Gewebe
Dauerstadien (Zysten, Oozysten)
Infektionswege
Vielfältig: Aufnahme von Eiern oder Larven über kontaminierte Nahrung/Wasser (fäkal-oral)
Insektenstiche
Aktive Penetration der Haut
Etwa 150 Arten sind humanpathogen
Filarien
Hakenwürmer, Zerkarien von Saugwürmern
Diagnose
Mikroskopisch durch Blut-, Stuhl-, Urin-, Sputum- oder Gewebeuntersuchung
Großes Blutbild
Immunologische und (selten) molekulargenetische Untersuchungen
Adulte Würmer oder Proglottiden von Bandwürmern
Hohe Variabilität des richtigen Diagnose-Zeitpunkts
Sehr oft Eosinophilie!
Nachweis von spezifischen Antikörpern, DNA
z. B. Madenwurm
Therapie
Prävention
Band- und Saugwürmer: häufig Praziquantel
Rundwürmer: Mebendazol, Albendazol, Ivermectin
Hygiene, Abkochen/Erhitzen von Nahrung/Getränken
Manchmal selbstlimitierend
Fleischbeschau (Rinder-, Schweinebandwurm, Trichinen)
Vermehrung
Produktion von Eiern oder Larven, häufig über Zwischenwirte, getrennt geschlechtlich oder Zwitter
Saugwürmer (Ausnahme Pärchenegel) und Bandwürmer zwittrig, Rundwürmer getrennt geschlechtlich
Biologie für Mediziner für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: Christoph Burgstedt - stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-71912-9ePub ISBN: 978-3-527-83624-6
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Konventionen in diesem Buch
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Danke
Teil I: Biologie der Zelle
Kapitel 1: Die Zelle – Mikroskopisch klein … und doch ein Riese
Der Zellbegriff – Ein Ausflug in die Geschichte
Prokaryoten und Eukaryoten
Kapitel 2: Expedition in den Mikrokosmos »Zelle«
Bleib mir vom Leibe – Die Zell- oder Plasmamembran
Austausch und Kommunikation – Die Rolle der Membranproteine
Innenansichten einer Zelle – Das Endomembransystem
Ordnung ist das halbe Leben – Die Organisation des Chromatins
Ein Schwimmbad für Organellen – Das Zytosol
Schläuche und kleine Netze – Das endoplasmatische Retikulum
Wo bitte geht es zur Hauptpost? – Der Golgi-Apparat
Energie ist alles – Die Mitochondrien
Zelluläre Fossilien – Die Peroxisomen
Sauer macht lustig – Die Lysosomen
Kapitel 3: Der Weg in die Zelle
Feed me – Die verschiedenen Arten der Endozytose
Das zelluläre Endlager – Lysosomale Speicherung
Nix wie raus hier – Die Exozytose
Lasst mich mal durch, bitte – Die Transzytose
Kapitel 4: Ein hochdynamisches System – Das Zytoskelett
Das Aktinfilamentsystem – Ein ständiger Wechsel von Umbau und Zerfall
Es geht dynamisch weiter – Mikrotubuli (MT) und ihre Motorproteine
Jetzt wird’s stressig – Intermediärfilamente und Septine
Kapitel 5: Live and let die – Der Lebenskreislauf einer Zelle
Farbige Körper im Zellkern – Die Chromosomen
Immer (?) im Kreis herum – Der Zellzyklus
Kapitel 6: Viele Arten zu sterben – Der Zelltod
Die Nekrose – Hilfe, ich zerfließe!
Die Apoptose – Es fällt ein Blatt vom Baum
Kapitel 7: Kommunikation ist (fast) alles – Wie Zellen sich verständigen
Signale senden und empfangen
Teil II: Vom Erbsenzählen zur quantitativen Genetik
Kapitel 8: »Mendeln« wir mal ein wenig …
Die Anfänge der Genetik
Formale Genetik
Jetzt wird vererbt … und berechnet
Von den Pflanzen zu den Menschen
Epigenetik und genomische Prägung/Genomic Imprinting
Kapitel 9: Ein Mikroskop bitte – Chromosomen unter der Lupe
Chromosomenfärbung – GTG-Bänderung
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Populationsgenetik – oder: Hardy plus Weinberg
Kapitel 10: Mutationen – Veränderungen als Motor der Evolution
Mechanismen der Mutationsentstehung
Kapitel 11: DNA und RNA
Modellbauer unter sich – Struktur und Funktion der DNA
Das doppelte Lottchen – Die DNA-Replikation
Kapitel 12: Abschreiben erlaubt – Die Transkription der DNA
Die Schritte der Transkription
Drei lang, drei kurz – Der genetische Code
Übersetzer*in gesucht – Die Translation
Regulation der Genexpression
Wo steckt es denn nur? – oder: Die Kartierung von Genen
Vorhanden, aber unnötig? – Nicht-codierende DNA
Erna hat auch Gene – Die RNA-Gene
Genome Editing
Der Prokaryot in uns – Das mitochondriale Genom
»Multi-Omiks« – oder: Die Erweiterung des Wissens
Teil III: Mikrobiologie
Kapitel 13: Bakteriologie
Unser Körper – Ein Bakterienmutterschiff
Zellen ohne Zellkern – Die Prokaryoten
Prinzipien der Bakteriengenetik
Pathogenität von bakteriellen Infektionserregern
Kapitel 14: Pilze (Fungi)
Lebensweise
Morphologie der Pilze
Pilzerkrankungen und Pilzgifte
Pilze als Heilmittel
Kapitel 15: Hier geht was viral – Einführung in die Virologie
Aufbau der Viren – Klein, aber fein
Aus wenigen viele machen – Grundzüge der viralen Replikation
Karzinogene Viren und virale Onkogenese
Einmal umschreiben bitte – Die Retroviren
Ein Haufen seltsamer Gestalten – Die Virusklassifikationen
Es geht noch kleiner – Die Viroide und Virusoide
The Dark Side of Proteins – Fehlgefaltete Proteine als Krankheitserreger
Früher oder später kriegen wir euch – Die Virusdiagnostik
In aller Munde: Das Mikrobiom – oder: Wir sind nicht allein
Teil IV: Parasitologie
Kapitel 16: Parasiten – Die heimliche Macht
Spannung ohne Ende – Das Phänomen Parasitismus
Kleine Ursache – meist große Wirkung: Protozoa
Zusammenfassende Betrachtung in der Diagnostik parasitischer Protozoa
Kapitel 17: Helminthen
Saugwürmer (Trematoden)
Bandwürmer (Zestoden)
Nematoden (Fadenwürmer)
Kapitel 18: Das große Krabbeln – Ektoparasiten
Arachnida (Spinnentiere) – Milben und Zecken
Insecta (Insekten) – Zwei Beine weniger
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 19: Zehn beeindruckende Entwicklungsschritte der Biowissenschaften (… und weil das nicht ausreicht, noch sehr viele Entdeckungen dazu)
Wo und wann Begriff und Denken entstanden
Früh übt sich …
Siesta in der Wissenschaft
Viva la Revolution!
Biologie in Zeiten der Aufklärung
Technik und Chemie – Hand in Hand
Da wäre dann noch diese Doppelhelix
Weiter, immer weiter … und ohne Siesta
Verrücktes und Seltsames – Ausgewählte Beispiele
Ein Ausblick zum Schluss
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Wichtige Unterschiede zwischen Pro- und Eukaryoten
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Richtwerte der intra- und extrazellulären Ionen-/Elektrolytkonzentra...
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Erbliche lysosomale Speicherkrankheiten
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Zytoskelettkomponenten einer Zelle
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Hauptunterschiede zwischen Mitose und Meiose
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Unterschiede der Replikation bei Pro- und Eukaryoten
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Genomgrößen und Genanzahl einiger Pro- und Eukaryoten
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Wichtige Unterschiede zwischen Pro- und Eukaryoten
Tabelle 13.2: Wichtige humanpathogene Bakterien und die durch sie verursachten E...
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Die wichtigsten Protozoen und die Krankheiten, die sie beim Mensche...
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Hauptinfektionswege und -quellen für den Befall mit Helminthen
Tabelle 17.2: Wohn-/Aufenthaltsorte einiger Helminthen oder Larven
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Ektoparasiten und durch sie übertragene Erreger und Erkrankungen
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
9
10
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
323
324
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
Über dieses Buch
Als mich der Verlag mit der Frage kontaktierte, ob ich ein Buch mit dem Titel »Biologie für Mediziner« verfassen und im inzwischen bewährten Dummies-System publizieren möchte, habe ich nicht lange überlegt – auch wenn es bereits einige Lehrbücher zum Thema gibt. Und natürlich hat mich auch die Frage beschäftigt, ob in Zeiten von Internet, 24/7 abrufbaren Videos, Apps und Co. der Bedarf und die Leserschaft für ein solches, gedrucktes Buch vorhanden sind. Letztlich habe ich die Frage für mich mit einem eindeutigen »Ja« beantwortet. Denn die Biologie ist so vielfältig und spannend (und täglich gibt es neue Entdeckungen), dass dieses Buch hoffentlich nicht nur die primäre Zielgruppe der Medizin- und Zahnmedizinstudierenden anspricht, sondern fächerübergreifend oder auch für interessierte Laien eine Einladung darstellt, sich mit diesem faszinierendsten Fach der Lebenswissenschaften zu befassen.
Die oben zunächst genannte potenzielle Leserschaft wird in den ersten Semestern ihres Studiums mit der Biologie Bekanntschaft machen (müssen) und im 1. Staatsexamen dazu geprüft. Prüfungsinhalte sind – wie auch in der geplanten Novellierung der Ärztlichen Approbationsordnung (Einführung geplant für Herbst 2027) vorgesehen und im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) hinterlegt – Verknüpfungen des biomedizinischen Grundlagenwissens mit klinischen Inhalten (Trennung von Vorklinik und Klinik soll aufgehoben werden, longitudinales Studium). Daher finden sich immer wieder klinische Hinweise im Buch. Ausgehend von einer sehr heterogenen Gruppe mit ebenso heterogenen Vorkenntnissen über die in diesem Buch behandelten Kapitel zur Zellbiologie, Genetik, Mikrobiologie und Parasitologie kann und will dieses Buch nicht allumfassend gestaltet sein, sondern legt den Schwerpunkt vor allen Dingen auf die Grundlagen und Kernthemen, aber immer – wenn auch nicht umfassend möglich – mit einem Blick auf die medizinisch relevanten Sachverhalte sowie die Anforderungen, die im aktuell gültigen Gegenstandskatalog für das Studium der Humanmedizin hinterlegt sind. Aber auch vor dem Hintergrund der geplanten neuen Approbationsordnung und einem überarbeiteten Gegenstandskatalog für Medizin sind einige mögliche Inhalte bereits integriert. Ein Hinweis sei dennoch erlaubt: Die Grundlagen bleiben meist konstant, aber kaum ein anderes Fach verändert sich so schnell durch täglichen Erkenntnis- und Wissensgewinn wie die Biologie.
Zielpublikum sind außer den oben genannten Lernenden alle Neugierigen, Interessierten und Wissbegierigen, die ein Grundverständnis in Biologie, aber kein tiefes biomedizinisches Vorwissen mitbringen sollten, wenn Sie sich auf dieses Buch einlassen möchten. Seien Sie einfach nur neugierig und lassen Sie sich nicht täuschen: Nach einem eher gemächlichen oder ruhigen Einstieg heißt es »Bitte anschnallen und das Rauchen einstellen« – der Zug nimmt Fahrt auf!
Es ist naheliegend und unumgänglich, dass Fachbegriffe eingesetzt werden. Aber diese werden bei der ersten Verwendung erklärt. Um Inhalte besonders hervorzuheben, finden Sie diese im Fettdruck oder kursiv gedruckt.
Unstrittig ist auch, dass den geneigten Lesenden auch ein gesundes Maß an Konzentration (und anfangs auch Frustrationstoleranz) hilfreich zur Seite stehen kann, um tiefer in die Materie einzutauchen.
Erleichtert wird der Zugang zu den teilweise sehr komplexen Inhalten durch Bilder und/oder teils aufwendige, teils simple grafische Darstellungen, sodass es in diesem Buch viele Abbildungen gibt.
Schlussendlich hoffe ich natürlich, dass durch dieses Buch ein nachhaltiges Interesse an biomedizinischen Fragestellungen geweckt werden kann.
Törichte Annahmen über den Leser
Warum haben Sie dieses Buch zur Hand genommen? Mit einer einigermaßen hohen Trefferquote (Irrtümer nicht ausgeschlossen) geht der Buchautor davon aus, dass Sie
Studierende der Medizin und/oder Zahnmedizin oder eines anderen lebenswissenschaftlichen Fachs sind
Neugierde Sie antreibt und Sie ein Interesse an biomedizinischen Fragestellungen mitbringen
Wissen erwerben wollen, das Sie unter Umständen in Ihrem Studium (Biologie braucht man immer …) oder auch für die Schule anwenden können
vor einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung den Stoff noch einmal schnell wiederholen wollen
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Gegliedert in fünf Teile mit einer in Anlehnung an den Gegenstandskatalog vorgegebenen Asymmetrie in Seitenzahl und Gewichtung können Sie anhand der folgenden Kurzbeschreibung (oder auch mit dem Inhaltsverzeichnis) Ihre persönliche Studien- und Lernstrategie festlegen.
Teil I – Biologie der Zelle
In diesem Teil finden Sie nach einem kurzen Rückblick in die Historie eine umfangreiche Reiseroute in das Innere der Zelle und erfahren teilweise spezielle Details über ihren Aufbau und ihre Funktion und ihre Einrichtungen wie die Plasmamembran oder die Organellen. Es empfiehlt sich, mit der Lektüre dieses Abschnitts zu beginnen, da Sie die nachfolgenden Teile dann vermutlich besser verstehen werden.
Teil II – Genetik
In Teil II erfolgt eine ausführliche Beschäftigung mit den Grundlagen der Genetik. Sie erfahren etwas über die Mendel-Gesetze, lernen, die Grundlagen der Bewertung der Pathogenität von somatischen und die Keimbahn betreffenden genetischen Varianten zu benennen, Stammbäume zu erstellen und zu interpretieren und bei der Interpretation humangenetischer Befunde anzuwenden.
Teil III – Mikrobiologie
Dieser Teil handelt von Bakterien, Viren und Pilzen. Diese Mikroorganismen werden zunächst allgemein in den jeweiligen Kapiteln mit ihren biologischen Charakteristika vorgestellt, um nachfolgend die Erreger und von ihnen ausgelöste Infektionskrankheiten abzuhandeln. Außerdem erfahren Sie auch etwas über Nachweismethoden, um den Erreger zu identifizieren. Beachten Sie aber bitte, dass dieser Teil – wie die anderen Teile auch – kein spezielleres Lehrbuch zum Thema ersetzen kann.
Teil IV – Parasitologie
Dieser Abschnitt wurde bewusst aus dem Teil III herausgetrennt, um ihm mehr Raum aufgrund der zunehmenden medizinischen Bedeutung zu geben. Üblicherweise wird die Parasitologie in der Medizinischen Mikrobiologie zu finden sein, fristet dort aber eher ein Stiefmütterchen-Dasein. Außerdem verbindet dieser Teil wie kaum ein anderer Inhalt dieses Buches die Biologie (der Parasiten) mit medizinisch relevanten Sachverhalten – den durch Parasiten verursachten Erkrankungen des Menschen. Nach einer allgemeinen Einführung in die Parasitologie werden Ihnen die wichtigsten humanparasitologischen Vertreter – basierend auf ihrer Einordnung in die zoologische Systematik beginnend mit den einzelligen Erregern – in ihren Entwicklungszyklen und den durch sie verursachten Erkrankungen vorgestellt. Ergänzend finden Sie Tipps zur (teilweise simplen) Diagnostik und zur Therapie. (Bitte beachten: Diese kann sich eventuell sehr schnell ändern!)
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass diesem Teil auch durch die Spezialinteressen (man kann es auch Hobby nennen) und dem Berufsweg des Autors eine zusätzliche Bedeutung beigemessen wird.
Teil V – Der Top-Ten-Teil
Traditionell bildet dieser Teil den Schluss der Reihe. Hier finden Sie – rein subjektiv durch den Autor vorgegeben – ausgewählte oder faszinierende Themen der Biologie, die vielleicht eine Motivation liefern, sich über die in diesem Buch erwähnten Inhalte hinaus mit dem höchst abwechslungsreichen Stoff zu beschäftigen.
Konventionen in diesem Buch
Die Inhalte der Vorlesung oder auch des Praktikums »Biologie für Mediziner« variieren von Universität zu Universität und von Lehrperson zu Lehrperson. Der rote Faden in diesem Buch bildet daher weitestgehend die Themenabfolge im Gegenstandskatalog ab, ohne diesen sklavisch zu kopieren. Die eingesetzten Symbole helfen Ihnen, Wichtiges zügig zu erkennen, oder rufen Ihnen Kernaussagen in Erinnerung.
Aber bitte vergessen Sie nicht: Teilgebiete der Biologie haben sich in den letzten Jahren so rapide fortentwickelt, spezialisiert und eigene Studiengänge hervorgebracht (unter anderem Molekularbiologie, Biochemie, Zellbiologie, Molekulare Medizin), dass es deutlich mehr in die Tiefe gehende Fachlehrbücher zu diesen Themen gibt.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wenn Sie schon einmal mit einem Buch der … für Dummies-Reihe in Berührung gekommen sind, werden Ihnen einige Symbole bekannt sein. Für Neulinge (aber nicht nur diese) folgt hier eine Erklärung dazu:
Hier finden Sie Erläuterungen/Ergänzungen zu vorab genannten Inhalten.
Dieses Symbol weist auf zentrale Kernaussagen hin, die man sich merken sollte.
Dieses Symbol kündigt Hintergrundinformationen zum Vertiefen eines Sachverhalts an.
Dieses Symbol weist auf einen potenziell lebensgefährlichen Aspekt hin. Unbedingt beachten!
Dieses Symbol steht bei kurzen, knappen Lernhilfen.
Hier finden Sie Historisches (und manchmal Amüsantes) zu ausgewählten Inhalten des Kapitels.
Hier geht es um Verwechslungsmöglichkeiten oder speziellere, wichtige Sachverhalte
Bei diesem Symbol finden Sie die Erklärung eines Begriffs in knapper Form.
Danke
An alle Lektorinnen, die mit wertvollen Hinweisen und Korrekturen an diesem Buch mitgearbeitet haben: Katharina Hemschemeier und Petra Heubach-Erdmann.
An Frau Irina Nünning aus dem Anatomischen Institut der CAU zu Kiel, die einige der Graphiken erstellt hat.
An Herrn Marcel Ferner von Wiley-VCH, der die Erstellung dieses Buches in allen Phasen begleitet, Tipps und Tricks vermittelt und viel Geduld bewiesen hat.
An Frau Prof. Dr. Renate Lüllmann-Rauch(†) für die Erlaubnis zur Nutzung der elektronenmikroskopischen Aufnahmen aus ihrem schier unermeßlichen Fundus.
Teil I
Biologie der Zelle
IN DIESEM TEIL …
Exkursion in die VergangenheitDer Begriff der ZelltheorieWichtige Meilensteinen der Zellforschung.Grundlegende Unterschiede zwischen pro- und eukaryotischen Zellen kennenStruktur und Funktion der eukaryotischen ZelleKommunikationsmöglichkeiten von ZellenDie Zellvermehrung und der unausweichliche ZelltodKapitel 2
Expedition in den Mikrokosmos »Zelle«
IN DIESEM KAPITEL
Plasmamembran: Barriere zur AußenweltMolekültransport durch die PlasmamembranMembranproteine: Pumpen, Rezeptoren, Kanäle, Carrier und mehrIntrazelluläre KompartimentierungWenn Sie dieses Kapitel durcharbeiten, können Sie faszinierende Einblicke in den Mikrokosmos Zelle gewinnen und sind gut gerüstet für wichtige Fragen, die Ihnen – zu welcher Gelegenheit auch immer – gestellt werden können. Machen Sie sich aber trotzdem klar, dass unser Wissen nur den letzten – kaum aber den endgültigen – Stand erfassen kann.
Bleib mir vom Leibe – Die Zell- oder Plasmamembran
Die Zellmembran, auch Plasmamembran oder Zellplasmalemma genannt, ist eine lebenswichtige strukturelle Komponente jeder Zelle. Sie grenzt das Zytoplasma zum Extrazellularraum (der »Außenwelt« der Zelle) hin ab und erlaubt aufgrund ihres Aufbaus einen streng geregelten, selektiven Stoffaustausch. Außer der Regulation des Stoffaustauschs zwischen der Zelle und ihrer Außenwelt sind intrazelluläre Membranen an der Abgrenzung verschiedener intrazellulärer Reaktionsräume – den Zellorganellen – beteiligt. Die Plasmamembran passt sich sehr gut jeder Formveränderung der Zelle an und ist eine hochkomplexe, dynamische Struktur (Flüssig-Mosaik- oder Singer-Nicolson-Modell). Die Integrität der Plasmamembran ist essenziell für das Überleben einer Zelle. Somit hat sie viel mehr Aufgaben als nur die der Abgrenzung zur Außenwelt – sie reguliert praktisch alle Wechselbeziehungen zwischen einer Zelle und ihren Nachbarn sowie der zellulären Umgebung. Ermöglicht wird das durch die einzigartige Bauweise aus Phospholipiden, Cholesterin, Glykolipiden und Proteinen.
Grundstruktur der Zellmembran
Die Grundstruktur einer Zellmembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht, deren Hauptanteile Phospholipide sind. Lipidmoleküle machen etwa 50 Prozent der tierischen Zellmembranen aus; der Rest besteht fast ausschließlich aus Proteinen. Phospholipide zeigen folgenden Aufbau: Das hydrophile (wasserliebende) Köpfchen besteht aus einer negativ geladenen Phosphatgruppe (Phosphorsäure- Gruppe) und Cholin, an das zwei hydrophobe (wasserabweisende) Fettsäureketten/- reste verknüpft sind (Abbildung 2.1). Solche Moleküle werden amphiphil (»doppelliebend«) genannt. In wässrigem Milieu lagern sich die Phospholipide spontan zu einem Film zusammen, der Lipiddoppelschicht. Die hydrophoben Fettsäurereste sind im Inneren der Phospholipid-Doppelschicht zu finden, während die hydrophilen Phosphatköpfchen zur wässrigen Umgebung (Extrazellularraum und/oder Zytoplasma) gewandt sind.
Abbildung 2.1 Aufbau der Plasmamembran (zvitaliy79 - stock.adobe.com)
Die Dicke der Phospholipid-Doppelschicht lässt sich mittels der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) bestimmen und beträgt ca. 5 bis 10 nm (Abbildung 2.2).
Abbildung 2.2: Elektronenmikroskopische Aufnahme der Plasmamembran mit deutlich sichtbarer Lipiddoppelschicht (innere, helle Schicht: hydrophile Anteile, äußere, dunkel gefärbte Schichten: hydrophile Bereiche, Aufnahme: R. Lüllmann-Rauch, Kiel)
Detailstruktur der Zellmembran
Die Plasmamembran besitzt einen asymmetrischen Aufbau: Die dem Zellinneren (Zytosol) oder Zellorganell zugewandte Oberfläche unterscheidet sich stark von der nach außen (extrazellulär) orientierten Seite. Hier findet man mit Zuckermolekülen aufgebaute Seitenketten an Proteinen, die dann entsprechend als Glykoproteine bezeichnet werden. Auch findet man hier einige zuckerhaltige Lipidmoleküle, die sogenannten Glykolipide. Manche Glykolipide spielen eine Rolle als Eintrittspforten oder Erkennungsstrukturen für bakterielle Toxine (zum Beispiel das Choleratoxin) oder Viren. Da die meisten Plasmamembranproteine zur Außenseite hin glykolisiert sind, bildet sich eine filzartige Schutzschicht gegen mechanische oder chemische Schäden an der Außenseite der Zelle, die als Glykokalix (= Zuckermantel) bezeichnet wird (Abbildung 2.3).
Abbildung 2.3 Asymmetrischer Aufbau der Plasmamembran mit außen liegender Glykokalix (Glykoproteine, Glykolipide) (Quelle: designua - stock.adobe.com)
Die Glykokalix ist art- und zellspezifisch in ihrer Zusammensetzung und spielt auch eine wichtige Rolle in der Zelladhäsion sowie der Zell-Zell-Erkennung (zum Beispiel Blutgruppenantigene). Außerdem sorgt sie aufgrund zahlreicher anionischer Reste für eine negative Ladung der Zelloberfläche.
Zu den wichtigen Glykoproteinen gehören die Lektine, die bei verschiedenen biologischen Prozessen eine Rolle spielen, darunter Zell-Zell-Erkennung, Immunantworten und Entzündungsreaktionen.
Die Asymmetrie der Membran ist insbesondere wichtig für die Signalübertragung von außen in das Zellinnere, in dem dann Bindungsstellen an der Membraninnenseite für zytosolische (Signal-)Proteine dafür sorgen, dass die Signale in das Zellinnere weitergeleitet werden. Dazu erfahren Sie später mehr.
Aus dem oben geschilderten Grundbauplan kann man auf einige wichtige Eigenschaften der Plasmamembran schließen:
Durch die Lipidfilm-Struktur ergibt sich die hohe Flexibilität der Membran, da sich Moleküle darin seitlich frei bewegen können (laterale Diffusion, Fluidität der Biomembran). Diese Fähigkeit ist temperaturabhängig. Wenn Fette zu sehr abkühlen (denken Sie nur an kalte Butter!), erstarren die Ketten zu einer festen Struktur, sodass die Membran ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Die sogenannte Umwandlungstemperatur ist aber innerhalb der verschiedenen Membranlipide variabel (es sind schätzungsweise 500 bis 2000 unterschiedliche Lipide), wodurch Zellen – bedingt durch die Fettsäurezusammensetzung der Membranlipide – an sehr unterschiedliche Temperaturbereiche in ihrer Umgebung spezifisch angepasst sind.Zusätzlich in die Membran eingelagerte Substanzen beeinflussen darüber hinaus die Flüssigkeitseigenschaft (Fluidität) der Membran. Bei Eukaryoten ist vor allem das Cholesterin, das zwischen den Phospholipiden steckt, als Schlüsselsubstanz der Plasmamembran zu betrachten. Cholesterin dient im Zellstoffwechsel als Ausgangspunkt für die Biosynthese der Steroidhormone, aber das Hauptvorkommen liegt in den Biomembranen. Es festigt über chemische Wechselwirkung die Packung der Phospholipide. Bei eher niedrigen Temperaturen erhöht das Cholesterin die Membranfluidität, bei höheren Temperaturen wird die Fluidität der Membran reduziert.Auch die Fähigkeit zum Selbstverschluss




























